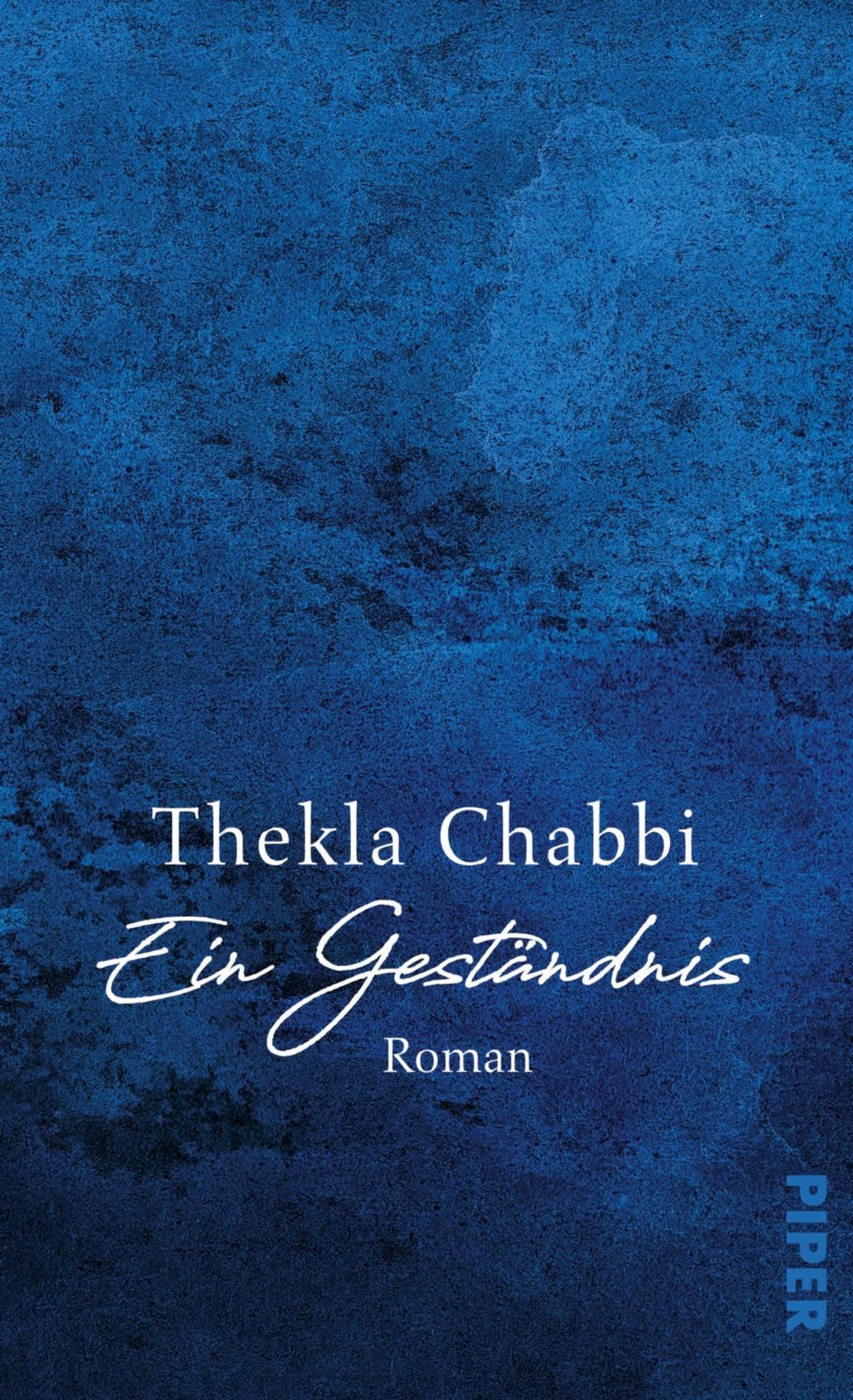
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amelie Frank wurde zur Zuschauerin ihres eigenen Lebens. Erst im Gefängnis legt sie dieses Geständnis ab. Vor der Haft verteidigt sie als erfolgreiche Wirtschaftsanwältin einen Anlageberater, der in großem Stil Cum-/Ex-Geschäfte betrieben hat. Doch sie möchte ihrem bisherigen Leben den Rücken kehren. Als sie den Mut dazu fasst, verhindert ein Fahrradunfall den nächsten Schritt. Diszipliniert führt sie ihren Alltag fort, bleibt aber auf der Suche nach einem Ausweg. Da begegnet ihr der rätselhafte Mario, der sich der Welt verweigert und mit seinem musikalischen Talent ihre Sehnsucht berührt. Mit beeindruckender sprachlicher Genauigkeit und psychologischem Feinsinn lotet Thekla Chabbi die Grenzen menschlicher Wahrnehmung aus und erzählt, wie Amelies Suche in ein Verbrechen mündet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
Für Leonid und Amelie
ISBN 978-3-492-99101-8März 2018© der deutschsprachigen Ausgabe:Piper Verlag GmbH, München 2018Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: FinePic®, MünchenDatenkonvertierung: psb, BerlinSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Wer dich verlässt …
Sehr geehrter Herr Kugler …
Riegelkrachen, Scheppern …
Amelie drückte die Tür …
Luna und Kay haben heute …
Kuglers Bürotür war angelehnt …
Amelie sitzt auf der Bettkante …
Im Kanzleiflur lief ihr …
Sie liegt im Bett …
Sie fuhr mit dem Fahrrad …
Ich habe vorhin im Radio …
Bedeutungslos …
Amelie steht auf dem Stuhl …
Sorglos …
Dass Luna und Kay …
Lunas Eltern lebten …
In Marios Augen …
Anfang September war Luna …
Amelie steht schon bereit …
Eine Woche war vergangen …
Sie unterbricht das Grollen …
Zitate
»Wer dich verlässt, denkt nicht an dich, sondern an sich.«
»Die Grenze des Verstehens ist schwer zu ertragen. Kein Mensch kann sich von der Verlassenheit eines anderen Menschen eine Vorstellung machen.«
»Offenbar.«
»Bis nächsten Mittwoch, Amelie.«
»Danke, Herr Blum. Machen Sie es gut.«
Amelie bleibt sitzen, als Herr Blum mit seinem Mantel überm Arm und dem Hut in der Hand schon an der breiten grauen Stahltür steht. Die Tür öffnet sich beinahe im selben Moment, in dem der hagere, dunkelblau uniformierte Wärter seinen Schlüsselbund zückt, einen Schlüssel mit dumpfem Scheppern ins Schloss drückt und ihn harsch herumdreht. Die vergangenen fünfundvierzig Minuten hatte er geräuschlos in der Ecke des matt erleuchteten Raumes mit den beiden Klappstühlen vor einem mit Eichenoptik-Folie beklebten Tisch abgesessen. Herr Blum geht, ohne sich umzuschauen. Der Uniformierte wirft Amelie einen leeren Blick zu, der ihr verständlich macht, sie solle aufstehen und mit ihm zusammen den Raum verlassen.
Um vier ist sie wieder in der Zelle. Abendessen und Frühstück stehen schon da. Sie zieht sich Sporthose, Turnschuhe und eine leichte Jacke an und bindet ihr braunes Haar mit einem Gummi zu einem Pferdeschwanz. Hinunter in den Innenhof. Sie rennt eine Stunde im größtmöglichen Radius an den Mauern entlang. Erst langsam, bis sich die Fußgelenke nicht mehr wehren, dann schneller und schneller, in die Stille und Schwerelosigkeit hinein. Als die Glocke schrillt, steht sie inmitten des Gewühls. Die Häftlinge strömen in den Trakt. Gedränge am Eingang und auf der Treppe.
Zurück in der Zelle. Sie zieht sich aus, verteilt ihre durchtränkte Kleidung auf Stuhl, Bettgestell und Heizkörper. In der Nasszelle hält sie den Waschlappen unter das Wasser, reibt ihn mit Seife ein und wäscht sich eilig, trocknet sich ab, zieht Hose und Hemd an. Kaum ist sie fertig, ein Schlag gegen die Tür. Im selben Moment brüllt jemand: »Lebendkontrolle!« Dann fliegt die Tür auf, kurz darauf wieder zu. Sie lässt den Putzeimer mit warmem Wasser halb volllaufen, greift Wischmopp und Besen und geht hinaus, über den Flur bis zum Freizeitraum, der ihr zur Reinigung zugeteilt ist. Wie ihr Schatten folgt der Wärter in schweren Stiefeln und Uniform einen Schritt hinter ihr. Im Türrahmen bleibt er stehen. Sie kehrt den Staub von den Ecken aus in die Mitte, dann alles zur Türschwelle. Sie taucht den Mopp ins Wasser, wischt den Fußboden, wieder von den Seiten auf die Mitte zu. Zweimal. Sie umschließt den Kehricht und lässt den Mopp in den Eimer gleiten. Zurück in der Zelle leert sie das Putzwasser in die Toilette, sie spült den Lappen aus und hängt ihn über den Eimerrand.
Sie stellt sich auf den Stuhl, schaut durch das vergitterte Fenster. Krächzende Raben ziehen über dem Gefängnishof ihre Kreise. Zu ihrer Linken gibt die Zelle den Blick über die Gefängnismauer hinweg auf einen stattlichen Baum frei. Die letzten Sonnenstrahlen des Tages lassen seine roten und goldenen Blätter leuchten. Einige haben sich gelöst und gleiten zu Boden. Heute ist mehr schwarzes Geäst sichtbar als gestern noch. Inzwischen beherrscht Rot das Gold des Laubes. Als hätte sie kaum einen Wimpernschlag getan, sieht sie den Baum in frischem gelbgrünen Kleid vor sich. Das saftige Grün hat er abgelegt, nachdem er sich ihr zartgrün beblättert gezeigt hatte. Sie hatte gesehen, wie er spross und sich mit feinen Ästen, die in Frühjahrsstürmen wogten, immer mehr Raum unter dem Himmel verschaffte. Denselben Baum hatte sie schwarz und starr erlebt in tobendem Regen und krustigem Eis, sich totstellend, von einer wärmenden Schneedecke nackt zurückgelassen. Die Sonne schwindet und überlässt den Blick einem diffusen Dämmerlicht.
Plötzlich ein erneuter Schlag gegen die Tür. Amelie schreckt auf. »Lebendkontrolle!« Danach lautes Scheppern im Schloss, Riegelkrachen. Sieben Uhr. Nachtruhe. Sie geht die zwei Schritte zum Tisch, nimmt den Wasserkocher, dreht sich herum, wieder zwei Schritte, dann füllt sie ihn am Waschbecken. Sie stellt den Stuhl vor den Tisch, setzt sich und hebt den Deckel des Abendbrot-Tellers an. Sie bestreicht die dünne Scheibe Graubrot mit Butter, während das Wasser zu rauschen beginnt, legt eine Scheibe Käse und etwas Gurke darauf. Sie unterbricht das Grollen des dampfenden Wassers und gießt einen weißen Kunststoffbecher voll. Dann hängt sie einen Teebeutel hinein, sieht das Wasser nach und nach die Farbe der grünen Schlieren aufnehmen. Minzgeruch steigt ihr in die Nase. Nach dem Essen stellt sie beide Tabletts in das Regal über dem Tisch. Abermals bringt sie Wasser zum Kochen und gießt eine zweite Tasse Tee auf.
Sehr geehrter Herr Kugler,
hiermit kündige ich fristgerecht zum Ende des Quartals meine Anstellung in Ihrem Hause.
Mit freundlichen Grüßen
Amelie Frank
Sie musste den Brief nur noch in ein Kuvert stecken und eine Briefmarke darauf kleben. Sie las die Zeilen. In sechs Wochen würde die Zukunft beginnen. Der Gang zum Briefkasten wäre ihr Weg in ein neues Leben. Abermals las sie die Zeilen vor sich. Sie musste das Kuvert nur noch zukleben und in den Briefkasten werfen. Was war das schon? Aber ihr zitterten Hände und Knie. Vor dem Fenster bot sich ein trüber Anblick – grauer Februarhimmel, im Sturm wogende Äste und von Zeit zu Zeit kurze heftige Regengüsse. Trotzdem nahm sie das Fahrrad und fuhr etwas wackelig gegen die Böen an. Vielleicht würde sie in ein paar Monaten als Kellnerin arbeiten oder ihre Wohnung verkaufen müssen, ging es ihr durch den gegen Sturm und Regen gesenkten Kopf. Vielleicht würde sie alles bereuen und sich für diese Fahrt verfluchen. Sie durchquerte einen kleinen Park und schlingerte in den aufbrausenden Windböen über den Schotterweg, als sie plötzlich jemanden hinter sich brüllen hörte.
»Bist du besoffen? Fahr geradeaus, Schabracke!«
Erschrocken riss sie den Lenker nach rechts. Aber der erregte Radfahrer hatte bereits auf derselben Seite zum Überholen angesetzt. Sie stießen zusammen und stürzten mit ihren Rädern auf die nasse Wiese. Der Mann sprang laut fluchend sofort wieder auf. Amelie entschuldigte sich, noch im Gras liegend. Der Radfahrer wollte davon nichts hören.
»Pass gefälligst auf und sauf nicht so viel am helllichten Tag. Das kommt dich teuer zu stehen, wenn mein Rad kaputt ist!«
Er fuhr ein flottes Rennrad und war offenbar im Training. Das verrieten seine Radlermontur, der Helm und das Tempo, mit dem er in ihr Vorderrad gerast war. Er überprüfte, ob sein Fahrrad Schaden genommen habe, drückte die Bremsgriffe und rüttelte an der Gangschaltung, dann stellte er es auf Sattel und Lenker, um ein paarmal an Reifen und Pedalen zu drehen. Mit einem Schwung drehte er das Rad wieder herum und jagte wortlos davon. Amelie setzte sich auf. Ihre Kleidung triefte, der Inhalt ihrer Handtasche lag verstreut neben ihr, der Vorderreifen ihres Fahrrads hatte die Form einer Acht. Als sie versuchte aufzustehen, fuhr ihr ein scharfer Schmerz ins rechte Knie, und sie sah, dass ihre Hose nicht nur vom Regen, sondern auch von Blut durchnässt war. Auf den Ellenbogen und dem linken Knie – das rechte Bein ließ sich nicht beugen – robbte sie zu ihrer Tasche und sammelte die Sachen zusammen.
»Be careful with that axe, Eugene!«, hörte Amelie jemanden laut rufen.
Eine Frau in dunkler Regenkleidung kam auf sie zu.
»Ist Ihnen etwas passiert?«, fragte sie und half Amelie beim Aufsammeln. »Was für ein blöder Kerl! Kann ich Ihnen helfen?«
»Danke, es geht schon«, antwortete Amelie knapp.
»Da war bestimmt der Mars im Spiel, das war eine eindeutige Mars-Situation«, sagte die Frau.
»Was für eine Situation?«
»Man müsste es sich genauer anschauen. Unfälle sind oft eine Warnung. Der Mars-Einfluss. Machete, Mauser, Massaker, martialisch, Messer, Metzelei. Marsch-Marsch, Mephisto, Mine, Mörder, Munition, Metall. Attentat, Auslöschung, Axt. Anschlag, Attacke, Arglist, Acheron, Amok, Angst, Aggression. Ares, Asche!«
Amelie starrte die Frau an.
»Wissen Sie, ich bin Astrologin, und wenn ich so etwas sehe, interessiert mich immer, was dahintersteckt.«
»Aha«, erwiderte Amelie befremdet, während die Frau ihr das Rad aufstellte. »Danke für Ihre Hilfe.«
Als sie dann ihr aufhelfen wollte, lehnte Amelie ab. Sie beachtete die Frau nicht mehr und mühte sich wieder auf die Beine. Mit dem linken Fuß schob sie den Fahrradständer hoch, humpelte zwei Schritte vorwärts. Beinahe wäre sie erneut gestürzt, als der zerstörte Reifen blockierte. Das Rad ließ sich nicht schieben. Also schloss sie es an einem Baum fest und winkte an der nahen Straße ein Taxi herbei.
Zu Hause leerte sie ihre Tasche aus und verteilte den Inhalt zum Trocknen auf der Heizung. Der Umschlag ihres Kündigungsschreibens war verdreckt, die Adresse verlaufen. Unter Schmerzen zog sie sich aus und ließ die Badewanne mit warmem Wasser volllaufen. Sie stieg vorsichtig hinein, streckte Arme und Beine von sich. Eine Wunde am Schienbein färbte das Wasser rosa. Sie schloss die Augen. Was für ein Tag: Alles zunichte wegen eines fanatischen Rennfahrers – und dann noch diese seltsame Frau; sie war wohl verrückt gewesen.
Am nächsten Morgen um sieben klingelte der Wecker. Amelie stieg aus dem Bett, ging in die Küche und setzte Wasser auf. Unter der Dusche ließ sie sich mit geschlossenen Augen das Wasser über den Körper laufen. Dieses Mal war sie schnell wach, denn der Strahl brannte auf der Wunde. Sie desinfizierte sie und verband ihr Schienbein und Knie. Mit umgeschlungenem Handtuch setzte sie sich an den Küchentisch, trank Tee und frühstückte. Anschließend stand sie ratlos vor ihrem Kleiderschrank, bis im Radio die Zeit durchgesagt wurde. Eilig zog sie eine Hose, eine Bluse und einen Blazer heraus, schlüpfte hinein und verließ das Haus. Sie ging zum Auto und fuhr los. An der ersten Ampel legte sie den Gang ein, hielt die Kupplung gedrückt. Sie holte Wimperntusche hervor und färbte die untere Wimpernreihe des rechten Auges. Da schaltete die Ampel auf Grün. An der nächsten Ampel schminkte sie die untere Wimpernreihe des linken Auges und begann mit der oberen des rechten, bevor sie wieder anfahren musste. Bis sie ankam, war sie fertig, hatte Lippenstift aufgetragen und mit einem Wattestäbchen die ungewollten Sprenkel der Wimperntusche entfernt. Sie nahm den Aufzug.
»Guten Morgen, Frau Frank«, wurde sie von der Sekretärin begrüßt.
»Guten Morgen, Frau Kamp«, antwortete Amelie, »wie geht es Ihnen? Hatten Sie ein schönes Wochenende?«
»Ja, sehr schön. Meine Tochter war mit den Kleinen zu Besuch. Möchten Sie einen Kaffee? Ich mache Ihnen gerne einen.«
Sie tranken ihren Kaffee, und Amelie erzählte Frau Kamp von ihrem Fahrradunfall. Sie erwähnte auch die merkwürdige Frau, die ihr nach dem Sturz geholfen hatte.
»Meine Tochter hat sich auch mal mit Astrologie beschäftigt«, erwiderte Frau Kamp, »aber ich halte nicht viel davon. Manchmal fragte sie nach Dingen, die unsere Familie betrafen. Das waren gespenstische Fragen. Gott sei Dank hat sie es wieder sein gelassen, als die Kinder zur Welt kamen.«
Kugler betrat die Kanzlei und ging zügigen Schrittes in sein Büro. Im Vorbeigehen war ein ›Guten Morgen‹ zu erahnen, dann wurde aus seinem Büro ein leises Quietschen hörbar. Amelie begab sich ebenfalls an ihren Schreibtisch. Der Anblick der Akten rief ihr die missglückte Kündigung ins Gedächtnis zurück. Sie hätte sie ausdrucken und Kugler persönlich überreichen sollen, dachte sie kurz. Aber der Postweg war ihr lieber, weil es für sie nichts weiter zu sagen gab. Bis Ende der Woche musste sie das erledigt haben, sagte sie sich und schaltete den Computer an.
Als sie spät abends nach Hause kam, öffnete sie eine Flasche Rotwein, schenkte sich ein Glas ein und setzte sich an den Küchentisch. Durch das Fenster schaute sie in eine klare Nacht. Sie ging auf den Balkon und blickte zu den Sternen hinauf. Da fiel ihr wieder die verrückte Frau aus dem Park ein. Vielleicht könnte sie auch einmal etwas Verrücktes tun, etwas, dessen Sinn ihr bisher verborgen war, wenn es überhaupt einen hatte, etwas wie Astrologie; vielleicht würde sie dadurch Erklärungen für den Schwebezustand finden, in den sie vor einer ganzen Weile geraten war. Ihr Verstand tat ja offensichtlich nur noch willkürlich seinen Dienst. Kurz entschlossen ging sie in den Flur, öffnete die Schublade der kleinen Kommode und nahm ihren Laptop heraus. Am Esszimmertisch klappte sie ihn auf und gab in den Gelben Seiten »Astrologie« ein. Dann setzte sie den Entfernungsradius der Suche auf die maximal möglichen fünfzig Kilometer und begann die am weitesten entfernten Orte zu durchstöbern. Eine »Schule für Astrologie« fand sie dort und notierte Telefonnummer und Adresse. Als sie den Zettel in ihren Geldbeutel steckte, spürte sie auf einmal, dass ihr die gerade getroffene Entscheidung Kraft gab. Sie ging zum Regal, holte die CD mit der Musik des Films Frida hervor und legte sie auf. Dann streckte sie sich mit ihrem Glas in der Hand auf dem Sofa aus.
Im Juni vergangenen Jahres war sie mit Luna für vier Tage nach London gereist, zum Tanzen, Einkaufen und Schlemmen, und um es sich einfach gut gehen zu lassen. Zufällig waren sie dort in der Michael Hoppen Gallery auf die Ausstellung einer japanischen Fotografin gestoßen, die in Frida Kahlos Geburtshaus in Mexiko deren Gebrauchsgegenstände abgelichtet hatte. Luna, die vor einigen Jahren selbst einmal dort gewesen war, verehrte Frida Kahlo seither. Amelie kannte sie nicht. In der Ausstellung erfuhr sie, dass die mexikanische Malerin als Schülerin einen schweren Busunfall erlitten hatte und dabei fast zerteilt worden war. Fortan führte sie ein Leben unter unerträglichen Schmerzen. Zunächst vollends ans Bett gefesselt, begann sie mit der Malerei. Sie malte und unterrichtete unermüdlich, bis sie mit nur siebenundvierzig Jahren starb. Amelie und Luna bewunderten Kahlos Katzenaugen-Sonnenbrille mit gelbem Gestell, Nagellackfläschchen, Kleidungsstücke und Schuhe – Gegenstände aus einer versunkenen Zeit in grellen Farben und schön anzuschauen. Trotzdem bedrückte der Anblick, weil mehr sichtbar wurde, als zu sehen war: Zwei unterschiedlich verformte Stiefel mit unterschiedlich abgenutzten Absätzen, die nur noch durch ihre grellrosa Farbe als Paar zu erkennen waren, verrieten, wie beschwerlich das Gehen gewesen sein musste; oder ein roter, um ein Gipskorsett geschwungener Rock oder eine Beinprothese in einem feuerroten Lederstiefel mit Stickereien und einem Glöckchen am Schnürriemen ließen in all den Accessoires Steinchen eines Schicksalsmosaiks erahnen. Doch ungeachtet ihres Leidens und ihrer Drogensucht lebte Frida Kahlo voll kräftiger Leidenschaft. Seichtigkeit hatte bei ihr keinen Platz gehabt. Sie gab sich hin dem Leid, der Freude, Liebe, Wut, Gewalt, Schmerz, Genuss und notierte einmal: Ich habe niemals meine Träume gemalt. Ich habe meine eigene Wirklichkeit gemalt.
Die raue Stimme der unvergleichlichen Chavela Vargas hob an, Stimme einer verletzten Seele, und erfüllte den Raum mit mexikanischen Rhythmen und Melodien, mit Freudenklängen, Sehnsuchtsfeuer, Mollschmerz. Seit dem Besuch der Ausstellung wollte Amelie den Film über diese faszinierende Frau anschauen, jedoch hatte sie in all den Monaten nie die Zeit dafür gefunden.
Gleich am nächsten Vormittag rief sie vom Büro aus in der Astrologieschule an. Es meldete sich eine freundliche weibliche Stimme.
»Guten Tag«, sagte Amelie, »ich bin an einem Astrologiekurs für Anfänger interessiert.«
»Dann kommen Sie am besten gleich heute Abend vorbei, denn der Kurs fängt gerade heute an! Er findet immer am Dienstag- und Donnerstagabend statt. Sie benötigen keinerlei Vorkenntnisse«, hörte Amelie die Dame sagen.
»Das geht jetzt ziemlich schnell. Wann wäre denn der nächste Kurs?«, fragte Amelie.
»Erst in sieben Monaten. Wenn Sie am Anfang kaum etwas verstehen, machen Sie sich nichts draus, sondern fragen Sie immer wieder nach. Nach ein paar Wochen wird sich alles gesetzt haben, und Ihr Blick wird klarer.«
Für einen Moment zögerte Amelie.
»Na gut, dann komme ich heute«, sagte sie schließlich.
Die Frau erklärte ihr noch den Weg, dann legten sie auf. Seufzend und fassungslos über sich selbst, ließ sich Amelie in ihren Stuhl zurücksinken und atmete durch. Dann machte sie sich wieder an die Arbeit. Gerade hatte sie eine Akte aufgeschlagen, als das Telefon klingelte.
»Das hatte ich noch vergessen«, erklang Kuglers Stimme. »Die Sache Pascal Matt wird jetzt heiß. Wenn wir das nicht hinbekommen, ist der Mann ruiniert. Und unser Ruf auch. Hier geht es um unseren Scharfsinn, Frau Frank. Vor allem um Ihren. Die Akte liegt auf meinem Schreibtisch.«
»Ich bin unterwegs.«
Amelie stand auf, ging über den Flur zu Kuglers Büro, klopfte kurz und trat ein. Mit ausgestreckter Hand hielt er ihr schon die Mappe entgegen, sein Blick starr aus dem Fenster gerichtet, während er ein Glas Cola in sich hineinschüttete. Amelie übernahm, schloss hinter sich die Tür und begann, zurück in ihrem Büro, mit der Lektüre der Notizen, Briefe, Protokolle. Pascal Matt war ein Anlageberater aus Zürich, der in Zusammenarbeit mit deutschen Banken Großanlegern dazu verholfen hatte, mehr Steuern erstattet zu bekommen, als der deutsche Staat von ihnen kassiert hatte. Den Gesprächsprotokollen zwischen ihm und Kugler entnahm sie, dass Matt gesagt hatte:
»Wenn es keinen Anspruch auf einen Geldbetrag gibt, gibt es auch keinen Schaden. Das ist geltendes Recht.«
Und Kugler hatte erwidert:
»Ich haue Sie da raus, Herr Matt. Steuern sind ein Kostenfaktor. Und wo steht, dass es illegal ist, Kosten zu minimieren?«
Amelie vertiefte sich in die Akte. Matt hatte mit Anlegergeldern in Milliardenhöhe Aktiengeschäfte betrieben. Erwarb ein Anleger über ihn Anteile eines deutschen Großkonzerns in Höhe von einer Million Euro, verkaufte Matt dieselben Aktien, ohne sie noch zu besitzen, kurz vor dem Dividendenstichtag abermals an einen zweiten Anleger. Wenn am Tag der Ausschüttung eine Dividende von hunderttausend Euro fällig wurde, erhielt der erste Anleger fünfundsiebzigtausend Euro sowie eine Bescheinigung seiner Bank darüber, dass der Konzern fünfundzwanzig Prozent der Dividende, also fünfundzwanzigtausend Euro, als Kapitalertragssteuer einbehalten habe. Gleich nach der Dividendenausschüttung erstand Matt die Wertpapiere vom ersten Anleger abzüglich der Dividende für nun neunhunderttausend Euro und leitete sie an den zweiten Anleger weiter, dem er sie zuvor nur auf dem Papier als Leerkauf bereits veräußert hatte. Da der zweite Anleger den Preis der Aktien ohne Abzug der Dividende entrichtet hatte, glich Matt fünfundsiebzigtausend Euro aus. Über die fehlenden fünfundzwanzigtausend Euro stellte die Bank, bei der der zweite Anleger sein Aktiendepot unterhielt, diesem ganz selbstverständlich ebenfalls eine Steuerbescheinigung aus. So konnten beide Anleger die Kapitalertragssteuer geltend machen, obwohl sie in Wirklichkeit nur einmal vom ersten Anleger abgeführt worden war. Matt trug das Geschäft einen Gewinn von fünfundzwanzigtausend Euro ein, den er für sich behalten oder mit seinen beiden Komplizen brüderlich durch drei teilen konnte.
Einem unauffälligen Nebensatz entnahm Amelie, dass Matt dieses Geschäft zuletzt auf die Spitze getrieben hatte. Immer häufiger hatte er die von einem Anleger erworbenen Anteile kurz vor dem Stichtag an fünf bis acht weitere Kunden leer veräußert und dadurch bewirkt, dass jeder Anleger von seiner Bank eine Steuerbescheinigung erhielt. Somit erstatteten die deutschen Finanzämter fünf- bis achtfach eine einmalig entrichtete Steuerabgabe.
Ihre spontanen Gedanken zum Sachverhalt notierte sie auf einen Zettel, den sie in die Akte klebte. Anschließend nahm sie die Abgabenordnung aus dem Regal und blätterte darin, um sich zu vergewissern, dass es tatsächlich zwei Eigentümer eines Wirtschaftsguts, also auch einer Aktie, geben konnte: einen sachenrechtlichen und einen wirtschaftlichen. Damit hatte sie sich den ersten Überblick verschafft, um ihre Argumentation auszuarbeiten. Abgesehen von der Sache Matt warteten etliche Routinearbeiten darauf, erledigt zu werden, und sie musste pünktlich Feierabend machen, um es zum Astrologiekurs zu schaffen.
Wieder klingelte das Telefon, wieder Kugler:
»Noch etwas. Bitte gehen Sie doch in die Galerie meines Vaters und leisten eine Unterschrift. Ich habe für unser Foyer einen Gerhard Richter bestellt. Vielleicht können Sie in der Mittagspause kurz vorbeischauen?«
»Wie Sie meinen.«
»Bestens. Mein Vater weiß Bescheid.«
Ohne ein weiteres Wort legte Kugler auf.
Riegelkrachen, Scheppern im Schloss, dann geht die Tür auf. Im Türrahmen steht die Gefängniswärterin, die einzige, die Amelie freundlich erlebt, weil sie sanfter als ihre Kollegen erscheint.
»Ihr Vollzugshelfer wartet auf Sie. Wollen Sie kommen?«, fragt sie.
Amelie sitzt auf der Bettkante. Sie steht auf und folgt der Frau über nackte Flure bis in den Besucherraum. Sie reicht Herrn Blum die Hand. Die Wärterin setzt sich neben die Tür.
»Wie geht es Ihnen heute, Amelie?«
Sie nimmt Herrn Blum gegenüber Platz, blickt auf ihre Hände im Schoß.
»Luna und Kay haben heute Morgen wieder jede bei mir angerufen. Das ist zum Ritual geworden. Beide lassen ausrichten, dass sie an Sie denken.«
Amelie blickt Herrn Blum jetzt an.
»Mehr haben sie nicht gesagt«, fügt er hinzu.
»Danke. Das macht traurig und tut mir gut.«
»Sind Sie in der vergangenen Woche mit Ihrem Leben hier zurechtgekommen?«
»Ich habe kein Leben. Aber ich bin zurechtgekommen.«
Beide schweigen. Minutenlang.
»Machen Sie sich keine Gedanken, ich hatte auch vor der Tat kein Leben. Wenn du nichts spürst, weißt du nicht, dass du nichts spürst.«
»Aber Wahrnehmungen hatten Sie.«
»Ich war meine eigene Zuschauerin geworden. Sonst hätte es keinen Grund für Kündigungsschreiben gegeben.«
Sie spürt Herrn Blums Blick, obgleich sie ihn nicht ansieht.
»Die Selbstverständlichkeit, mit der ich meine Arbeit bis dahin verrichtet hatte, war mir auf einmal verloren gegangen. Ich war wie ein Mensch mit mehreren Persönlichkeiten. Ein Ich befahl die Handgriffe, eines die Gedanken, ein anderes führte die Befehle aus, und ein weiteres saß kopfschüttelnd daneben und lächelte verächtlich.«
»Wollen Sie mir einmal erzählen, wie Sie überhaupt in die Kanzlei kamen? Darüber haben wir noch nie gesprochen.«
»Das kam, weil ich nichts hinterfragte. Ich habe getan, was von mir erwartet wurde: Etwas Anständiges studieren, einen ordentlichen Job finden und ihn dann wie vorgesehen ausüben. Aus damaliger Sicht habe ich auch Glück gehabt – es ist immerhin eine erfolgreiche Kanzlei, ich bekam sozusagen spannende Fälle. Das kann ich heute nicht mehr empfinden.«
»Es gibt keine Regel, die Ihnen vorschreibt, was Sie zu empfinden haben. Dass Sie empfinden, was Sie empfinden, reicht.«
»Wenn Sie meinen. Ich würde Ihnen gerne glauben.«
Sie blickt wieder auf ihre Hände, die Finger aufgefächert auf den Oberschenkeln, sieht die blau verzweigten Aderläufe.
»Nach dem Studium erst mal dieses Praktikum. In einer kleinen Kanzlei. Habe viel gelernt dort. Der Chef, Sachs hieß er, war ein weiser Rechtsanwalt. Und pfiffig war er. Ich habe ihn bewundert. Er fühlte sich gleich als mein Mentor. Er sagte, ich müsse mich spezialisieren. Auf europäisches Wirtschaftsrecht.«
»Und Sie ließen sich überzeugen.«
»Immer wieder sagte er: ›Der juristische Spielraum bleibt noch lange unüberschaubar groß!‹ Also machte ich nach Referendariat und zweitem Staatsexamen diesen Master of Law in europäischem und internationalem Wirtschaftsrecht. Und dann kam ich in eine sogenannte renommierte Kanzlei. Das war’s.«
»Mit Herrn Kugler kamen Sie dann anfangs noch gut zurecht?«
»Der erste Chef war sympathisch. Erst später kam Pirmin Kugler. Er war von Anfang an unzugänglich. Etwas jünger als ich. Über die schlagende Studentenverbindung meines ersten Chefs war er in die Kanzlei gekommen. Dementsprechend konnte er sich protegiert fühlen. Und von Anfang an war er faul und ehrgeizig zugleich. Dass ich ihn und seine Strategien durchschaute, ließ er sich äußerlich nicht anmerken. Mich ließ er es spüren. Mir gelang es trotzdem ganz gut, seine Allüren hinzunehmen. Darauf war ich sogar ein wenig stolz. Doch irgendwann wurde ich eben auf einmal meine eigene Beobachterin. Jeden Morgen um sieben Uhr klingelte der Wecker. Ich sah mich aus dem Bett steigen und in der Küche Wasser aufsetzen. Ich ging unter die Dusche, ließ mir mit geschlossenen Augen das Wasser über den Körper laufen, bis der Schlaf wich. Mit umgeschlungenem Handtuch an den Küchentisch, trank Tee, frühstückte, stand jeden Morgen ratlos vor dem Kleiderschrank, dann aus dem Radio die Zeitansage, ich zog mich eilig an, verließ das Haus, an jeder der sieben meist roten Ampeln auf dem Weg zur Arbeit trug ich nach und nach das Make-up auf – die reine Maskerade, in der Kanzlei jeden Morgen mein dynamisch auftretender Vorgesetzter, mit frisch gewienerten Schuhen hastete er in sein Büro, im Vorbeigehen konnte man ein ›Guten Morgen‹ höchstens erahnen, dann hörte man ihn in seinem Zimmer mit den Schuhen quietschen, weil er die Schuhcreme Tag für Tag zu dick auftrug und die Spuren mit den Sohlen vom glänzenden Boden zu beseitigen versuchte.«
Amelies Blick bleibt am grauen Gummiboden haften, reglos.
»Irgendwann befremdete es mich, nichts als ein gut funktionierendes Rädchen in diesem verrückten Getriebe zu sein. Am schlimmsten, wenn ich selbst in Aktion trat. Wenn ich um Einlass in Kuglers Büro bat, um mit ihm Fälle und Fristen zu besprechen. Erst ließ er mich warten, dann fertigte er mich ab. Meine Bedeutungslosigkeit sollte demonstriert werden und seine Geltung.«
»Ich kann mir nichts anderes vorstellen, Amelie, als dass ihn Neid zu diesem Verhalten trieb. Es muss Neid gewesen sein.«
»Das macht es nicht angenehmer.«
»Hatten Sie denn unter den anderen Kollegen vielleicht Vertraute?«
»Die Zusammenarbeit funktionierte. Eine Art persönlichen Kontakt hatte ich nur mit Frau Kamp. Die arbeitet seit fünfundzwanzig Jahren in der Kanzlei. Die gute Seele des Hauses. Für mich manchmal so etwas wie eine Mutter. Frau Kamp wusste Bescheid. Das wusste ich. Trotzdem half es mir plötzlich nicht mehr, in meinen im Laufe der Jahre gesammelten Erfahrungen ein System zu entdecken; es half mir nicht, dass ich die Spielregeln unseres Gesellschaftsbetriebs kannte und sie selber – wenn man so will – einigermaßen erfolgreich mitgespielt habe. Für meine Mutter natürlich nicht erfolgreich genug. Aber was soll’s. Es half mir nicht, manche Erlebnisse, die sich dieser Ordnung widersetzten, als Ausnahmen zu betrachten, wie Ausnahmen eben üblich sind, und über sie hinwegzusehen. Irgendetwas stimmte nicht mehr.«
»Deshalb haben Sie begonnen, sich mit Astrologie zu beschäftigen?«
»Wahrscheinlich war es so. Vorher wäre ich dafür nicht empfänglich gewesen. In der Kanzlei durfte natürlich niemand mitbekommen, dass ich abends solche Kurse besuchte. Zweimal in der Woche bin ich nach der Arbeit zu der Astrologieschule geeilt und danach sofort nach Hause gefahren. Weil ich nichts riskieren wollte, mied ich den Kontakt zu Mitschülern, so gut es ging – anfangs jedenfalls. Ich bemühte mich nur um ein Verständnis für den Stoff. Beim Bemühen ist es eigentlich geblieben. Darüber waren Gespräche mit den anderen ohnehin nicht möglich. Viele erschienen mir ebenso orientierungslos wie ich. Und schon bald war ich vom Geräusch der Unterwürfigkeit abgestoßen, mit dem die Teilnehmer jeden zaghaften Scherz des Astrologen würdigten. Umgekehrt schien das Interesse an mir ebenso gering. Bis auf abtastende Blicke blieb Kontakt aus.«
Amelie schweigt. Herrn Blum hat sie nicht ein einziges Mal angeschaut. Es kommt ihr vor, als hätte sie zu sich selbst gesprochen. Und viel zu viel, von Dingen, über die sie nicht sprechen will.
»Mit der Astrologie haben Sie ein Gegengewicht zu Ihrem Berufsalltag gefunden.«
»Das ist wahr. Diese Denkansätze und Folgerungen, die sich aus der Sternenlehre ergaben, waren mir fremd. Die Tierkreiszeichen, die Häuser, Planeten und die ganzen Gradzahlen brachten mich um den Verstand. Aufhören wollte ich aber nicht. Erst als ich begann, die Sterne zu beobachten, und mich mit den mythologischen Entsprechungen der Planeten und Sternbilder beschäftigte, entstanden Geschichten. Jetzt habe ich viel zu viel geredet.«
Die Wärterin erhebt sich lautlos. Es ist spürbar, dass es ihr leidtut, das Gespräch unterbrechen zu müssen.
»Danke, Amelie. Ich hoffe, dass wir uns am nächsten Mittwoch wiedersehen.«
»Auf Wiedersehen, Herr Blum.«
Er geht voran. Die Wärterin schließt die Tür auf und tritt hinter Amelie auf den Flur. Herr Blum geht nach rechts, schaut sich nicht mehr um, Amelie neben der Wärterin nach links. Schweigend bis zur Zelle.
Amelie drückte die Tür der Galerie auf. Es bimmelte. Von einer Empore, zu der fünf Stufen hinaufführten, schaute Kugler senior um die Ecke.
»Frau Frank, bitte setzen Sie sich für ein paar Minuten. Ich bin, so schnell ich kann, bei Ihnen.«
»Guten Tag, Herr Kugler. Natürlich. Ich warte.«
»Sie sehen bezaubernd aus!«, rief er noch.
In dem Moment flog eines der Fenster auf. Eine heftige Windböe stob durch den Raum, einige Blätter auf dem tiefen Tisch vor dem Sofa wirbelten durcheinander und glitten zu Boden. In einem Satz sprang Pius Kugler die Stufen hinab. Als hätte auch ihn ein Sturm erfasst, jagte er auf das Fenster zu und schloss es wieder.
»Das hätten Sie mir vermutlich nicht zugetraut, habe ich recht?«, fragte er mit einem Zwinkern. »Also, bis gleich.«
Dieses Mal nahm er die Stufen zu seinem Büro in zwei großen Schritten. Von dort vernahm sie seine Stimme, er musste die Bürotür offen gelassen haben. Amelie hörte, was auch sie bereits von ihm erzählt bekommen hatte:
»Das, was Sie hier in der Galerie sehen, ist im Vergleich zu meinem Lager im Keller nicht mehr als ein Taubenschiss.«
»Ehrlich?«, hörte sie eine ruhige Frauenstimme staunend fragen.
»Natürlich! Was glauben Sie? Das passt hier bei Weitem nicht hinein. Und einladen will man doch auch niemanden.«
Der Senior lachte.
»Das ist imposant«, sagte die Frau. »Und alles Bilder von solchen Malern wie diesen hier?«
»Aber selbstverständlich, meine Liebe. Im Keller habe ich Kandinsky, Corinth, Klimt, Klee, Schmidt-Rottluff, Baselitz, Beuys, um nur ein paar Beispiele zu nennen.«
»Unglaublich!«
»Vielleicht zeige ich Ihnen einmal meine Katakomben.«
»Sehr gerne. Das wäre toll! Woher bekommen Sie diese Werke?«
»Viele aus Holland. Aber auch aus anderen Gegenden. Uns kennt man in der Branche. Da wird mir manches angeboten, häufig, wenn ein Sammler in Geldnot gerät. Den größten Teil hat jedoch mein Vater zusammengetragen. Der ist heute vierundneunzig. Und immer noch rüstig.«
»Beeindruckend.«
»Ja, das ist es. Meine Mutter ist schon mit siebenundsechzig gestorben. Aber mit einundsiebzig hat mein Vater wieder geheiratet, die Marina …«
Das Telefon klingelte.
»Entschuldigen Sie. Aber bitte, bleiben Sie ruhig sitzen«, sagte er.
»Kugler. – Willi, mein Lieber! Wie geht es dir? – Ja, auch ganz fabelhaft! Wie immer! – Die Idee ist spitze, könnte von mir sein. Lass mich im Kalender nachsehen. Die Woche vor Ostern passt. Palmsonntag hin und Ostermontag zurück. – Das wär’s, wenn wir dort wieder unterkommen. Und mit demselben Personal! Ich verlasse mich wie immer voll und ganz auf dich. – Ein paar Mädels, die kommen mit. – Selbstredend. – Ja, unbedingt! – Fraglos!«
Jetzt lachte Kugler aus voller Kehle.
»Ein absolutes Muss! Mach die Länge von der Anzahl der Mädels abhängig. Die müssen sich auf und unter Deck ausbreiten können. – Großartig. – Die schicke ich dann Ostern zu ihrer Schwester. Mach dir keine Gedanken. Das schaukeln wir schon.«
Wieder Gelächter.
»Willi, ich mache Schluss, ich habe hier Leute sitzen. Sag Alex und Mike, dass ich dabei bin. Ahoi!«
Amelie hörte ihn lachend auflegen und sich sogleich wieder an die Frau in seinem Büro wenden:
»Also, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Sie sehen toll aus, aber für die Arbeit hier sind Sie zu alt.«
»Wenn Sie meinen«, antwortete die Frau enttäuscht. »Aber nur damit Sie Bescheid wissen: Ich suche einen zusätzlichen Job neben meiner Tätigkeit als Literaturübersetzerin. Ich könnte Sie organisatorisch unterstützen – ohne Kundenkontakt«, hörte Amelie die Stimme sagen.
Wieder klingelte das Telefon.
»Kugler. – Frau Biedenstock! Wie geht es Ihnen? – Wunderbar, das freut mich. – Kein Problem. – Ach, Frau Biedenstock, nicht der Rede wert, bei Ihnen doch nicht. Hundertfünfzigtausend. – Ich bitte Sie, wo kämen wir da hin? – Oder übernächste Woche. Wann immer Sie die Gelegenheit haben. – Machen Sie es gut, Frau Biedenstock.«
Er legte auf.
»Diese Kundin ist vierundachtzig. Eine feine Dame. Ihr verstorbener Mann und sie waren schon Kunden meines Vaters. Hundertfünfzigtausend sind für sie ein Taschengeld.«
»Nicht schlecht«, sagte die Frau.
Vermutlich hatte sie während dieses Telefonats zum zweiten Mal mit großen Augen vor Pius Kugler gesessen.
»Dann noch mal zu Ihnen: Sie wollen den anderen Mädels doch erzählen, wo es langgeht. Das ist völlig normal.«
»Herr Kugler, ich will niemandem etwas erzählen, ich möchte nur einen Nebenjob, um mit meinem zwölfjährigen Sohn besser über die Runden zu kommen. Das können Sie mir glauben. Anerkennung und Herausforderung bekomme ich durch meine Übersetzungen.«
»Es tut mir leid. Aber vielleicht kommen Sie trotzdem wieder vorbei. Ich lade Sie immer gerne zu einem Kaffee ein. Und beim nächsten Mal zeige ich Ihnen die Katakomben. Abgemacht?«
Geräusche wurden vernehmbar. Offensichtlich hatte sich Kugler erhoben.
»Wie Sie meinen. Wenn auch schade, muss ich sagen. Ich hätte hier gerne als Sekretärin gearbeitet.«
Kugler erschien am Treppenabsatz und ließ einer apart aussehenden Frau den Vortritt. Ihren Kopf zierte ein dezentes Haarband mit verstreuten weißen Blümchen. Sie grüßte Amelie lächelnd und verließ die Galerie. Amelie schaute ihr nach. Eine Frau von Mitte dreißig, das hatte sie nicht erwartet.
Der Senior lief mit ausgebreiteten Armen auf Amelie zu, nahm ihre Hand und führte sie bis kurz vor seine Lippen.
»Schön, dass Sie da sind! Kommen Sie. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten?«
»Lieber nicht. Ich muss zurück an die Arbeit«, erwiderte Amelie.
»Sehr bedauerlich. Es scheint unser Schicksal zu sein, dass wir uns jedes Mal verpassen. Das muss ich einmal durchbrechen.«
Sie gingen in sein Büro.
»Hier der Vertrag und die Versicherung. Bei den Kreuzen bitte.«
Amelie setzte zwei Unterschriften.
»Und hier ist das Wunderwerk!«
Er wies auf ein enormes gerahmtes Gemälde, das an der Wand lehnte. Amelie schaute gefesselt auf das Bild. Ein Wirbelsturm jagte über die Leinwand und schien dem Maler seine Farben entrissen zu haben. Über die linke Hälfte schon hinweg, herbstlich braune Röte, dazwischen der Sonne letzte Strahlen hinterlassend, wälzt er sich gewaltig hinter seinem eigenen Schatten her. Blätter und Blüten und Blutstropfen stieben hinauf, hinab, hinfort.
»Stellen Sie sich das in Ihrem Foyer vor, eine Pracht, die reine Begierde.«
Er zwinkerte ihr zu.
»Meine Leihgabe, für den Junior.«
»Herr Kugler, ich muss mich auf den Weg machen.«
»Ich bringe Sie zur Tür. Sagen Sie Pirmin, Montagvormittag hängt der Richter in eurem Foyer. Ich hoffe, ich sehe Sie bald wieder, Frau Frank. Ade.«
Sie besuchte den Astrologiekurs schon seit mehreren Wochen, als sie eines Abends jemanden schräg hinter sich unaufhörlich mit den Schuhen scharren und quietschen hörte. Amelie zuckte zusammen. Sie bemühte sich, das Geräusch zu ignorieren. Das gelang nicht. Langsam und leicht geduckt drehte sie sich zum Verursacher. Es war Mario, ein junger Mann von höchstens Ende zwanzig, der ihr geradewegs in die Augen blickte und den Anschein erweckte, ihn strengte der direkte Blick an. Sie drehte sich wieder nach vorne. Konzentrieren konnte sie sich nicht mehr. Dieses Geräusch traf sie wie ein Schnitt in die Eingeweide. Mit einem verächtlichen Blick drehte sie sich abermals zu Mario in der Hoffnung, ihm jeden Mut an der Fortsetzung des Quietschens zu nehmen. Der schaute sie unverfroren an.
»Entschuldigung«, sagte er in sich überschlagendem Flüsterton.
Sie wandte sich wieder nach vorne. Sie reagierte über, dessen war sie sich bewusst. Aber sie hätte den Kerl am liebsten in der Luft zerrissen und dafür bestraft, dass er sie gedanklich in die Welt zurücktrug, der sie mithilfe der Astrologie zu entfliehen versuchte. Das Geräusch hielt an. Wieder drehte sie sich um, und wieder kam dieser unverfrorene Blick zurück.
»Hör verdammt noch mal damit auf!«, brach es aus Amelie hervor, so unbeherrscht, wie sie es nicht von sich kannte.
Alle blickten erstaunt zu ihr. Mario sagte nichts, grinste nur verstohlen.
»Was ist los?«, fragte der Lehrer neugierig und amüsiert.
»Nichts«, antwortete Amelie, »entschuldigen Sie bitte die Störung.«
Der Unterricht ging weiter, als wäre nichts geschehen. Amelie war erleichtert. Mario tat ihr jetzt leid. Er hatte ihr ganzes Unbehagen darüber zu spüren bekommen, dass sie es nicht fertigbrachte, eine Entscheidung zu fällen und ihr Leben zu ordnen. Sie hätte es höflicher, vielleicht als Bitte formulieren sollen.
Während der kommenden Wochen beobachtete sie ihn heimlich. Sobald er sie ansah, lenkte sie ihren Blick in eine andere Richtung. Er war ein hübscher Kerl und wirkte unabhängiger als die anderen. Hin und wieder machte er einen Scherz. Sein Blick war ständig in Bewegung, flackerte, als müsste er in alle Richtungen gleichzeitig schweifen. Er war eine Erfrischung in dem verstaubten Kurssaal.
»Grüß Sie, Frau Frank«, sagte Frau Kamp, als Amelie an einem regnerischen Tag von ihrem Gerichtstermin zurück in die Kanzlei kam. »Ist alles gut gegangen?«
»Ja, danke, keine besonderen Vorkommnisse.«
»Ihre Mutter hat heute Morgen angerufen. Sie bittet um einen Rückruf. Und der Chef auch.«
»Danke, Frau Kamp.«
Amelie machte sich in der Küche einen Espresso, trank ihn im Stehen und stellte die Tasse in die Spülmaschine. Dann nahm sie eine Flasche Wasser und ein Glas mit in ihr Büro, bevor sie die Tür hinter sich schloss und Kugler anrief.
»Wie weit sind Sie mit Matt?«, kam es sogleich aus dem Hörer.
»Ich habe mir einiges notiert, bin aber noch nicht fertig. Gibt es einen Termin?«
»Zwei Wochen nach Ostern fliege ich nach Zürich und besuche Matt, um ihm unsere Verteidigungsstrategie zu schildern.«
Amelie schluckte geräuschlos.
»Gut, dann weiß ich Bescheid.«
»Eventuell nehme ich Sie mit. Also dann.«
Er legte auf.
Amelie wählte die Nummer ihrer Mutter.
»Zahnarztpraxis Dr. Frank, guten Tag.«
»Hallo Sabina, hier ist Amelie. Bitte sagen Sie meiner Mutter, dass ich jetzt im Büro erreichbar bin, falls sie nicht zufällig gerade frei ist.«
»Tut mir leid, sie ist im Behandlungszimmer. Ich richte es ihr aus.«
»Vielen Dank, Sabina. Also, dann bis bald.«
»Bis bald.«
Sie öffnete ihre Tasche, holte die Akte vom Gerichtstermin heraus, schlug sie auf und diktierte einen kurzen Brief an die Mandantschaft, in dem sie darauf hinwies, dass das Urteil erst nach Zustellung rechtskräftig werde. Dann legte sie die Akte zur Seite. Sie schaltete den Computer ein, las die eingegangenen E-Mails, beantwortete eilige, wichtige druckte sie aus und sammelte sie in einer Mappe. Anschließend durchblätterte sie die Postmappe, die Frau Kamp ihr auf den Schreibtisch gelegt hatte, setzte Unterschriften, entnahm wichtige Schreiben und legte sie zu den ausgedruckten E-Mails. Danach legte sie die Postmappe in einen Metallkorb auf ihrem Schreibtisch, aus dem Frau Kamp sie wieder mitnehmen konnte. Dort hinein legte sie auch die Speicherkarte ihres diktierten Briefes. Gerade nahm sie sich wieder die Matt-Akte vor, da klingelte das Telefon.
»Amelie, geht es dir gut?«, fragte ihre Mutter.
»Ja, danke, und dir?«
»Ach, ich bin erledigt. Dein Vater.«
Sie seufzte.
Ende der Leseprobe





























