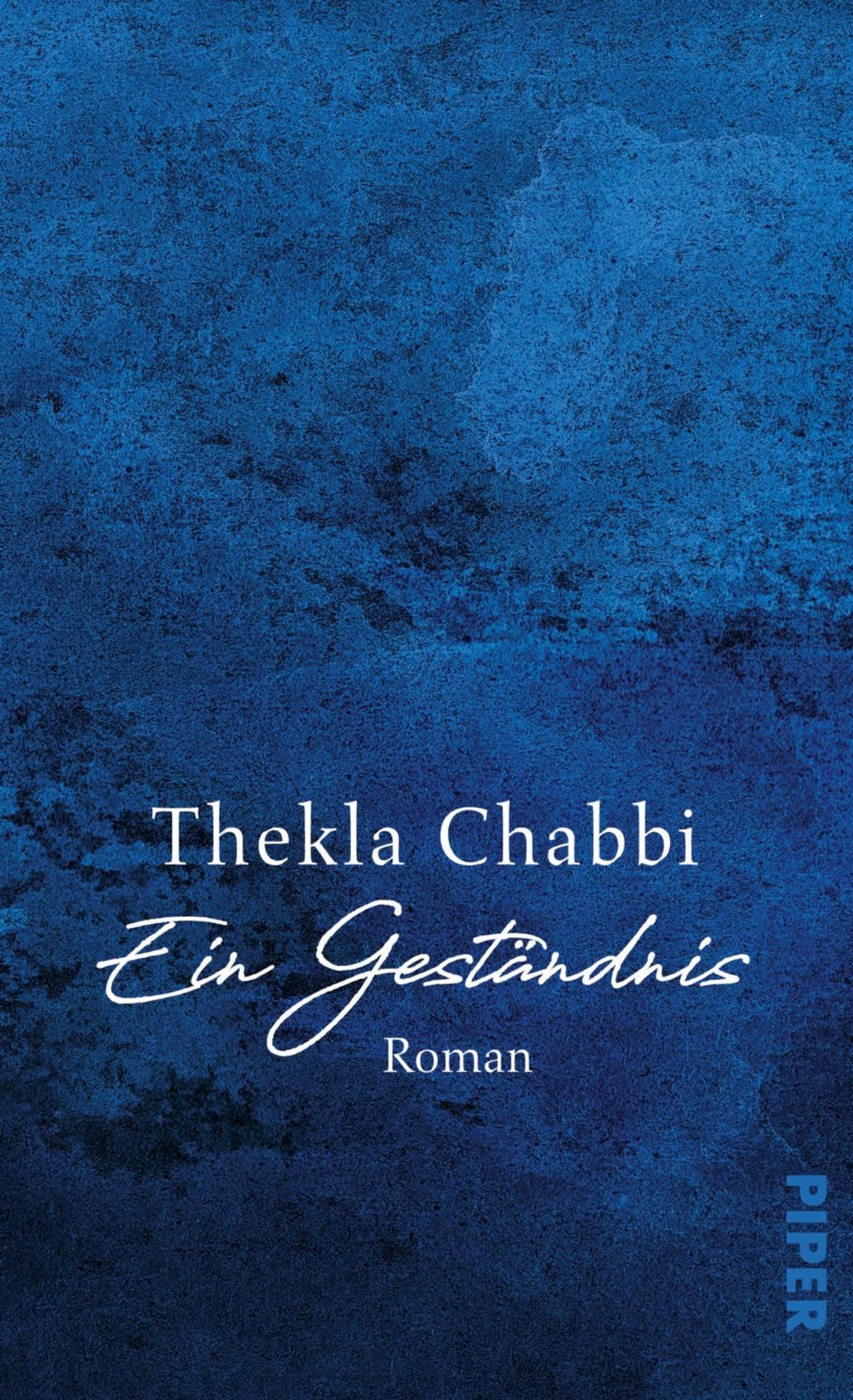14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was die meistgesprochene Sprache der Welt über Chinas Aufstieg zur Großmacht verrät «Inzwischen haben sich die Verhältnisse gewandelt. Heute spielt China weltpolitisch eine gewichtige Rolle, die es sich nicht mehr streitig machen lässt. Diese Entwicklung wäre ohne die grenzenlose, aus der konfuzianischen Tradition hervorgegangene Lern- und Bildungsbereitschaft der Chinesen nicht möglich gewesen. Heute reicht es nicht mehr, China auf der Oberfläche zu begegnen, es wie früher zu missionieren, zu erobern oder als reinen Wirtschaftsstandort zu betrachten und ansonsten verächtlich auf die Nation herabzublicken. Denn die Volksrepublik braucht den Westen nicht mehr, als der Westen China braucht. Heute bedarf es einer Verständigung in Kenntnis der Erfahrungen, die unformuliert im Hintergrund wirken.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Thekla Chabbi
Die Zeichen der Sieger
Der Aufstieg Chinas im Spiegel seiner Sprache
Über dieses Buch
Was die meistgesprochene Sprache der Welt über Chinas Aufstieg zur Weltmacht verrät.
«Inzwischen haben sich die Verhältnisse gewandelt. Heute spielt China weltpolitisch eine gewichtige Rolle, die es sich nicht mehr streitig machen lässt. Und diese Entwicklung wäre ohne die grenzenlose, aus der konfuzianischen Tradition hervorgegangene Lern- und Bildungsbereitschaft der Chinesen nicht möglich gewesen. Heute reicht es nicht mehr, China auf der Oberfläche zu begegnen, es wie früher zu missionieren, zu erobern oder als Wirtschaftsstandort zu betrachten, und auf die die Nation ansonsten verächtlich herabzublicken. Denn die Volksrepublik braucht den Westen nicht mehr, als der Westen China braucht. Heute bedarf es einer Verständigung. Und dazu gehört die Sprache, weil sie Erfahrungen fassbar macht, die unformuliert im Hintergrund wirken.»
Vita
Thekla Chabbi, 1968 geboren, studierte Sinologie in Trier und Nanjing. Sie übersetzte u.a. die Romane des chinesischen Schriftstellers Li Er ins Deutsche. Für ihr Lehrwerk «Liao Liao» erhielt sie den Friedhelm-Denninghaus-Preis. Sie ist Co-Autorin von Martin Walsers Roman «Ein sterbender Mann» (2016). 2018 erschien ihr Roman «Ein Geständnis».
Inhaltsübersicht
Frage des Sperlings
Der Sperling fragt:
Warum sehen alle Menschen
gleich aus
und nicht jeder anders
– wie unsereiner?
Liu Huiru
Für Leonid
Einleitung
Die Wut über den Westen entlud sich in China vor hundert Jahren am 4. Mai 1919. Es war ein Ereignis, das der Entstehung der Volksrepublik den Boden bereitete und als Beginn der chinesischen Moderne gilt. Zum ersten Mal keimte in einer breiten Masse der Chinesen ein Nationalgefühl auf. Was als politische Empörung – auch gegen die Machtlosigkeit der eigenen Regierung – begann, weitete sich bald zu einer Massenkulturbewegung aus. Landesweit stritten die Menschen für eine bessere Zukunft in allen Lebensbereichen und riefen nach einer gemeinsamen Sprache fürs ganze Volk. Zwei Jahre später wurde die Kommunistische Partei gegründet. Unter ihr wuchs China zur zweitgrößten Volkswirtschaft heran, nimmt selbstbewusst seinen Platz in der Welt ein, im Begriff, einen Handelsgürtel quer über den Globus zu spannen, investiert kräftig in Osteuropa und Afrika und bietet den USA im Handelskampf die Stirn.
Heute ist die Volksrepublik das bevölkerungsreichste und drittgrößte Land der Erde mit nahezu 1,4 Milliarden Einwohnern. Das chinesische Territorium erstreckt sich über fast zehn Millionen Quadratkilometer – das ist knapp siebenundzwanzigmal die Fläche der Bundesrepublik –, umfasst fünf Zeitzonen und teilt sich Landesgrenzen mit vierzehn Staaten. Die Nationalsprache dieses Landes, die landläufig Mandarin genannt wird, hat die längste ununterbrochene Schrifttradition der Welt. Sie ist auch die Amtssprache Taiwans und Singapurs, die meistgesprochene Muttersprache und nach Englisch die am weitesten verbreitete Weltsprache. Diesen Siegeszug treibt die Regierung heute durch die Errichtung der Konfuzius-Institute voran, deren Aufgabe es ist, die chinesische Sprache und Kultur auf der ganzen Welt zu verbreiten. Bis 2020 soll ihre Zahl die Tausend erreichen. Zum Vergleich: Das Goethe-Institut unterhält 159 Niederlassungen in 98 Ländern.
Die Kraft der Sprache ist im Bewusstsein der Chinesen tief verankert. Seit alters geht ein Machtanspruch mit hohem Sprachvermögen einher. Aber auch für das Identitätsgefühl der Menschen und ihre Beziehung zum Staat ist die Sprache von zentraler Bedeutung. Denn innenpolitisch diente sie den Herrschern schon immer als Instrument, um in dem riesigen, kulturell disparaten Reich die Allgegenwart ihrer Macht aufscheinen zu lassen. Gleichzeitig unterwandert das Volk mit Hilfe dieses sensiblen Mittels die Anordnungen der Staatsgewalt.
Auch im Westen ist die chinesische Sprache seit Jahrhunderten Gegenstand des Interesses, doch nur selten befreite sich die Betrachtung aus dem Rahmen des eigenen Weltbildes. Jesuitenmissionare strebten danach, im Chinesischen die christliche Ursprache wiederzufinden, Gelehrte suchten im Vergleich mit europäischen Sprachen, Unterschiede und Mängel aufzuspüren. Die Schlüsse, die sie daraus zogen, dass Chinesisch nicht als christliche Ursprache taugt und sich einem formalen Vergleich mit europäischen Sprachen verweigert, wirken bis heute auf unser Chinabild. Die eurozentristische Überlegenheitshaltung ließ kein günstiges Urteil zu. Missionare bescheinigten den Chinesen eine dümmliche Versonnenheit, weil ihnen das Bewusstsein für ihren christlichen Ursprung fehle, die Gelehrten schlossen aus der Grammatik auf Charaktereigenschaften der Menschen: So erklärte das fehlende Subjekt im Satz die fehlende Subjektivität und den Kollektivismus, auch die Massennomen unterstrichen einen Mangel an Individualität; das Fehlen von Tempusformen und Buchstaben wiesen auf ein fehlendes Zeitbewusstsein und ein geringes Abstraktionsvermögen hin; dass die Wörter bei ihrer Verwendung in unterschiedlichen Wortarten (schön – Schönheit) sich nicht formal unterscheiden, war ein Beleg für eine unterentwickelte Präzision des Denkens, die fehlenden Flexionen sprachen für ein schwaches Reflexionsvermögen. Nie ging es bei der Betrachtung darum, was die chinesische Sprache möglicherweise mehr hat als westliche, wo sie genauer und konsequenter ist, weil sie sich auf den Inhalt richtet und ihm die Grammatik zu Diensten sein lässt. Nie geriet ins Blickfeld, was die Sprache jenseits einer äußeren Kennzeichnung als Gedachtes in sich trägt.
Von Chinesen ist häufig zu hören, Ausländern sei es nicht möglich, China und seine Sprache zu begreifen, dafür sei beides zu schwierig und zu rätselhaft. Außer Zweifel steht für sie hingegen, dass Lerneifer genüge, um sich westliche Sprachen anzueignen und die Kultur des Abendlandes zu verstehen. Und in der Tat zeigen Chinesen seit Jahrhunderten ein vielfach regeres Interesse am Westen als umgekehrt. Von den Missionaren im 17. und 18. Jahrhundert über die Imperialisten im 19. bis hin zu den Geschäftsleuten seit Ende des 20. Jahrhunderts stand für westliche Ausländer meist der Zweck, der sie nach China führte, im Vordergrund und ließ sie angesichts ihrer machtpolitischen Überlegenheit kaum eine Notwendigkeit verspüren, sich darüber hinaus mit dem Land zu beschäftigen. Inzwischen haben sich die Verhältnisse gewandelt. Heute spielt China weltpolitisch eine gewichtige Rolle, die es sich nicht mehr streitig machen lässt. Diese Entwicklung wäre ohne die grenzenlose, aus der konfuzianischen Tradition hervorgegangene Lern- und Bildungsbereitschaft der Chinesen nicht möglich gewesen. Heute reicht es nicht mehr, China auf der Oberfläche zu begegnen, es wie früher zu missionieren, zu erobern oder als reinen Wirtschaftsstandort zu betrachten und ansonsten verächtlich auf die Nation herabzublicken. Denn die Volksrepublik braucht den Westen nicht mehr, als der Westen China braucht. Heute bedarf es einer Verständigung in Kenntnis der Erfahrungen, die unformuliert im Hintergrund wirken.
Das gesprochene Chinesisch und die Schrift sind zwei auskunftsfreudige Systeme, voneinander unabhängig und eng verwoben zugleich. Die gesprochene Sprache ist Musik, ist ein auf Zusammenhänge angewiesenes Klangsystem. Die Schrift ist Malerei, ein auf die bildhafte Veranschaulichung von Gedanken und Ideen zurückgehendes Zeichensystem ohne eindeutige Lautinformation, das seit über zweitausend Jahren nahezu unverändert geblieben ist. Die Unerschöpflichkeit der Zeichen und der erzählerische Reichtum der Bilder sind Schönheit und Schwierigkeit zugleich. Die Tücken des Klangsystems verbergen sich in seiner Einfachheit, seine Schönheit in den melodischen Möglichkeiten des Ausdrucks. Die chinesische Sprache ist also eine Einladung an die Ohren und an die Augen, sich in eine Welt zu begeben, in der Vergangenheit und Gegenwart stärker miteinander verbunden sind als im Westen.
Dieses Buch will die Sprache als Erzählerin und als Mittlerin zu Wort kommen lassen. Es will das historische Kontinuum betrachten, ohne das Chinas Siegeszug, die Erfahrungszusammenhänge der Chinesen und der Umgang mit westlichen Staaten nicht begreifbar sind. Es will ein Verständnis für die begrifflichen und strukturellen Möglichkeiten der Sprache erschließen, das Chinesische erklären und auf die Beziehung der Chinesen zu ihrer Muttersprache blicken. Weil die Sprache die Kontinuität der Geschichte mit ihren Geschichten lebendig hält, ist der Bezug auf bedeutende historische Persönlichkeiten nicht wie hierzulande vor allem intellektuelle Referenz. In China haben sie Eingang gefunden in den Alltagsgebrauch der Sprache. Darüber hinaus will dieses Buch die Sprache als politisches Instrument für die Selbstdarstellung des Staates in der Welt, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Innern und zur Abgrenzung nach außen beleuchten. Die staatlich propagierte Einheit, deren Repräsentantin die Nationalsprache ist, halten auch die meisten Chinesen hoch. Allerdings nur nach außen. Die Lebenswirklichkeit der Menschen bestimmt eine ethnische, kulturelle und weltanschauliche Vielfalt innerhalb einer Gesellschaft, die alles andere als homogen ist. Die chinesische Gesellschaft ist bunt und reich an Ideen, Meinungen, Witz und Subversion, wie es moderne Gesellschaften sind. Neben der Kunst ist es die Sprache, die Gedanken und Anschauungen der Menschen Ausdruck verleiht. Deshalb soll chinesischen Zweifeln zum Trotz der Versuch unternommen werden, dem Rätsel China durch die Begegnung mit seiner Sprache nachzugehen und die Zeichen der Sieger zu entschlüsseln.
Und nach der Lektüre dieses Buches soll niemand den Namen des chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei je wieder falsch aussprechen müssen.
Kapitel 1Mit der Sprache durch die Geschichte
Die ganze Kunst der Sprache bestehe darin, verstanden zu werden, soll Konfuzius gesagt haben, der große chinesische Weise des 6. vorchristlichen Jahrhunderts, der China bis heute prägt, obwohl er selbst nichts Schriftliches hinterlassen hat. Und Goethe sagte zu Eckermann, als er diesem nicht ohne Stolz berichtete, er habe am selben Morgen im Weimarer Fürstenhaus die dort beschäftigten Mailänder Maler sogleich auf Italienisch angeredet: «Die Sprache bringt doch eine Art von Atmosphäre des Landes mit.» Denn, so Goethe an anderer Stelle: «Beim Übersetzen muß man bis ans Unübersetzliche herangehen; alsdann wird man aber erst die fremde Nation und die fremde Sprache gewahr.» Die Sprache schöpft aus Erfahrung, erschafft über eine Abbildung der Wirklichkeit hinausreichende Bilder, transportiert Tradition und ist zugleich lebendiger Ausdruck des Zeitgeistes. Sie beschränkt sich nicht auf Sprechgewohnheiten, die aus der kulturellen Prägung eines Volkes entstehen. Auch sie selbst verfügt über Wirkmächtigkeit.
Die Vierte-Mai-Bewegung von 1919 bestätigt die politische und gesellschaftliche Kraft der Sprache. Sie gilt als eines der bedeutendsten Ereignisse der Geschichte Chinas, dessen wichtigste Ziele, um China zu einer starken Nation zu machen, demokratische Rechte nach westlichem Vorbild und, als Voraussetzung dafür, ein neuer Umgang mit der Sprache waren. Chinas Wehrlosigkeit seit dem Verfall der letzten Dynastie ab Mitte des 19. Jahrhunderts hatte zu anhaltenden innenpolitischen Unruhen geführt und zu unterschiedlichen Vorstellungen, wie China seine Stärke zurückerlangen könne. Eine dieser Gruppen geistiger Erneuerer – Schriftsteller und Intellektuelle, die den Westen bewunderten – wurde zur Ideengeberin der Bewegung, weil sie dem Kanzler der Peking Universität nahestand. Rund dreitausend Studierende seiner Hochschule hatten den Protest angezettelt als politische Reaktion auf die Aushandlung des Versailler Vertrags. China hatte Deutschland 1917 den Krieg erklärt, sich nach der deutschen Niederlage als Siegermacht verstanden und in der Gewissheit gewiegt, das Kolonialgebiet des deutschen Kaiserreichs auf der Shandong-Halbinsel zurückzuerhalten. Als bekannt wurde, dass die Westmächte in einem Geheimabkommen das Territorium bereits Japan zugeteilt hatten und die chinesische Regierung sich ihre Einwilligung mit einem japanischen Kredit von 20 Millionen Yen hatte abkaufen lassen, brach eine Welle der Empörung los. Während chinesische Studierende in Paris das Hotel von Chinas Delegierten umstellten, um die Unterschrift unter den Versailler Vertrag zu verhindern, kam es in der Heimat zu Großdemonstrationen, landesweiten Streiks und zum Boykott japanischer Güter.
Ihre Tragweite verdankt die Vierte-Mai-Bewegung nicht nur den revolutionären Inhalten und den Folgen des Protests, sondern vor allem ihrer gesellschaftlichen und weltanschaulichen Vielschichtigkeit. In dieser Bewegung gipfelten die politischen Entwicklungen der vorangegangenen Jahrzehnte als Aufschrei der Massen. Nie trafen Tradition und Aufbruch umfassender aufeinander als an diesem Wendepunkt, der die Wechselwirkung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen China und der westlichen Welt verdichtet. Zum ersten und einzigen Mal stritten sämtliche gesellschaftliche Gruppen – Intellektuelle, Geschäftsleute und Arbeiter – vereint für eine bessere Zukunft und ließen dadurch eine in der chinesischen Geschichte beispiellose Massenkulturbewegung entstehen. Eine starke Nation brauche ein mündiges Volk, dem die Sprache vollumfänglich zugänglich sei, die Sprache durfte nicht mehr der aristokratischen Oberschicht überlassen werden.
Während die gesprochene Sprache einen Wandel durchlaufen hatte, der sich natürlicherweise vollzieht, war für schriftlich verfasste Texte die klassische Literatursprache bestimmend geblieben. Das klassische Chinesisch geht zurück auf die Sprache, in der die Texte zu Konfuzius’ Lebzeiten geschrieben wurden. Schon damals waren Literatursprache und die Sprache des Alltags nicht identisch – zumal der mündlichen Verständigung vor allem unterschiedliche Regionalsprachen dienten –, im Lauf der Zeit entfernten sie sich immer weiter voneinander. Vor Beginn unserer Zeitrechnung war das klassische Chinesisch bereits eine tote Sprache ähnlich wie Latein später in Europa. Als Kunstsprache musste es mühevoll erlernt werden, um die chinesische Tradition zu studieren und aristokratischen Ansprüchen genügende Schriften zu verfassen. Dem Volk blieb dadurch der Zugang zu Literatur, Geschichtsschreibung und politischen Erlassen verwehrt, die Macht über Chinas Textreichtum war den Herrschern und der Oberschicht vorbehalten. Gegen diese Hoheit wandten sich die Aktivisten der Vierten-Mai-Bewegung, indem sie forderten, fortan nur noch in der Umgangssprache zu schreiben, die klassische Literatursprache zu eliminieren und das Volk aus seiner Unmündigkeit zu befreien.
Dass die Sprache in China bis heute eine gesellschaftlich weittragende Bedeutung hat, ist dem politischen Ringen um die Einheit des Staates zu verdanken. Denn die ethnische Vielfalt prägt China seit seiner Gründung im Jahr 221 vor Christus, dem Beginn des chinesischen Kaiserreichs. Zuvor, in der so genannten Zeit der Streitenden Reiche, hatten sich auf einem vorwiegend nördlichen Teil des heutigen Territoriums mehrere Fürstentümer jahrhundertelang erbitterte Kämpfe um die Vorherrschaft geliefert, bis es Ying Zheng, dem Herrscher des Staates Qin, gelang, seine Gegner nach und nach zu unterwerfen und sich schließlich zum Kaiser auszurufen. Damit wurde die Utopie von einem geeinten Reich Wirklichkeit: «Alles unter dem Himmel.» Nach dieser alten chinesischen Idee entsprach das Reich der Welt mit dem Kaiserhof als Zentrum. Der Kaiser, der als Sohn des Himmels das Reich im Auftrag des Himmels regierte, war nominell der Herrscher der ganzen Welt. Ying Zheng benannte die erste Dynastie nach seinem Staat Qin und gab sich den Namen «Erster erhabener Herrscher von Qin».
Auf ihn gehen nicht nur zwei bedeutende Bauwerke zurück, die Große Mauer und sein Mausoleum mit den geschätzten achttausend Terrakottafiguren. Auch der westliche Name Chinas leitet sich mit großer Wahrscheinlichkeit von einer Transliteration des Namens der ersten Dynastie ab. Im Sanskrit wurde das chinesische Reich Cina genannt, und es scheint, dass das Land, aus dem die begehrte Seide kam, vor unserer Zeitrechnung im gesamten zentralasiatischen Raum unter der Bezeichnung Cin geläufig war. Daraus entstand der im 17. Jahrhundert im Lateinischen und Altgriechischen gebräuchliche Name Sina, der in den Begriffen «sinitisch», China betreffend, und «Sinologie» für Chinawissenschaft erkennbar ist. Der erste Kaiser einte nicht nur das Reich unter seinem Verwaltungssystem, auch die Schrift und die Sprachen der einst unabhängigen Staaten wollte er als Zeichen der Unanfechtbarkeit seiner Herrschaft über das gesamte Land vereinheitlichen. Er brachte eine gemeinsame Schrift für mehrere der damals verwendeten Regionalsprachen auf den Weg. Diese Kleine Siegelschrift blieb bestimmend für die Weiterentwicklung der Zeichen und ist bis heute lesbar. Seine Bemühungen, auch die zahlreichen gesprochenen Sprachen zu einer zusammenzubringen, sind jedoch gescheitert.
Eine staatlich normierte Sprache erhielt China erst 1932, als die Kommission zur Vereinheitlichung der Aussprache ein Lexikon mit der modernen Aussprache häufig gebrauchter Zeichen herausgab. Dieses Lexikon war das Ergebnis eines langwierigen Prozesses, der Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen und größtenteils seit der Republikgründung 1912 als eine Maßnahme vorangetrieben worden war, um China als Nation nach innen und außen zu stärken. Die Standardisierung des Wortschatzes und der Grammatik wurde als nächster Schritt bis auf weiteres verschoben. Die Sprache erhielt die Bezeichnung «Nationalsprache» (Guoyu) und verfügte durch die Namensgebung fortan über die Voraussetzung dafür, dass sich die Menschen zu ihr bekennen und als Mitglieder einer Sprachgemeinschaft fühlen konnten. In der Volksrepublik heißt diese standardisierte Hochsprache Putonghua («Allgemeinsprache»), in Taiwan, der Republik China, weiterhin Guoyu. Beide unterscheiden sich nur geringfügig, gehen auf den Pekinger Dialekt zurück, bereinigt von speziellen, nur regional gebrauchten Lauten und Begriffen. Hochchinesisch ist eine der sinitischen Sprachen. Die sechs sinitischen Hauptsprachen neben Hochchinesisch werden aus politischen Gründen als Dialekte bezeichnet. Schriftlich sind sie weitgehend übereinstimmend darstellbar, aber verbal unterscheiden sie sich erheblich. Das bedeutet, dass sich Menschen mit verschiedenen sinitischen Muttersprachen nicht telefonisch, wohl aber schriftlich miteinander verständigen können. Für Chinesen unterschiedlicher Herkunftsregionen, die seit Generationen im Ausland leben und innerhalb der Familie nur ihre Regionalsprache pflegen, kann diese Barriere zur Folge haben, dass sie untereinander lieber auf die Sprache der neuen Heimat ausweichen. Das würde indes für Friesen und Bayern genauso gelten. In China selbst, wo die Kinder das Schreiben zusammen mit der Hochsprache erlernen, entbehrt diese Vorstellung der Realität. Wie überall auf der Welt ist das Einüben der staatlich normierten Sprache einer der wichtigsten Aufträge der Schulen, um der Nationalsprache zur Verbreitung und Anerkennung zu verhelfen.
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts und bis zu der Erkenntnis, dass es Japan gelungen war, eine Nationalsprache einzuführen, beschränkten sich die chinesischen Bemühungen um eine gemeinsame Volkssprache auf vereinzelte, halbherzige Versuche. Für die Bewältigung administrativer, diplomatischer, kommerzieller und militärischer Belange gab es bereits seit dem zweiten vorchristlichen Jahrtausend eine Lingua franca, hervorgegangen aus einem Dialekt der zentralchinesischen Provinz Henan. Darauf basierend entwickelte sich im ersten vorchristlichen Jahrtausend eine elaboriertere Form mit einer standardisierten Aussprache, die in den Schulen gelehrt und von den kaiserlichen Beamtenanwärtern beherrscht werden musste. Doch da China nicht nur seine Grenzen laufend verschob und unterschiedliche Volksgruppen in das Reich integrierte, sondern auch wiederholt die Hauptstadt verlegte, flossen in die Aussprache dieser Lingua franca mehr und mehr Besonderheiten anderer Regionalsprachen ein. Ab Ende des 14. Jahrhunderts, als die Ming-Dynastie den Kaiserthron übernahm, zunächst das südchinesische Nanjing zur Hauptstadt bestimmte und zu Beginn des 15. Jahrhunderts in den Norden nach Peking übersiedelte, wurde die Lingua franca Beamtensprache genannt. Chinesische Gelehrte beschäftigten sich bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts kaum mit ihr. Auskünfte über diese am Kaiserhof und von den Gelehrten gesprochene Sprache lieferten vor allem westliche Missionare. Zurückgehend auf das malaiische Wort mantari, nannten sie einen hohen chinesischen Beamten Mandarin und dessen Sprache «Mandarinensprache». Damit prägten sie die landläufige Bezeichnung Mandarin für das standardisierte Chinesisch. Ihren Aufzeichnungen ist zu entnehmen, dass sich die Beamtensprache bis zum Ende des Kaiserreichs Anfang des 20. Jahrhunderts stark wandelte. Während zunächst die südliche Sprache Nanjings bestimmend war, dominierte nach und nach die Pekinger Aussprache und konnte deshalb schließlich zur Grundlage der modernen Hochsprache werden. In der Wirklichkeit des Alltags gab es jedoch in der Vorzeit mühelosen Reisens und moderner Kommunikationsmittel nicht nur für die einfachen Leute, sondern auch für die Gebildeten keine Notwendigkeit, die Verwendung ihrer Regionalsprachen in Frage zu stellen. Selbst lange nach der Standardisierung gelang es auch bedeutenden Persönlichkeiten wie Mao Zedong und Deng Xiaoping nicht, ihren starken regionalen Akzent abzulegen und sich in ihren Reden den Massen verständlich zu machen. Oft waren sie auf Dolmetscher angewiesen und im Fernsehen auf die Untertitelung. Der amtierende Präsident Xi Jinping gilt als das erste Staatsoberhaupt der Volksrepublik, das des Hochchinesischen mächtig ist.
Über den langen Weg bis zu einer mündlichen Verständigung ohne regionale und gesellschaftliche Schranken trägt sprachlich eine gewaltige Menge schriftlicher Werke. Mündlich könnten sich die alten Chinesen ihren heutigen Nachfahren nicht mehr verständlich machen, doch ihre schriftlich festgehaltenen Gedanken sind für jeden der klassischen Schriftsprache Kundigen noch immer lesbar. Der im Laufe der Jahrhunderte angewachsene Textbestand hat Gewicht und prägt das kollektive Bewusstsein der Chinesen für ihre lange Kulturtradition. Obgleich die klassischen Texte nur einen Teil des gesellschaftlich, ethnisch und kulturell vielschichtigen Landes widerspiegeln, übertönt ihre Stimme das Orchester der Mehrheit und dominiert die Wahrnehmung von der chinesischen Kultur. Die Herrscher und Angehörigen der feudalen Oberschicht instrumentalisierten die literarischen, philosophischen und historiographischen Publikationen für ihre Zwecke. Die Sprache verlieh ihnen die Deutungshoheit über den Tod hinaus.
Schon einige Jahre vor der Vierten-Mai-Bewegung hatte die Gruppe ihrer Ideengeber die Rückwärtsgewandtheit als Chinas Schwäche und als Ursache für den politischen Zerfall des Landes ausgemacht. Ihr Sprachrohr wurde die Zeitschrift Neue Jugend, die Chen Duxiu, hernach Gründungsmitglied der Kommunistischen Partei, 1915 ins Leben rief. Die Denker, die sich in der Neuen Jugend zu Wort meldeten, waren größtenteils glühende Befürworter einer Republik China gewesen. Aber schon bald nach ihrer Gründung am 1. Januar 1912 kehrte Ernüchterung ein. Die Revolution, die das zweitausend Jahre alte Kaiserreich zu Grabe getragen hatte, erwies sich nur scheinbar als radikalster Umbruch der chinesischen Geschichte. In Wirklichkeit hatte sich nicht viel verändert. Der Staat erhielt einen anderen Namen, und nicht einmal einen neuen. Denn Sun Yatsen, der Anstifter des Umsturzes und erste chinesische Präsident, wählte mit rhetorischem Bedacht Gonghe als chinesisches Wort für Republik und trug damit der Geschichtsautorität Rechnung: Gonghe bedeutet «Gemeinsame Harmonie» und ist ein Begriff aus dem 9. vorchristlichen Jahrhundert. Weil damals der grausame König die Flucht ergreifen musste und sein Sohn zu jung war, um die Regierungsgeschäfte zu führen, übernahmen vorübergehend zwei Kanzler die Staatsmacht. Über diese Epoche gibt es in der ersten Dynastiengeschichte aus dem 2. vorchristlichen Jahrhundert einen Eintrag, in dem der Begriff Gonghe erstmals auftaucht: «Kanzler Shao und Kanzler Zhou führten die Regierung zu zweit, das wurde Gemeinsame Harmonie genannt.» Jene Zeit, in der das Land keinen König hatte, die Macht nicht bei einem Einzelnen lag, sondern geteilt wurde, diente den chinesischen Republikanern und ihrer Nationalpartei als klassisches Vorbild mit Symbolkraft. Indem sie bei der Namensfindung für die neue Staatsform einen Bezug auf Altbewährtes herstellten, hofften sie, Verunsicherung entgegenzuwirken und das Vertrauen der Bevölkerung für sich zu gewinnen. Die Realität der Republikjahre zeigte jedoch, dass Sun Yatsens amerikanisch-linksliberal geprägten Ideale wirkungslos und dem Volk unverständlich waren. Allerorts brachen Machtkämpfe aus, die das Land in große Not stürzten und den Staat in eine brutale Militärdiktatur mit monarchistischen Bestrebungen und ungebrochen feudalen Strukturen verwandelten.
Laut rief die Neue Jugend zum Widerstand gegen die alte Gesellschaft auf, gegen ihre Werte und ihre Moral, zu Mündigkeit, Frauenemanzipation, wissenschaftlichem Denken, einer neuen chinesischen Literatur und Kultur, zu Demokratie. Viele der Intellektuellen, die in der Neuen Jugend ihre Stimme erhoben, hatten in Russland, Japan, den USA oder Europa studiert und waren mit demokratischen und marxistischen Ideen zurückgekehrt. Um aus China eine weltweit anerkannte und respektierte Nation zu machen und das Land von seinem Selbstverständnis als konfuzianische Kultur zu befreien, müsse man vom Westen lernen. «Herr Konfuzius» solle, schrieb Chen Duxiu, durch «Herrn Wissenschaft und Herrn Demokratie» ersetzt werden. Da es der Kulturwende widersprach, sie in tote Worte zu kleiden, musste vor allem eine neue Sprache gefunden werden. Es kam zu hitzigen Debatten darüber, ob es der Bruch mit der Vergangenheit erfordere, die Schriftzeichen abzuschaffen und durch eine alphabetische Schrift zu ersetzen, auch Esperanto wurde als Nationalsprache erwogen, und vorauseilend wurden einige Esperanto-Schulen gegründet. Aber eine Übereinkunft erwies sich in intellektuellen Kreisen als ebenso schwierig wie in politischen. Einhelligkeit herrschte unter den Intellektuellen indes darin, dass China eine neue Literatur brauche, die formal und inhaltlich von traditionellen Vorgaben entbunden in einer einfachen Sprache die Wirklichkeit beschrieb. Anders als die Romane, die schon früher in der Alltagssprache verfasst und vor allem im 16. und 17. Jahrhundert vom Volk verschlungen worden waren, sollten es die neue Literatur und die neuen Erzähler zu gesellschaftlichem Ansehen bringen. In der Praxis zeigte sich schließlich, dass die neue Literatursprache dann doch nicht für jedermann leicht verständlich war. Zwar hatte sie sich vom klassischen Chinesisch befreit, experimentierte aber stattdessen unter dem Einfluss fremdsprachiger Werke mit begrifflichen und grammatischen Neuschöpfungen.
Die erste Veröffentlichung der «Neuen Literatur» ist die im Mai 1918 in der Neuen Jugend erschienene Kurzgeschichte Tagebuch eines Verrückten von Lu Xun, dem wohl bedeutendsten chinesischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts und einem der radikalsten Verfechter einer neuen Sprache. Er war ein ausgezeichneter Kenner der westlichen Literatur, sein Werk ist eng mit ihr verwoben. Nicht nur der Titel seiner Kurzgeschichte ist an Nikolai Gogols Erzählung Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen angelehnt. Lu Xun, der 1881 als Sohn einer später verarmten Großgrundbesitzerfamilie zur Welt kam, besuchte nach seiner klassischen Schulausbildung eine von Deutschen gegründete Akademie für Bergbau in Nanjing. Dort lernte er eifrig Deutsch und Englisch, entdeckte die westliche Literatur und kam mit Naturwissenschaften in Kontakt, bevor er sich 1902 nach Japan begab. Zunächst lernte er in Tokio Japanisch und weiter Deutsch, anschließend nahm er in Sendai ein Medizinstudium auf. Seine Sprachkenntnisse ermöglichten ihm eine umfassende Lektüre wissenschaftlicher, philosophischer und literarischer Werke, die auf Deutsch, Englisch und Japanisch vorlagen. Besonders die russische und osteuropäische Literatur nahmen ihn für sich ein. Dafür, dass sie einer stummen, gepeinigten Masse eine Stimme gaben, bewunderte er vor allem Autoren aus jenen Ländern, die ein ähnliches politisches Schicksal wie China erfahren hatten. Nach kaum einem Jahr gab er sein Medizinstudium auf und widmete sich ganz der Literatur. Seine Beweggründe schildert er im Vorwort zu seiner Kurzgeschichtensammlung:
«Eines Tages, nachdem ich schon lange keinem Chinesen mehr begegnet war, sah ich auf Bildern unverhofft eine ganze Schar meiner Landsleute. In der Mitte war einer gefesselt, die Menge stand um ihn herum. Alle waren sie von kräftiger Statur, aber ihr Gesichtsausdruck wirkte stumpf. Es hieß, der Gefesselte sei ein Spion des russischen Militärs gewesen und sollte von japanischen Soldaten demonstrativ vor den Augen der Menge, die solch ein Spektakel zu schätzen weiß, geköpft werden.
Noch vor Ablauf des Studienjahres war ich zurück in Tokio. Die Medizin hielt ich seitdem nicht mehr im Geringsten für dringlich. Ein Volk geistig Beschränkter, gleichviel wie gesund und kräftig, wird nie etwas anderes sein als Kanonenfutter und Glotzer. Wenn ein paar davon an Krankheiten zugrunde gehen, ist das wahrlich kein Schaden. Daher war unsere wichtigste Aufgabe, ihren Geist zu verändern, und das beste Mittel dafür, so glaubte ich damals, seien natürlich die Literatur und die Kunst. Also wollte ich mich für eine Literaturbewegung stark machen.»
Lu Xun wurde zum Vorreiter einer neuen Schriftstellergeneration und zu einem der produktivsten Übersetzer. Über zweihundert Werke unterschiedlicher Genres von mehr als hundert Autoren aus fünfzehn Ländern gehen auf ihn zurück. Allerdings scherte er sich als Verfechter der wörtlichen Übersetzung nur wenig um die Lesbarkeit auf Chinesisch. Vielmehr lag ihm daran, keiner Verfälschung des Inhalts zu erliegen und die Leser herauszufordern. Sie sollten sich nicht nur mit neuen Ideen vertraut machen, sondern auch mit der Sprache, die die Ideen wiedergab. Ein Volk gedankenloser Opportunisten, wie es das konfuzianische Gesellschaftssystem hervorgebracht habe, weil es hierarchisch missbraucht worden sei, war allzeit Gegenstand seiner Kritik: «Die so genannte chinesische Zivilisation ist in Wirklichkeit nur ein Festschmaus aus Menschenfleisch für Reiche, das so genannte China nur die Küche, in der der Festschmaus zubereitet wird.» So ist seine Erzählung «Tagebuch eines Verrückten» in Form und Inhalt ein scharfer Angriff auf die Unmenschlichkeit der korrumpierten chinesischen Tradition. Neu war nicht nur die Sprache, sondern auch die Gattung der Kurzgeschichte.