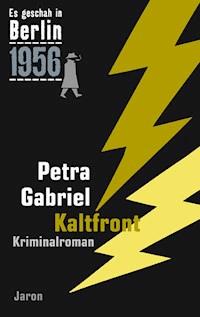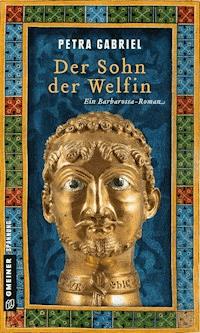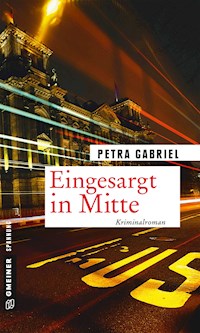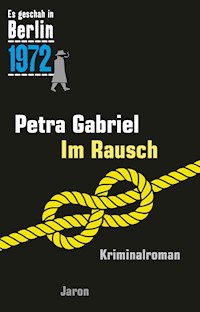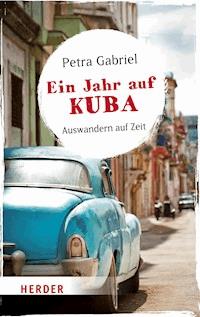
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es piept, pfeift, trillert, tutet, trötet unablässig aus den Autos, Motorrädern, Bussen, Cocotaxis und Bicitaxis auf Havannas Straßen. Fliegende Händler ziehen durch die Gassen, Scherenschleifer zücken ihre Trillerpfeifen. Petra Gabriel hat sich ihren Traum von der Sehnsuchtsinsel Kuba erfüllt. Sie stürzt sich ins pulsierende Leben der Hauptstadt und erlebt eine Insel zwischen dem Gestern der Revolution und dem Morgen einer hoffnungsvollen Zukunft. Ein einmaliges Leseerlebnis – und eine Einladung, Kuba reisend zu erobern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Petra Gabriel
Ein Jahr aufKuba
Auswandern auf Zeit
Impressum
Titel der Originalausgabe: Ein Jahr auf Kuba
Auswandern auf Zeit
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2016
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: © ArtMarie – iStock
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-80766-4
ISBN (Buch): 978-3-451-06765-5
„Schützengräben aus Ideen sind mehr wertals Schützengräben aus Stein.“
JOSÉ MARTÍ (1853–1895), SCHRIFTSTELLERUNDKUBANISCHER NATIONALHELDDER FREIHEITSKRIEGE
Inhalt
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Januar
Februar
März
MIT VORURTEILEN IST DAS SO EINE SACHE, besonders mit jenen, die uns mit einer gewissen Nachhaltigkeit eingeimpft wurden. Irgendwann beginnt man zu glauben, es könnte etwas Wahres dran sein. Diesen Satz zum Beispiel höre ich immer wieder: „Wer das alte Kuba noch erleben will, der sollte sich beeilen.“ Als ausgesprochene Westpflanze ohne jede Erfahrung mit dem real existierenden Sozialismus habe ich keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Auch nicht, wie das „neue“ Kuba aussehen könnte. Es klingt für mich jedoch so, als ginge aufgrund der sich anbahnenden Annäherung zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten in nächster Zukunft eine Welt unter, eine Art Paradies verloren. Das muss ich mir anschauen, solange es noch existiert, denke ich mir – und buche kurzentschlossen die erste Busrundreise meines Lebens.
Um mich einzustimmen, fliege ich zunächst nach Varadero in die Provinz Matanzas, zu jener Halbinsel also, auf der Hotel an Hotel steht. Ich mag es, die Welten langsam zu wechseln. Und dann geht es vierzehn Tage einmal quer durch Kuba, von West nach Ost bis Baracoa. Mein Kopf ist vollgepfropft mit Informationen aus Reiseführern. Gut, es steht überall, dass die Kubaner offen sind, zuvorkommend, gastfreundlich, lebenslustig. Stimmt. Und die Insel ist tatsächlich wunderschön mit ihrer abwechslungsreichen Natur, den Tabakfeldern im Tal von Viñales und den unwegsamen Mogotes, den Kegelkarstbergen, bis hin zum Humboldt-Nationalpark und den Regenwaldgebieten im Osten. Trinidad, Santiago de Kuba, Cienfuegos, Holguín – ich genieße die Fahrten durch das Land, vorbei an den meist einstöckigen Häusern der campesinos, den oft liebevoll gepflegten Gärten davor, den bodegas am Wegesrand. Ja, stimmt alles.
Dennoch ist das nur ein Teil der Realität. Was ich noch nicht ahne: Es werden weitere Monate auf Kuba folgen. Monate, die mir mehr bieten und abfordern werden als jene „Wahrheit“, die ich bei meinem ersten organisierten Besuch auf der Insel erlebt habe. Denn bei dieser Busrundreise ist etwas Entscheidendes geschehen: Am Ende habe ich mich Hals über Kopf in die Insel und ihre Menschen verliebt. Ich will unbedingt wiederkommen, länger blieben, leben wie die Kubaner.
Schon während der gut zehn Stunden, die mein erster Flug von Frankfurt nach Varadero dauert, habe ich genügend Gelegenheit, mein Vorwissen über Kuba zu rekapitulieren. Zumal ich Holzklasse fliege, und das bedeutet: Ich kann wegen fehlender Beinfreiheit nicht schlafen. Andererseits hätte ich auch mit mehr Beinfreiheit nicht schlafen können. Ich kann unterwegs nie schlafen, sei es im Auto, im Zug oder im Flugzeug.
Bereits kurz nach dem Start werde ich mit einem Kuba-Vorurteil konfrontiert, das sich meiner Erfahrung nach in vielen westlichen Köpfen findet. So auch in dem meines Sitznachbarn Anton aus Bayern, der wie ich noch nie auf der Insel war. Er vertritt es beredt. „Auf Kuba herrscht Kommunismus“, erklärt er dröhnend, sodass es bis in die letzte Sitzreihe zu hören ist. Ich zucke kurz zusammen und vermute, Anton ist einer jener Menschen, die andere gerne belehren. Also bleibe ich erst einmal stumm. Zumal ich, wie bereits gesagt, weder mit dem Kommunismus noch dem Sozialismus persönliche Erfahrungen gesammelt habe. Und Anton fährt ungestört fort: „Der Kommunismus ist dem Kapitalismus unterlegen. Der Zusammenbruch der Sowjetunion und der Untergang der DDR sind der beste Beweis.“ Es ficht ihn auch nicht an, dass die beiden älteren Damen in der Reihe vor uns immer wieder versichern, auf Kuba sei es wunderbar. Eine erzählt, in vielen Häusern gebe es Läden mit beweglichen Lamellen ohne Glas statt der „normalen“ Fenster. Sie habe auf Kuba eine Freundin, und die stocke gerade ihr Haus auf, um eine Privatunterkunft anbieten zu können.
Wasser auf Antons Mühlen. Keine Fenster! Im Kommunismus funktioniere eben nichts, noch nicht einmal die Fensterproduktion.
Warum er denn dann nach Kuba fliege, frage ich Anton. Wegen der alten amerikanischen Straßenkreuzer. Außerdem solle ich mir keine Sorgen wegen des Kommunismus machen. Che Guevara sei schon tot. Und die beiden Castros würden auch bald von der Bildfläche verschwinden. Er schaut erwartungsvoll. Warum er mit seiner Reise denn dann nicht auf das „neue“ Kuba warte, hätte ich am liebsten gefragt. Doch wieder bleibe ich stumm, um eine Diskussion zu vermeiden, schließe die Augen, tue so, als würde ich schlafen, und höre erst damit auf, als ich neben mir das Schnarchen von Anton höre, aus dem ich schließe, dass ich jetzt vor seinen Belehrungen sicher bin.
Kaum auf dem Flughafen Varadero angekommen, lege ich so schnell wie möglich großen Abstand zwischen Anton und mich. Musik, lachende Menschen (okay, nicht alle sahen aus wie Kubaner), ein klimatisierter Flughafen, freundliche ZöllnerInnen. Nur das Formular mit der Frage nach möglichen Schmuggelgütern, Waffen, Pornografie und was weiß ich noch alles (ich habe das Kreuzchen selbstredend immer beim Nein gemacht), das ich bereits im Flugzeug hatte ausfüllen müssen, sowie die Kamera, vor die ich beim offiziellen Grenzübertritt mein Gesicht halten muss, stören meine trotz Schlafmangel gute Stimmung. Waffen! Pornografie! Drogen! Wofür halten die mich? Ich wage es ja noch nicht einmal, falsch zu parken oder schwarz in der U-Bahn zu fahren. Während mein Gesicht fotografiert wird, fallen mir die biometrischen Zollkontrollen ein, die es im Kapitalismusland ja ebenfalls gibt, und ich bin besänftigt.
Mein Optimismus gewinnt wieder die Oberhand und steigert sich noch, als ich ein gewisses Örtchen aufsuche. Für eine Türkei- und Griechenland-erfahrene Deutsche eröffnen sich paradiesische Aussichten. Nichts mit Plumpsklo oder Abtritt, sondern Schüssel und Spülung. Gut riechend. Ziemlich sauber.
Auch die Organisation scheint zu klappen. Eine Luke spuckt Koffer aus, viele in einem ähnlichen Grau wie meiner, zwei Transportbänder liefern sie an die Reisenden. Und das ziemlich schnell nach der Landung. Gut, der Flughafen Varadero ist eher klein, in etwa so provinziell wie der Flughafen Basel. Ich persönlich würde diese Größe unter gemütlich subsumieren. Erwartungsvoll harre ich also dem Auftauchen meines Rollkoffers entgegen, neu erstanden für den Flug auf die Insel. Ich starre und starre und bekomme jede Menge Zeit, zu bedauern, dass ich nicht eine rote Schleife drangebunden hatte. Ich habe mir meine Neuerwerbung beim Packen nicht so genau angeschaut, wie ich dies hätte tun sollen, oder besser: nach dem Packen und Zuklappen, denn es geht ja ums Außen.
Stattdessen ziehen immer mehr Koffer ihre Schleifen, werden vom Band gehoben. Meiner ist nicht darunter. Sollte ich doch ans andere Band? Ich harre aus. Schließlich wurde mir gleich nach der Landung erklärt, dass ich meinen Koffer an diesem finde. Neidvoll blicke ich einigen Mitreisenden nach, die samt Gepäck in Richtung Zoll marschieren. Ich warte, entschlossen, die Unrast und Nervosität, die Europäern gemeinhin nachgesagt wird, insbesondere den Deutschen, nicht durchscheinen zu lassen. Denn bin ich nicht auf Kuba, der Insel der lauen Sommernächte, des Salsa, der wunderbaren Longdrinks (dies war das einzige Vorurteil, und das betrifft auch die positiven, das sich komplett bewahrheiten sollte)? Also gebe ich mich cool. Carpe diem.
Anton aus Bayern hat sich neben mir postiert und macht mich schließlich auf eine Legion Koffer aufmerksam, die sorgsam arrangiert in Reih und Glied neben dem anderen Band stehen. Neben den Koffern wiederum entdecke ich mehrere junge Männer. Ich schöpfe Hoffnung und gehe auf sie zu. Auf die Koffer natürlich. Einer der jungen Männer, das Sinnbild des rassigen Kubaners, schlank, schmale Hüften, breite Schultern, lächelt mir so nett entgegen, dass ich mir schon ganz willkommen vorkomme, und sagt anschließend etwas auf Spanisch. Ich verstehe, dass er annimmt, ich suche mein Gepäck und nicke. Er führt mich das letzte Stück zu den Koffern. Und, o Wunder, da ist meiner. „Ein CUC“, sagt der freundliche junge Mann. In diesem Moment wird mir klar, dass auf Kuba vieles sehr wohl gut organisiert ist.
Und weil wir schon beim Thema Organisation sind, ist es vielleicht ratsam, an dieser Stelle etwas über die kubanischen Toilettengepflogenheiten zu erzählen. Die gute Nachricht: Es gibt nach europäischen Maßstäben einigermaßen annehmbare Toiletten, also solche, bei denen die Toilettenspülung funktioniert und die Türen abschließar sind. Meist dort, wo Touristen verkehren. Also in den großen Hotels, alle staatlich, die zumeist zusammen mit spanischen Gesellschaften hochgezogen worden sind. Und in denen meiner Erfahrung nach das Meiste klappt. Wirklich. Soweit das auf Kuba eben möglich ist. Denn damit, dass mal Wasser und Strom ausfallen, muss man rechnen. Das steht in jedem Reiseführer. Sie sollten das glauben.
Die schlechte Nachricht: Es gibt viele gewisse Örtchen, die zwischen gewöhnungsbedürftig und anrüchig rangieren, um es mal vornehm auszudrücken. Aber egal, welche Art von Toilette, bitte niemals, NIEMALS das Toilettenpapier in die Toilette werfen. Dafür stehen eigene Abfalleimer bereit. Ich habe übrigens schnell gelernt, entweder Toilettenpapier oder Kleingeld dabei zu haben, um selbiges zu kaufen, am besten CUP, kubanische Pesos, die Währung, in der den Einheimischen der Lohn ausgezahlt wird. Dieses Toilettenpapier besteht dann meist nicht mehr als aus drei Blatt, sorgsam zusammengefaltet.
Sagte ich schon, dass auf Kuba der Tourismus nach dem Medizinsektor zur wichtigsten Einnahmequelle avanciert ist? Ich meine nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der auch den Kollaps für die kubanische Wirtschaft bedeutete. Die Kubaner nennen jene Zeit, in der sie sich ein weiteres Mal am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen mussten, die zweite große Krise. Dabei haben sie, was die Unterbringung der Touristen betrifft, ihre Sache vergleichsweise gut gemacht – anders als die Spanier. Die staatlichen Reiseagenturen halten meist, was sie versprechen. Die Bauten auf der All-inclusive-Halbinsel Varadero sind, soweit ich das gesehen habe, keine Bettenburgen, sondern bis auf das Haupthaus selten mehr als zweistöckig, zumindest die neueren. Die Bungalows mit den Zimmern liegen in parkähnlichen Anlagen.
Die älteren Hotels sind trotzdem einen Aufenthalt wert. Im Stadtteil Miramar von Havanna habe ich so eines erlebt, eines, das noch aus der Zeit übriggeblieben ist, als die Amerikaner die Insel in ein Spielerparadies à la Las Vegas mit allen seinen Folgeerscheinungen verwandelt hatten. Das Comodoro ist weit davon entfernt, perfekt zu sein, vermittelt dafür aber den Charme einer abgetakelten Diva. Ich mag Diven. Dafür verzichte ich gerne auf Luxus.
Bezüglich meiner Verständigungsmöglichkeiten beschließe ich nach der ersten Erfahrung auf dem Flughafen, erst einmal Kubanisch zu lernen. Denn das, was ich als Spanisch auf Disketten gehört hatte, klingt auf Kuba völlig anders. Despues (danach) zum Beispiel etwa wie denpue. Oder so ähnlich.
April
ZIEMLICH GENAU EIN JAHR SPÄTER bin ich also wieder da, aufgeregt und voller Erwartungen. Ich werde die nächsten Monate leben, wo auf Kuba das Leben am heftigsten pulsiert: in Havanna. Es heißt, in der Hauptstadt Kubas gibt es von allem viel. Manchmal zu viel. Aber genau das ist es, was ich dieses Mal kennenlernen will, die volle Dosis kubanisches Leben. Keinen weichgespülten Aufenthalt vor restaurierter Kulisse. Keine Rundreise in klimatisierten Bussen mehr, sondern bleiben, mich einlassen auf den Alltag, auf Menschen, hoffentlich Freunde finden. Also fliege ich dieses Mal direkt Frankfurt–Havanna, Terminal 2, Flughafen José Martí. Premium Holzklasse, mehr Beinfreiheit. Das Tauwetter zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten hat inzwischen voll eingesetzt. Die Cuban Five sind alle wieder daheim und Helden. So wird eine Gruppe von Kubanern bezeichnet, die in den USA, genauer in Miami, angeblich als Teil eines Spionagenetzwerks 1998 verhaftet und 2001 zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt worden sind. Und ich freue mich unbändig auf mein neues Zuhause auf Zeit im Stadtteil Vedado in Havanna, nicht weit vom Meer entfernt, freue mich auf meine „erste Nacht“.
Am Flughafen – dieses Mal wie gesagt Havanna/José Martí – erwartet mich Anita, wie per Mail vereinbart. Ich folge ihr zu ihrem Wagen, der etwas weiter entfernt steht, und werde die ersten meiner am Flughafen noch schnell eingewechselten pesos convertibles, genannt CUC, los. Parkgebühren, angeblich zwei Euro, grob umgerechnet. Mehr rechnen kann mein nachtfluggeschädigtes Gehirn zu diesem Zeitpunkt nicht. Immerhin, das Auto von Anita fährt, obwohl es nicht so aussieht. Es ist kein Oldtimer, schon gar kein Straßenkreuzer amerikanischer Bauart, sondern ein Kleinwagen. Er klappert und rappelt jedoch wie ein alter, der Rost rieselt, der Kofferraumdeckel lässt sich nicht mehr öffnen. Mein Koffer wandert also auf die Rückbank. Ich muss an Anton denken.
Anita ist eine Freundin meiner Vermieter, wenn ich sie richtig verstanden habe. Doch sie hat keine Lizenz zur Beförderung von Passagieren gegen Geld, und wenn sie dabei erwischt wird, kann das sehr teuer für sie werden. Ich habe gehört, darauf stehen hohe Strafen. Einmal vom Flughafen nach Vedado, geschätzte zwanzig Kilometer, dafür will sie dreißig CUC. Das scheint mir viel. Ich habe nämlich bei meinem ersten Aufenthalt gehört, ein Arzt in Kuba verdient nur 120 CUC im Monat, das sind nach derzeitigem Kurs umgerechnet gut 110 Euro. Ärzte sind Staatsangestellte, ebenso wie Anwälte und viele andere, bei uns freiberuflich arbeitende Berufsgruppen. Privatpraxen sind nicht erlaubt. Lizenz hin oder her, Anita drückt mir nach der Ankunft vor meiner casa particular, also meiner Privatpension, ihre Telefonnummer in die Hand. Falls ich mal ein Auto brauche.
Die Verkehrs- und sonstige Infrastruktur der kubanischen Hauptstadt ist für Außenstehende ziemlich verwirrend. Mich im Durcheinander der Routen und Preise der privaten und der staatlichen Taxis, der Sammeltaxis, der Busse und sonstigen Transporter, der Cocotaxis (Motorräder mit einem gelben kokosnussartigen Aufbau) und der Bicitaxis (Fahrradrikschas) zurechtzufinden, wird wohl zu meinen größten Herausforderungen gehören.
Dankbar für das Bett und ziemlich übermüdet sinke ich in dieser ersten Nacht in Havanna in die Kissen. Doch statt zu schlafen, muss ich an meinen ersten Flug und an Anton mit seiner Vorliebe für Oldtimer denken. Denn letztere sind in dieser Nacht sowie an allen folgenden Tagen und Nächten auf der mehrspurigen Straße vor meinem Apartment unterwegs. In Massen.
Zur Klarstellung: Unter Oldtimer verstehe ich alles, was motorisiert ist und bis zur Revolution um 1960 auf die Insel kam. Also auch alte Motorräder, Busse und Lastwagen, die über Havannas mehr oder weniger holprige Straßen klappern, scheppern und um die Kurven röhren. Eigentlich mag ich Oldtimer sehr, ganz besonders amerikanische Straßenkreuzer. Ähnlich wie Anton. Ich gehe auch gerne mal ins Museum und sehe sie da stehen. Doch sobald sie fahren, sind alte Autos vor allem eines: laut.
Und ihre Fahrer hupen unentwegt. Zum Beispiel, weil sie ein Sammeltaxi betreiben und noch Platz für weitere Passagiere haben. Oder sie hupen, weil die Fußgänger stören, die genau dort über die Straße schlendern, wo keine Ampel steht. Oder einfach so.
Jedenfalls: Es piept, pfeift, trillert, tutet, trötet unablässig aus den Autos, Motorrädern, Bussen, Cocotaxis und Bicitaxis auf Havannas Straßen. Dass meine für die nächsten Monate ausersehene und über eine Homepage reservierte Bleibe in einem der vielen casas particulares nicht nur im Zentrum des zentral gelegenen Stadtteils Vedado liegt, sondern dort auch noch mitten in der Mitte, an einer mehrspurigen Durchgangsstraße mit ständigen Staus, besonders beliebt bei Touristenbussen und klapprigen Transportfahrzeugen aller Art, war mir bei der Buchung nicht klar.
Mein Apartment hat übrigens keine Fenster, nur Klappläden mit Lamellen. Innen. Deshalb herrscht ein ständiges und für mich ziemlich gewöhnungsbedürftiges Dämmerlicht. Die Klimaanlage ist ebenfalls laut, und nachdem ich sie ausgeschaltet habe, will sie nicht mehr. Dafür habe ich den in einer Ecke neben dem Schrank abgestellten Ventilator aktiviert. Der bläst die schwül-heiße, mit Autoabgasen angereicherte Luft umher, dass meine Haare fliegen. Schließlich beendet die Klimaanlage ihre Pause und setzt scheppernd wieder ein. Zu diesem Zeitpunkt habe ich längst aufgehört, ökologisch korrekt Strom sparen zu wollen. Dafür ist es einfach zu heiß. Ist ja egal, was mich nicht schlafen lässt. Ich hoffe auf mehr Ruhe in den frühen Morgenstunden. Doch die Fahrer alter Autos werden offenbar nie müde.
Das Apartment hatte ich mir eigentlich wegen seiner Vorteile ausgesucht. Die Uni, an der ich Spanisch lernen kann, liegt quasi nebenan. Es ist nicht weit zur Altstadt. Und die Rampa, die 23. Straße, die Amüsiermeile von Vedado, beginnt an der übernächsten Ecke. Das Amüsement hatte ich mir aber anders vorgestellt. Laue Nächte, Mojito, Daquiri, irgendein Longdrink mit Rum eben, und dazu Meeresrauschen. So in etwa war das jedenfalls in den Hotels bei meiner ersten Rundreise.
Zu meiner Überraschung bekomme ich gegen Morgen Heimweh und finde es ziemlich schlimm, dass ich mir in diesem Land des Kaffeeanbaus noch keinen Kaffee kochen kann. Ich muss erst welchen besorgen, weiß nicht wo, weiß nicht wie. Es fehlt überhaupt an so einigem. Der Kühlschrank ist noch leer.
Dass ich gleich für vier Wochen im Voraus bezahlt habe, macht die Lage nicht besser. Meine Vermieter scheinen sehr nett zu sein, ich wurde freundlich empfangen. Die Miete für einen ganzen Monat will der Herr des Hauses trotzdem sofort. Und ich zahle auch brav. Zudem bin ich viel zu müde für Widerspruch oder die Frage, ob es nicht wochenweise geht. Außerdem bin ich, beflügelt durch den mir angeborenen Optimismus, zunächst überzeugt, es wird schon alles gut werden. Erst später in dieser durchwachten Nacht wird mir klar: Ich stecke hier vermutlich erst einmal fest, werde vielleicht nichts von dem Geld wiedersehen, wenn ich die Wohnung wechsele.
Ich wüsste auch nicht, wie ich meine Auszugsabsichten verständlich erklären sollte. Mein Spanisch ist trotz einiger zwischenzeitlicher Bemühungen mit Hilfe eines Onlineportals mehr als dürftig. Das Portal behauptet, ich könne 294 Wörter. Ich hingegen habe große Zweifel, ob die hier auch jemand versteht und ich eine andere bezahlbare casa particular finde. Also versuche ich mir einzureden, dass ich mich schon an den ständigen Lärm gewöhne werde.
Um es vorwegzunehmen: Es gelingt mir nicht, in dieser ersten Nacht nicht und auch nicht in allen weiteren. Die Klimaanlage arbeitet unentwegt und so fleißig, dass sie es sogar schafft, den Verkehr zu übertönen. So springe ich wenigstens nicht bei jedem aufröhrenden Bus, der beim Haus die Kurve nimmt, vor Schreck fast aus dem Bett. Ich schreibe bewusst fast, denn zu derart abrupten Bewegungen bin ich eigentlich nicht fähig, wenn ich gewaltsam aus dem Tiefschlaf gerissen werde. Um mich abzulenken und um mir Mut zu machen – andere haben es auch nicht leicht –, denke ich in meinen schlaflosen Nachtstunden an die Rebellen um Che Guevara und die Castros bei ihrem Guerillakampf in den Bergen der Sierra Maestra. Da war es heiß, feucht, es gab jede Menge Natur, Moskitos und wahrscheinlich nur wenig Antimückenmittel. Obendrein musste Che auch noch gegen sein Asthma kämpfen. Geraucht hat er trotzdem.
Die Karibikromantikgefühle haben sich schon am ersten Morgen komplett verabschiedet. Meine Glieder sind schwer, im Kopf hat sich Sülze breitgemacht. Die Zivilisation scheint Lichtjahre entfernt. Ich erinnere mich immer wieder wehmütig an die Busrundreise durch Kuba im vergangenen Jahr. Hotels mit Pool und Frühstück. Gepampert und umsorgt. Dass das nicht das wirkliche Leben auf Kuba ist, hatte ich geahnt. Bloß verdrängt. Jetzt überfällt mich das echte Leben mit Macht. Und das Heimweh nach meinem eigenen Bett.
Bereits im Frühtau stehe ich auf. Aufgeben gilt nicht. Also auf ins Getümmel. Der Kühlschrank will befüllt werden, ich brauche unbedingt meine tägliche Ration Kaffee.
Die nächste Erkenntnis trifft mich trotz der frühen Morgenstunde und ihrer bereits ziemlich feuchtschwülen Hitze mit der Wucht eines Hammers: Es gibt jede Menge Steigerungen von laut. Und alte Autos in Massen stinken. Aus den schwarzen Dampfwolken, die manchem Auspuff entweichen, schließe ich, dass Salatöl hier günstig zu haben sein muss. Feinstaub pur und in Massen. Ich versuche heroisch, das zu ignorieren.
Dass die Fensterläden innen angebracht sind, finde ich später, nach dem ersten Vormittag unterwegs in Vedado, sehr schön. Mein Apartment ist angenehm kühl, und ich bin beinahe versöhnt. Die neu gewonnene Zuversicht ist das Ergebnis eines Frühstücks mit den Resten von Vollkornbrot aus dem Flugzeug. Und während ich meine ersten Eindrücke in meinem Tagebuch notiere, steht eine Tasse Kaffee neben mir. Wunderbarer kubanischer Kaffee der Marke Serrano, die beste Sorte, die Packung ist rot. Übrigens: Der kubanische Nationalfeiertag ist der 26. Juli. An diesem Tag habe ich Geburtstag. Wenn das kein gutes Omen ist.
Nachmittags geht es zum Markt an der 17. Straße. Die Mutter meiner Vermieterin hat mich an die Hand genommen, zeigt mir, wo ich was bekomme, immer kombiniert mit dem dazugehörigen spanischen Wort. Sie ist eine Frau mit einem großen Herzen. Abends habe ich neben Kaffee nun Reis, Melonen, Tomaten und – Pringles. Für umgerechnet 4,40 Euro. Teuer. Nicht kubanisch. Ich weiß. Aber ein kleiner Tribut an zuhause.
In den nächsten Tagen stürmt viel Neues auf mich ein. Weiter die Straße runter halten die roten Doppeldeckerbusse bei ihren Havanna-Rundfahrten. Die Oficina de Inmigración oder so ist ebenfalls nicht weit weg, ganz in der Nähe des Marktes. Bei dieser Behörde muss ich meine Touristenkarte verlängern lassen. Die Bank zum Geldwechseln finde ich drei Straßen weiter.
Den Weg zum Meer muss mir niemand zeigen. Ich sehe es in der Ferne in der Sonne glitzern. Mein erster Abendspaziergang führt mich dorthin. Auf dem Heimweg (man beachte die Wortwahl) besorge ich noch zwei Flaschen Wasser. Außerdem brauche ich Salz, Zucker … und jede Menge weiterer spanischer Vokabeln. Zudem bin ich ziemlich verwundert, dass ich nicht schon zerflossen bin, wärmetechnisch gesehen. Ach ja, Seife zum Wäschewaschen benötige ich auch.
Apropos Wasser: Für den Fünf-Liter-Plastikballon zahle ich zu Beginn meines Aufenthaltes knapp fünf CUC. Es dauert eine Weile, bis ich begreife, dass der Preis für Wasser staatlicherseits festgelegt ist, zumindest in den staatlichen Läden. Da kostet der Ballon 1,90 CUC. Doch den großen Ballon finde ich in den Staatsläden, die einigermaßen in der Nähe sind, nur selten. Dafür verkauft die private dulceria in der 25. Straße (es gibt Croissants und Baguettes zu moderaten Preisen) die Literflasche für 80 CUC-Cents.
In meiner casa wird das Wasser abgekocht und dann mittels einer Art Brigitta-Filter von dem dicken weißen Film befreit, der sich auf der Oberfläche bildet, während es abkühlt. Und wenn ich das richtig rieche, ist das Leitungswasser auch mit Chlor versetzt. Zum Zähneputzen nehme ich es trotzdem, ohne dass es mir schadet. Im kubanischen Fernsehen wird zudem immer wieder darauf hingewiesen, dass das Wasser staatlicherseits kontrolliert wird.
Am zweiten Tag weitere Einkäufe. Ganz allein. Salz, Thunfisch, Paprikasauce, Ananassaft …
Ich starte darüber hinaus erste Versuche, ins weltweite Netz zu kommen. WLAN, beziehungsweise Wifi, gibt es, mein Tablet findet auch Verbindungen. Nur das Reinkommen funktioniert nicht. Nicht auf die legale Weise, sagen meine Vermieter. Ich beobachte die Gäste einer Cafeteria in der Nähe, sehe sie in ihre Computer starren und mit ihren Handys und Tablets hantieren. Sie halten sie in die Luft, gehen mal hierhin, mal dorthin, dann wieder hierhin. Ab und an jubelt einer. Dann eilen die Verbliebenen mit ihren Handys sofort zu ihm, beginnen eifrig zu tippen und über Displays zu wischen. In mir keimt der Verdacht, dass es jede Menge kubanischer Menschen gibt, die die Legalitäten ignorieren. Manche Hotelnetzwerke reichen weit, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Mir ist die legale Weise lieber, zumal ich ohnehin nicht so viel Geduld habe. Im Hotel Habana Libre soll es einen legalen Zugang und ein stabiles Netz geben, allerdings teuer, für Durchschnittskubaner unerschwinglich. Ich beschließe, mich trotzdem der legalen Möglichkeiten zu bedienen. Später, in ein zwei Tagen. Wenn ich richtig geschlafen habe.
Die Nächte bleiben jedoch schwierig, um nicht zu sagen frustrierend, und ich mutiere zur Frühaufsteherin. Am Morgen ist es ohnehin am schönsten, tröste ich mich, dann liegt noch die Kühle der Nacht über der Stadt. Wobei Kühle um die 26 Grad bedeutet. Tagsüber steigt das Quecksilber auf weit über 30 Grad, die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 80 und 90 Prozent. Es ist ganz schön schweißtreibend, mein Abenteuer Kuba. Es sei denn, ich sitze still in einer Bar. Bis auf die Bewegung, die das Führen eines geeisten Drinks an den Mund nun mal erfordert.
Solche Durchhänger erlaube ich mir jedoch nicht oft. Denn ich habe mir vorgenommen, meine neue Welt zu erkunden, streife begeistert durch die Straßen und fotografiere Häuser – jedes für sich ein Unikat, jedes hat seine ganz besondere Art, alt zu werden. So wie jedes Gesicht seine eigenen Falten entwickelt. Und die Mehrzahl dieser Häuser verkünden auch: Es ist viel Zeit vergangen seit der Revolution, wir haben gelitten. Aber wir sind noch da.
Da ist zudem mein Vorhaben, besser Spanisch zu lernen. Auf dem Gelände der nahen Universität, auf der Suche nach einem Ansprechpartner, begegnet mir Alberto, laut eigener Aussage Professor für Soziologie. Er zeigt mir den Campus, unter anderem den Balkon, von dem aus in den Fünfzigerjahren Che (oder Fidel, da hat Alberto genuschelt) den Studenten erklärt hat, warum sie sich gegen das Batista-Regime erheben sollten. Und er führt mich zum Büro, in dem ich angeblich alle Informationen bekomme, die ich brauche, um mich für einen Spanischkurs einzuschreiben. Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass es mit dem universitären Betrieb in La Habana erst gegen neun Uhr losgeht. Ich bin wieder zu früh dran. Die junge Dame, die genügend Englisch spricht, um mich zu verstehen, ist noch nicht da. Ich verspreche, um 9.30 Uhr wiederzukommen. Was ich am Ende doch nicht tue.
Alberto ist in der Zwischenzeit in ein Büro marschiert und hat Hermano im Schlepptau, als er wieder erscheint. Der erklärt, er sei Professor für Spanisch und könne mir Privatstunden geben. Ganz billig. Ich müsse unbedingt am nächsten Morgen gleich zu ihm kommen. Ich nicke. Zusammen zeigen sie mir ihr Vedado, San Lazaro, die Straße der Studenten, die direkt an der große Freitreppe der Universität beginnt, von der aus die Büste der „Alma Mater“ über ihre Zöglinge wacht. Sie zeigen mir das gelbe Haus, in dem Che lebte und in dem sich heute die Studenten treffen, oder jenes Haus mit der Aufschrift „26. Juli“, in dem sich angeblich heute ein Studentenwohnheim befindet.
Mir wird endgültig klar: Hier hat einfach alles mit der Revolution, zumindest aber mit Politik zu tun. Natürlich auch die Gespräche mit Alberto und Hermano bei einem Drink. Die Bar, in der wir sitzen, gehört einem „berühmten kubanischen Künstler“, von dem ich noch nie gehört habe. Alberto weist mich auf ein Foto hin, auf dem dieser mit Led Zeppelin zu sehen ist. Auf einem anderen lächelt er Harry Belafonte zu, der wiederum mit Fidel Castro befreundet war. In der Eile und müde, wie ich bin, verstehe ich jedoch den Namen des Künstlers nicht. Der Mann hat sein ganzes Viertel bemalt und mit Recyclingkunst verschönert. Lustig, verspielt, kraftvoll, gespickt mit Allegorien auf die kubanische Geschichte und Kultur. In diesem Moment kommt der Künstler höchstselbst in die Bar. Hermano macht ein Foto von uns beiden. Der Künstler sieht darauf etwas verstört aus. Ich strahle.
Wir sitzen also in der Bar, und ich beginne zu fragen: Was halten Alberto und Hermano von der Annäherung zwischen Kuba und Amerika? Sind sie begeistert? Mitnichten. Es ist ihnen, frei übersetzt, ziemlich mulmig bei dem Gedanken. Sie wollen nicht, dass ihr Land wieder von Amerika vereinnahmt wird. Andererseits – sie möchten sich etwas leisten können, gut und sicher leben und Zugang zum Internet bekommen. So denken die meisten jungen Kubaner, habe ich festgestellt.
Was würde Tamara Bunke, Tania la Guerillera, die Deutschargentinierin und Revolutionärin sagen, wäre sie nicht mit dreißig Jahren erschossen worden? Auf Kuba ist sie eine Heldin, in Deutschland war sie vor allem in der DDR bekannt. Ich habe im Vorfeld meines Kuba-Abenteuers viel über sie gelesen. Würde sie sagen, der Kampf für den Kommunismus und der Tod so vieler Menschen haben sich gelohnt?
Nein, antworten Alberto und Hermano, das würde sie nicht. Die Menschen damals hätten nicht für den Kommunismus oder den Sozialismus gekämpft, sondern für ein besseres Leben. Dieses Ziel sei nur bedingt erreicht, trotz aller Fortschritte in den Jahren seit der „zweiten großen Krise“. Dass nicht alle Ziele erreicht worden sind, bestreiten auch jene nicht, die damals Kämpfer der Revolution waren. Doch wenn ich solche Menschen frage, lautet die Antwort eindeutig: Ja, es hat sich gelohnt. „Von der Öffnung Kubas für die Marktwirtschaft profitieren sowieso nur die Kubaner mit Geld, die mit Verwandten in Amerika“, fügt Hermano nach einer Pause hinzu. Ob ich ihnen Geld geben könne, die Milch für die Kinder sei teuer … Ich kann. Dieses Mal jedenfalls. War die ganze Freundlichkeit am Ende nur ein eingefädeltes Manöver? Ich ahne, dass ich solche Fragen noch öfter hören werde. Egal, auch wenn ich mir ein wenig gelinkt vorkomme. Andererseits: Hatten die beiden Herren mir nicht eben noch das Kompliment gemacht, ich sei eine kluge Frau? Ich entscheide mich dafür, an diese Variante zu glauben, gebe ihnen Geld für die Milch, beschließe allerdings stillschweigend, lieber auf die Dienste Hermanos als Spanischlehrer zu verzichten.
Später wird mir klar, dass das tatsächlich eine beliebte Masche ist. Insbesondere vor den großen Hotels und von Frauen, die Kinder mit großen braunen Augen vorschieben, welche hin und wieder auch „caramelo“ sagen. Sie wollen Bonbons. „Die Straße ist der beste Lehrmeister“, sagt am folgenden Abend sehr überzeugend meine Vermieterin, eine