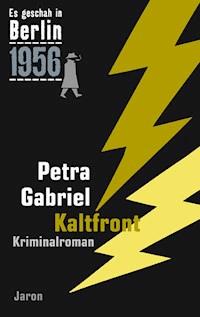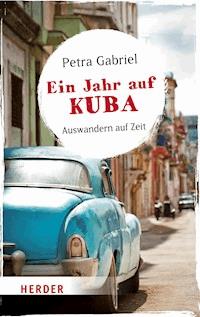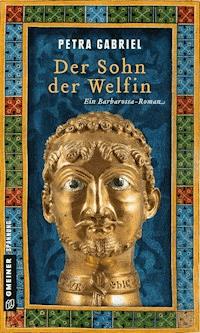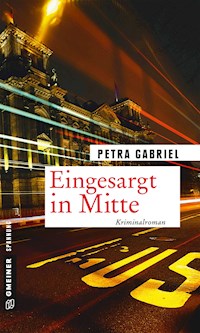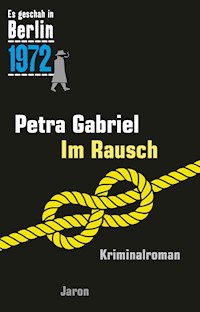Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Olga von Leonowa
- Sprache: Deutsch
Sie wird geliebt und verraten, bewundert, gehasst, verfolgt, als feindliche Agentin verhaftet, bedroht und erpresst: Als die reiche Russin Olga von Leonowa 1910 in eine Villa hoch über dem Rhein in die badische Kleinstadt zieht, munkeln die Laufenburger, sie sei eine russische Prinzessin. Angeblich soll sie eine Freundin der mindestens ebenso reichen Amerikanerin Mary Codman sein. Doch niemand weiß, wer sie wirklich ist. Olga von Leonowa spielt ihr eigenes Spiel - und bewahrt ihr schreckliches Geheimnis bis zuletzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Petra Gabriel
Madame Codman und die traurige Gräfin
Roman
Zum Buch
Spionin wider Willen Sie wird geliebt und verraten, bewundert, gehasst, verfolgt, bedroht und erpresst: Als die reiche Russin Olga von Leonowa 1910 in eine Villa hoch über dem Rhein in die badische Kleinstadt zieht, munkeln die Laufenburger, sie sei eine russische Prinzessin, verkehre aber auch in Exilantenkreisen um den Bolschewikenführer Lenin. Angeblich soll sie eine Freundin der mindestens ebenso reichen Amerikanerin Mary Codman sein, im Städtchen die „Schlösslemadame“ genannt. Doch niemand weiß Genaues über die Russin, nur, dass sie eine berühmte Neurowissenschaftlerin ist, die mit Größen wie Freud und Alzheimer verkehrt. Dass die Neubürgerin sehr zurückgezogen lebt, feuert die Gerüchte noch an. Kurz nach Beginn des Ersten Weltkrieges wird sie als russische Spionin verhaftet. Aber niemand weiß, wer sie wirklich ist. Olga von Leonowa spielt ihr eigenes Spiel – und bewahrt ihr schreckliches Geheimnis bis zuletzt.
Petra Gabriel, geboren in Stuttgart, Spross einer rheinisch-schwäbischen Verbindung mit schlesischen Elementen, ist in Friedrichshafen aufgewachsen und über Irland, München und Norddeutschland schließlich im südbadischen Laufenburg angekommen. Sie ist ausgebildete Übersetzerin sowie Hotelkauffrau und war nach dem Volontariat rund 15 Jahre lang Redakteurin des SÜDKURIER Konstanz. Seit 2004 ist sie freischaffende Autorin und lebt seit 2006 zudem zeitweise in Berlin. Sie ist Mitglied im Schriftstellerverband VS Berlin. Petra Gabriel schreibt neben historischen Romanen auch Krimis. Zuletzt ist im Gmeiner Verlag die Biografie „Madame kam aus Amerika“ erschienen. Mehr Informationen zur Autorin unter: www.petra-gabriel.de
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © Stadt Laufenburg
ISBN 978-3-8392-7750-8
Die wichtigsten Personen
Olga von Leonowa,alias Olga Vassiliewna Leonowa
Mary Codman Freund, die Laufenburger Schlösslemadame
Robert Freund, Madames zweiter Ehemann
Emma, eine Zofe
Max Härtli, ein Schweizer Privatermittler
Parvus, alias Alexander Parvus, wurde 1867 als Israil Lasarewitsch Helphand geboren, nannte sich ab 1894 Parvus
Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin
Inessa Armand, Lenins Geliebte
Nadja Krupskaja, Lenins Frau
Esmeralda, eine Wahrsagerin
Boris Iwanowitsch Semijonow, Geheimdienstoffizier der Ochrana
Igor Gregorewitsch Nawolnij, Olgas Diener
Wilhelm Eschbach, Privatier, Laufenburg
Henri Guilbeaux, Lyriker, Journalist, Mary Codman kennt ihn aus Berlin
Hermann Probst, Sachverwalter Olgas, Meerfräulein-Wirt
Prolog oder: Aufbruch ins Morgen
Die sibirische Kälte des Winters hat sich in den Knochen festgefressen und will nicht weichen. Es ist bereits April, jedoch keineswegs Frühling. Auf der Zugspitze liegen fast zwei Meter Schnee. Die Erde buckelt schon seit Januar. Vor 13 Tagen hat es im Schweizer Blauengebiet ein heftiges Erdbeben gegeben, das bis nach Deutschland, sogar bis Straßburg, spürbar war. In Basel erreichte es die Stärke fünf.
Dazu der Hunger. Er wühlt sich durch die Gedärme der Menschen, fräst Linien der Verzweiflung in Gesichter, modelliert ausgemergelte Gestalten und Kinder mit Blähbäuchen. Die Hoffnung hat vor dem Schrecken kapituliert; der Krieg will einfach nicht enden.
Erst kam die Seeblockade der Briten. Vor drei Tagen haben nun auch noch die Amerikaner dem Deutschen Reich den Krieg erklärt. Dazu von morgens bis abends schweres Trommelfeuer an der Westfront. Schreie, Wimmern, Priester spenden Sakramente in Schützengräben. Sterben. Auch wieder an jenem 9. April 1917, dem Ostermontag.
Der Kanonendonner ist an klaren Tagen bis in die neutrale Schweiz zu hören: im unteren Tessin, im oberen und unteren Rheintal, im Prättigau, im Säntisgebiet bis an den Bodensee, im Kanton Glarus, in der Gegend um die Rigi.
Bis Zürich reichen die Schallwellen des Trommelfeuers nicht. Trotzdem ist der Krieg auch dort allgegenwärtig, sogar in dieser reichen Stadt regiert Meister Schmalhans. Den Mann, der laut Pass Konstantin Petrowitsch Leonow heißt, sich Lenin nennt und als Wladimir Iljitsch Uljanow geboren wurde, ficht das nicht an. Er hat sich für das Passfoto den Bart abrasiert und trägt eine Schiebermütze auf einer Perücke mit Locken über dem schütteren eigenen Haar. Er wirkt ernst, aber nicht besorgt, sieht eher aus wie ein Geselle auf der Walz denn wie ein Mann, der einen Regierungsumsturz in einem der größten Reiche der Welt plant.
Millionen russischer Soldaten sind in den letzten Jahren auf den Schlachtfeldern verreckt. Lenins Zielen kommt das entgegen. Die Not und die Kriegsmüdigkeit der russischen Bevölkerung werden seine Pläne voranbringen, da ist er sich sicher. Seine Landsleute, die Bauern, die Arbeiter die Soldaten, die Angehörigen des Proletariats, im Duktus von Karl Marx jener neuen Klasse, die mit der Entwicklung der Industriellen Revolution entstanden ist, alle sehnen sich verzweifelt nach Frieden. Seine Bolschewiki haben versprochen, ihn zu bringen. Deswegen werden sie ihn feiern und ihm folgen. Selbstzweifel kennt er nicht.
Im knapp 2.000 Kilometer entfernten Petrograd entwickeln sich die Dinge momentan in einem für Lenin schwindelerregenden Tempo. Er hat die Abdankung des Zaren nicht kommen sehen, nicht so schnell jedenfalls. Das wurmt ihn. Es ist für ihn unerträglich, dass er zu dieser kritischen Stunde nicht in Russland sein, die Massen aufpeitschen und den Putsch befördern kann, auf den er so lange hingearbeitet hat. Doch immerhin, endlich haben sie einen Weg gefunden und können dank des Geldes der Deutschen von Zürich aus heimkehren.
Er und einige seine Mitstreiter haben in Windeseile ihre Habseligkeiten zusammengepackt, im Zähringer Hof noch einmal ausgiebig getafelt und sich dann von ihren Freunden verabschiedet. Die Menschen auf dem Zürcher Bahnhofsvorplatz und dem Bahnsteig, die ihn und seine Gruppe mit Buhrufen bedenken, bemerkt Lenin kaum. Er kämpft sich mit versteinerter Miene durch die Menge, die anderen der 32-köpfigen Reisegruppe ihm hinterher. Er marschiert einfach auf die Sperre aus Leibern zu, die sich wie durch Geisterhand öffnet. Lenin ist kein groß gewachsener Mann, aber durch seine ebenso gigantische wie unerschütterliche Selbstsicherheit strahlt er eine bezwingende Autorität aus.
Endlich haben sie die riesige neoklassizistische Bahnhofshalle durchquert und sind auf dem Bahnsteig angekommen. Das mit Holz verschalte Dach spannt sich über sieben Quergiebel und besitzt mehrere Öffnungen, durch die der Rauch der Lokomotiven gen Himmel dampft. Lenin rast innerlich vor Ungeduld, wandert den Perron auf und ab. Die Verzögerungen bei der Abfahrt des Nahverkehrszuges Richtung deutscher Grenze bereiten ihm nicht nur nervliche, sondern auch regelrecht körperliche Schmerzen. Nadja versucht immer wieder, ihn zu beruhigen. Er hört seiner Frau kaum zu, sondern schaut und sucht. Wo bleibt sie nur? Sie können nicht länger warten.
Einige von Lenins Mitreisenden nutzen die Verspätung und wuchten weitere Lebensmittel in die Abteile: Wodka, Würste, Brot und vieles mehr. Proviant für eine Reise nach Russland, von der sie nicht wissen, wie lange sie dauern wird. Sicher ist nur, dass es in diesem Schweizer Nahverkehrszug nach Schaffhausen und zum deutschen Grenzposten Gottmadingen geht. Dort warten eigens für sie vorbereitete Waggons, die sie gen Norden bringen werden. Diese sind exterritoriales, also russisches Gebiet und deshalb verplombt. Lenin will sich, auch wenn es stimmt, später nicht nachsagen lassen, dass seine Rückkehr und damit die Revolution nur durch die Deutschen, den verhassten Kriegsgegner, möglich geworden ist.
Wo bleibt sie nur?
Die Lokomotive zischt, Dampf vernebelt den Bahnsteig. Ein Mann drängt sich an ihm vorbei und erklimmt die Treppe des Waggons, vor dem er steht. Der Bolschewikenführer klettert ihm eilig nach, packt ihn am Kragen und expediert ihn mit einem heftigen Stoß wieder hinaus. Der Mann stürzt auf den Bahnsteig. Ein Pfiff ertönt, die Waggontür schließt sich. Der Mann rappelt sich hoch, reckt die Fäuste und schimpft dem abdampfenden Zug auf Russisch hinterher. Erst viel später wird Lenin erfahren, dass er kein Spion war, sondern ein Exilant und Bolschewik, der versucht hat, sich unter die Reisenden zu schmuggeln.
Sie ist nicht gekommen.
Major von Bismarck, deutscher Militärattaché, steht nicht weit von einer der monumentalen Arkaden entfernt und schaut dem Zug hinterher, der den Bahnhof prustend verlässt. Den Mann, der sich, noch immer fluchend, den Staub aus der Kleidung klopft, würdigt er keines Blickes. Bismarck zuckt mit den Schultern und wendet sich zum Gehen. Ein Leutnant der deutschen Landgendarmerie, der inkognito im Zug mitreist, wird den Gang der Dinge beobachten und ihm Meldung erstatten, sobald die Reisegruppe den Reisepreis entrichtet und den Schweizer Zoll passiert hat.
Bezüglich der Grenze gibt es noch einige Unsicherheiten, denn die Eidgenossen haben die Vereinbarung zwischen der Reisegruppe und dem Deutschen Reich nicht mitunterzeichnet. Sie werden die russischen Exilanten wie gewöhnliche Ausländer behandeln. Das heißt, alle mitgenommenen Lebensmittel werden mit großer Sicherheit beschlagnahmt. Kriegsbedingt. Von Bismarck hätte das den Russen sagen können. Er hätte ihnen auch erklären können, was noch auf sie zukommt: langes Warten bei der Kontrolle in Schaffhausen. Doch das ist nicht seine Aufgabe.
Für Lenin ist die erneute Wartezeit in Schaffhausen ebenso unerträglich wie zuvor die Verzögerung in Zürich. Er war noch nie ein geduldiger Mann. Mehrfach gefilzt von den Schweizer Zöllnern, geht es für die Reisenden nach einer gefühlten Ewigkeit weiter. Es folgt noch eine Kontrolle in Thayngen. Die anderen russischen Passagiere jammern über den Verlust ihrer letzten Vorräte.
Lenin registriert das eher am Rande. Er hat nur einen vorherrschenden Gedanken: Er will weiter, endlich die Schweiz hinter sich lassen. Zuletzt hat er dieses Land gehasst, in dem er schon so lange lebt, die Enge, die Spießigkeit. Er hatte das Gefühl zu ersticken, sehnt sich nach den Weiten Russlands.
Warum ist sie wieder nicht da?
Dann können sie endlich die Grenze überqueren und erreichen das deutsche Gottmadingen. Dort ist kein Zöllner zu sehen, nur eine Gruppe von Männern, das Empfangskomitee. Es handelt sich um deutsche Offiziere, angeführt von Arwed von der Planitz, Rittmeister in Reserve. Von der Planitz hat genaue Anweisungen des Ersten Generalquartiermeisters Erich Ludendorff erhalten, wie mit den Ausländern zu verfahren ist. Lenin hat nur ein kurzes Kopfnicken für ihn.
Sie kommt auch nicht, als die Reisenden in Gottmadingen zum eigens für sie bereitgestellten Sonderzug geleitet werden. Der besteht aus einem Personenwagen mit zweiter und dritter Klasse sowie einem Gepäckwagen. Auf dem Gang des Waggons ist zwischen dem russischen und dem deutschen Teil ein Kreidestrich gezogen worden, den weder die Deutschen noch die Russen überschreiten dürfen. Als Vermittler zwischen diesen beiden Welten fungiert der Schweizer Fritz von Platten.
Beim Einsteigen drückt jemand Lenin ein Papier in die Hand. Er hätte wegen des Trubels später nicht mehr sagen können, wer. Es ist eine Depesche: Gute Reise. Stopp. Alles vorbereitet. Stopp. Weibliche Leiche im Rhein gefunden. Stopp. O. wird nicht erscheinen. Stopp. Parvus.
Kapitel 1
In diesem Sommer des Jahres 1884 flirrt die Hitze über dem Horizont, der sich glasig mit dem Schwarzen Meer vereint. Das mächtige Dampfschiff der Russischen Handelsgesellschaft im Hafen von Odessa ist zum Ablegen bereit. Olga kann von ihrem Fenster aus die Kommandos der Offiziere hören. Matrosen spurten übers Deck. Der Ozean, fast unbewegt, fängt die Sonnenstrahlen und wirft sie als Glitzern zurück. Die schweren Kessel im Bauch des Überseegiganten sind angefeuert. Das kann sie an der dunklen Fahne erkennen, die sich aus dem hoch aufgereckten Schornstein in den blauen Himmel windet und dann auflöst. Olga schaut dem mäandernden Rauch nach, der sich in der Weite verliert, und wird von Sehnsucht überflutet. Bald. Bald. Nur noch eine halbe Stunde, und sie ist frei. Doch ehe sie frei sein kann, muss sie hier heraus, fort aus diesem großen Haus hoch über dem Hafen, einen Weg finden, ungesehen zu verschwinden.
Olga weiß, dass es keine Rückkehr mehr gibt, wenn sie mit ihm geht. Sie wird den Gutshof ihrer Kindheit etwas außerhalb von Moskau und ihren Lieblingsort, die Datscha der Familie nahe Sankt Petersburg, nicht wiedersehen. Das komfortable zweistöckige Holzhaus mit den großzügigen Empfangs- und Wohnräumen, vor allem aber die Bibliothek fehlen ihr schon jetzt. Dem Sommerhaus in Odessa, in dem die Familie gerade lebt, hat sie – außer den Blick auf den Hafen – nie viel abgewinnen können. Nur in der Datscha in Sankt Petersburg gab es die wunderbare Welt der Bücher. Schon der Anblick der Buchrücken, einer neben dem anderen, in den raumhohen Regalen, versprach Wunder und neue Welten. Die Grenze zwischen Sein und Schein, zwischen Wirklichkeit und Traum war in dieser Bibliothek aufgehoben, hatten ihr Freunde wie Puschkin und Tolstoi beschert. Aber auch ausländische Romane standen dort, alphabetisch sortiert.
Die Eltern hatten vergeblich versucht, sie vom Lesen abzuhalten, denn einige diese Bücher waren von der Zensur verboten. Des Vaters konservative Beamtenkollegen wären schockiert gewesen, hätten sie gewusst, welche Literatur dort stand. Am liebsten war ihr Harriet Beecher Stowes Onkel Toms Hütte, die Geschichte eines amerikanischen Sklaven.
Sklaven. Damals war sie zwar noch sehr klein gewesen, aber sie erinnerte sich noch genau, wie der Vater getobt hatte, als der Zar die Leibeigenschaft aufhob. Die meisten Dienstboten hatten jedoch auf dem Landgut bei Moskau ausgeharrt. Es war ihr Zuhause. Sie hatten kein anderes. Zu den Menschen, die für ihn arbeiteten, den Bauern, die zu seinem Besitz gehörten, war Graf Vassilij, der janusköpfige, nachsichtiger und freundlicher als zu seinen Kindern. Gute Landarbeiter waren selten, Land vermehrte sich nicht, Kinder konnte man nachmachen. Viele starben sowieso in den ersten Jahren nach der Geburt.
Wie oft war Olga vor ihrem Vater in den Garten der Datscha mit seinen Apfel-, Pflaumen- und Kirschbäumen geflüchtet. Das war ihr zweites Reich. Am schönsten fand sie es dort, wenn der Flieder blühte. In dieser Zeit hüllte ein verheißungsvoller Duft die Gegend ein, der ihr geheime Botschaften brachte. Du kannst alles, die Welt ist bereit für dich, versprach dieser Duft.
Dann der Fluss, die Newa. An ihrem Ufer fühlte sie sich niemals einsam. »Du bist wie ein schrecklicher Kobold. Benimm dich wie ein Mädchen, nur Jungen steigen auf Bäume«, schalt die Mutter, wenn sie wieder einmal mit schmutzigen oder zerrissenen Röcken von ihren ausgedehnten Streifzügen zurückkam, während Alina, die kleine Schwester, brav mit dem Kindermädchen Krocket oder auf dem großen, breiten Balkon mit ihren Puppen spielte. »Wenn ich groß bin, dann werde ich sowieso ein Junge«, hatte sie damals geantwortet und nicht verstanden, warum die Mutter lachte. Alina. Sie war viel zu früh gestorben, nicht lange nach diesem Ereignis ertrunken beim Spielen an der Newa. Sie war damals nicht dabei gewesen, hatte sich jedoch jahrelang Vorwürfe gemacht, weil sie nicht auf die Schwester aufgepasst, sondern lieber mit den Jungs aus der Nachbarschaft gespielt hatte. Die Mutter hatte den Tod der Schwester, ihres Nesthäkchens, nie verwunden. Damals war der Tod in ihr Leben getreten.
Dem Vater waren seine Töchter egal, er nahm sie meistens nicht einmal wahr. Es gab nur eines, das Olga mit ihm verband: die Liebe zum Schachspiel. Sie hatte es sich selbst beigebracht. Nachdem er bemerkt hatte, wie begabt sie darin war, ließ er sich manchmal herab, sich mit ihr ans Schachbrett zu setzen. »Du hast den Verstand eines Mannes«, sagte er hin und wieder. Olga wusste, das war kein Lob. Da saßen sie dann, der große, massige Mann und seine untersetzte, etwas pummelige Tochter, versunken ins Spiel, nach außen wirkten sie wie eine Einheit.
Nun, sie würde die Datscha nie wiedersehen, auch ihn nicht. Nicht die Mutter, nicht den Bruder, niemals mehr die Weißen Nächte von Sankt Petersburg erleben, in denen die Energie vibrierte und den Geist betrunken machte.
Der Vater. Er würde sie totprügeln, wenn zu früh herauskäme, was sie vorhatte. Doch wie könnte sie nicht mit Sascha gehen! Sie sieht seine lachenden Augen vor sich, die Lebensfreude, die aus ihm sprudelt und sie mitreißt in eine Welt voller Wunder und Abenteuer. Er will sie mit sich nehmen, hinaus aus dieser drückenden Enge von Vorschriften und Zwängen. Wenn sie bei ihm ist, singt ihr Körper, tanzt ihr Geist. Dann kann sie atmen, als wäre sie aus einem Gefängnis befreit. Es ist ihr gleich, dass er in einer Schlosser- und Schmiedewerkstatt arbeitet, dass sein Vater Schauermann im Hafen und er einige Jahre jünger ist. Saschas Denken reicht weiter als Russlands Grenzen, um gesellschaftliche Klassen und Konventionen schert er sich nicht. Er sieht nur Menschen. Und das, obwohl oder vielleicht auch weil die Juden bei den Pogromen so schrecklich gelitten hatten. Er spricht nicht darüber, hat ihr nur erzählt, die Gräuel hätten seine Familie aus der Heimat nach Odessa vertrieben.
Dennoch kommt es ihr vor, als könne er die Welt erobern, sie besser machen. Und sie mit ihm. Er hat ihr das Leben der Armen beschrieben, berichtet, wie die Not krank macht. Hat ihr geschildert, wie die Arbeiter in den Fabriken buckeln, vom Dreck, vom Elend, in dem sie hausen, erzählt. Er wird einmal herrschen, das weiß sie gewiss. Er wird den Marxismus in die Welt bringen, die Arbeiter aus der Knechtschaft befreien; er und seine Freunde von Narodnaja Volja. Dann wird sie an seiner Seite sein. Sie zweifelt nicht eine Sekunde daran, dass er sie mitnehmen wird, wenn er demnächst zum Studium in die Schweiz geht. Vielleicht kann sie dort ja auch studieren. Weit weg vom Vater, der ein Studium für Mädchen kategorisch ablehnt. Olga soll einen reichen Ehemann finden. Sie kann bisher nur einen Bewerber um ihre Hand vorweisen. Einen alten, stinkenden Bauern, der sich als Gutsherr bezeichnet und irgendwo auf dem Land lebt, einen Witwer mit sechs Kindern, der eine Haushälterin und Kinderfrau sucht. Ihr Vater hat sie angebrüllt, als sie die Bewerbung ablehnte. Die Aufgabe von Frauen sei es, einem Mann zu dienen.
Sie wird nicht dienen, niemals. Sie hat ihm diese Worte ins Gesicht geschleudert. Wird sich auch nicht verkaufen lassen für ein Stück Land, ein Dorf und zwei Handvoll Bauern.
Da hatte Graf Vassilij zur Reitgerte gegriffen. Sie hat sich woanders hingeträumt, während er auf sie einprügelte. Sie wird studieren! Ja, ebenfalls in der Schweiz.
Eine Zukunft ohne Sascha? Unvorstellbar. Sie weiß nicht, woher er das Geld für sein Jurastudium an der Universität Petersburg nimmt, denn seine Familie ist nicht reich. Sie hat ihn auch nie danach gefragt, sie weiß nur eines: Es wird alles gut, weil alles gut gehen muss. Das Schicksal hat keine andere Wahl. Sie selbst hat ja das Erbe ihrer Großmutter, das reicht notfalls für sie beide. Sascha, nur Sascha wird ihr Ehemann werden.
Drei Tage danach lag sie zerschunden und übersät von Striemen im Bett. Damals hatte die Mutter ihr zum ersten Mal Laudanum gegeben, und, als sie trotzdem vor Schmerzen wimmerte, schließlich den Arzt mit seiner Opiumspritze geholt. Die sorgte dafür, dass sie in einem angenehmen Zustand vor sich hin dämmerte, auf einer Welle weichen Wohlgefühls schwamm. Keine Schmerzen, keine inneren Kämpfe, nichts dergleichen. Als die Welle abebbte und sie wieder an den Strand der Wirklichkeit gespült hatte, kam die Sehnsucht nach Freiheit wieder und rieb ihr die Seele wund. Der Arzt weigerte sich aber, ihr eine weitere Spritze zu geben. Erst Jahre später hat sie begriffen, was das Medikament anrichten kann, das die Mutter so oft nahm.
Sascha und sie haben verabredet, sich am Hafen zu treffen, an derselben Stelle, an der sie ihn zum ersten Mal sah. Alexander Gregorewitsch Dolgow. Sie lächelt. Schon sein Name klingt wie ein Lied, das von Freiheit erzählt. Viele Frauen kämpfen heutzutage Seite an Seite mit den Männern für die Revolution. Das will sie auch. Lernen und kämpfen, so wie Wera Sassulitsch, die versucht hatte, General Fjodor Trepow, den Gouverneur von Sankt Petersburg, zu erschießen, nachdem dieser die Auspeitschung eines radikalen Studenten angeordnet hatte. Dessen einziges Vergehen war die Weigerung gewesen, ihn angemessen zu grüßen. Wera war freigesprochen worden. Ja, so will sie werden. Wie Wera, eine Kämpferin gegen die Ungerechtigkeit. Zusammen mit Sascha. Er soll stolz auf sie sein.
Leise öffnet Olga ihre Zimmertür. Es ist still in dem großen Haus über dem Hafen von Odessa. Alle haben sich zur Mittagsruhe zurückgezogen. Niemand sieht sie, niemand folgt ihr, als sie die Haustür hinter sich zuzieht und zunächst gemessenen Schrittes, um nicht aufzufallen, dem Hafen zustrebt. Dann hält es sie nicht mehr. Olga schürzt ihre Röcke und rennt. Da, da vorne steht er schon, breitet die Arme aus. Sie spürt bereits die Wärme, die sie umgeben wird, wenn sie sich hineinstürzt. Er ist ihre Zukunft, er ist ihr Leben. Sie jubelt innerlich, als sie das Lachen sieht, mit dem er auf sie wartet.
Gleich darauf hält sie überrascht inne. Damit hat sie nicht gerechnet: Ihr Liebster ist nicht allein. An seiner Seite steht ein junger Mann, Israil Lasarewitsch Helphand, diese Klette. Er ist um einiges jünger. Sascha ist sein großer Held. Immer wieder war er auch zu den geheimen Begegnungen von Narodnaja Volja mitgekommen. Einmal hatte sie sich darüber beschwert: »Wir haben kaum Zeit für uns, wie soll ich, ich meine, wie sollen wir miteinander …« An dieser Stelle war sie errötet.
»Lass ihn doch, wir haben noch unser ganzes Leben. Er hat nicht das Glück, eine Frau wie dich zu kennen. llja ist in dich verliebt, Olguschka. Das kann ich verstehen, also wie kann ich ihm das übel nehmen«, hatte Sascha lachend erwidert.
Nun ist er schon wieder dabei! Dabei ist das doch Saschas und ihre Stunde. Was soll’s. Sie ist zu glücklich, um sich zu ärgern. Hauptsache, Sascha wartet auf sie und mit ihm auf ihr gemeinsames neues Leben. Olgas Herz hämmert so sehr, dass es fast ihren Brustkorb sprengt, und sie fürchtet, ohnmächtig zu werden.
Unvermittelt taucht hinter den beiden Wartenden ein Mann in dunkler Kleidung auf. Er schwingt einen Knüppel, Israil wird getroffen und fällt.
»Sascha!« Sie schreit seinen Namen, so laut sie kann.
Er dreht sich um und wirft sich geistesgegenwärtig auf den Angreifer. Die beiden ringen miteinander. Der Angreifer verliert den Knüppel. Sie ist nun fast bei den Männern. Olga stürzt sich auf den Schlagstock, zögert einen Moment und zieht ihn dem Angreifer mit voller Wucht über den Schädel. Der sinkt zu Boden. In der Hand hält er ein Messer. Es ist blutig. Olga sieht es, begreift aber zunächst nicht, was es bedeutet. Dann hört sie Saschas Stöhnen, er sackt in sich zusammen. Olga entdeckt das Blut, das aus seiner Brust sickert, und kniet neben ihm nieder. »Sascha«, flüstert sie, »Sascha!« Sie weiß nicht, was sie tun soll. Menschenstimmen, es werden immer mehr. Verwirrt blickt sie hoch. Eine Pfeife schrillt. »Die Polizei«, sagt jemand.
»Geh, Liebste, geh. Geh heim, sie dürfen dich hier nicht finden«, flüstert er. »Ilja, bring sie weg von hier! Sofort.«
Israil Helphand, der es inzwischen geschafft hat, wieder auf die Beine zu kommen, versucht, sie hochzuzerren. Sie schüttelt seine Hände ab.
»Sascha«, flüstert sie, »ich kann doch nicht gehen. Ich muss doch …«
»Olguschka, geh, Liebste, geh«, raunt er eindringlich. »Sonst werden wir uns niemals wiedersehen.«
Der letzte Satz gibt den Ausschlag. Sie richtet sich auf und flüchtet zusammen mit Helphand.
Schließlich trennen sie sich. »Achte auf Sascha!«, befiehlt Olga ihm noch. Israil schaut sie an wie ein verstörtes Tier, nickt und rennt davon.
Niemand sieht, wie sie durch die Hintertür wieder in das Haus hoch über dem Meer mit den Fenstern zum Hafen hin schlüpft. Es ist, als wäre sie niemals fort gewesen. Sie wirft sich aufs Bett und schluchzt haltlos.
Es klopft an der Tür. »Olga, Olguschka!«, ruft die Gesellschafterin der Mutter.
»Ich bin krank«, erwidert sie. Es klopft noch einige Male, dann entfernt sich die Frau, sie kann die Schritte hören.
Stunden verharrt sie so, hat das Gefühl, neben sich zu stehen, als müsse sie gleich aus diesem Albtraum erwachen. In ihr ist alles taub, sie fühlt nichts. Es wird dunkel. Schließlich schläft sie ein. Als sie wieder erwacht, wird ihr schlagartig klar, was geschehen ist. Sie hat Sascha im Stich gelassen, als er blutend am Boden lag. Ihn, ihr Leben! Sie hätte nicht gehen dürfen, nicht auf ihn hören. Sie weiß, sie wird sich diesen Moment der Feigheit niemals verzeihen, ihn ewig mit sich herumtragen, jenen Augenblick, in dem sie sich von ihm abwandte und floh.
Am nächsten Tag erzählt ihr Vater beim Abendessen mit der Familie, an dem er ausnahmsweise einmal teilnimmt, weil er sich weder seinen Geschäften noch seiner Geliebten widmen muss, dass am Hafen ein Mann mit einem Knüppel totgeschlagen worden ist. Also ist sie eine Mörderin. An diesem und an allen Abenden, die folgen, weiß sie es, muss den Gedanken noch nicht einmal denken, um es zu wissen, so sehr wird er ein Teil von ihr: Sie ist eine Mörderin, hat einen Mann mit einem Knüppel getötet.
Vor allem aber: Sie hat Sascha im Stich gelassen. Sascha. Lebt er noch? Hat er den Messerstich überstanden? Die Ungewissheit bringt sie fast um den Verstand.
Sie versucht immer und immer wieder, Sascha zu finden, fragt im Krankenhaus nach, geht zu seiner Wohnung, läutet. Doch niemand öffnet. Vom Vermieter erfährt sie schließlich, dass die Familie nicht mehr dort lebt. Helphand scheint ebenfalls wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Die Genossen von Narodnaja Volja wissen nicht, wo er steckt. Vielleicht wollen sie es auch nicht sagen.
Aber wo ist Ilja? Ist er zurückgekehrt? War er nicht so feige? Hat er Sascha weggebracht und ist dann mit ihm zusammen vor den Schergen der Ochrana geflüchtet? Manchmal ertappt sie sich bei dem Gedanken, lieber tot sein zu wollen, als diese Ungewissheit weiter zu ertragen. Doch der Tod ist auch das Ende der Hoffnung. Dieser Gedanke hält sie am Leben.
Kapitel 2
Die russische Gräfin drückt die Zigarette im kleinen silbernen Aschenbecher neben ihrem Teller aus. Es ist die fünfte an diesem Abend. Dann legt sie die Zigarettenspitze aus geschnitztem Elfenbein behutsam daneben und greift zum Salzfässchen. Weiße Kristalle rieseln auf die pochierte Forelle.
Emma beobachtet sie genau. Es heißt, die Fremde sei eine Adelige und stamme aus Moskau. Angeblich hat sie Medizin studiert. Medizin studiert. In Moskau, Petersburg, Wien, Leipzig und sonst wo. In Amerika soll sie auch gewesen sein, sagt Madame. Dabei ist sie alleinstehend. Ein Fräulein Doktor. Madame findet das »very interesting«. So nennt sie alles, was anders als üblich ist, was sie neugierig macht. Diese Frau ist ganz sicher anders. Wahrscheinlich wurde sie deshalb eingeladen. Sie sieht aber eindeutig so aus, als wäre sie gerade lieber woanders.
Medizin studiert. Wie das schon klingt. So was tun sonst nur Männer. Außerdem scheint sie Kettenraucherin zu sein. Emma hat gehört, viele Russen seien das. Doch das gehört sich nicht für eine Frau. In der Öffentlichkeit rauchen sonst nur Männer, und die ziehen sich dann meist dazu in den Rauchsalon zurück. Bei einer Frau sieht das trotz der zierlichen Zigarettenspitze irgendwie – unanständig aus.
Eigentlich wirkt sie auch wie ein Mannweib. Herbe, etwas bäuerliche Züge, ein einfaches Kleid, Taft, schwarz, mit Puffärmeln, leicht zerknittert. Daran erkennt man, dass sie kein Personal hat, schon seltsam für eine adelige Dame. Ihre Haare sind kurz und streng zurückgekämmt. Eine russische Adelige, eine Adelige überhaupt, hat Emma sich anders vorgestellt. Nicht so … schäbig. Dabei soll sie reich sein. Die Leute sagen, die Russin sei eigentlich sogar eine Prinzessin, die unter falschem Namen in Europa lebt.
Es sieht nicht so aus, als habe sie sich für die Soiree feingemacht, nicht so wie Madame Codman Freund. Die trägt jede Menge Schmuck, Perlen und Goldketten, Ringe, fast an jedem Finger einen. Ihr Abendkleid ist aus einem schimmernden geblümten Seidenstoff mit feinen Spitzenapplikationen gefertigt. Die tief angesetzten Ärmel lassen ihre Taille noch schmaler wirken, die von einem breiten Samtgürtel zusätzlich betont wird. Madame hat das Kleid aus Paris kommen lassen. Es stammt von einem berühmten Modeschöpfer. Er heißt Poiret. Emma hat sich den Namen aufgeschrieben. Falls sie jemals viel Geld haben sollte, wird sie sich auch so ein Kleid von ihm bestellen, das bestimmt doppelt so viel kostet, wie sie in einem Jahr verdient.
Madame hat immer eine Wespentaille, das Dienstmädchen Luisa muss sie jeden Morgen schnüren. Emma fragt sich manchmal, wie ihre Arbeitgeberin überhaupt Luft bekommt. Und das, obwohl Madame doch schon wirklich alt ist, über 70, sagt der neue Oberdiener Hermann Brutsche. Vielleicht ist dieses enge Schnüren in amerikanischen Millionärskreisen ja so üblich. In Deutschland allerdings nicht mehr.
Die Russin lächelt selten, spricht wenig. Sie hält den Blick meist gesenkt, sieht niemanden direkt an, als habe sie etwas zu verbergen, als befinde sie sich in einem – Gefängnis. Aber nicht äußerlich, mehr so innen. Sie wirkt ganz in sich zurückgezogen. Wie alt sie wohl ist? Um die 50? Das ist bei ihr schwer zu schätzen, findet Emma.
Ob alle Frauen, die studiert haben, so merkwürdig sind? Abgesehen davon, dass sie kaum an den Gesprächen teilnimmt, hat die Gräfin die Angewohnheit, hin und wieder den Kopf zu neigen, als flüstere ihr jemand etwas ins Ohr. Aber da flüstert niemand.
Dabei ist sie ganz sicher nicht verrückt, vielleicht nur ein bisschen absonderlich. Sie muss nämlich klug sein, sie hat nicht nur studiert, sie spricht auch noch mehrere Sprachen. Die Russin kennt außerdem einen Herrn Aloys Alzheimer und einen Herrn Sigmund Freud. Besonders diese beiden Namen haben Madame sehr beeindruckt. Monsieur und Madame haben darüber gesprochen. Das sind offenbar alles ganz berühmte Wissenschaftler.
Gruselig ist es aber schon, das mit der Medizin. Besonders das, was Monsieur Madame erzählt hat, als sie dachten, niemand hört zu.
»Warum hast du sie eingeladen, meine Liebe?«, hat Monsieur gefragt.
Madame, die gerade an ihrem Frisiertisch saß, konnte ihn im Spiegel sehen. Sie hat ihn eine Weile gemustert und dann gesagt. »Henri Guilbeaux drängt mich schon lange, sie einmal einzuladen, du weißt schon, der Dichter und Journalist. Ich schätze sein Urteil, auch wenn er sometimes weird – äh, wie sagt man auf Deutsch – manchmal gewöhnungsbedürftige Ansichten vertritt. Bisher konnte ich nicht herausfinden, woher er sie kennt. Guilbeaux hält sich da sehr bedeckt.«
»Weird« heißt vermutlich so etwas wie seltsam, hat Emma da vermutet, aber sie hat nicht weiter darüber nachdenken können, sonst hätte sie den Faden des Gesprächs verloren.
»Von Monakow hat mir erzählt …«
Madame hat manchmal die Angewohnheit, ihren Mann zu unterbrechen, so auch dieses Mal: »Der Zürcher Professor, mit dem sie zusammenarbeitet?«
»Ja, der. Er hat mir erzählt, dass sie an Embryos forscht, sie zerschneidet, weil sie wissen will, wie das Nervensystem entsteht. So ähnlich jedenfalls.«
»Robert, sag, dass das nicht wahr ist! Wenn ich das gewusst hätte. How terrible! Brrrr. Als ich sie in Philadelphia kennenlernte, machte sie einen ganz passablen Eindruck. Ich glaube, das war bei irgendeiner Abendgesellschaft. Wir haben nicht viel miteinander gesprochen.«
Monsieur tätschelt Madame die Schulter. »Warten wir ab, wie sie sich gibt. Von Monakow sagt, er hat schon lange keine so begabte Forscherin mehr erlebt. Ihre Veröffentlichungen sind in der medizinischen Welt auf große Beachtung gestoßen. Allerdings sei sie persönlich etwas – nun, etwas schwierig. Deswegen müsse sie jetzt auch fort von Zürich.«
»Uh. That sounds weird too. Was ist mit ihrem Mann, wie heißt er noch?«
»Lange, von Lange, glaube ich. Ich habe ihn nie gesehen. Ich kenne auch niemanden, der ihn kennt. Der Mann ist wie ein Geist.«
»Seltsam.«
Als Madame das sagte, hat sie ein Gesicht gezogen wie jedes Mal, wenn sie entscheidet, dass es da ein Geheimnis gibt. Und wenn sie so schaut, dann gibt es wenig, was sie davon abhalten kann, es zu ergründen.
Obwohl Madame erst zuvor heftig mit ihrem Mann gestritten hat, lächelt sie ihn jetzt an. »Well, Rob, mein Lieber, wir werden sehen. Lass uns optimistisch sein. Vielleicht ist sie doch nicht so … seltsam, wie alle Welt behauptet, sondern einfach nur zurückhaltend. Kein Wunder, bei ihrem Aussehen. Schön ist sie nicht. Andererseits – sie hat etwas. Vielleicht taut sie ja auf, wenn du deinen Charme einsetzt. Außerdem sollte sie mir dankbar sein. Ohne mich hätte sie die Villa am Lierenbach nicht bekommen, auch den Hypothekenkredit nicht.«
Danach hat Madame ziemlich übergangslos das Thema gewechselt und von den Pflanzen erzählt, die sie für ihren Laufenburger Park bestellen will. Sie hat das ganze Anwesen erst kürzlich mit viel Aufwand ganz prächtig umbauen und den Garten neu anlegen lassen. Die Leute nennen sie inzwischen die »Schlösslemadame«. Das gefällt der Amerikanerin, sie hat sich sogar ein Wappen anfertigen lassen.
Erneut rieseln Salzkristalle auf die Forelle. Herumschneiden an toten Babys. Das ist wirklich gruselig! Wie kann eine Frau so etwas nur tun! Ob die Russin eigene Kinder hat? Nein, das glaubt Emma nicht. Sie kann sich nicht vorstellen, dass jemand tote Säuglinge zerschneidet, der selbst ein Kind geboren hat.
Die Gräfin sitzt links von Monsieur und rechts von Madame. Damit ist sie der Ehrengast des Abends. Herr Freund mag Frauen, das ist allgemein bekannt. Manchmal zu sehr für den Geschmack von Madame.
Monsieur lächelt die Russin an. »Wie geht es von Monakow? Ich habe ihn neulich nach einem Konzert in der Tonhalle getroffen. Ich weiß noch, wie in ganz Zürich früher von seinem Labörli die Rede war und der Forschung, die dort stattfindet. Wo haben Sie denn bisher in Zürich gelebt, wenn Sie dort waren? Haben Sie nicht manchmal Heimweh?«
Die Gräfin schaut von der Forelle hoch, ihr Blick fixiert eine Stelle an der gegenüberliegenden Wand. »Oh, ich bin immer wieder in Russland … Kaiserliche Universität Moskau, auch an Universität Petersburg für Forschungen, manchmal sogar in Amerika.«
Sie sieht zu Madame. Die Amerikanerin nickt und lächelt.
»Von Monakow – geht ihm gut«, fährt die Russin dann fort. »Er lässt Sie grüßen. Und natürlich auch Madame.« Die Gräfin lächelt nicht, sondern schaut sofort wieder auf den Fisch, beginnt, die Forelle geschickt zu filetieren. Sie wirkt dabei so konzentriert, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt. Ihre Stimme klingt schön, etwas rau, dunkel und guttural, aber kultiviert, findet Emma, obwohl man merkt, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist.
Das Mädchen betrachtet die Hände der Gräfin und bekommt eine Gänsehaut. Es sind kleine Hände, eher zart, aber nicht sorgsam eingecremt, sondern gerötet, als würden sie oft gewaschen, mit sehr kurzen Nägeln. Hände, die tote Kinder zerschneiden.
»Ich … keine Wohnung in Zürich, von Monakow hat mir erlaubt, im Labörli zu … übernachten, wenn ich da bin.«
Emma ist verblüfft. Keine eigene Wohnung in Zürich? Ob die Gräfin am Ende ein Verhältnis mit dem Zürcher Professor hat? Das dürfte dessen Frau nicht gefallen. Falls er eine hat. Der Mann der Russin ist jedenfalls schon mal verschwunden. Vielleicht deshalb? Wäre ja kein Wunder.
Die Blicke der anderen Gäste wandern immer wieder zu Madames und Monsieurs Ehrengast, auch wenn sie versuchen, ihre Neugier zu verbergen. Emma kann das verstehen, ihr geht es ja ähnlich. Diese Frau hat etwas Faszinierendes, Dunkles, Schweres, irgendwie Geheimnisvolles. Die Leute in Kleinlaufenburg und auch jenseits der Grenze in Großlaufenburg reden viel über sie. Dass sie so zurückgezogen lebt, heizt die Gerüchteküche zusätzlich an.
Mit der Kunst des vornehmen Parlierens scheint sich die Gräfin jedenfalls nicht auszukennen. Nicht so wie Madame und Monsieur. Parlieren heißt, gekonnt eine Unterhaltung führen zu können. Emma ist stolz darauf, dass sie dieses Wort gelernt hat. Sie sammelt ihr unbekannte Worte und schreibt sie auf, um sie nicht wieder zu vergessen. Auch den Namen der Russin hat sie sich notiert: Gräfin Olga Vassiliewna von Leonowa.
Warum die Russin sich bei der Soiree nicht wohlfühlt, hat Emma bisher nicht ergründen können. Madames Soireen sind berühmt, die Amerikanerin ist eine selbst für die Verhältnisse der reichen Zürcher großzügige Gastgeberin. Alles ist vom Feinsten, das Essen wie bei Königen und Kaisern. Emma ist stolz darauf, zu Madames Dienstboten zu gehören, auch wenn ihre Arbeitgeberin sehr eigen ist. Viele der Dienstboten, die sie kennt, sind neidisch, denn Madames Reichtum ist legendär. Sie zeigt ihn außerdem gerne. Heute liegt neben dem Teller jedes Gastes wieder ein kleines Geschenk: für die Herren eine Krawattennadel mit Perle, für die Damen ein von Luise wundervoll besticktes seidenes Taschentuch mit dem jeweiligen Monogramm. Sie hat Luise beim Sticken geholfen.
Die Gräfin scheint das noch nicht einmal wahrzunehmen. Vom feinen Essen versteht sie ebenfalls nichts. Emma kann sich nicht vorstellen, dass die Forelle nicht perfekt gesalzen sein soll. Madames Küchenchef Hermann Probst ist berühmt, hat bei großen Meistern gelernt und in Berlin, wo Madame auch hin und wieder logiert, sogar für den deutschen Kaiser gekocht. Er führt in Großlaufenburg auf der anderen Rheinseite ein bekanntes Lokal, das Meerfräulein. Emma stammt ursprünglich ebenfalls von der Schweizer Rheinseite, aus Großlaufenburg.
Vielleicht stimmt es ja, dass die Russen Barbaren sind, obwohl am Zarenhof angeblich nur Französisch gesprochen und Champagner getrunken wird. Ob die Reichen dort auch so festlich gedeckte Tische haben, solche mit feinen gestärkten Damastservietten? Ansonsten trinken Russen viel Wodka und werfen die Gläser dann hinter sich über die Schulter, hat sie gehört. Bisher hat die Gräfin noch kein Glas geworfen. Bisher gab es aber auch keinen Wodka.
Die Tafel bietet einen prächtigen Anblick. Emma wird innerlich ganz warm. Niemand kann Damasttischtücher und -servietten so gut stärken wie sie, obwohl sie nur ein Kleinstadtmädchen aus dem Fricktal ist.
Emmas Nase juckt. Einen Moment lang befürchtet sie, gleich niesen zu müssen. Sie unterdrückt den Impuls. Hoffentlich bekommt sie keine Erkältung. Viele sind derzeit krank. Das macht wohl das Wetter. Dieser Dezember ist vergleichsweise warm, und es regnet ständig. Nein, nur nicht krank werden. Madame kann Krankheiten nicht ausstehen. Zumindest nicht bei anderen.
Einige Gäste lachen. Gerade schaut Madame zur Russin. »Darling, youknow, es ist so schrecklich. Dieses Attentat auf den österreichischen Statthalter, ein … Freiherr von Vareš. Ja, ich glaube, so heißt er«, sagt sie gerade. »Der arme Kaiser Wilhelm, ständig neue Probleme. Manche behaupten, wenn das so weitergeht, gibt es Krieg. Ich denke ja nicht, aber was meinen Sie, meine Liebe? Sie haben doch auch in Wien studiert. Haben sie den österreichischen Kaiser Franz Josef damals kennengelernt?«
Die Gräfin antwortet nicht, zieht aber ein Gesicht, als habe sie noch nie etwas vom österreichischen Kaiser gehört und als habe sie auch nicht das geringste Interesse, ihn kennenzulernen. Emma denkt, sie selbst hätte ihr letztes Hemd dafür gegeben, einmal am Hof eines Kaisers Mäuschen spielen zu können.
Madame schaut verstimmt.
»Prawda. Das ist wahr. Schrrrecklich. In Sarrrajevo.« Olga von Leonowa scheint die Verärgerung ihrer Gastgeberin bemerkt zu haben, sie lächelt sogar ebenfalls etwas. Das macht, dass sie aussieht wie ein junges Mädchen. Die Blicke der beiden Frauen treffen sich. Nach kurzem Zögern lächelt Madame zurück.
Die Gräfin sagt »schrrrecklich«. Und »Sarrrajevo«. An dem rollenden R kann man die Russin erkennen. Emma hat das R auf dem Weg zur Küche vorhin heimlich vor dem Spiegel geübt. Doch es gelingt ihr nicht, es so auszusprechen wie die Russin. Als Schweizerin kann sie das R nur hinten im Hals formen.
Jetzt erst wird Emma bewusst, dass Madame gerade eben »Krieg« gesagt hat, und wie still die anderen Gäste plötzlich geworden sind. Sie zieht die Schultern hoch. Dann beruhigt sie sich wieder. Es wird sicher nicht so schlimm werden. Wer will schon Krieg! Das Leben ist viel zu schön, um zu sterben.
An diesem Abend darf sie zum ersten Mal bei einer der großen Soireen im Zürcher Haus von Madame und ihrem Künstlerehemann servieren. Eigentlich hat Madame sie ja als Wäscherin, Näherin und Bügelfrau eingestellt. Doch das für die Bedienung der heutigen Abendgesellschaft vorgesehene Mädchen ist nicht aufgetaucht. Vermutlich wird sich Madame morgen energisch bei der Personalvermittlung beschweren. Sie ist zwar Amerikanerin, aber schimpfen kann sie akzentfrei.
Emma genießt jede Sekunde dieses Abendessens. Die spitzenbesetzten Roben der Damen, die bei jeder Bewegung leise rascheln, der Duft des Essens, Kaviar, die teuren Weine, die Kristalllüster, die Kerzen und Blumen der Tischdekoration … wenn sie doch nur einmal in einer solchen Runde dinieren dürfte, sich bedienen lassen könnte! Sie würde die Gabel ganz zierlich zum Mund führen, immer nur kleine Happen essen. Nach links und rechts lächeln, den Rücken gerade halten, sich nicht so unzugänglich benehmen wie die Russin. Mehr so wie Gerda Hegar, die imponiert Emma. Sie ist die Frau von Friedrich Hegar, einem Freund von Monsieur. Der ist ebenfalls ein berühmter Musiker und Komponist und Dirigent des Tonhallenvereins und Direktor des Zürcher Konservatoriums. Der Oberdiener behauptet, diese Leute seien alle dekadent. Emma weiß noch nicht, was das heißen soll, aber sie wird es herausfinden.
Sie unterdrückt ein Gähnen. Wenn alle gegessen haben, und das dauert noch mindestens zwei Stunden, dann gibt es wieder Hausmusik. Vielleicht setzt sich sogar der Hausherr an den Flügel. Robert Freund sei ein Schüler von einem gewissen Franz Liszt gewesen, sagt der Oberdiener. Der spielt wohl auch Klavier.
Die Menschen am Tisch wirken noch immer bedrückt. Madame runzelt die Stirn, dann nickt sie der Gräfin unvermittelt zu. »Ah, ich sehe, der Fisch mundet Ihnen. Wie schön, darling. Also weg mit den traurigen Gedanken, ich weiß auch nicht, warum ich heute so negggatiffbin. Lassen Sie uns den Abend nach diesem wunderbaren Konzert in der Tonhalle genießen, jetzt, wo ich Sie endlich einmal bei mir in Zürich begrüßen darf. Außerdem freue ich mich schon auf den Besuch in Ihrem neuen Heim in Kleinlaufenburg. Ich bin richtig neidisch auf den steinernen Turm in Ihrem Garten. Er wirkt so – charming altmodisch.«