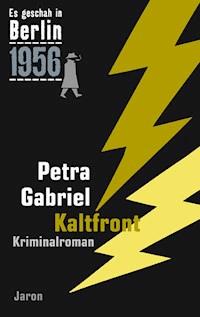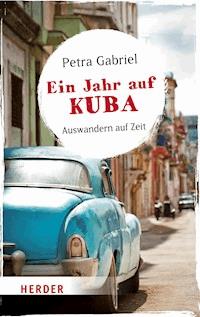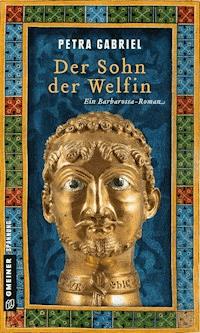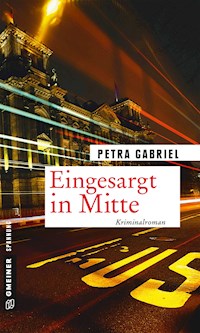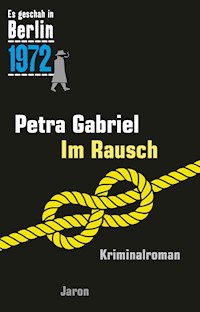
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jaron Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Es geschah in Berlin
- Sprache: Deutsch
Anfang 1972 herrschen unruhige Zeiten in West-Berlin: Nach der Studentenrevolte haben viele Intellektuelle den „Marsch durch die Institutionen“ angetreten, doch auch linksextremistische Aktivitäten nehmen zu. Der bundesweite Radikalenerlass, mit dem die Bundesländer „Verfassungsfeinde“ vom öffentlichen Dienst fernhalten möchten, macht vielen Beamten zu schaffen, darunter auch Peter Kappe. Der gehört seit einem Jahr als Polizist dem Diskussionskommando des Referats MEK 5 an und befürchtet aufgrund seiner linken Vergangenheit den Verlust seiner Stelle. Genau zu jener Zeit findet Peter Kappe, als er beim Abriss mehrerer Häuser in Charlottenburg deeskalierend auf Protestanten einwirken soll, einen Toten. Neben dem sitzt ein verwirrtes Mädchen, das offenbar unter Drogen steht. Sofort informiert der junge Polizist seinen Vater, den Kriminaloberkommissar Otto Kappe. Aber kaum will der die Ermittlungen aufnehmen, wird er auf einen älteren Fall angesetzt: Bei einem Sprengstoffanschlag auf den Britischen Yachtclub in Gatow am 2. Februar 1972 kam ein Hausmeister ums Leben, und man munkelt über einen Zusammenhang mit der linksextremistischen „Bewegung 2. Juni“. Als Vater und Sohn erfahren, dass auch das drogenabhängige Mädchen der „Bewegung 2. Juni“ nahesteht, ahnen sie, dass zwischen beiden Fällen ein Zusammenhang besteht …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Petra Gabriel
Im Rausch
Ein Kappe-Krimi
Jaron Verlag
Petra Gabriel, geborene Stuttgarterin, ist gelernte Hotelkauffrau, Dolmetscherin und Journalistin. Als freiberufliche Autorin lebt sie in Laufenburg und Berlin. Sie schreibt historische Romane, Jugendbücher und Krimis, zudem verfasst sie Kurzgeschichten. Zur Krimireihe «Es geschah in Berlin» trug sie bereits vier Bände bei, zuletzt «Tod eines Clowns» (2015).
Originalausgabe
1. Auflage 2019
© 2019 Jaron Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
www.jaron-verlag.de
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin
Satz: Prill Partners | producing, Barcelona
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2019
ISBN 978-3-95552-042-7
Für Horst Bosetzky (1938–2018), den Kollegen und Freund, der mich mit Kappe bekannt gemacht hat
Inhalt
Cover
Titel
Über die Autorin
Impressum
Prolog
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Epilog
Es geschah in Berlin …
PROLOG
ALLES war wie sonst in der Hafenstraße in Königs Wusterhausen, in dieser idyllischen Wohngegend mit den gemütlichen Einfamilienhäusern. Ihr gegenüber reckten sich große Kiefern der Augustsonne entgegen. Die brütende Hitze brachte die Luft zum Flirren. Ab und zu bog ein Radfahrer auf einen Plattenweg ab, der von der Hafenstraße in den Wald führte. Paul B. kannte jeden Quadratmeter um das Wasserwerk, das in dem Waldstück lag. Gegen siebzehn Uhr war der 32-jährige Sicherheits- und Brandschutzinspektor auf dem Weg nach Hause. Er freute sich auf seine Familie, auf seine Frau und seinen dreijährigen Sohn.
Paul B. war glücklich über sein neues Moped, denn Fahrradfahren wäre an diesem 14. August des Jahres 1972 sehr schweißtreibend gewesen. Er dachte darüber nach, dass Erich Honecker in elf Tagen Geburtstag feierte, am selben Tag wie seine Frau Monika. Sie wurde dreißig Jahre alt. Übermorgen, so hoffte Paul B., würde er Nachricht bekommen, ob es mit dem Kurzurlaub in Schwerin klappte. Wenigstens zwei Tage. Das sollte die Geburtstagsüberraschung für seine Frau werden. In etwa zwei Wochen, am 1. September, mussten die Kinder zurück auf die Schulbänke.
Meer, Wind, Wellen – Paul B. seufzte sehnsuchtsvoll. Als er gestern zur Arbeit gefahren war, hatten die Meiers gerade ihren Trabant beladen. Sie fuhren jeden Sommer an die Ostsee. Es hatte den üblichen Vorbereitungsstress gegeben. Die Kinder waren ständig im Weg gewesen und deshalb weggeschickt worden. Sie hatten dann Fußball auf dem Wäscheplatz vor dem dreistöckigen Mehrfamilienhaus gespielt. Eigentlich war das nicht erlaubt. Im Haus lebten Ärzte und Krankenschwestern mit ihren Familien, die manchmal auch Nachtdienst hatten. Aber niemand hatte Einspruch erhoben, trotz des Lärms.
Auch am Zentralflughafen Berlin-Schönefeld schien alles zu sein wie immer. Der Lärm der Flugzeugstarts und -landungen, der von dort herüberschallte, war für die Menschen im Ortsteil Neue Mühle von Königs Wusterhausen an der Tagesordnung. Die TU-134, die IL-18 oder die IL-62 waren nun mal laut. Königs Wusterhausen, die Kleinstadt nahe dem Berliner S-Bahn-Ring, die zum Bezirk Potsdam gehörte, war für die Bewohner ohne die ständigen Überflieger nicht mehr vorstellbar.
Am 22. April 1970 hatte die DDR-Staatsfluglinie Interflug ihren ersten Langstreckenjet vom Typ Iljuschin IL-62 vom großen Bruder Sowjetunion bekommen. Der 51-jährige Kommandant Heinz P. flog die IL-62 seit ihrer Einführung. Er hatte 8100 Flugstunden mit über vier Millionen Kilometern Flugerfahrung vorzuweisen, auch als Pilot der IL-14 und der IL-18. Mit Urlaubern an Bord sollte es an die Schwarzmeerküste gehen. An seiner Seite wusste er an diesem Tag erfahrene Männer: Copilot Lothar W. mit 6041, Navigator Achim F. mit 8570 sowie Flugingenieur Ingolf S. mit 2258 Flugstunden. Die 148 Fluggäste an Bord der IL-62 mit der Kennung DM-SEA wurden von vier Flugbegleiterinnen betreut. Christa K. war eine von ihnen. Sie begriff als Erste, dass etwas nicht stimmte. Unwillkürlich begann sie zu beten.
KAPITEL EINS
in dem Peter Kappe einen Toten findet
PETER KAPPE streifte mit Wolle Kaufmann, seinem Kollegen vom sogenannten Diskussionskommando, durch Charlottenburg. Die Gegend war als «Brennpunkt für Diskussionen und Bürgeraufruhr» eingestuft worden. Bisher sah es allerdings gut aus, keine Antiräumungsdemo weit und breit. Hoffentlich kam er heute mal früher heim. Sarah hatte von einer Überraschung gesprochen.
Peter vermutete, dass sich seine Eltern zu einem Besuch angekündigt hatten. Denn heute, am 30. März 1972, wurde seine Tochter ein halbes Jahr alt. Die Kleine war ungeplant, aber dafür umso heftiger in sein Leben getreten – und sie hatte es komplett umgekrempelt. Tabea Gertrud Kappe. Der Name Tabea sollte an die jüdische Herkunft seiner Frau erinnern. Im Arbeiter-und-Bauern-Staat, aus dem Sarah geflüchtet war, war die Ausübung des jüdischen Glaubens nicht gern gesehen und zog Repressalien nach sich. Seit Sarah in West-Berlin lebte, konnte sie sich aber den religiösen Riten ihrer Mutter ohne Angst vor staatlichen Übergriffen widmen. Neulich hatte sie sogar einen siebenarmigen Leuchter mitgebracht. Ja, die Dinge hatten sich geändert, nicht nur, weil Sarah jetzt in einem anderen Staat lebte, sondern auch, weil sie inzwischen selbst Mutter und damit Teil einer Tradition war.
Der zweite Vorname der Kleinen, Gertrud, war ein Kompromiss. Damit hatte Peter seinen Eltern Gertrud und Otto einen Gefallen tun wollen.
Peter wurde warm ums Herz. Er nannte seine Tochter einfach Tabbi. So ein kleiner Sonnenschein, der einen anstrahlte, das war schon was. Und eine Frau, die sich freute, wenn er nach Hause kam. Zumindest meistens. Ihretwegen lebten sie jetzt in Berlin, obwohl er als Psychologe in der Wendland-Klinik hätte bleiben können, anstatt zur Polizei zu gehen. Aber Sarah fand, es sei wichtig, in der Nähe der Großeltern der Kleinen zu wohnen. Wenigstens mit einem Großelternpaar sollte Tabea aufwachsen. Sarahs Mutter war Witwe und lebte in der DDR, in Köpenick. Der Vater war während des Pogroms in Kielce am 4. Juli 1946 erschlagen worden.
Der Alltag hinterließ in Peters Ehe langsam Spuren, ein Baby war nicht immer eitel Freude und Sarah oft müde. Der erste Lack der jungen Liebe blätterte ab. Doch die Verbindung hielt. Obwohl Sarah sich mehr und mehr in eine Feministin verwandelte. «Die 68er-Revolte», pflegte sie zu sagen, «das ist doch die Revolution der Männchen und Sexisten. Die freie Liebe wird nur propagiert, damit die mehr Frauen zur Auswahl haben. Lass dir ja nicht einfallen, mir untreu zu werden! Dann bin ich weg. Nichts mit freier Liebe und so!»
Dabei hatte Peter gar nicht vor, sie zu betrügen. Er liebte seine Frau, er achtete sie. Sarah, seine schöne braunäugige Sarah mit dem blonden Lockenkopf, der trotz der Geburt immer noch knabenhaften Figur und der schmalen Taille wusste, was sie wert war. Sie bildete sich ihre eigene Meinung und hielt sich nicht an die gängigen Verhaltenskodizes.
Auch mit seinem Vater kam Peter wieder besser zurecht. Das war nicht zuletzt auf die Polizeiarbeit zurückzuführen. Peter war inzwischen einer von sechzig sogenannten Laberbullen vom Diskussionskommando des Referats MEK 5, der Einsatzgruppe Erprobung und Sonderaufgaben, kurz EgrEuS genannt.
Die Polizeieinheit war 1969, rund zwei Jahre nach dem Tod von Benno Ohnesorg und der zunehmend eskalierenden Gewalt in den Straßen Berlins, gegründet worden. Anfangs hatte sie nur aus 47 Männern bestanden. Deshalb war sie ursprünglich auch Gruppe 47 genannt worden. Nun waren es schon sechzig. Das Wort Laberbullen war schnell in die Berliner Alltagssprache eingegangen. «Reden statt knüppeln» lautete jetzt die Devise.
Peter schaute sich um. Vieles in dieser Gegend war ihm vertraut. Er war hier aufgewachsen. Die Eltern lebten seit Ewigkeiten im Horstweg. Eigentlich ein friedlicher Kiez. Doch jetzt lag Ärger in der Luft. Und Staub. Der Bau der U-Bahn-Linie 7 Richtung Spandau hatte auch jenen der schiefen Häuser im Sumpf von Charlottenburg den Rest gegeben, die bisher noch vom Abriss verschont geblieben waren. Sie sackten immer weiter ab. Die teilweise eilig angeordneten und schlecht geplanten Räumungen hatten den Zorn der Bürger zusätzlich befeuert. Besonders bei der Blitzräumung im Februar in der Hebbelstraße hatte es Proteste und Aufruhr gegeben. Sogar der Bausenator Rolf Schwedler hatte die Räumung im Nachhinein als überstürzt bezeichnet.
Es gärte nicht nur hier im Charlottenburger Sumpf. Peter und seine Kollegen besuchten auch die Studenten an der Freien Universität, um zuzuhören, zu schlichten und zu deeskalieren. Die Wut auf die USA und die Professoren, die für die staatliche Ordnung standen, war groß. Der Vietnamkrieg, dieses sinnlose Abschlachten, trieb die jungen Leute auf die Barrikaden. Peter verstand jeden, der dagegen protestierte. Er fühlte sich durchaus nicht immer wohl in seiner neuen Rolle als Polizist. Viele der Vorbehalte gegen das etablierte System teilte er.
Der Charlottenburger Sumpf war eine der größten Bausünden Berlins. Kurz nach 1900 hatte der Baulöwe Alfred Schrobsdorff im Dreieck von Zillestraße, Fritschestraße und Hebbelstraße jene Miethäuser errichten lassen, die jetzt fielen. Und das im Bereich eines Torfgrabens und des ehemaligen königlichen Karpfenteichs, mitten im Morast. Man hätte wissen können, dass hier niemals Häuser hätten erbaut werden dürfen. Doch die Gier nach Rendite hatte einmal mehr den Sieg über die Vernunft davongetragen.
1955 hatten dann die ersten der vom Einsturz bedrohten Quergebäude und Seitenflügel abgerissen werden müssen. Nun, rund achtzehn Jahre später, sollten die Häuser vollends verschwinden. Das wollten einige der Bewohner nicht einfach so hinnehmen. Es brodelte hinter den Kulissen, der Senat befürchtete Ausschreitungen. Und genau diese sollten die beiden Polizisten vom Diskussionskommando verhindern. Ihre Aufgabe war es, mit Argumenten für Deeskalation zu sorgen. Aber was gab es da schon zu diskutieren? Die Häuser mussten weg.
Peter wurde auf zwei ältere Damen in geblümten Kittelschürzen aufmerksam. Sie beobachteten etwa fünfzig Meter vor ihm mit griesgrämigem Gesichtsausdruck einen Bauarbeiter im Blaumann, der in das Führerhaus eines Krans kletterte. An der mächtigen Maschine auf der anderen Straßenseite baumelte eine Abrissbirne.
Wolle Kaufmann würdigte die Frauen keines Blickes. Er hielt einen Vortrag über den Abriss der Häuser. Peter ließ es über sich ergehen, obwohl er die ganze Geschichte kannte.
«Det hätte alles nicht sein müssen. Die von der Baufirma für die U-Bahn-Station Wilmersdorfer Straße ham mehr als hundert Kubikmeter Grundwasser die Stunde abgepumpt. Kein Wunder, det hier allet abgesackt is. Inzwischen müssen die ’ne Extraerlaubnis fürs Pumpen von solchen Mengen einholen.»
Peter nickte, aber er war mit seinen Gedanken ganz woanders. Er hatte eine Bewerbung für die Zulassungsprüfung zum Kripo-Fachlehrgang abgeschickt. Die sollte sehr schwierig sein. Aber er wusste genau, worauf er sich einließ. Als Kind eines Beamten der Mordkommission hatte er schon so einiges mitbekommen. Erst hatte sich sein Onkel Hermann, dann dessen Neffe Otto, sein Vater, inzwischen 61 Jahre alt, im Dienste der Kripo abgerackert. Und bald würde er das womöglich auch tun. Hoffentlich. Denn noch war er bei der Schutzpolizei.
«Du bist ’n Streber, Peter!», sagte Wolle Kaufmann. «Aber zuhören tuste nicht. Müsstest du aber können als Psychologe.»
«Wie kommst du darauf?»
«Na, da bist du schon een Studierter, aber dann mussteste ja unbedingt Schupo werden. Und nun reicht es dir nicht, den Schupo-Fachlehrgang II zu machen. Nee, die Kripo muss es sein. Aber klar doch, wenn der Vater schon bei der Mordkommission gedient hat … Liegt praktisch im Blut, die Kriminalistik, wa? Is wie bei Kaisers.»
Das klang, als glaubte Wolle, Peter wolle mit Vitamin B, mit Beziehungen Karriere machen.
Das mit dem Vater bei der Mordkommission stimmte natürlich, aber beide hatten lange Zeit ein kompliziertes Verhältnis zueinander gehabt. Inzwischen konnten sie wieder entspannter miteinander umgehen. Otto Kappe hätte seinem Sohn aber niemals Vorteile verschafft.
Peter schmunzelte in sich hinein. Er sah seinen Vater in Gedanken vor sich, wie er mit Tabea spielte, voller Staunen angesichts dieses kleinen Wunders. Otto und Gertrud Kappe waren ganz verrückt nach ihrer Enkelin. Mittlerweile hatten sie auch Sarah ins Herz geschlossen. Deshalb begegnete Peter seinem Vater nun öfter. Sie hatten Frieden geschlossen, schon der Kleinen zuliebe. Otto hatte nach wie vor seine Vorbehalte gegen Peters linke Vergangenheit. Aber er sagte nichts mehr dazu.
«Kaiser gibt’s bei uns schon lange nicht mehr», erwiderte Peter leicht verärgert über Wolles Bemerkung und fügte hinzu, dass ein Mann schließlich seine Familie ernähren müsse. Er runzelte die Stirn. Nein, es war noch lange nicht sicher, dass das mit der Bewerbung klappte. Seit Neuestem gab es den sogenannten Radikalenerlass, der allen das Leben schwerzumachen drohte, die sich in der linken Szene zu Hause gefühlt hatten. So wie er. Seine diesbezüglichen Kenntnisse hatten ihm zwar gemeinsam mit seinem Psychologiestudium nach einer ungewöhnlich kurzen Anfangszeit als Quereinsteiger bei der Bereitschaftspolizei die Aufnahme beim Kommunikationskommando beschert, doch nun drohte ihm seine Vergangenheit Schwierigkeiten zu bereiten. Er befürchtete, als Radikaler eingestuft zu werden.
Das neue Gesetz, auch Extremistenbeschluss genannt und von den Ländern im Januar 1972 auf Bestreben der CDU verabschiedet, konnte Berufsverbot für ihn bedeuten. Denn danach durfte nur derjenige in das Beamtenverhältnis berufen werden, der jederzeit aktiv für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintrat. Peter war zu Ohren gekommen, dass einige Kollegen bereits überprüft wurden. Wenn die Sachverständigen nun zu dem Schluss kamen, dass er, Peter Kappe, in der Vergangenheit nicht jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung eingetreten war, dann bedeutete dies das Aus für seine Polizeikarriere.
«Guck mal dort vorn auf der anderen Straßenseite! Gleich kracht die Abrissbirne in ein weiteres Haus!», sagte er zu Wolle, statt weiter auf dessen Vorwurf einzugehen.
Wolle schaute kurz hoch, zuckte aber nur mit den Schultern und fuhr fort: «Die in der Hebbelstraße haben den Bescheid, dass sie aus den Wohnungen rausmüssen, erst an dem Tag bekommen, an dem die Räumungen offiziell bekannt geworden sind. Wusstest du, dass kaum Ersatzwohnungen für die Leute bereitstehen? Auch nicht für die aus der Schloßstraße, da wo meine Oma wohnt? Den Kriech ham wa hier überstanden, un nu ditte, sagt sie.» Wolle hielt inne. Denn eine der beiden Kittelfrauen zeterte jetzt so laut, dass auch er aufmerksam wurde.
«Kiek ma, gleich is schon wieda een Jemäuer dahin. Und dann die Bruchbuden, in die se uns jesteckt ham! Man sollte die alle … Bomben inne Amtsstuben, sag ick nur, Bomben!»
Bomben? Peter schaute zu den Damen. Sie schienen ein Fall fürs Diskussionskommando zu sein. Hoffentlich konnten Wolle und er sie beruhigen. Er beschleunigte seinen Schritt.
Immerhin, die Polizeieinheit, zu der er derzeit gehörte, galt als das Fortschrittlichste vom Fortschrittlichen in der gesamten Geschichte polizeistrategischer Konzepte West-Berlins. Die «Leberwursttaktik», die noch bei der Demonstration vor der Deutschen Oper ihre Anwendung gefunden hatte, hatte ausgedient. «In die Mitte hineinstechen und an beiden Enden ausdrücken», hatte Polizeipräsident Erich Duensing am 2. Juni 1967 anlässlich der Proteste gegen den Besuch des Schahs von Persien propagiert. Der folgende Aufruhr auf den Straßen hatte aber dazu geführt, dass der Regierende Bürgermeister Heinrich Albertz und sein Innensenator den Hut nehmen mussten. Polizeipräsident Duensing war entlassen worden. Und spätestens seit den Auseinandersetzungen zwischen der Außerparlamentarischen Opposition und der Polizei am Tegeler Weg im Frühjahr 1968, als in West-Berlin ganze Hundertschaften der Polizei die Flucht hatten ergreifen müssen, war deutlich geworden, dass man eine neue Strategie benötigte. Im Frühjahr 1969 hatte dann der neue Polizeipräsident Klaus Hübner als erste Reaktion auf die anhaltenden APO-Unruhen die Aufstellung des Diskussionskommandos verfügt. Seitdem debattierten die Polizisten, mit Mao-Zitaten ausgerüstet und getreu Hübners Motto «Wer redet, wirft keine Steine».
Die beiden erbosten Damen jedenfalls wirkten, als könnten sie sich durchaus vorstellen, mit Steinen zu werfen. Es lagen ja auch genügend davon herum. Inzwischen hatten Peter und Wolle sich ihnen bis auf fünfzehn Meter genähert.
«Ick hab schon vor Jahren an den Senat jeschrieben. Und was machen die? Nüscht! Noch nich mal Messungen. Det musste doch schiefjehen. Schon der alte Otto Springer, der Baustoffhändler in der Nähe der alten Caprivibrücke war, hat det gesagt. Von dem haste bestimmt schon jehört – haste, Margret?»
Die Angesprochene nickte. Ihr Gesicht war hochrot, die Arme hatte sie vor der Brust verschränkt, ihr Minipli kräuselte sich um ihren Kopf, als stünde sie unter Strom. Sie war vielleicht siebzig Jahre, schon etwas in sich zusammengesunken, aber hatte ebenfalls eine kräftige Stimme. «Klar, den kenn ick, der wohnte am Luisenplatz. Hat mit meene Eltern verkehrt. Det Töchterchen wurde vom Kinderfräulein am alten Karpfenteich spazieren jeführt. Der war nur noch eene Pfütze und wurde dann Müllabladeplatz … ’ne Schande, so wat!»
«Weeß ick doch, Margret! Und der Springer hat von Anfang an jesagt, det mit den Häusern da, det jeht nich jut. Da ham se een paar Pfähle in den Sumpf jerammt. Und darauf ham se denn Häuser jebaut. Hatta aber abjelehnt, da mitzumachen. Damals jab es noch anständije Leute.»
«Zu denen jehörn aba nich die im Baustadtrat. Solln die doch mal ihre Häuser verlassen, wo sie lange jelebt ham, und inne Bruchbude ziehn zu Wuchermieten. ’n janzet Leben einfach so futsch. Da oben, dritter Stock, det war mal meen Küchenfenster. Kannste dir noch erinnern, wie wa da jefeiert ham, als die Gören kleen warn? Schöne Zeiten warn det. Un nu? Kaum ham se uns rausjeworfen, da hat sich so ’n Gesocks einjenistet, obwohl det doch vabotn is, det da jemand wohnt. Steht übaall uffn Schildern. Betretn vabotn! Aba manche könn wohl nich lesn. Kannste dir noch anne Aufstände vonne Insassen inne Erziehungsheime erinnern und det viele damals wegen die üblen Zustände einfach abjehaun sind? Ick denke, zwee oda drei Jahre is det her. Und wo denkste, sind die Gören hin? Die hatten ja nüscht, ooch keen Respekt vor janüscht. Ick gloobe ja, ’n paar von denen ham die Jelegenheit für ’n Übergangsquartier gewittert und sind jetzt in unsere Wohnungen. Uns werfen se raus, und jegen die tun se nüscht. ’ne Demo ausrufen solltn wa! Wie die jungen Leute heutzutage. Die da oben mal uffrütteln.»
Die Stimme der Frau, die Margret hieß, stieg noch um eine halbe Oktave und schallte jetzt weithin durch die Hebbelstraße. «Hört ihr det, Leute? Auflehn müssen wa uns!» Dann wurde sie wieder etwas leiser. «Haste det jelesen, wat heute im Tagesspiegel stand über die Räumungen der Häuser inner Zillestraße, Inge? Stehn ja nun ooch leer. Offiziell jedenfalls. Rita hat jesagt, sie jeht heimlich wieder rin. Trau ick der zu. Hoffentlich passiert nüscht, wenn der da drüben im Kran uff die andere Straßenseite in der Nähe von dem Steinhaufen gleich die Abrissbirne schwingt. ’n Trauerspiel is det.»
Peter musste den Damen im Stillen recht geben. Insgesamt waren im «nassen Dreieck» bis zum heutigen Tag 436 Wohnungen, neunzehn Läden, zwei Gaststätten und ein Kino geräumt worden, wie der Leiter des Charlottenburger Bauaufsichtsamtes, Baudirektor Horst Georg Lüders, unlängst erklärt hatte. Hinter diesen Zahlen verbargen sich Geschichten von Verlust, Entwurzelung und Trauer.
Und das mit den überteuerten neuen Wohnungen stimmte ebenfalls. Der Charlottenburger Baustadtrat Hans-Jürgen Bultmann hatte unter Hinweis auf Mängel in den Wohnungen an die Vermieter appelliert, die zum 1. Januar zulässige fünfzehnprozentige Mieterhöhung nicht vorzunehmen. Doch kaum einer hatte sich daran gehalten. Und viele der Ersatzwohnungen waren tatsächlich Bruchbuden.
Im Moment bereitete Peter aber eine andere Sache Sorgen. Hatte er richtig gehört? War da noch jemand in den Wohnungen, die eigentlich leer stehen sollten? Wenn stimmte, was die beiden Frauen behaupteten, dann mussten sich dort nach der Räumung illegal Menschen eingenistet haben. An entlaufene Zöglinge aus Berliner Erziehungsheimen glaubte er aber weniger. Er hielt es für wahrscheinlicher, dass die Hausbesetzer, sollte es sie tatsächlich geben, aus der linken Szene stammten. Vielleicht gehörten sie den «umherschweifenden Haschrebellen» an. Einige von denen kannte Peter sogar, allerdings nicht von einem gemeinsamen Drogenrausch, sondern nur vom Sehen. Neuerdings machten sie wieder von sich reden. Sie sollten sich mit Mitgliedern anarchokommunistischer Zellen in der «Bewegung 2. Juni» zusammengefunden haben. Benannt worden war die neue Gruppe nach dem Todesdatum von Benno Ohnesorg.
Peter atmete tief durch. Hoffentlich fanden sie in den Abrisshäusern keine gewaltbereiten Aufwiegler. Dann könnte die Lage brenzlig werden. Wie auch immer, sie mussten schnellstens kontrollieren, ob sich noch Menschen in den Häusern befanden. Und das, bevor der Kranführer mit seiner Abrissbirne loslegte.
Unwillkürlich wanderten Peters Gedanken erneut zurück in seine linke Vergangenheit. Die erschien ihm manchmal wie ein anderes Leben. Er hatte die Seiten gewechselt, redete jetzt auf Demonstranten und Unzufriedene ein. Er war einer der Psychobullen, oft belächelt, aber irgendwie doch akzeptiert. Bei den Laberbullen sah Peter die Chance, sein psychologisches Wissen für die Stärkung des sozialen Friedens einzusetzen. Die Anwendung von Gewalt zur Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse widersprach seinen Überzeugungen zutiefst. Ja, der Untertanengeist hatte verheerende Folgen gehabt. Trotzdem glaubte Peter daran, dass es zuallererst guter Bildung bedurfte, um Kinder zu jenen mündigen Bürgern zu erziehen, für die Jürgen Habermas in der Nachfolge von Max Horkheimer und der Frankfurter Schule eintrat. Und neben der Soziologie spielte nach Peters Meinung die Psychologie dabei eine wichtige Rolle.
Der erste Chef der Laberbullen war Werner Textor gewesen – inzwischen eine Legende bei den Kollegen. Der Polizeioberkommissar mit der Dienstnummer 79 444 war ein kräftiger Mann mit ausgeprägten Gesichtszügen, der die Menschen in seinen Bann zog. Statt mit Gewalt nach Lösungen zu suchen, nutzte Textor seinen Wortwitz, die trainierte Stimme und ab und an sogar einen Zaubertrick, um zu deeskalieren. Er war zudem keiner, der katzbuckelte.
Der jetzige Chef des Diskussionskommandos, Oberkommissar Andreas Wagner, war ein anderes Kaliber, im Herzen war er ein Sozialarbeiter. Wagner schickte seine Leute schon mal mit Verpflegungsrationen zu den Hippies und Haschrauchern auf den Stufen der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche. So war er bei den fliegenden Händlern, den Gedächtniskirchen-Gammlern und den Selbsthilfeorganisationen ehemaliger Rauschgiftsüchtiger bestens als «Andi» bekannt. Aber auch an den anderen größeren Unruheherden wie dem Grunewaldsee oder dem Wannsee tauchten auf seinen Befehl hin die Psychobullen auf.
Inzwischen hatten Peter und Wolle die beiden Frauen erreicht, die gerade die Straße überquerten.
«Bomben sollte man legen! Bomben! Und den Kerl sollte man von seinem Kran holen», keifte die Frau namens Margret.
«Aber meine Damen, Bomben, Gewalt – det meenen Sie doch sicherlich nich so. Und der arme Kranführer kann auch nüscht dafür. Da finden sich bestimmt andere Möglichkeiten. Vielleicht kann ick ja helfen. Gestatten, Wolfgang Kaufmann, Schutzpolizei.»
«Erst einmal sollten wir von der Straße gehen, sonst passiert hier wirklich noch etwas», mischte sich Peter ein. Kurzerhand nahm er die beiden Frauen am Arm und führte sie auf den gegenüberliegenden Bürgersteig. Gleich darauf schrien die Damen erschreckt auf. Kein Wunder, die Erde bebte, als die Abrissbirne gegen eine nicht allzu weit entfernte Mauer krachte.
Margret schüttelte seinen Arm ab. «Da sehn Se, wat die mit unsere Wohnungen machen tun!»
Plötzlich brüllte eine männliche Stimme: «Gehen Sie sofort da weg! Hallo, Sie, gehen Sie da weg! Sehen Sie denn nicht, dass hier ein Haus abgerissen wird?»
Als Peter niemanden entdecken konnte, schaute er nach oben und begriff, dass die Stimme dem Führer des Krans gehörte, an dem die Abrissbirne inzwischen unruhig hin- und herschwang. Der Mann gestikulierte wild und wies immer wieder mit dem Arm nach unten, auf einen Haufen Steine, der sich etwa zehn Meter von ihnen entfernt direkt unter der Abrissbirne befand. Als Peter verstand, was der Kranführer meinte, bekam er einen Riesenschreck und spurtete zum Schutthaufen. Dort kniete ein junges Mädchen auf dem Boden und wühlte ungerührt im Schutt. Was um sie herum geschah, schien sie nicht zu stören. Auch um das Geschrei des Kranführers kümmerte sie sich nicht. Doch wo kam sie so plötzlich her? Vermutlich hatte er sie nicht bemerkt, weil er so stark in seine Gedanken vertieft gewesen war.
Wieder brüllte der Kranführer. Peter war bei der jungen Frau angelangt und fasste sie bei der Schulter. «Sind Sie wahnsinnig geworden? Was tun Sie hier? Sie müssen sofort weg von hier. Stehen Sie auf! Wenn Sie nicht aufpassen, werden Sie noch von der Abrissbirne oder von herumfliegenden Steinen getroffen.»
Große grüne Augen sahen zu ihm auf. «Ich suche die Vergangenheit», sagte sie sanft. «Die, in der noch alles besser war. Die muss hier irgendwo vergraben sein. Vielleicht kommt sie jetzt wieder heraus, weil die Häuser abgerissen werden. Dann werd ich sie zu meinen Freunden bringen.» Das Mädchen kicherte.
Peter hätte beinahe mitgelacht, so ansteckend war ihr Kichern. Dann registrierte er die geweiteten Pupillen, die unreine Gesichtshaut. Das Mädchen war so mager wie eine streunende Katze. Offenbar eine Fixerin. Verwahrlost schien sie aber nicht.
«Kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause. Sie können hier nicht bleiben!»
Sie runzelte die Stirn. «Ich geh nicht hier weg. Ich hab schon einen Zipfel der Vergangenheit gesehen. Da, schau!»
Der Kranführer schimpfte erneut lauthals. Schließlich schüttelte er den Kopf.
Peter versuchte das Mädchen wegzuzerren, doch sie war erstaunlich stark, stärker, als er vermutet hatte.
«Ich geh hier nicht weg. Erst müssen wir die Vergangenheit herausholen, sonst erstickt sie. Da, schau!»
Peter begriff, dass er keine Wahl hatte, wenn er nicht Gewalt anwenden wollte. «Da ist nichts.» Er trat an den Steinhaufen, in dem sie gewühlt hatte.
«Sehen Sie, da ist …»
Er erstarrte. Doch, da war etwas. Zwischen den Steinen schimmerte etwas Hautfarbenes. «Hören Sie sofort auf, da liegt ein Mensch vergraben!», rief er dem Kranführer zu. «Wolle, komm her! Hilf mir!»
Der Kranführer schien verstanden zu haben, denn er begann, von seinem Kran herunterzuklettern.
Peter räumte mit fliegenden Händen Steine zur Seite und dankte dem Himmel für die Trockenheit in den letzten Wochen, im März hatte es kaum geregnet. Bald bedeckte ihn Staub, und er musste husten. Das Mädchen war inzwischen von alleine aufgestanden und schaute ihm zu.
Zwei Minuten später wühlte auch der Kranfahrer neben Peter Kappe und Wolle Kaufmann im Schutt. Doch schnell wurde klar: Sie kamen zu spät. Der Mann unter den Steinen war tot.
«Haste det gesehen? Das …» Inge schwand die Stimme.
Der Kranführer war kreidebleich. «Ich hab das Mädchen vorhin nicht gesehen. Die muss gekommen sein, während ich auf den Kran gestiegen bin … Wirklich, ich hab sie jetzt erst entdeckt.» Der Mann wimmerte fast.
«Ganz ruhig. Das wird sich alles klären. Ich werde das Mädchen jetzt nach Hause bringen. Bleiben Sie bitte hier, bis die Kollegen kommen», antwortete Peter ihm.
Der Kranführer nickte.
«Wie heißen Sie?»
«Gieseke, Paul Gieseke.»
«Ich verlasse mich auf Sie. Mein Kollege wird Ihre Personalien aufnehmen.» Peter sah zu Wolle. «Ich suche ein Telefon, sage den Kollegen Bescheid, und dann bringe ich das Mädchen erst einmal nach Hause. Sie sieht aus, als stünde sie unter Drogen. In diesem Zustand kann sie nicht vernommen werden.» Er wandte sich an die junge Frau. «Wo wohnen Sie?» Er rechnete eigentlich nicht mit einer klaren Antwort.
«Wir können zum Richter gehen. Grätz. Der beschäftigt sich oft mit der Vergangenheit. Da putzt meine Mutter heute», sagte sie voller Stolz, als müsse jedermann wissen, wer der Richter war. «Das ist nicht weit. In Charlottenburg.»
«Gibt es da ein Telefon?», fragte Peter.
«Natürlich», sagte sie und kicherte ein weiteres Mal.
«Dann mal los.» Peter Kappe packte die junge Frau zur Sicherheit am Arm, und beide machten sich auf den Weg.
KAPITEL ZWEI
in dem Otto Kappe die Ermittlungen aufnimmt
ETWA EINE STUNDE SPÄTER stand Kriminaloberkommissar Otto Kappe neben Steinhaufen und Leiche und machte sich Sorgen. Ihn beschäftigte aber nicht die Frage, wie der Tote in den Charlottenburger Schutt gekommen war, das würde er schon noch klären. Er machte sich Gedanken über seinen Leibesumfang. Einst hatte Kappe die Figur eines Mittelstreckenläufers gehabt, doch die war längst der eines gemütlichen, ziemlich molligen Bären gewichen. Es wurde für ihn zunehmend schwieriger sich zu bücken, zum Beispiel beim Schnürsenkelbinden. Deswegen suchte er sich in letzter Zeit unauffällig einen Ort, an dem er sich setzen konnte, wenn er seine Schuhe anzog. Seine Frau Gertrud pflegte in solchen Fällen regelmäßig und ziemlich spitz anzumerken: «Otto, du musst etwas für deine Figur tun, mach Sport!» Ebenso regelmäßig erwiderte er dann: «Mach ich doch.» Und stets lautete ihre Antwort: «Kegeln und Fußballgucken reicht nicht.»
Gertrud … Otto Kappe musste zugeben, dass sich seine Frau gut gehalten hatte. Sie war immer noch schlank und sah aus wie aus dem Ei gepellt. Sie arbeitete als Kontokorrentbuchhalterin bei Sarotti in Tempelhof und hatte seit einigen Jahren Prokura. Soweit er wusste, war sie eine bei den Kollegen beliebte und bei den Chefs geschätzte Mitarbeiterin. Solch einen Spagat musste man erst einmal hinbekommen. Nur der etwas verkniffene Zug um den Mund passte nicht zu ihrer äußerlichen Perfektion. Es war nicht immer alles rundgelaufen in ihrer Ehe, und die Krisen hatten ihre Spuren hinterlassen. Aber auch nach dem letzten großen Streit waren sich Gertrud und er einander wieder nähergekommen. Für seine Ehe galt, was auch andere Beziehungen bestimmte: Die Liebe und das gegenseitige Vertrauen waren zerbrechlich und konnten schnell verloren gehen. Eines wusste Kappe jedoch: Gertrud war ebenso bereit wie er, am Erhalt ihrer Partnerschaft zu arbeiten. Und ebenso wenig wie er war sie jemand, der schnell davonlief. Auch wenn es heutzutage in Mode gekommen zu sein schien, sich scheiden zu lassen. Ein Eheversprechen war ein Eheversprechen. Und es war heilig. Da waren sich Gertrud und er einig, nicht nur weil sie einen gemeinsamen Sohn hatten.
Peter hatte immer schon ein engeres Verhältnis zu seiner Mutter gehabt als zu ihm. Vielleicht war das normal. Glücklicherweise gab es nun Sarah und Tabbi, den kleinen Sonnenschein. Kappe lächelte, als er an seine Enkelin dachte. Anfangs hatte er Sarah, der studierten Medizinerin aus der DDR mit den jüdischen Wurzeln, eher skeptisch gegenübergestanden. Peter hatte sie bei einem Urlaub am Balaton kennengelernt und ihr dann zur Flucht nach West-Berlin verholfen. Inzwischen mochte Otto Kappe die Frau, die so unversehens zu seiner Schwiegertochter geworden war – nämlich als klar geworden war, dass sie ein Kind von Peter erwartete.
Sarah verstand sich gut mit Gertrud und tat alles, um Vater und Sohn einander näherzubringen. Das rechnete Otto Kappe ihr hoch an. Außerdem war sie klug genug, um das nicht allzu direkt zu versuchen. Offenbar hatte sie in ihrem früheren Leben Erfahrungen mit Sturköpfen gesammelt. Vielleicht hatte es davon auch welche in ihrer Familie gegeben. Sarah vermisste ihre Mutter und hatte immer wieder versucht, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Doch die wollte mit ihr, der Republikflüchtigen, nichts mehr zu tun haben. Auch nicht, nachdem die kleine Tabbi geboren worden war.
Otto Kappe stand also im nassen Dreieck und schickte sich an, sich zu dem Toten im Schutt hinunterzubeugen. Dabei schnaufte er unwillkürlich. Das Bücken fiel ihm wegen seiner Leibesfülle immer schwerer. Wie ein Walross, dachte er. Vielleicht hatte Gertrud doch recht, er musste mehr für seine Linie tun. Diese ganze neumodische Diäterei widerstrebte ihm allerdings zutiefst.
Die drei Männer von der Kriminaltechnik hatten den Toten im Schutt bereits zum großen Teil freigelegt. Kappe nickte ihnen zu und ging in die Knie, um die Leiche aus der Nähe zu betrachten.
Der Kollege von der KT, der neben ihm stand, wich zur Seite. Kappe kannte ihn nicht, er musste neu sein.
«Passen Sie auf!», bekam er zu hören.
«Wo ist denn Wuttke?», muffelte Kappe zurück.
«Was weiß denn ich! Mal wieder im Urlaub, glaub ich.»
«Na Meester, da kiekste, wa?», sagte da eine bekannte Männerstimme.
Kappe schaute hoch und grinste verhalten. Der Kollege Hans-Gert Galgenberg war eingetroffen. Er gehörte seit einigen Jahren dem Verein zur Erhaltung der Berliner Mundart an und verwendete, wenn immer es angemessen schien, Berliner Jargon. Galgenberg war vor kurzer Zeit zum Kriminalkommissar befördert worden. Kriminalrat Friedhelm Keunitz, ihrer beider Chef, hatte Druck gemacht und erklärt, Galgenberg sei aufgrund seiner unbestreitbaren Verdienste endlich «an der Reihe». Kappe war schon lange dieser Meinung gewesen. Der Rangunterschied zwischen ihnen hatte ohnehin nie eine Rolle gespielt. Sie waren längst mehr als Kollegen. Sie waren Freunde.
Wie immer zweckmäßig gekleidet und auf alles vorbereitet, stand Galgenberg neben ihm, in seiner inzwischen jahrzehntealten graugrünen Jacke, Nietenhosen und einer Art halbhoher Cowboystiefel. Hinter der randlosen Brille, die wie festgetackert auf dem freundlichen Mondgesicht saß, zwinkerte sein linkes Auge Kappe zu. Der Kollege liebte diese Brille und weigerte sich standhaft, eine neue anzuschaffen. Auch seine Frau Sabine konnte ihn nicht davon überzeugen, sich eine neue Sehhilfe zuzulegen.
Zur Überraschung aller hatte Galgenberg vor einigen Jahren geheiratet. Denn eigentlich hatte ihn jeder für den typischen ewigen Junggesellen gehalten. Seine Frau Sabine war Buchhändlerin und liebte Fontane. Kappe mochte sie. Gertrud konnte sie nicht leiden. Frauen! Was sollte man da machen? Frauen hatten es eben nicht so mit der Logik.
Die Galgenbergs lebten nun schon eine Weile in Steinstücken, der kaum einen Kilometer langen und dreihundert Meter breiten, zum Zehlendorfer Ortsteil Wannsee gehörenden Exklave mitten in der DDR. Um zur Arbeit zu kommen, musste Galgenberg einen DDR-Grenzposten passieren, weshalb er ab und an zu spät zum Dienst erschien. Vor etwa zwei Jahren hatte er sogar einmal einen Republikflüchtling in seinem Holzschuppen entdeckt. Da war es noch später geworden mit dem Dienstantritt.
«Was machst du hier überhaupt?», fragte Kappe.
«Keunitz hat mich geschickt.» Immer wenn Galgenberg ernst oder amtlich wurde, sprach er fast astreines Hochdeutsch. Hin und wieder aber auch aus Gründen, die Kappe nicht genau nachzuvollziehen vermochte.