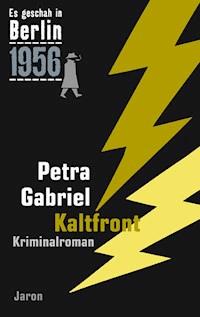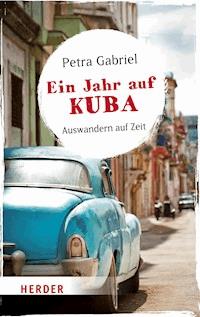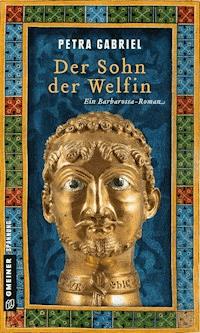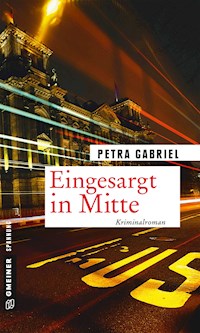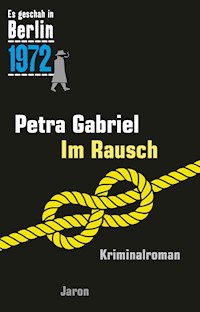Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Konstanz 1414. Auf der Flucht vor einem Kinderfänger gelangt Ennlin mit ihrem kleinen Bruder nach Konstanz. Könige, Fürsten und Gelehrte aus aller Herren Länder wollen dort beim großen Konzil die Kirche reformieren. Ennlin findet Freunde und begegnet einem Mann, der sie tief beeindruckt - Jan Hus, der Ketzer aus Böhmen. Fassungslos erlebt sie mit, wie er zum Spielball von Intrigen wird. Und auch Ennlin gerät in die Mühlen der Mächtigen und muss um Leib und Leben fürchten …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Petra Gabriel
Der Ketzer und das Mädchen
Ein Roman zum Konstanzer Konzil
Impressum
Gefördert durch einen Zuschuss der Stadt Konstanz.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © msdnv - Fotolia.com sowie http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Follower_of_the_Boucicaut_Master_(French,_active_about_1390_-_1430)_-_The_Annunciation_-_Google_Art_Project.jpg
ISBN978-3-8392-4282-7
Widmung
Für Elke und Imke, mit denen ich gern Geschichten mache
Kapitel eins: Der Gelbe Hans
Bis zum erstenHahnenschrei konnte es nicht mehr lang dauern. Ennlin war vollständig angezogen. Aus Furcht, zu verschlafen, hatte sie die ganze Nacht kein Auge zugetan. Sie fuhr unter der Decke mit den Händen über ihren Körper, als könne sie die Erinnerung an die tastenden Finger der Hexe damit abstreifen.
Der Mann wurde der Gelbe Hans genannt. Ennlin vermutete, dass seine Hautfarbe der Grund dafür war. Das Gelb war sogar bis ins Weiß seiner Augen gekrochen. Der löchrige schwarze Mantel schlackerte ihm um den dürren Leib. Er sah aus wie eine Vogelscheuche. Eklig. Ebenso abstoßend wie die alte Vettel in ihrem speckigen Gewand, die ihm auf Schritt und Tritt hinterher wuselte, gebeugt und in sich verknotet wie eine der Alraunenwurzeln, von denen die Frauen sagten, sie wüchsen am besten unter einem Galgen. Aus einer Warze an ihrem Kinn sprossen borstige Haare, die giftigen kleinen Augen unter den dicken Brauen waren meist zusammengekniffen. Sie war bestimmt eine Hexe. Bei jedem Wort des Mannes hatte sie heftig genickt, den zahnlosen Mund zu einem Grinsen verzogen. Fast immer tropfte ihr dabei ein Speichelfaden aus dem Mundwinkel.
Der Gelbe Hans reiste mit der Hexe durch den Hegau und kaufte den Armen ihre Kinder ab. Manche verschwanden auch einfach, nachdem das Pärchen durch ihr Dorf gezogen war.
Und nun suchte er in Glashütten und Heudorf nach Kindern, die er mitnehmen konnte. Heimlich, hinter dem Rücken des Grafen von Nellenburg.
Gestern war er in ihrem Weiler angekommen. Selbst vor einem Wallfahrtsort wie Rorgenwies machte er nicht Halt. Er ging immer zu den bitterarmen Familien, die ihre Kinder verkaufen mussten, weil sie nicht mehr alle Mäuler stopfen konnten. Der Verwalter des Herrn steckte mit dem Gelben Hans unter einer Decke. Er bekam sein Teil vom Handel ab. Er meldete die verschwundenen Kinder der Eigenleute des Grafen einfach als tot. Viele Kinder starben schon vor ihrem fünften Lebensjahr. Der Herr von Nellenburg würde keinen Verdacht schöpfen, er kannte nicht alle Leute persönlich, die zu seinem Besitz gehörten. Dafür hatte er ja den Verwalter.
»Stell dich nicht so an«, hatte der Gelbe Hans sie angezischt und ihr den sauer-schalen Geruch eines gewohnheitsmäßigen Zechers ins Gesicht geblasen. Er stank widerlich nach Urin und altem Schweiß. Ennlin hatte den Würgreiz gerade noch so unterdrückt. »Ich kaufe doch nicht die Katze im Sack«, hatte er noch gemurmelt, begleitet von einem weiteren Schwall seines fauligen Atems. »Mach sofort den Mund auf. Wenn du nicht gefügig bist, nehme ich nur deinen Bruder.«
Das hatte sie nicht zulassen können. Jakob ganz allein bei diesen Leuten! Bei diesem Gedanken drehte es Ennlin erneut den Magen um.
Auf ein Zeichen des Mannes hin hatte die Vettel sie plötzlich auf das Lager geworfen, das sie mit ihren Geschwistern teilte. Und ehe sie es sich versah, obwohl sie strampelte und sich dagegen gewehrt hatte, war sie ihr mit den gichtigen Klauen unter den Rock gefahren und hatte an Stellen herumgefingert, die Ennlin noch nicht einmal zu benennen wusste. Weil man nicht darüber sprach. Der Vater hatte mit unglücklichen Augen zugesehen und die Alte gewähren lassen. Als die Hexe wieder von ihr abließ, hatte sie zufrieden gekichert, etwas von »noch ganz« gemurmelt.
Wenn doch nur die Mutter noch gelebt hätte! Dann wäre alles anders. Die Mutter hätte sie beschützt.
Jakob murmelte etwas im Schlaf. Das tat er oft. Ennlin rüttelte sanft an seiner Schulter. »Jakob, wach auf«, raunte sie. »Wir müssen fort.«
Der Fünfjährige drehte sich auf die andere Seite.
»Jakob, bitte, du musst aufwachen!«
Er drehte sich zurück.
»Scht, Jakob!«
Ennlin hatte kurz Angst, der Zischlaut könnte auch Nele, Feigel und Gudrun aufgeweckt haben, doch sie rührten sich nicht. Die Kleinen lagen dicht aneinander geschmiegt auf dem Lager aus Strohsäcken unter einem gemeinsamen, aus alten Kleidern zusammengenähten Flickenteppich. Ennlin als Älteste hatte ihre eigene Decke. Sie dachte kurz darüber nach, ob sie sie mitnehmen sollte, entschied sich aber dagegen. Zu viel zu tragen, das behinderte sie bei der Flucht. Und sie mussten schnell sein. Ein Blick zur Bettstatt des Vaters und der Stiefmutter zeigte ihr, dass auch sie tief schliefen.
Der Vater hatte seine neue Frau bald nach dem Tod der Mutter im Kindbett ins Haus geholt. Er war mit dem schreienden Neugeborenen nicht zurechtgekommen. Und die Neue, kaum älter als sie selbst, hatte Jakob tatsächlich durchgebracht. Das war nicht selbstverständlich. Doch für Ennlin würde sie immer die Fremde bleiben. Sie war nicht böse. Nur ausgelaugt. Ihre Kraft reichte gerade so für die Feldarbeit und die eigene, inzwischen dreiköpfige Brut.
Der Bruder rührte sich. »Jakob, wach auf!«, flüsterte sie ihm erneut ins Ohr.
Der Junge rieb sich die Augen. »Was isn? Lass mich schlafen!« Sein borstiges dunkelblondes Haar stand in alle Himmelsrichtungen ab. Er hatte den widerspenstigen Schopf des Vaters. Und dessen blaue Augen.
»Jakob, wir müssen fort. Sofort. Denk an den Gelben Hans, er kommt uns nach Sonnenaufgang holen.«
»Wo isser? Isser da? Wo, wo isser? Ennlin, ich hab Angst.«
»Psst Jakob.« Sie streichelte den Bruder sanft. Was für ein Dreikäsehoch er doch noch war. Trotz seiner fünf Jahre. Jakob war anders als andere Kinder. Er war ein Träumer, immer mit den Gedanken in einer anderen Welt. Sie musste ihn an Mutters statt beschützen. Sie würde ihn beschützen. »Komm, sei leise. Sonst wecken wir die anderen.« Ennlin stand auf.
Jakob krabbelte folgsam hinterher. »Holt er die anderen denn nich?«
»Nein, die anderen sind noch zu klein. Die holt er nicht. Die können ja noch nichts.«
Jakob nickte.
Das Mondlicht schien in die Hütte, als Ennlin langsam die Holztür öffnete, damit sie auch ja nicht knarrte, und fiel auf die Gesichter der Erwachsenen. Diese rührten sich noch immer nicht. Sie waren völlig erschöpft von der Landarbeit – wie sie selbst auch. Ehe sie sich um das ihnen überlassene winzige Stück Land kümmern konnten, mussten sie alle auf den Äckern und Wiesen des Grafen buckeln, auch die Kleinsten, sobald sie nicht mehr an der Brust der Mutter hingen, sondern selbstständig laufen konnten. Der Verwalter des Grafen Eberhard von Nellenburg trieb sie gnadenlos an. Der Nellenburger war der Herr über sie alle, er konnte mit seinen Eigenleuten machen, was er wollte. Sie schlagen, sie verkaufen, egal. Aber meist war er gerecht. Nur der Verwalter war böse. Er hatte Vergnügen daran, die Leute zu schinden. Jeder wusste, dass er den Grafen betrog, immer mal wieder Korn, ein Huhn oder ein gutes Stück Fleisch für sich abzweigte. Doch keiner sagte etwas aus Furcht, er könne Rache nehmen.
Draußen atmete Ennlin erleichtert auf. Der Anfang war geschafft.
»Linnie, wohin gehen wir? Wir ham doch nix zu essen.«
»Mach dir keine Sorgen Jakob, ich hab’ schon was eingepackt. Gestern, ganz heimlich. Da hinten unter dem Hollerbusch liegen zwei Bündel mit deinen und meinen Sachen. Da ist auch Brot drin und der Wasserschlauch. Auf dem Weg gibt es einen alten Brunnen, da können wir ihn füllen. Meinst du, du kannst deine Sachen tragen?«
»Ich bin doch kein Hosenpisser mehr. Ich bin schon stark.« Er reckte ihr seinen Arm entgegen. »Da, fass mal an. Ich hab’ gestern auf dem Reutehof ganz allein die Ochsen vom Grafen versorgt.«
Ennlin musste lachen. »Nein, bist kein Hosenpisser mehr, sondern ein tapferer Junge. Aber jetzt komm. Wir müssen weit weg sein, ehe es hell wird.«
»Sonst finden uns der böse Mann und seine Frau und tun uns weh«, flüsterte Jakob.
»Ja, sonst finden sie uns«, erwiderte Ennlin sanft.
»Aber wo geh’n wir denn hin?«
»Ich denk mir so, erst mal auf die Tudoburg. Da können wir uns verstecken.«
Hennslin von Heudorf hatte ihr vor Jahren schon von der Burg erzählt. Ennlin dachte kurz daran, wie er sie neulich in die Büsche gezogen hatte, als er mit seinem Onkel, dem Herrn Hans und dessen Sohn Wilhelm ins Dorf gesprengt kam. Hennslin hatte sie bedrängt, von ihr gefordert, sich mit ihm an der Burg zu treffen. Sonst werde er beim Verwalter dafür sorgen, dass es dem Vater schlecht erging. Oben auf der Tudoburg hatte er ihr dann feuchte Küsse auf den Mund geschmatzt, ihr ein schönes Gewand versprochen und geschworen, er werde sie nach Konstanz bringen. Dort würden derzeit fleißige Dienstmägde gesucht. Denn es sollte eine große Versammlung mit vielen wichtigen Leuten geben: Priestern, Bischöfen, Kardinälen und vielen weltlichen Herren von Stand wie Grafen und Herzögen. Dabei gehe es auch um so große Dinge wie den künftigen Papst.
Dann hatte er versucht, ihr an die Brust zu fassen.
Sie hatte sich nach Leibeskräften gewehrt, hörte seine Worte noch immer: »Wirst schon sehen, was du davon hast. Dich krieg ich noch.«
Das würde sie zu verhindern wissen. Hennslin war nicht der Schlaueste und außerdem dick und plump in seinen Bewegungen. Trotzdem bildete er sich etwas auf seine Herkunft ein. Er dachte wie die anderen jungen Herren, die glaubten, sie könnten sich jedes Bauernmädchen nehmen, das sie zu fassen bekamen. Doch Ennlin von Rorgenwies würde er nicht kriegen. Sie konnte viel schneller rennen als er.
Ennlin wusste sowieso nicht so recht, was die Leute am Küssen fanden. Nun, sie würde schon noch herausfinden, was es damit auf sich hatte. Und mit dem, über das die Leute nur hinter vorgehaltener Hand sprachen. Dabei taten es die Tiere doch auch. Sie hatte es oft genug gesehen. Ob alle dabei so seltsame Geräusche machten wie der Vater und die Stiefmutter?
»Linnie! Nich auf die Tudoburg! Da geh ich nich hin! Da sind Geister!«, unterbrach Jakob ihre Gedanken.
»Psst, willst wohl, dass alle Welt uns hört?« Sie zerrte ihn hinter sich her.
»Linnie! Da oben ist der Blutacker, da haben sie die ganzen Leute umgebracht, die in dem Dorf da wohnten. Die heißen – ich weiß nicht mehr …«
»Juden, Jakob. Sie heißen Juden. Das ist ganz lang her. Auf dem Hardberg sind keine mehr.«
»Sind sie wohl! Die Leute sagen, die Toten finden keine Ruhe. Es wurden schon Lichter da oben gesehen. Und das Wiibli, das die Kinder holt, soll dort umgehen. Raubritter gibt es da außerdem. Wenn es Nacht wird, preschen sie mit ihren Geisterpferden über die Burgmatte und hauen und stechen aufeinander ein, als wären sie nicht schon tot«, flüsterte er.
»Jakob, sei nicht dumm. Da oben sind keine Geister. In der Geistermühle in Glashütten, in der Vater manchmal aushelfen muss, sind auch keine Geister, obwohl sie so heißt. Und auf der Burg ebenfalls nicht. Ich weiß das, ich war da schon mal. Da ist niemand, nur der Wind streicht durch die Bäume.«
»Du warst da schon mal?« Er schaute sie mit großen Augen an. »War das immer dann, wenn du wieder verschwunden bist? Du musst Geister gesehen haben, kannst es mir ruhig sagen. Wieso warst du da?«
»Später. Komm jetzt, wir müssen fort. Bald geht die Sonne auf und es wird Tag. Auf der Burg spielen wir Burgherr und Burgfräulein.«
»Und ich bin ein Ritter?«
Trotz ihrer inneren Anspannung musste Ennlin erneut lachen. »Dann bist du ein Ritter.«
»Ich hab aber mein Holzschwert liegenlassen, dann geh ich noch mal zurück!«
»Jakob, nein! Wir machen dir ein neues, ein viel schöneres! Jetzt komm endlich, trödle nicht so.«
Ennlin sog die klare Nachtluft ein. Nicht mehr lang, und der Herbst würde in den Winter übergehen. Sie konnte die Kälte schon riechen. Dann fasste sie ihren kleinen Bruder fest bei der Hand.
»Au, du tust mir weh«, nörgelte der.
Ennlin streichelte ihm über den Kopf. Jakob schüttelte die Hand ab. Sie nahm es ihm nicht übel. Er wollte erwachsen wirken und stark. Sie und er – von jetzt an hatten sie nur noch einander.
Mit Schaudern dachte sie daran, was sich die Leute hinter vorgehaltener Hand von den Kindern erzählten, die dem Gelben Hans und seiner Frau in die Hände gefallen waren: Die kleinen Jungen wurden verstümmelt. Und dann schickte der Gelbe Hans die Kinder zum Betteln. Je schrecklicher ein Kind aussah, je Mitleid erregender es wirkte, desto lieber gaben die Leute. Denn dann hatten sie das Gefühl, etwas besonders Gutes getan zu haben. Die Mädchen wurden verkauft. Meist an Hurenhäuser. Oder an einen Herrn, der eine Dienstmagd suchte. Das beinhaltete oft auch gewisse Dienste für die männlichen Mitglieder eines Haushalts.
Es war eine schlimme Zeit. Das sagte auch der Pfarrer der Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau. Er wetterte gegen die Ketzer und drohte bei der Sonntagspredigt mit der Hölle und ewigen Qualen im Fegefeuer. Die Leute hatten bei diesem Sermon immer furchtsam zur Madonna geschielt. Sie konnte Wunder bewirken. Die Madonna war mächtig. So ein feines Gnadenbild, das sogar schon Lahme geheilt hatte, gab es nirgendwo sonst in der Umgebung. Höchstens noch im großen Münster zu Konstanz. Es gab auch jedes Jahr eine Wallfahrt. Seit sie hier wundertätiges Wasser gefunden hatten, das Augen-, Ohren- und Halskrankheiten heilte, kamen immer mehr Pilger zur Jungfrau von Rorgenwies.
Aber auch das Wasser würde Jakob nicht mehr helfen können, wenn er dem Gelben Hans in die Hände fiel.
Sie würden schon irgendwie durchkommen. Die verlassene Burg war für die erste Zeit ein gutes Versteck. Im Wald fanden sich sicher noch einige späte Beeren, die letzten Pilze, Bucheckern. Ein Brunnen war auch in der Nähe. Im kommenden Winter waren sie geschützt, konnten sich ein Feuer machen. Es gab genügend Holz in der Umgebung. Und zugiger als in der Hütte des Vaters war es dort auch nicht. Vielleicht hatten sie Glück und es gelang ihnen, einen Vogel zu fangen, einen Dachs oder einen Hasen. Ennlin wusste, wie man Fallen baute. Das hatte sie dem Vater abgeschaut. Natürlich durften die einfachen Leute nicht jagen. Und auch keine Fallen bauen. Die Jagd war das alleinige Vorrecht der Herren. Doch wenn der Hunger im Magen tobte, zerrte und biss, wenn ein Mann zuschauen musste, wie seine Kinder immer hohlwangiger wurden, dann verblasste die Angst vor der Strafe. Man durfte sich eben nicht erwischen lassen.
Jakob und sie durften sich auch nicht erwischen lassen.
Der Verwalter würde toben, wenn er entdeckte, dass sie weg waren, weil ihm nun sein Gewinn entging. Der Gelbe Hans würde ganz sicher ebenfalls nach ihnen suchen.
Kapitel zwei: Von Räubern und Rittern
Bruder und Schwesterschlugen den Weg nach Honstetten ein. Von dort aus ging es noch ein Stück weiter in Richtung Eckartsbrunn, bis – nicht weit entfernt von einem verwahrlosten Brunnen – ein schmaler Pfad in den dichten Wald abzweigte. An dem Brunnen hatten einst auch die Leute ihr Wasser geschöpft, die hier gelebt hatten. Ennlin füllte die Schweinsblase auf, die ihnen als Wasserschlauch diente.
Sie kamen nur mühsam voran. Obwohl es längst hell geworden war, stolperten sie im Halbdunkel unter den Bäumen über Wurzeln und Unterholz. Manchmal konnten sie den Weg kaum erkennen, er war stellenweise fast völlig überwachsen. Nur wenige Menschen wagten sich hierher, obwohl hier viel trockenes Knüppelholz zu finden war. Sie fürchteten sich vor den Geistern der Burg.
Nach etwa zwei Stunden erreichten sie die Stelle, an der der Pfad über einen Graben hinweg in die lang hingestreckte Vorburg führte. Diese war von einer mächtigen, mit Efeu bewachsenen Ringmauer umgeben.
Die Geschwister passierten halb verfallene Mauerreste und eingestürzte Wände. Ein Teil der Ställe stand noch, die Grundrisse einer Schmiede und eines Backhauses waren zu erkennen. Hier sollten einst die Juden gelebt haben. Während der Pestjahre hatte es Verfolgungen gegeben. Das wusste Ennlin vom Vater. Da hatte man sie alle umgebracht.
Jakobs kleine Hand schob sich in die der Schwester. Ennlin drückte beruhigend. »Musst dich wirklich nicht fürchten. Hier lebt niemand mehr. Der Verwalter der Leute, denen die Burg gehört, und die Dienstboten sind längst fort. Es ist auch nicht mehr weit. Gleich geht’s noch durch eine Schlucht, und dann sind wir auch schon fast bei der eigentlichen Burg. Die steht oben, direkt auf der Kante des Berges. Es ist schön da. Ich kenne eine Stelle, von der aus man ganz weit übers Land schauen kann. Außerdem weiß ich, wie wir in die Burg reinkommen.«
Bald darauf hatten sie ihr Ziel erreicht. Jakob schaute sie entsetzt an, Ennlin zog ihn mit sich. »Bleib jetzt dicht bei mir. Der Regen hat alles aufgeweicht«, befahl sie dem Bruder. »Musst am besten nah an der Mauer gehen, damit du nicht ausrutschst oder stolperst. Hier gibt es immer Mauerstücke oder Abfall, den die Leute früher in den Zwischenraum von Burg und Burgmauer geworfen haben. Man sieht es nur nicht, weil alles so überwachsen ist.«
Auch sie hielt sich eng an die säuberlich behauenen und fensterlos aufgemauerten Steine und vergewisserte sich immer wieder, dass Jakob direkt hinter ihr blieb. Sie wollte zu einer kleinen versteckten Pforte im hinteren Teil der Hauptburg.
Ab und an kamen sie an Öffnungen in der äußeren Ringmauer vorbei. Manchmal waren auch einfach Mauersteine ins Tal gestürzt, tief diesen steilen Felsen hinab, auf dem die Burg stand. Dann hatten sie einen freien Blick über bewaldete Täler. Ennlin fragte sich nicht zum ersten Mal, wie viele Wachleute hier gestanden, in die Weite gespäht und die Gegend nach herannahenden Feinden abgesucht haben mochten, als hier noch Menschen gelebt hatten.
Viel lieber war ihr aber die Vorstellung, dass die Tochter des Burgherrn sich hinter der Burg mit ihrem Liebsten getroffen haben könnte. Immer wieder hatte sie sich in deren Rolle geträumt. Unverzichtbarer Bestandteil dieses Traumes war ein blonder, gut gewachsener Jüngling, ein Ritter in glänzender Rüstung auf einem weißen Pferd und so tapfer, dass alle Welt ihn bewunderte. Der hatte sich ihr zu Füßen geworfen und ihr ewige Liebe geschworen. Doch darüber hinaus gingen ihre Träume nicht. Kein Ritter würde die Tochter eines Unfreien zum Weib nehmen.
Schließlich hatten sie es geschafft. Ennlin atmete erleichtert auf. Die kleine Pforte wollte sich zunächst nicht öffnen lassen. Sie stemmte sich mit aller Macht dagegen. Da gab die Tür knarzend nach, die Geschwister schlüpften hindurch und kamen in einen kleinen düsteren Raum. Ennlin vermutete, dass es die ehemalige Wächterstube war.
»Bleib stehen«, befahl sie ihrem Bruder. Sie tastete sich vor zur nächsten Ecke. Dort lag ein Stapel Holz, das sie bei früheren Besuchen in der Umgebung der Burg gesammelt hatte, daneben trockenes Stroh und Heu. Ennlin schichtete etwas Holz auf, holte sich eine Handvoll von dem Heu, legte es darauf und kramte Feuerstein, Feuereisen und Zunder aus dem kleinen Beutel an ihrem Gürtel. Sie konnte hören, wie Jakob erleichtert aufatmete, als endlich die Flammen aus dem trockenen Gras züngelten und das Feuer die Umgebung erhellte.
Das Zimmer war leer bis auf eine Kiste, in der Ennlin zwei Decken, eine Schale und Becher versteckt hatte. Alles stammte aus der Burg. Die ehemaligen Bewohner mussten hastig aufgebrochen sein, denn sie hatten noch manch Brauchbares zurückgelassen, das jetzt, von Spinnweben und Staub bedeckt, in diesem alten Gemäuer vor sich hindämmerte und den Mäusen als Nest diente.
Im flackernden Schein der Flammen tauchte auch ein Ständer aus dem Dämmerlicht auf. Daran hingen einige getrocknete Sträußchen aus Kräutern, die auf der Burgmatte und im Wald wuchsen und die sie gesammelt hatte.
Ennlin sah sich um. Ja, es war besser, sie blieben vorläufig hier. Hier waren sie sicher, die Spukgeschichten würden ungebetene Besucher fernhalten. Außerdem boten die dicken Mauern vor den Bären Schutz. Und vor den Wölfen, die durch die Wälder streiften und besonders in Winternächten so schauerlich heulten, dass man wirklich glauben konnte, in der alten Burg hausten Geister. Sie hatte aber noch nie einen Spuk erlebt. Hier raschelten nur die Ratten und die Mäuse in ihren Löchern.
Immer, wenn sie traurig gewesen war, wenn sie das Gefühl gehabt hatte, der drängenden Enge der kleinen Hütte des Vaters entfliehen zu müssen, war sie hierher gegangen. Und mehr als einmal war sie für ihr Verschwinden verprügelt worden. Doch das machte ihr nichts aus. In dieser Burg fühlte sie sich inzwischen fast zu Hause.
Sie öffnete ihr Bündel, reichte Jakob einen Kanten Brot. Dann gab sie ihm den Wasserschlauch. Der Junge trank gierig. Ennlin hatte ebenfalls großen Durst. Sie konnten sich später aus dem Brunnen neues Wasser holen, nachts, damit sie nicht entdeckt wurden. Nun mussten sie sich ohnehin erst einmal ausruhen. Nur ein wenig. Später würden sie sich daran machen, weitere Vorräte zu sammeln, damit sie durch den Winter kamen.
Ennlin holte zwei alte Decken aus dem Kasten und legte sie auf den Boden neben dem Feuer. Es prasselte gemütlich. Sie lehnte sich gegen die Wand, Jakob schmiegte sich an sie. Beide dämmerten weg.
Sie schrak hoch, weil Jakob sie schüttelte »Linnie, wach auf! Die Geister sind da!« Der Bruder flüsterte. Doch die Angst, die er fühlte, war trotzdem gut herauszuhören.
Tatsächlich, da waren Stimmen! »Wart hier. Rühr dich nicht von der Stelle«, raunte sie ihm zu.
In der Burg war es dämmrig. Ennlin musste aufpassen, wohin sie trat, um nicht in eines der Löcher auf dem Boden zu geraten und sich womöglich noch den Fuß zu verstauchen. Sie war schon in den Rittersaal eingebogen, als sie begriff, dass es sich um männliche Stimmen handelte. Sie erstarrte. Flammen malten dunkle Schemen an die nackten Wände. Für einen Moment glaubte Ennlin, tatsächlich Geister zu erblicken. Doch beim zweiten Hinschauen erkannte sie, es waren Menschen, denen das flackernde Feuer im Kamin das Aussehen von Dämonen verlieh. Sie hatte Hans von Heudorf gesehen. Und auch den Grafen von Nellenburg.
Sie schaute sich gehetzt um. Sie brauchte ein Versteck! Da, die Fensternische! Zurück zur Tür war es weiter. Sie musste es wagen. Vorsichtig setzte sie einen Fuß vor den anderen. Schließlich hatte sie es geschafft. Doch die Nische war klein und verbarg ihren Körper kaum.
»Das muss aufhören, Ritter Hans. Unsere Bruderschaft vom Sankt Jörgenschild sollte nicht vor allen als eine Vereinigung von Wegelagerern dastehen. Nein, sagt nichts. Ich weiß, dass nicht nur der Herr von Hewen in seiner ehemaligen Burg die Beute aus Raubzügen versteckt«, sagte da der Graf.
»Ihr müsst gerade reden«, gab Hans von Heudorf zurück. Wer hat denn immer wieder Wegezoll von den Handelsleuten verlangt, die in die Stadt strömen?«
»Und wer hat den König überzeugt und das Konzil nach Konstanz gebracht?«, fuhr Eberhard von Nellenburg auf. »Ihr zieht schließlich auch Euren Vorteil daraus.«
»Tut nicht so selbstlos. Ihr spechtet wohl auf die Landgrafschaft im Hegau und Madach«, spottete der Heudorfer. »Eine, von der keiner so recht weiß, wo sie anfängt und wo sie endet. Und das kostet unseren neuen römisch-deutschen König Sigismund nicht viel. Wie ich vernahm, stehen die Nellenburger nun also plötzlich nicht mehr ganz so treu zu Friedrich mit den leeren Taschen, sondern helfen unter der Hand jetzt Sigismund gegen das Haus Habsburg.«
Die braunen Augen des hageren Grafen von Nellenburg sprühten. Seine Schwerthand zuckte. An den mahlenden Kiefern im streng wirkenden Gesicht mit den hohen Wangenknochen war zu erkennen, wie sehr ihn die Bemerkung des Herrn von Heudorf getroffen hatte. »Jetzt ist nicht die Zeit für Sticheleien. Und glaubt ja nicht, dass ich dies aus Feigheit sage, das könnte Euch schlecht bekommen«, herrschte er ihn an und strich sich unwillkürlich über eine lange Narbe auf seiner rechten Wange.
Sie sieht aus, als stamme sie vom Schwertstreich eines Gegners, fand Ennlin.
»Bei einem Hauen und Stechen unter den schwäbischen Rittern verlieren alle«, fügte der Graf sodann ruhiger hinzu. »Wartet nur, bis der König nach Konstanz kommt. Er ist bekannt dafür, dass er an die denkt, die ihm gut dienen. Wie Ihr sehr wohl wisst, liegt Sigismund viel am Gelingen des Konzils.«
Sie jedenfalls wollte lieber nicht mit dem Schwert Bekanntschaft machen, dachte Ennlin und drückte sich noch weiter in den Schatten der Nische.
Hans von Heudorf, einen Kopf kleiner als der Graf, strich über sein bereits schütter werdendes rotblondes Haar und verzog den Mund zu einem schmallippigen Lächeln. »Das Konzil! Bin gespannt, was daraus wird. Hab ja meine Zweifel, dass wir am Ende nur noch einen Papst haben anstatt drei. Es dürfte Sigismund nicht gefallen haben, dieses Bündnis von Papst Johannes XXIII. mit Eurem früheren Freund Friedrich von Habsburg. Aber Freundschaften und Bündnisse kommen und gehen wie Päpste und Könige, nicht wahr? Und schon so mancher, der einmal als Sieger vom Schlachtfeld ging, hat am Ende den Kampf verloren. Nun, wir stecken alle mit drin. Ich hoffe nur, wir haben mit dem König nicht aufs falsche Pferd gesetzt.«
»Haltet Euch zurück, Heudorfer. Es ist besser, Ihr redet nicht weiter, das könnte Euch noch als Hochverrat ausgelegt werden. Seid friedlich. Wir stehen beide auf derselben Seite. Haben beide das Ohr des Königs. Und nun lasst uns die Angelegenheit besprechen, deretwegen wir hier zusammengekommen sind. Wie können wir diesem Gierhals Jörg vom End Einhalt gebieten? Seine Plünderungen und die Wegelagerei müssen ein Ende haben. Die Schaffhauser haben sich schon wieder über den raffgierigen Junker beschwert. Sie drohen, überhaupt keine Waren mehr nach Konstanz durchzulassen, wenn wir ihm nicht das Handwerk legen. Er hat erneut ein Handelsschiff aufgebracht, das über den See wollte. Soll es am Ende heißen, die schwäbische Ritterschaft des Sankt Jörgenschildes sei nicht in der Lage, die Sicherheit auf dem Land und auf dem Bodensee zu gewährleisten? Wie stehen wir denn dann da? Wo steckt eigentlich der Ritter Heinrich von Hewen? Ich hatte ihn ebenfalls herbeordert. Er muss die Beute aus seinen Raubzügen endlich von hier fortschaffen. Das ist kein sicheres Versteck. Gilt die Order eines Hauptmanns der Ritter des Sankt Jörgenschildes nichts mehr?«
»Wer soll was hier herausschaffen?« Der Ritter, der den Saal betrat, war ein noch junger Mann. Er trug wie die anderen einen Überwurf mit dem Wappen des Ritterbundes über dem Kettenhemd und wirkte angriffslustig. Der letzte Satz schien ihm sauer aufgestoßen zu sein. Ennlin war dankbar dafür. Denn in seiner Erregung verschwendete der Ankömmling keinen Blick auf die Nische.
»Ah, der Herr von Hewen. Endlich. Ihr schaltet und waltet schlecht auf dieser Burg«, empfing ihn der Graf von Nellenburg ungerührt. »Lasst mich offen sprechen. Die Tudoburg ist zu einem rechten Räubernest geworden. Wie soll man uns glauben, dass wir dem Junker vom End das Handwerk legen können, wenn es uns noch nicht einmal gelingt, in unseren eigenen Reihen Ordnung zu halten? Wenigstens bis zum Ende des Konzils. Denkt an den Schutzbund, den wir mit den Konstanzern geschlossen haben. Sie entlohnen uns gut für den Dienst unseres Schwertarmes.«
Heinrich von Hewen lachte dröhnend, sodass sein nicht unerheblicher Wanst dabei gehörig durchgeschüttelt wurde. Doch es klang nicht ganz echt. Dann schnaubte er, räusperte sich, spuckte aus und wischte mit dem Ärmel über seine rot geäderte Nase.
Sieht aus wie eine Hegaurübe, diese Nase, dachte Ennlin in ihrer Nische und hätte trotz der Gefahr, in der sie schwebte, beinahe gekichert.
»Hier wagt sich niemand her«, dröhnte der Herr von Hewen. »Wegen der Gespenster. Doch ob Graf oder nicht, Hauptmann hin oder her – niemand sagt mir auf meiner eigenen Burg, was ich zu tun und zu lassen habe. Und wenn wir schon dabei sind, offen zu sprechen, Nellenburger: Ihr seid bezüglich des Eigentums anderer ebenfalls kein Kind von Traurigkeit. Außerdem – was sollte es uns nützen, dass Ihr das Konzil nach Konstanz gebracht habt, wenn wir nicht auch für uns dabei etwas herausschlagen können?«
»Haltet Euch zurück, von Hewen. Und Ihr, Heudorfer, solltet Eurem Älteren, dem Wilhelm, bezüglich seiner Unternehmungen ein wenig die Flügel stutzen. Zumindest vorläufig. Sonst müssen wir ihm am Ende noch die Aufnahme in die Ritterschaft des Sankt Jörgenschildes verweigern.«
»Wie könnt Ihr es wagen, Euch hier so aufzuspielen! Von Nellenburg, das werden wir uns nicht gefallen lassen«, schnaubte Hans von Heudorf.
Heinrich von Hewen mischte sich ein, die Auseinandersetzung der beiden war ihm augenscheinlich nun auch wieder nicht recht. »Gemach, die Herren. Hier geht es doch um Jörg vom End. Ihm muss in der Tat Einhalt geboten werden. Und sei es nur, um uns diese lästige Laus aus dem Pelz zu schaffen. Er nimmt sich viel von dem, was auch in unseren Schatullen landen könnte. Und ich mag es nicht, wenn einer in meinem Beritt wildert.«
Ennlin bewegte sich leicht und stieß mit dem Fuß an eine Tonscherbe, die sie vorher nicht gesehen hatte.
»Ich muss mir von einem Grünschnabel wie Euch nicht sagen lassen, wer recht hat und wer nicht …«, setzte der von Heudorf an.
Eberhard von Nellenburg neigte den Kopf und hob dann die Hand. »Schweigt kurz still, Heudorfer. Ich glaube, außer uns ist noch jemand im Raum.«
Ennlin hielt die Luft an und versuchte, sich unsichtbar zu machen. »Hilf mir, Mutter Maria voll der Gnaden«, betete sie stumm.
»Ich lasse mir nicht über den Mund fahren. Das war das Knacken der Scheite im Kamin«, widersprach Hans von Heudorf.
»Nein, ich meine auch, dass da eine Art Scheppern war. Ich werde mich mal umschauen. Wir können keine Lauscher brauchen, die am Ende noch etwas über dieses Treffen herausposaunen«, meinte nun auch Heinrich von Hewen.
Ennlins Gedanken arbeiteten fieberhaft. Wenn sie nicht schnellstens einen Fluchtweg fand, wurde sie entdeckt. Die Herren würden nicht lang fackeln, wenn es darum ging, eine lästige Mitwisserin loszuwerden. Es blieb nur ein Ausweg, sie musste schnellstens aus der Tür.
Doch da wurde sie auch schon am Arm gepackt. »Schaut, meine Herren, wen haben wir denn da? Eine Maus in meiner Burg. Solches Wild jag ich doch gern! Lass dich anschauen, Mädchen.« Von Hewen zerrte sie ans Kaminfeuer.
Ennlin wollte sich dem Griff entwinden, doch es gelang ihr nicht.
»Reißt ihr nicht den Arm aus«, spottete Hans von Heudorf. »Zumindest nicht, bevor sie geredet hat. Viel wichtiger ist es nämlich, herauszufinden, wo sie so plötzlich herkommt. Wieso belauschst du uns? Für wen spielst du die Zuträgerin?«
Eberhard von Nellenburg hob die Hand. »Moment, Mädchen, dich kenn ich doch. Bist du nicht Agnes, die Dienstmagd? Ich dachte, du hilfst jetzt am Reutehof aus? Was machst du hier? Lasst sie los, von Hewen, sie wird uns schon nicht weglaufen. Meine Leute achten ihren Herrn. Nun, Mädchen, sprich.«
Ennlin fühlte, wie die harte Männerhand sie losließ, und überlegte fieberhaft, was sie tun sollte. Sie musste hier fort, ehe die Herren noch merkten, dass Jakob auch in der Burg war. Erst einmal Zeit gewinnen.
»Ich kam aus Zufall hierher, um Kräuter auf der Burgmatte zu sammeln. Hier gibt es viele Pflanzen, die heilen«, begann sie zaghaft. »Da hörte ich Stimmen und wollte nachschauen.«
»Hast also keine Angst vor den Geistern?« Heinrich von Hewen lachte scheppernd.
»Nein, Herr«, antwortete sie möglichst bescheiden und machte einen tiefen Knicks.
Eberhard von Nellenburg beobachtete sie aufmerksam. »So bist du also erst seit gerade eben hier?«
»Ja, durchlauchtigster Herr. Aber ich bin nicht Agnes. Das war meine Mutter.«
»Und wie geht es ihr? War ein flinkes Mädchen. Hast recht, jetzt, wo ich dich so anschaue, das kann auch nicht sein. Agnes würde heute älter aussehen.«
»Meine Mutter ist tot, Herr. Sie starb im Kindbett, als mein Bruder Jakob geboren wurde.«
Ennlin konnte sehen, dass Eberhard von Nellenburg betroffen war. Wieso das? Was hatte ein hoher Herr wie er mit ihrer Mutter zu schaffen? Doch dieser Gedanke wurde sogleich abgelöst von einem anderen. Wie kam sie nur hier heraus?
»Soso, Ihr kennt also ihre Mutter, Herr von Nellenburg«, meinte Heinrich von Hewen gedehnt. »Wenn sie so ansehnlich war wie dieses Mädchen … Aber ich denke, wir können sie nicht laufen lassen. Die Gefahr ist zu groß, dass sie doch etwas gehört hat. Wir sollten sicherstellen, dass sie nichts mehr erzählen kann. Auf eine mehr oder weniger kommt es Euch in Anbetracht der Umstände wohl nicht an.« Von Hewen griff unter seinen Umhang und zückte ein Messer.
Eberhard von Nellenburg fuhr herum. Das lenkte die Aufmerksamkeit der Herren für einen Moment von Ennlin ab. Sie nutzte die Gelegenheit und rannte.
Kapitel drei: Ein Papst zieht ein
Ständig strömte neuesVolk nach Konstanz. Viele Herren von Stand hatten schon ihre Wappen an die Türen ihrer Unterkünfte geschlagen: hohe Geistliche, berühmte Gelehrte, Ritter, Fürsten und solche, die vorgaben, welche zu sein. Die eigentlichen Besitzer des Hauses konnten sehen, wo sie blieben. Und die Dienstboten sowieso. In der Stadt wussten sie bald nicht mehr, wohin mit all den Menschen. Dabei wurden noch viel mehr Teilnehmer zum großen Konzil erwartet: aus Italien, Frankreich, England, Polen, Spanien, Armenien und von Gott weiß woher. Sogar eine Gesandtschaft des Kaisers aus Konstantinopel hatte sich angekündigt, Ketzer aus Griechenland und Mohren aus einem Land mit dem Namen Äthiopien. Benedikt wusste nicht genau, was ein Mohr war. Ein Mensch mit dunkler Haut hatte man ihm gesagt. Bisher hatte er noch keinen gesehen. Er konnte sich all die Gegenden und Länder, die ihm die Mutter genannt hatte, sowieso nicht merken.
In ihrem Schlepptau hatten die Gäste allerlei Gelichter in die Stadt gebracht: Diebe, Räuber und solche wie die beiden kleinen Taschendiebe da vorn. Benedikt beobachtete nicht ohne Schadenfreude, wie ein reicher Pfeffersack durch geschickte Finger um einen prall gefüllten Beutel erleichtert wurde. Der Mann merkte nichts. Er war abgelenkt, denn zehn Schritte weiter gab es mal wieder Händel. Ah, jetzt fuhren die Büttel dazwischen. Bald musste der Papst in die Stadt einreiten, da galt es, Ordnung zu halten.
Viele geistliche Herren waren dem Heiligen Vater bereits früh morgens an diesem Sonntag Sankt Simon und Judas bis nach Stadelhofen entgegengezogen, um ihn in die Stadt zu geleiten: sämtliche Prälaten, der Abt auf der Reichenau, der von Kreuzlingen, von Petershausen, alle Domherren, die Chorherren von Sankt Stephan, die Pfaffen von Sankt Johann und Sankt Paul. Benedikts Kopf schwirrte schon von all den Menschen, den Namen und dem ganzen Pomp. Dabei würden die hochrangigen Kirchenfürsten erst noch kommen.
Benedikt interessierte sich ohnehin eher für anderes. Er wusste, er sollte die drei Huren in den bunten Kleidern nicht so anstarren, die vor ihm hergingen. Aber er konnte einfach nicht verhindern, dass es ihn drängte, nach einem dieser drallen Hintern zu greifen, die da unter dem Stoff so verlockend vor ihm hin und her wogten. Es mit ihnen zu treiben, war eine Todsünde, sagte der Leutepriester. Dabei hatte er selbst eine Kebse. Liederliche Weiber nannte die Mutter sie. Aber nur nach außen hin. Insgeheim pflegte die Pfisterin mit den Konstanzer Huren rege Geschäftsbeziehungen. Insbesondere mit einer, die sich Constanzia nannte. Die Männer schwärmten von ihr. Aber sie ließ nur Leute von Stand in ihr Haus.
Benedikt war hinter die Bekanntschaft gekommen, weil die Mutter ihn manchmal schickte, wenn Constanzia wieder ausgefallene Spezereien geordert hatte. Er fragte sich, wozu sie diese in solchen Mengen benötigte. Wahrscheinlich bekamen die Freier sie vorgesetzt. Der Menge nach zu urteilen, die Benedikt zu schleppen hatte, mussten das ziemlich viele sein. Diese … Sache schien hungrig zu machen. Vielleicht hieß die Gegend von Stadelhofen jenseits des Emmishofer Tors, in der die meisten Hurenhäuser lagen, ja aus gutem Grund das Süße Viertel.
Constanzias Haus lag allerdings nicht dort, sondern gut erreichbar in einem sehr bürgerlichen Viertel in der Nähe des Markplatzes. Benedikt hatte keine Ahnung, wie es ihr gelungen war, die Erlaubnis zu bekommen, sich dort niederzulassen. Sie musste über gute Beziehungen verfügen.
Er hatte schwören müssen, niemandem von diesen Botengängen zu erzählen. »Ich bin eine Wittib, dein Onkel ist der Bürgermeister von Meersburg. Wir müssen auf uns halten«, hatte ihm Fida immer wieder eingebläut. »Aber wir müssen auch schauen, wo wir bleiben, damit ich dich und deine Geschwister durchbringen und deinen Bruder ins Kloster Reichenau einkaufen kann. Deine Schwester ist zudem bald im heiratsfähigen Alter, sie braucht eine Mitgift«, hatte Fida ihrem Ältesten klar gemacht. Anna, seine Schwester, war nervig, fand Benedikt. Sie war gerade in Meersburg. Angeblich brauchte sie Luftveränderung. Benedikt schnaubte. Wer’s glaubte. Der Onkel hatte einen Mann für sie. Zum Heiraten war Anna noch zu jung, aber die beiden sollten sich einmal unverbindlich kennenlernen.
Insgeheim war Benedikt zutiefst beeindruckt von seiner tüchtigen Mutter. Er hatte einen Riesenrespekt vor ihr. Die Pfisterin hatte nach dem frühen Tod des Vaters dessen Geschäfte übernommen und führte sie mit energischer Hand. Fida besaß Getreidemühlen, war aber auch Inhaberin einer Backstube, die jedoch ein Meister für sie betrieb. Die Mutter war eine geachtete Frau, ihr Wort galt etwas, selbst unter den Männern der Bäcker- und der Müllerzunft. Alle fürchteten ihre spitze Zunge. »Denk dran, ich muss mich auf dich verlassen können. Du bist jetzt der Mann im Haus«, sagte die Mutter oft. Aber das meinte sie nicht so. Was zu entscheiden war, entschied die Pfisterin allein. Ohne ihren Sohn zu fragen. Und das, obwohl er gar nicht schlecht lesen und schreiben konnte und jeden Morgen um sechs Uhr neben ihr im Kontor zu erscheinen hatte.
Er sollte lernen, die Bücher zu führen und auch sonst alles, was mit den Geschäften zusammenhing.
Dummerweise war er kein besonders guter Rechner, sein Kopf arbeitete da eher langsam, was die Mutter oft ärgerte. Diese konnte in Windeseile herausfinden, wie viele Schillinge oder Pfennige den Wert eines Rheinischen Gulden ergaben, oder was sie für einen alten oder einen neuen Blaphart bekam. Kaum war die nächste Liste da, auf der stand, wie viel Gewicht und Gehalt an Silber und Gold eine gute Münze haben sollte, da kannte sie diese auch schon auswendig. Und dann waren da noch die ganzen fremden Münzen, zum Beispiel aus Ungarn, oder das Gold aus Mailand. Ihm reichte es schon, wenn er sich das gebräuchlichste Geld merken konnte.
Aber das würde ihm heute keinen Kummer machen, denn an diesem Tag hatte sie ihm ausnahmsweise einmal freigegeben.
Benedikt schaute wieder auf die drei verführerischen Hintern und fühlte, wie sich an seinem Unterleib etwas zu regen begann. Ob er mal bei Constanzia nachfragen sollte? Nein, die würde ihn nicht nehmen.
Er hatte sie überhaupt nur einmal zu Gesicht bekommen. Üblicherweise endeten seine Botengänge am Hintereingang des Frauenhauses, wo ein Diener ihm die Waren abnahm. Doch eines Tages hatte sie ihn zu sich gebeten. Der Blick ihrer mandelförmigen grauen Augen war ihm durch und durch gegangen. Seitdem träumte er davon, neben ihr zu liegen, in diese üppige Haarpracht zu greifen, von der sich alle erzählten. Als er sie gesehen hatte, waren die Haare sittsam unter einem Tuch verborgen gewesen, das sie kunstvoll um Kopf, Hals und Nacken geschlungen hatte, sodass nur noch das Gesicht frei blieb. Es war ein Tuch in der Farbe ihrer Augen, was diese noch mehr zur Geltung brachte. Sie hatte etwas, das er nicht verstand. Etwas geheimnisvoll Zurückhaltendes und gleichzeitig so Verlockendes, dass ihm das Blut in den Ohren rauschte. Er hätte sich noch immer ohrfeigen können, dass er bei ihrem Anblick errötet war.
Sie sollte sich gut mit dem Grafen Eberhard von Nellenburg stehen, hatte er gehört. Der war ein Berater des Königs und hatte nicht nur das Konzil, sondern auch die schöne Constanzia in die Stadt gebracht. Vielleicht machte es den Konstanzer Ratsherren deshalb nichts aus, dass niemand wusste, wie sie wirklich hieß und woher sie kam. Sie ließen sie unbehelligt gewähren, während die Leute sich das Maul über sie zerrissen.
Benedikt seufzte. Nein, mit jemandem wie ihm gab sie sich sicher nicht ab. Das konnte er sich aus dem Kopf schlagen. Vielleicht, wenn er einmal selbst die Geschäfte der Familie führte und reich war. Aber das konnte noch Jahre dauern, bis die Mutter ihm diese Verantwortung übertrug.
Benedikt schaute sich um. Die Reliquienhändler machten gute Geschäfte. Die Mutter weigerte sich im Gegensatz zu vielen anderen jedoch, Knochensplitter zu kaufen. »Alles Mumpitz«, fand sie. Allerdings hatte sie einige für Constanzia erstanden und diese wunderbar in Gold fassen lassen. Als kleine Gefälligkeit sozusagen.
Solche Reliquien sollten vor dem schwarzen Tod schützen. Das behauptete auch der Leutepriester. Benedikt war sich nicht sicher, ob das stimmte. Beim letzten Ausbruch der Krankheit waren viele elendiglich verreckt, sogar solche, die fromm waren und täglich zu irgendwelchen Heiligen beteten. Das war zwar schon mehr als ein Menschenalter her, der Schrecken steckte den Menschen jedoch noch immer in den Knochen. Er selbst konnte sich nicht daran erinnern.
Andererseits, wenn der Priester das sagte! Und es konnte ja nichts schaden, sicherzugehen. Wenn sich die Mutter schon weigerte, vielleicht sollte er ein ganz kleines Knöchelchen einer Heiligen erwerben. Wenn wieder die Pest kam, und niemand im Haus daran starb, würde sie schön schauen, wenn er ihr die Reliquie zeigte, und ihn als Retter der Familie endlich wertschätzen wie er es seiner Meinung nach verdiente. Dann wäre er wirklich der Mann im Haus. Am besten wäre natürlich ein Finger der Katharina von Siena. Es hieß, ihr Körper verwese nicht. Sie hatte die Pestkranken gepflegt und sollte sehr tugendhaft gewesen sein. Solch ein Finger konnte ihn womöglich auch vor sündigen Gedanken bewahren. Doch so etwas gab es bei den fliegenden Händlern nicht zu kaufen, nur die Knochen von unbekannteren Heiligen. Die wertvolleren Stücke boten sie den Reichen direkt an.
»Eine Probe Stroh aus dem Stall von Bethlehem, eine Probe Stroh. Echt wie pures Gold!«, brüllte ein Händler neben ihm. Benedikt zückte seinen Beutel und wog ihn nachdenklich in der Hand. Das würde dann wohl auch pures Gold kosten. Doch so was hatte er nicht im Sack, nur einige silberne Pfennige und ein paar Heller. Seinen größten Schatz, einen goldenen Rheinischen Gulden, hatte er sorgsam unter seiner Bettstatt versteckt.
Benedikt steckte den Beutel wieder unter seinen Rock zurück. Sein Magen knurrte. Er war schon lang auf den Beinen, es musste inzwischen fast Mittag sein. Ob er zu einer der Garküchen gehen sollte, die sich zwischen Stephanskirche und Hofhalde eingerichtet hatten? Dort gab es das beste Angebot. Sein Blick wanderte suchend über die Stände von Handwerkern, Kaufleuten und Geldwechslern hinweg. Viele waren wegen des Konzils in die Stadt geströmt. Sie waren einfach überall, entlang der Stadtmauer, auf dem oberen Münsterhof, auf dem Kirchhof der Barfüßer, in den Kreuzgängen der Klöster. Sie kamen aus aller Herren Länder, um die vornehmen Herren zu versorgen und ihnen ihre Schillinge abzuknöpfen. Auch die Mutter versprach sich vom Konzil gute Geschäfte. Sie hatte sich sogar vorgenommen, die Bekanntschaft von Cosimo Medici zu suchen. Der berühmte Florentiner Kaufmann war der Bankier von Papst Johannes und schwamm in Gold, wie es hieß.
Ein Windstoß trieb Benedikt einen herrlichen Duft um die Nase. Sein Magen meldete sich erneut. Ah, da hinten war eine fahrende Garküche. Es roch herrlich nach gegrillten Hühnerkeulen. Wieder betastete er seinen Beutel. Nein, zu wenig. Er musste seine paar Münzen zusammenhalten. Er ging weiter in Richtung Kreuzlinger Tor. Von dort aus sollte der Papst einreiten.
Die ganze Straße, die ganze Stadt war festlich geschmückt in Erwartung des Heiligen Vaters, der sich Johannes XXIII. nannte. Überall wehten bunte Wimpel im Wind, Girlanden zierten die Häuser. Die Nacht sollte der Papst im Kloster Kreuzlingen geschlafen haben. In Konstanz war für sein Unterkommen fürstlich vorgesorgt worden. Eine Vorhut hatte den Hut des Papstes schon vor geraumer Zeit ans Haus zum Helffand auf den Platten genagelt.
Die Wohnstatt, die der Papst für sich und sein Gefolge mit Beschlag hatte belegen lassen, reichte bis hinüber zum Haus zum Ballen. Benedikt fragte sich, ob es von Nächstenliebe kündete, wenn einer so viel Raum für sich in Anspruch nahm, während andere sich wegen der vielen Gäste in den eigenen Wänden kaum noch drehen und wenden konnten und ins letzte Eck zurückgedrängt worden waren. Der Pfisterin und ihrer Familie war das bisher erspart geblieben.
Ah, da hinten war auch schon das Kreuzlinger Tor. Jetzt musste er sich einen guten Platz sichern. Was für ein Gedränge und Geschiebe! Jemand stieß ihn von hinten an. Benedikt schaute sich um, konnte den Übeltäter jedoch nicht entdecken. Es wurden immer mehr Leute. Ein Dreikäsehoch schob sich vor ihn.
»He! Das ist mein Platz!« Benedikt drängte ihn zur Seite und erwartete schon, zurückgestoßen zu werden. Doch der Knirps sah ihn nur ausdruckslos an, wandte sich ab und verschwand im Gedränge.
Der Reliquienhändler hatte ihn beobachtet, war ihm gefolgt und näherte sich ihm. »Nu, willst was für dein Seelenheil tun, Jungchen? Hab ganz günstige Knöchelchen. Aber so wie du aussiehst, ist das zu schäbig für dich – bist du nicht der … Junge der Pfisterin? Hätte da eine schöne Hand von einem berühmten Heiligen. Ist sogar die rechte, die Schwurhand, was Seltenes also. Eine bessere Hand bekommt das Herrlein nirgends. Außerdem ganz, mit allen Knochen, sogar mit Stammbaum und Urkunde.«
»Der Heilige Vater, der Heilige Vater!«, schrie eine Frau. Die Menschen, die hinter Benedikt standen, drängten sich nach vorn, zwischen ihn und den Händler. Er wäre beinahe gefallen und fluchte. Doch das enthob ihn glücklicherweise einer Antwort auf das Kaufangebot. Er schaute in Richtung Kreuzlinger Tor und versuchte nun seinerseits, nach vorn zu kommen. Er schaffte es bis in die zweite Reihe.
Die Stadtsoldaten trieben die Menschen vor ihm mit Knüppeln zurück. »Platz da, Platz für den Heiligen Vater!« Benedikt bekam einen Fußtritt ab. Er fuhr die Ellbogen aus.
Das Gemurmel der Menschenstimmen wurde lauter, Ah- und Oh-Rufe ertönten aus Richtung des Kreuzlinger Tors. Benedikt hob die Hand vor die Augen und wurde im selben Moment ebenfalls von den Schergen des Rats rüde zur Seite und weiter nach hinten geschoben: »Mach Platz für den Papst, Junge, aus dem Weg!«
Da die hinter ihm Stehenden jedoch nicht geneigt waren, ihren Platz einfach so aufzugeben, wurde Benedikt gegen sie gequetscht und bekam fast keine Luft mehr. Seine Nase war jetzt in den mächtigen Rücken eines Bauern gedrückt, der durch das Hin- und Hergeschiebe vor ihn geraten war.
Doch auch Benedikt gedachte nicht, so einfach aufzugeben. Er boxte und rempelte sich wieder weiter nach vorn, auch auf die Gefahr hin, den Ellenbogen eines Mannes oder den Fluch eines Weibes mit auf den Weg zu bekommen, dem er auf den Fuß getreten war. Endlich stand er wieder in der zweiten Reihe.
»Platz hier, Platz für den Heiligen Vater!«, erschallte der Ruf erneut, dieses Mal aus der Gegenrichtung. Benedikt sah nur das große Kreuz, das der Empfangsprozession vorausgetragen wurde. Als die beiden Züge dann aufeinanderstießen, gab es einiges Durcheinander. Benedikt konnte nicht recht erkennen, was da geschah. Offenbar vereinigten sich die beiden Züge und strebten gemeinsam dem Konstanzer Münster zu.
Er reckte den Hals und sah einen Priester auf einem Pferd, der ein goldenes Kreuz auf einer langen Stange trug. Ihm folgten neun weiße Rösser, alle mit Überwürfen aus rotem Tuch, die von prächtig gewandeten Dienern geführt wurden. Acht der Rösser trugen verschnürte Säcke, das Reisegepäck des Heiligen Vaters. Was da wohl drin sein mochte? Es war für Benedikt unvorstellbar, dass ein Mann allein so viel Gepäck benötigen sollte. Das neunte Ross trug etwas Viereckiges unter dem roten Tuch. Es musste fest sein, denn es standen sogar zwei silberne Kerzenständer mit brennenden Kerzen darauf. Dieses Pferd hatte eine kleine Glocke am Hals.
Da kam ein Windstoß auf, und eine silberne und goldene Lade blitzte unter dem roten Tuch hervor. Benedikt hatte von der Lade gehört, darin sollte sich das Heilige Sakrament befinden.
Nach dem Ross mit der Lade kam ein Mann auf einem mächtigen Rappen. Der hielt eine Michelstange in der Hand, die er auf dem Widerrist seines Pferdes aufgesetzt hatte. Und auf dieser Stange war eine Art kegelförmiges Zelt aus gelb-rot gestreiftem Tuch angebracht, fast so groß wie das Pferd. Oben hatte das Zelt einen goldenen Knopf. Und auf dem Knopf stand ein goldener Engel, der ein Kreuz in der Hand hielt.
Benedikt staunte, wurde aber gleich darauf abgelenkt. Denn nun kamen die Kardinäle in ihren langen roten Mänteln, alle auf prächtigen Rössern. Und alle trugen sie rote Kappen und darüber breite rote Hüte auf dem Kopf. Was hatte die Mutter noch erzählt? Wenn die Kardinäle ritten, dann hatten sie immer ihre roten Hüte auf. Wenn sie jedoch zu Fuß gingen, dann genügten die Mäntel und die Kappen.
Benedikt kniff die Augen zusammen. Er wusste nicht, ob es das Aufblitzen der Sonnenstrahlen auf dem Edelmetall der Lade war, das ihn blendete, oder die massige Gestalt in dem prachtvollen weißen Messgewand auf dem weißen Ross, die nun folgte. Das Pferd war ebenfalls mit einem weißen Messgewand angetan. Ja, das musste der Heilige Vater sein. Die kleinen Äuglein in dem feisten Gesicht sahen aufmerksam auf die Wartenden, denen er mit seiner juwelenberingten rechten Hand zuwinkte. Die Menschen jubelten ihm entgegen und fielen auf die Knie, wenn er an ihnen vorüberzog.
Auch Benedikt sank zu Boden und faltete die Hände. Sogar das Ross dieses Heiligen Vaters war gekleidet wie ein Pfarrer, dachte er dabei. Und der Heilige Vater hatte etwas von einer Kröte. Gleich darauf verbot er sich diese Gedanken. Doch es half nichts. Der Papst erinnerte ihn an einen dieser Frösche, die die Mutter neulich für eine stolze Summe hatte taufen lassen, um sie später der Kräuterfrau zu geben. Diese sollte damit und mit ihren Heilkräutern einen Trank gegen den quälenden Husten der Schwester brauen.
Direkt vor Benedikt geriet der Zug für einige Momente ins Stocken. Er schaute hoch. Vier Männer hielten ein goldenes Tuch wie einen Baldachin über Johannes XXIII. Er erkannte Heinrich Schulter, den Stadtamman Heinrich Ehinger, Hanns Hagen, den Vogt und Heinrich von Ulm, den Bürgermeister. Ihre Gesichter spiegelten wieder, was sie dachten. Es war schon etwas ganz Besonderes, so nah am Heiligen Vater zu sein, und das hatte sie eine Stange Geld gekostet, auch wenn’s nur einer von Dreien war, die sich Papst nannten. Benedikts Mutter hatte dem Bürgermeister sogar mit Geld aushelfen müssen.
Benedikt reckte den Hals so lang er konnte. Man hörte hinter vorgehaltener Hand ja allerlei von diesem Papst. Ein Hurenbock sollte er sein, ein Säufer und Prasser und gleichzeitig ein ungerechter und strenger Mann. Die Römer, seine eigenen Leute, hatten ihn verjagt, die Bürger von Bologna auch.
Und dann kursierte da noch diese andere Geschichte in der Stadt. Benedikt gluckste in sich hinein. Selbst die streng gläubige Mutter hatte sich ein Lachen nicht ganz verkneifen können, als sie sie dem Kaufmann Muntprat erzählt hatte. Glücklicherweise hatte sie nicht bemerkt, dass er lauschte. Nach außen hin gab sich die Pfisterin nämlich als überzeugte Anhängerin dieses italienischen Papstes. Ihre Gründe dafür waren jedoch weniger in der Überzeugung zu suchen, er sei der geeignetste der drei amtierenden Päpste, sondern handfester Natur. Zumal sie von den anderen beiden so gut wie nichts wusste. Für sie zählte nur eins: Zusammen mit König Sigismund hatte Johannes XXIII. das Konzil nach Konstanz und damit wunderbare Aussichten auf gute Geschäfte in die Stadt geholt.
Die Geschichte hatte die Stadt lang vor dem Papst erreicht, bereits im September – oder war es schon der Oktober gewesen? Jedenfalls zu der Zeit, als das Gerücht die Runde gemacht hatte, dass Papst Johannes XXIII. nach Konstanz aufgebrochen sei. Benedikt gluckste wieder in sich hinein. Irgendwo bei dem Klösterle am Arlberg, da war sein Wagen umgekippt. Und der Heilige Vater war zappelnd und schimpfend wie ein großer Käfer im Schnee unter dem Wagen gelegen. Als ihn dann seine Schranzen gefragt hatten: ›Heiliger Vater, ist Ihnen etwas geschehen?‹ sollte er geantwortet haben ›Ich lieg hier im Namen des Teufels.‹
An diesem Punkt der Erzählung hatte die Pfisterin zu Muntprat gesagt: »Der Teufel, den er meinte, das war wohl dieser Ketzer, Jan Hus, der Magister aus Böhmen. Der Allmächtige schütze unsere Stadt vor Leuten wie ihm.« Benedikt fand das Verhalten seiner Mutter bemerkenswert. Sie war keine, die schnell Angst bekam. Aber vor diesem Jan Hus, diesem Ketzer, schien sie sich zu fürchten. Ob er wohl Hörner hatte oder einen Klumpfuß wie der Satan?
Der Papst sah jedenfalls nicht aus, wie er sich einen solchen Herrn vorgestellt hatte. Der feiste Mann ritt nicht aufrecht und würdevoll daher, sondern schien sich förmlich in sein prächtiges Gewand verkriechen zu wollen. Diese verweichlichten Südländer waren eben nichts gewohnt. Gut, es war ein kalter Tag für Ende Oktober, aber so kalt auch wieder nicht. Das starke Ross des Papstes hatte sogar Schaum auf den Flanken, es ging schwer. Kein Wunder bei dem Gewicht, das es zu tragen hatte.
Benedikt taten die Knie weh. Warum ging es denn nicht weiter? Ah, endlich. Gleich darauf war der Heilige Vater an ihm vorbei.
Er stand auf und klopfte sich den Straßendreck von den Beinkleidern. Die Mutter würde ärgerlich sein, wenn sie das sah. Auch seine neuen Schuhe, nach der Mode mit langen Spitzen gefertigt, waren völlig verdreckt. Benedikt seufzte. Das gab nachher eine Abreibung. Aber vielleicht hatte die Mutter ja anderes zu tun, jetzt, wo der Papst in der Stadt war, als auf die Kleidung ihres Ältesten zu achten.
Wieder wurde er angerempelt. Er sah zur Seite und blickte direkt in die hellbraunen Augen eines Mädchens. Sie hatten die Farbe von angelaufenen Kupfermünzen. Die tief stehende Spätherbstsonne zauberte gelbe Lichter hinein. Sie blinzelte. Benedikt schätzte, dass sie etwa in seinem Alter sein musste, vielleicht ein Jahr jünger. Er starrte sie an, völlig hingerissen. Sie war nicht wirklich schön, mit all dem Dreck, den verfilzten dunkelblonden Haaren und dieser schmutzstrarrenden Decke um die Schultern. Sie war schmal, bestimmt zwei Köpfe kleiner als er. Und ihr Mund war viel zu groß. Wirklich schöne Frauen hatten einen Kirschmund zu haben und keine geröteten Wangen, sondern eine bleiche, ebenmäßige Haut. Wie Constanzia. Doch in ihren leicht schräg gestellten Augen lag etwas, ein Leuchten, das er so noch nie gesehen hatte.
Gleich darauf schalt er sich einen Narren. Das Leuchten hatte allein die Sonne bewirkt. Sie war eine Bettlerin, eine von zahllosen, die in diesen Tagen in die Stadt strömten, weil sie sich von all den Kirchenmännern, Händlern, Fürsten und Rittern gute Einnahmen versprach. Vermutlich verkaufte sie sich selbst. Viele Mädchen taten das. Das war ein leichterer Verdienst, als sich abzurackern mit eigener Hände Arbeit. Er wusste, dass die meisten dieser Huren hofften, sich für die Dauer des Konzils einen reichen Galan zu angeln und in dieser Zeit für die kommenden schlechten Tage vorzusorgen. Ob er sie sich kaufen sollte?
Nein, so etwas kam nicht infrage bei den paar Schillingen in seinem Beutel, selbst wenn er sie billig haben konnte. Seine Mutter hatte ihn eindringlich vor solchen Weibern gewarnt. Äußerlicher Dreck färbt ab nach innen, hatte sie gesagt. Falls sie keine Käufliche war, würde sie ihn bestimmt gleich um Almosen bitten.
Doch es war seine Hand, die sich wie von selbst ausstreckte. Als ihm das bewusst wurde, ließ er sie wieder sinken.
Er fühlte sich linkisch, benahm sich wie ein tumber Tor und hasste sich dafür. Wahrscheinlich glühte der Pickel auf seiner Nase mal wieder feuerrot. Er konnte darauf herumdrücken so viel er wollte, das blöde Ding kam immer wieder. Der Bruder und die Schwester machten sich deswegen schon über ihn lustig. Die Mutter hatte gesagt, Pickel seien normal für einen jungen Mann in seinem Alter. Da sei er nicht allein. Sie würden mit der Zeit schon weggehen. Benedikt hoffte inbrünstig, dass sie recht behielt. Außerdem hatte keiner seiner Altersgenossen so viele davon im Gesicht wie er. Ständig blühten neue auf, egal, wie viel Salbe und Cremen er auch darauf verteilte. Ansonsten, fand Benedikt, sah er eigentlich nicht schlecht aus. Gute Zähne, einen dichten dunklen Lockenschopf, gerade Beine und breite Schultern. Mancher gestandene Mann ließ sich Schultern und Brust aufpolstern, um ebenso eindrucksvoll daher zu kommen. Gut, die Augenbrauen waren etwas dick und borstig. Aber dafür hatte er recht lange Wimpern, das ließ seine blauen Augen größer erscheinen. Das war nicht schlecht. Auch wenn der Bruder immer behauptete, er habe ein Gesicht wie ein Mädchen. Allerdings ein pickeliges. Aber nicht mehr lang! Der erste Bartflaum bildete sich schon. Und aus dem blöden Stimmbruch war er endlich heraus. Herrje, war das ein Gequietsche gewesen, wenn ihm die Stimme ausrutschte.
Es war schon ein Kreuz mit dem Erwachsenwerden. Einerseits sollte man vernünftig sein, andererseits behandelte ihn die Mutter wie ein Kind.
»Verzeiht, Herr«, sagte das Mädchen, schlug die Augen nieder und errötete. Das konnte er selbst durch die Dreckschlieren auf ihren Wangen erkennen. Hatte sie etwa geweint? Ihm wurde klar: Sie war ebenso schüchtern wie er selbst! Benedikt hätte sie am liebsten umarmt. Angesichts der Verlegenheit des Mädchens kam er sich männlich und stark vor.
Da fühlte er eine Hand an seinem Gürtel. Er sah nach unten. Es war ihre. Doch ehe er danach greifen konnte, war sie auch schon weg, wie ein Geist zwischen den Menschen verschwunden. Er tastete nach seinem Beutel, den er sicherheitshalber vorn unter den Rock geschoben und mit einem Bändel am Gürtel befestigt hatte. Doch wo er sein sollte, baumelte nur noch das Bändel.
Benedikt schaute sich hektisch um. Nein, sie war nirgends mehr. Verfluchte Brut. Die Mutter hatte recht, wenn sie ihn vor den leichten Mädchen warnte. Er hatte sich wieder einmal von schönen Augen einfangen lassen. Die Mutter würde ihm eine gehörige Kopfnuss verpassen.
Was sollte er tun? Heim? Nein, besser er ging jetzt nicht gleich heim. Er musste sich erst einmal eine gute Ausrede zurechtlegen. Bis dahin konnte er genauso gut weiter zuschauen, was dieser Papst in der Stadt trieb. Dann hatte er wenigstens etwas zu erzählen. Seine Mutter liebte Klatsch und Tratsch, eine gute Geschichte würde sie vielleicht gnädiger stimmen. Sein Magen knurrte erneut. Benedikt beschloss, das nicht zu beachten. Und irgendwo in seinem Hinterkopf schauten ihn zwei hellbraune Augen an und eine sanfte Mädchenstimme sagte: »Verzeiht, Herr.«
Die Mutter. Sie musste hier irgendwo sein. Den Einzug des Papstes hatte sie sich nicht entgehen lassen wollen. Er wollte ihr jetzt keinesfalls begegnen. Sie würde sofort merken, dass etwas nicht stimmte.
Benedikt mischte sich unter die Menschen, die der Prozession folgten, noch immer unschlüssig, was er jetzt tun sollte. Er war schließlich noch niemals bestohlen worden.
Ziel des prächtigen Zuges war der Untere Hof beim großen Münster auf dem Hügel. Nicht allen gelang es, schnell noch durch die Mauer zu schlüpfen, die das Gotteshaus schützte. Doch Benedikt war jung und schlank, er konnte sich gerade noch so hindurchschlängeln. Allerdings war auch im Unteren Hof das Gedränge groß. So ahnte er mehr als er sah, wie die hohen Herren dort von ihren Rössern stiegen und würdevoll ins Münster zu unserer Lieben Frau schritten.
Für die einfachen Leute wie Benedikt war in der Kathedrale kein Platz mehr. Ihnen blieb nur, draußen zu warten, sich die Beine in den Bauch zu stehen und währenddessen dem Te Deum Laudamus zu lauschen, das nicht lang darauf aus dem Münster zu ihnen herausschallte.
Da sah Benedikt, dass Diener das Ross des Papstes fortführten. Ah, es sollte wohl vom Unteren auf den Oberen Hof gebracht werden. Er marschierte hinterher. Er hatte schon immer ein so wunderbares Pferd haben wollen. Doch die Mutter weigerte sich, Pferde anzuschaffen. »Wir haben es nicht nötig, zu protzen. Das erweckt nur Neid und Missgunst«, hatte sie ihm erklärt. Wenn sie einmal fort musste, mietete sie eines. Und so hatte Benedikt mehr schlecht als recht reiten gelernt und musste sich meist auf Schusters Rappen beschränken.
Der Kämmerer des Papstes und sein Torhüter ergriffen das Ross am Zügel und sagten den Dienern, es sei ihre Sache, sich darum zu kümmern. Doch da stürmte ein anderer Mann auf sie zu, und Benedikt erkannte die Stimme des Konstanzer Bürgermeisters Heinrich von Ulm. Sie wurde immer lauter. Er klang wütend. Auch dessen älterer Sohn war da. Benedikt konnte diesen Georg nicht leiden. Ständig strolchte er mit den anderen Laffen durch die Stadt, hielt sich für etwas Besseres, wähnte sich sogar gleichgestellt zu Wilhelm, Hennslin und Bilgeri von Heudorf. Das waren wirkliche Herrensöhne, allerdings auch ziemliche Kotzbrocken, die glaubten, sie könnten sich gegenüber den einfachen Leuten alles erlauben. Aber die Väter kamen trotzdem zu seiner Mutter, um sich Geld zu borgen.
Der Knecht des Bürgermeisters zerrte nun seinerseits am Zügel des päpstlichen Rosses. Das Pferd zu versorgen sei seine Sache, brüllte Heinrich von Ulm jetzt mit zornrotem Gesicht. Denn er sei hier der Bürgermeister. Am Ende gaben die anderen nach. Und so marschierten der Schultheiß und sein Sohn mit stolzgeschwellter Brust mit dem Ross des Papstes davon.
Plötzlich läuteten überall die Glocken. Das war das Zeichen, dass innen im Münster die Vesper abgehalten wurde. Benedikt machte, dass er wieder auf den Unteren Hof kam. Und dann schwangen die Türen des großen Gotteshauses auf. Der Papst, das wusste Benedikt von seiner Mutter, würde jedoch nicht mehr hier erscheinen, sondern durch die Sankt-Margarethen-Kapelle zu Fuß in die Pfalz gehen. Bei solch hohen Gästen wurde nichts dem Zufall überlassen. Und es war auch wichtig, dass sich die Herren nicht mehr als nötig dem gemeinen Volk aussetzen mussten.
Benedikt dachte an den Kampf um das Pferd des Papstes und feixte.
Die Kardinäle indessen stiegen wieder auf ihre Rösser. Vermutlich ritten sie zurück in die jeweiligen Herbergen. Und das Volk jubelte.