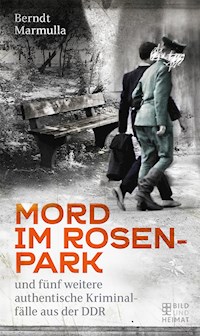Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Das Neue Berlin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Berndt Marmulla, lange Jahre als Leiter der Abteilung "Schwere Verbrechen und Serientäter" tätig, öffnet seine Akten und präsentiert fünf ungewöhnliche Fälle: Ein Mord in Ostberlin, den erst das BKA aufklären kann. Ein Raubmord an der Inhaberin eines Lottoladens - kann eine Frau so brutal morden? Ein Kunstdiebstahl, der zu diplomatischen Verwicklungen führt. Ein toter Homosexueller, die Spur führt in den Westen. Und: ein Brand ruft die Feuerwehr auf den Plan, die findet eine Leiche. War das Feuer ein Vertuschungsmanöver? Marmulla gibt aus erster Hand Einblick in die Ermittlungsarbeit der Volkspolizei und ihrer Sonderermittler - ein schauriges Lesevergnügen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Impressum
ISBN eBook 978-3-360-50041-0
ISBN Print 978-3-360-02163-2
© 2013 Verlag Das Neue Berlin, Berlin
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin,
unter Verwendung eines Motivs von Fotolia@zea_lenanet
Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH
Neue Grünstr. 18, 10179 Berlin
Die Bücher des Verlags Das Neue Berlin
erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.eulenspiegel-verlagsgruppe.de
Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurden alle Namen
von Tätern und Opfern sowie Tatorte verfremdet.
Namensgleichheiten sind dem Zufall zuzuschreiben.
Berndt Marmulla
Ein Mord wie im Kino
Authentische Kriminalfälle aus der DDR
Das Neue Berlin
Inhalt
Frauen als Mörderinnen
Ein Mord wie im Kino
Besuch der alten Dame
Vier Schachteln Zigaretten
Weitere authentische Kriminalfälle:
Frauen als Mörderinnen
Die Statistik gibt jenen recht, die Frauen für das sanftere Geschlecht halten. Und sollten sie mal morden, dann allenfalls mit Gift. In diesem Band wird von drei Fällen berichtet, in denen dies widerlegt wird. Da töten Frauen mit Hammer, mit der Schere oder lassen mit dem Beil zuschlagen. Ist das typisch?
Es ist vermutlich so atypisch, wie diese Verbrechen nicht unbedingt exemplarisch für die DDR-Gesellschaft sind, in der sie sich in den 60er, 70er und 80er Jahren zutrugen. Aber es gab sie. Dass sie damals nicht in der Zeitung standen und darum in der Öffentlichkeit auch nicht publik wurden, bedeutet nicht, dass »so etwas« nicht stattfand.
Mag sein, dass in Berlin, der Hauptstadt, begünstigende Umstände existierten. In einer Großstadt mit mehr als anderthalb Millionen Menschen passiert objektiv mehr als in kleineren Ortschaften, wo das Netz wechselseitiger Aufmerksamkeit und Kontrolle ein wenig engmaschiger war (und ist). Zugleich aber widerlegen solche Verbrechen die heutzutage gern kolportierte These von der flächendeckenden Überwachung: Hätte sie bestanden, wäre manches Opfer eines Gewaltverbrechens heute noch am Leben.
Das ironische Bonmot von Gerichtsmedizinern, demzufolge unsere Friedhöfe wie Spargelfelder aussähen, würden all jene Menschen, die eines unnatürlichen Todes gestorben sind, ihren Finger aus der Grube recken, verweist zwar zunächst auf das (aktuelle und darum beklagte) Manko, dass Tote hierzulande zu wenig und zu oberflächlich untersucht würden. Aber es macht zugleich auch den Umstand sichtbar: In jeder Gesellschaft, in jedem Staat gibt es Bereiche, die sich kollektiver Kontrolle entziehen.
So verhielt es sich auch bei den drei nachfolgend geschilderten Fällen. Es handelte sich um labile, charakterschwache, im Grunde um asoziale Personen, die sich weder helfen lassen mochten noch überhaupt meinten, dass man ihnen helfen wollte, sondern jegliche Unterstützung als eine Art Bevormundung ablehnten oder sich ihr entzogen.
Dabei wird niemand asozial geboren, der Mensch ist von Natur aus ein Gemeinschaftswesen. Es sind immer auch die Umstände, die Menschen werden lassen, was sie am Ende sind. Insofern sind die Lebensläufe und Charaktereigenschaften der hier behandelten Täterinnen gleichsam aus dem Lehrbuch, sind so exemplarisch wie nur irgendwas. Sie wuchsen in Familien auf, die diese Bezeichnung nicht verdienten, »Väter« kamen und gingen, statt Liebe und Zuwendung herrschten Gewalt und Jähzorn, es wurde getrunken und geschlagen, vergewaltigt und missbraucht. So etwas pflanzt sich in den Generationen fort.
Da konnten (und können) die Institutionen des Gemeinwesens noch so aufmerksam sein: Das meiste, was hinter den Wohnungstüren geschieht, bleibt ihren Blicken verborgen.
Ich weiß, wovon ich schreibe: Seit Ende der 60er Jahre war ich bei der Polizei. Bis 1990 leitete ich im Berliner Polizeipräsidium das Dezernat X (Schwere Verbrechen und Serientäter), danach arbeitete ich in der Direktion Spezialaufgaben der Verbrechensbekämpfung im Raubdezernat. Als Kriminaloberrat schied ich zwar aus dem Polizeidienst, nicht aber aus dem Beruf. Ich bin noch immer als Sachverständiger für Kriminalistik und als Privatdetektiv tätig.
Mit diesem Buch beginne ich, über Fälle aus meiner aktiven Zeit zu berichten, bei denen ich direkt oder indirekt an der Ermittlungen beteiligt war.
Im ersten Fall verliert ein gutmütiger Rentner sein Leben, der offensichtlich jemandem im Wege ist … Oder da ist jene Berlinerin, die zwischen ihren Gefängnisaufenthalten vom Klauen und von Gelegenheitsprostitution lebte. Sie ersticht eine Bekannte, weil die sich weigert, ihr fünfhundert Mark zu leihen. Und: Eine junge Frau erschlägt den 13-jährigen Sohn jenes Mannes, der sie mit 16 zum ersten Mal beschlief. Warum?
Drei ungewöhnliche Fälle, in denen Frauen eine maßgebliche Rolle spielten, die man ihnen gemeinhin nicht zugetraut hätte.
Kriminaloberrat a. D. Berndt Marmulla
Berlin, im März 2013
Ein Mord wie im Kino
»Der Apfel ersetzt eine ganze Apotheke.« Otto Siedler lächelt wie der leicht gelbe Kornapfel, den er seiner Nichte reicht. Das habe seine Großmutter immer gesagt, und damit hätte sie recht behalten. Jeden Tag ein Apfel, das ist die beste Altersvorsorge. »So wird man uralt.«
Über ihren Köpfen donnert ein Flugzeug im Landeanflug. Das Gebiet mit Kleingärten und Einfamilienhäusern im Nordosten Berlins liegt in der Einflugschneise von Tegel, dem Westberliner Flughafen. Die in Pankow lebenden Menschen haben sich daran gewöhnt. Berliner sind flexibel, sie stellen sich rasch auf neue Situationen ein. Als Siedler damals, im Sommer vor 22 Jahren, nicht mehr zu seiner Schwester nach Charlottenburg konnte, hatte er sich wie die vielen anderen, denen die Verwandten und Freunde in Westberlin zwangsweise abhanden gekommen waren, erst mächtig aufgeregt, dann aber geschluckt. Seit neun Jahren ist er Rentner, da stellt die Mauer kein Hindernis mehr dar. Und Rosi, seine Nichte, kommt ohne Probleme herüber. Sie musste nur das »Eintrittsgeld« zahlen, jene 25 D-Mark, welche die meisten »Zwangsumtausch« nennen – zu Recht. Bei der Einreise hat jeder aus dem Westen inzwischen diesen Betrag gegen 25 Ostmark zu tauschen. Die Maßnahme begründet man damit, dass während des Aufenthaltes in der DDR schließlich Ausgaben anfallen, etwa Restaurantbesuche und Fahrgeld für den Nahverkehr. Und diese Beträge sollen gefälligst in der gültigen Landeswährung beglichen werden. Dass seit der Einführung des beschönigend »Mindestumtausch« genannten Wegezolls dessen Höhe ständig wechselt, kann nicht mit der Inflationsrate erklärt werden. Die Einreisenden begann man 1964 zu schröpfen. Bundesbürger hatten pro Tag fünf, Westberliner drei Mark zu entrichten. Unter Honecker unterschied man nicht mehr zwischen Bundesbürgern und Westberlinern, ab 1973 hatte jeder für Reisen in die Republik zwanzig, für den Besuch der DDR-Hauptstadt zehn D-Mark zu entrichten. Später reduzierte man die Sätze, weil man in Bonn für Gut-Wetter sorgen wollte, um 1980 schließlich den Betrag dramatisch anzuheben auf eben jene stolzen 25 Mark.
Inzwischen kommt Siedlers Schwester nicht mehr, sie war erst bettlägerig, dann ist sie verstorben. Doch Rosi, ihre Tochter, besucht an Wochenenden gern Onkel und Tante in Ostberlin. Besonders im Sommer, wenn Siedler und seine Frau Elli im Garten sind. Er hatte das Grundstück gleich nach dem Krieg für’n Appel und’n Ei, wie man in Berlin sagt, erworben. In den späten 60er Jahren baute er die Laube aus, so dass sie ganzjährig draußen hätten wohnen können, wenn sie es gewollt hätten. Den Aus- und Umbau verdankte Siedler der Rekonstruktion der Werner-Seelenbinder-Halle. Dort hatte er so viel Baumaterial, vor allem Bretter, abzweigen können, dass es nicht nur für einen Geräteschuppen reichte, sondern auch für eine erhebliche Erweiterung der Laube. Das ist nun eine richtige Datsche mit fließend warmem Wasser aus dem Boiler, mit Dusche und WC und einer überdachten Terrasse. Als gelernter Maurer und Bautischler hatte er sich hier geradezu ausgetobt.
Geheizt wird mit einem Ölradiator, den er sich von einer Urlaubsreise aus der Sowjetunion mitgebracht hat. In der DDR gibt es solche elektrischen Wärmeöfen nicht, weil sie zu viel Strom fressen.
So können die Siedlers die meiste Zeit des Jahres, seit sie Rentner sind, auf dem Grundstück in Niederschönhausen zubringen. Sobald der Herbst in den trüben, ungemütlichen November eintritt, macht Siedler das Anwesen winterfest. Er baut die elektrische Pumpe aus, lässt den Kessel wie auch die Boiler und den Spülkasten leerlaufen. Anschließend nagelt er die Pressspanplatten vor die Fenster und verrammelt alle Türen. Das ist das alljährliche Ritual. Darin folgt er mehr einer Gewohnheit denn der Sorge, es könnte eingebrochen werden. Das passiert hier so gut wie nie. Erstens leben in der Nachbarschaft dauerhaft etliche Menschen, was potenzielle Diebe abschreckt. Zweitens ist in den Lauben nicht viel zu holen. Und drittens schließlich: wozu und warum? Es gibt weder Obdachlose, die ein Winterquartier suchen, noch Beschaffungskriminalität, weil es im Land keine Drogensüchtigen gibt.
»Bringst du mich nachher zum Bahnhof Friedrichstraße?« Rosi beißt kräftig in den Apfel. Er besitzt noch die fruchtige Säure eines Klarapfels kurz vor der Vollreife. Es ist nur eine Frage von wenigen Tagen, bis der Geschmack kippt. Sobald die Äpfel goldgelb ins Gras fallen, schmecken sie mehlig. Es sind die ersten Äpfel des Jahres, sie werden mit dem Korn reif, deshalb hat nahezu jeder einen solchen Baum in seinem Schrebergarten stehen. Aber sie taugen nicht zum Vermosten und nicht zum Einwecken, nicht einmal als Belag für einen Blechkuchen sind sie geeignet: zu saft- und zu geschmacklos.
»Natürlich bringe ich dich.« Siedler schnurpst ebenfalls einen Apfel. Sie hätten die paar hundert Meter auch zu Fuß bis zum S-Bahnhof Pankow-Heinersdorf laufen und von dort bis zum Grenzübergang mit der Stadtbahn fahren können. Doch irgendwie müssen die 25 Mark ausgegeben werden, da es ja sonst keine Gelegenheit dazu gibt. Morgens kommt Rosi zum gemeinsamen Frühstück, dann liegt man tagsüber in der Sonne und quatscht, pusselt in den Beeten oder vertreibt sich die Zeit mit einem Spaziergang durch die Anlage und trinkt Kaffee unterm Dach des ausladenden Walnussbaums. Später wird der Grill angeworfen und ordentlich gespachtelt: Steaks, Würste, Hühnerbeine. Was nicht verzehrt wird, kommt in Folie und anschließend in Rosis Tasche. Dort befinden sich, je nach Jahreszeit, frisches Obst und Gemüse aus dem Garten, beginnend mit Rhabarber, endend mit Grünkohl nach dem ersten Frost, im Herbst sind es sogar Kartoffeln. Denn die schmecken einfach besser. Wann also hätte sie Geld ausgeben können oder gar müssen?
So lässt sie sich denn, wie viele andere auch, für das zwangsweise eingetauschte Ostgeld mit dem Taxi kutschieren. Es langt selbst noch für die Rückfahrt, denn Taxifahren ist billig, wie alles im Osten. Es herrscht jedoch, ebenfalls typisch DDR, auch bei den Mietdroschken Mangel. Manchmal steht Rosi ewig am Bahnhof Friedrichstraße, ehe sie in der Warteschlange bis zur Bürgersteigkante vorgerückt ist und wieder mal eine Taxi vorbeikommt. Retour geht es schneller. Inzwischen fahren in Ostberlin sogenannte Funktaxis, und sofern man ein Telefon oder eine Telefonzelle in der Nähe hat, kann man ein Gefährt zu einer bestimmten Zeit ordern. Wie immer hat Onkel Otto auch heute – am letzten Julitag des Jahres 1983, einem Sonntag – längst ein Gefährt für 21 Uhr in den Garten nach Pankow-Heinersdorf bestellt.
Siedler ist kein besonders gesprächiger Mann. Die Arbeit auf dem Bau hat ihn hart und stumm werden lassen. Die meiste Zeit sitzt er schweigend neben seiner Frau, wenn diese schnattert, und starrt ins Blattwerk über dem Tisch oder lächelt seine Nichte an, die die Wortkaskaden über sich herniedergehen lässt. Offenkundig geht auch ihr die Tante auf den Geist. Elli ist Ende sechzig und sechs Jahre jünger als ihr Mann. Das Verhältnis der beiden ist nicht sonderlich innig. Man erträgt sich halt. Das liegt vermutlich an den Umständen. Nach vielen gemeinsamen Ehejahren hat man sich nichts mehr zu sagen. Positiv formuliert: Die beiden verstehen sich blind. Man kann es aber auch so sagen: Es herrscht gähnende Leere zwischen ihnen. Elli hat zeitlebens im Konsum gearbeitet und ist schlichten Gemüts, Otto war immer auf dem Bau. Worüber sollten sie miteinander reden? Sie hatten sich gefunden, als Ottos Frau verstorben und Rosi geschieden worden war. Nicht Liebe brachte sie zusammen, sondern die Not. Otto brauchte jemanden, der ihm die Sachen wusch und das Essen kochte, und Elli einen Mann, an dessen Schultern sie sich ausruhen konnte und der ordentlich Geld brachte. Sie war damals alsbald zu ihm in seine schöne Wohnung in der Richard-Sorge-Straße gezogen.
Ihre Tochter Irene hatte zunächst kritisch, gar ablehnend reagiert. Aber letztlich war es ihr egal, mit wem die Mutter zusammenlebte. Sie hatte genug mit sich selbst zu tun. Irene Krause war in der Vergangenheit wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt geraten und verurteilt worden. Ende der 60er Jahre – keine dreißig Jahre alt – musste sie wegen schweren Raubes sogar ins Gefängnis. Ihr Mann Herbert, gleich ihr dem Alkohol zugetan, trennte sich damals von ihr. Doch nachdem sie aus dem Knast gekommen war, kroch man wieder zusammen. »Pack schlägt sich, Pack verträgt sich«, urteilt der Volksmund abfällig über solche Verbindungen. Seit ihrer Entlassung führen die beiden ein nach außen wenig auffälliges Leben. Hin und wieder kommen Irene Krause und ihr geschiedener Mann in den Garten und schütten sich ordentlich beim Grillen einen auf die Lampe, um dann am nächsten Tag mit Kater zur Arbeit zu schleichen.
Tochter Marina, die sie mit 17 bekommen hat, geht schon lange eigene Wege und ist verheiratet. Wer Marinas Vater ist, kann Irene Krause nicht sagen. Sie war damals im Vollrausch von mehreren Männern nach einer Tanzveranstaltung im Friedrichshain vergewaltigt worden und konnte sich anschließend an nichts mehr erinnern. Marina, die inzwischen Meyer heißt, kommt gelegentlich mit ihrem Mann ebenfalls aufs Grundstück. Diese häufigen Zusammentreffen im Garten sind keinem ausgeprägten Familiensinn zuzuschreiben oder einer besonderen Anhänglichkeit, sondern wohl eher dem Mangel an Alternativen. Außerdem gibt es dort immer reichlich zu essen und zu trinken, was auch nicht zu verachten ist. Erstens setzt man sich an den gemachten Tisch, und zweitens hilft es sparen. So »dicke« hat es keiner von ihnen.
Otto Siedler fühlt sich bei diesen Familientreffen, ohne dass er dies konkret benennen oder an bestimmten Reaktionen hätte festmachen können, stets irgendwie ausgegrenzt. Wenn seine Frau, deren Tochter und ihre Marina die Köpfe schnatternd zusammenstecken, hält er sich von ihnen fern. Diese Weiberclique scheint ihm irgendwie fremd, auch deren Männer sind es. Er gehört jedenfalls nicht dazu. Da steht ihm seine Nichte Rosi aus Westberlin wesentlich näher. Das ist sein eigen Fleisch und Blut, gewissermaßen »seine« Familie. Die anderen sind angeheiratet. Er mag die stille Rosi wegen ihrer sanften Art. Sie arbeitet drüben als Friseuse und lebt nicht sonderlich üppig, Trinkgeld, dass hat Otto wiederholt beobachtet, wenn er in Westberlin war, gibt man dort selten. Die meisten Westberliner sind knickrig und lassen sich selbst im Restaurant bis auf den Groschen herausgeben. Im Osten ist man da erheblich großzügiger. Beim Frisör lässt man beim Hinausgehen stets unauffällig in die Tasche der Kittelschürze einen Fuffziger, wenn nicht sogar eine Mark fallen.
Obgleich die alleinstehende Rosi nicht viel hat, steckt sie Otto hin und wieder einen Schein zu. Auch vermittelt sie hin und wieder einen Job im Hause. Bei den Nachbarn ist immer etwas zu reparieren, und der Mann aus Ostberlin ist nicht nur geschickt und bringt alles wieder zum Laufen, sondern er ist vor allem preiswert. Billiger als die Handwerker, die man ruft, wenn der Abfluss verstopft ist oder die Heizung tropft, wenn das Fenster nicht schließt oder die Sicherung immer wieder herausfliegt. Otto Siedler ist clever und ausgeschlafen, im Osten hat er zeitlebens improvisiert und sich wie die meisten anderen auch selbst zu behelfen gewusst.
Die dankbaren Westberliner zahlen in bar oder mit Naturalien. Otto nimmt eine alte Bosch-Bohrmaschine ebenso erfreut als Bezahlung entgegen wie ein Kilo Bananen. Einmal schenkt ihm eine Witwe, der er die Küche und den Flur gestrichen hat, eine goldene Uhr ihres verstorbenen Mannes. Der hat davon ein Dutzend hinterlassen. Die Chronometer liegen neben anderen Erinnerungsstücken in einem Schubfach in der Vitrine nutzlos herum. Die Uhr gefällt ihm, sie macht etwas her. Und darum trägt er sie seither stolz am Handgelenk, nachdem er sie beim Uhrmacher in der Richard-Sorge-Straße fachmännisch hat reinigen und überholen lassen. Naja, mehr Schein als Sein, hatte der gesagt, als Otto das vermeintlich kostbare Stück bei ihm abholte und die Generalüberholung bezahlte. Außen hui, innen pfui. Das Gold sei auch nur ein dünner Überzug.
So hat Otto Siedler über die Jahre daheim etliche »bunte Scheine« angehäuft. Er spart für nichts und kann darum auch nicht sagen, was er damit anfangen wird. Vielleicht leistet er sich mal einen großen Farbfernseher. Die in der DDR sind ja nicht nur sündhaft teuer, sondern auch erkennbar schlechter als jene, die es drüben gibt. Aber wie bekommt er die Kiste über die Grenze und durch den Zoll? So hat er diesen Gedanken nicht weiter verfolgt und häuft stattdessen Scheinchen auf Scheinchen im Vertiko in der Stadtwohnung und lebt mit dem Wissen dahin: wenn er denn wollte, dann könnte er …
Rosi lässt den Stiel auf den kurz geschnittenen Rasen fallen und tritt ihn breit. »Noch einen?«, erkundigt sich Otto Siedler. Und als er damit Kopfschütteln auslöst, legt er nach. »Willst du ein paar mitnehmen? Wenn du das nächste Mal kommst, dann sind die bereits weg.«
»Ja, aber dafür ist dann der Boskop reif.«
»Nee, das ist ein Winterapfel. Den pflücke ich als letzten. Der schmeckt erst zu Weihnachten.«
»Ach, Onkel Otto, Weihnachten esse ich Apfelsinen aus Kalifornien und Weintrauben aus Südafrika und Äpfel aus Neuseeland.«
»Ob das so gut ist?«
»Was?«
»Dass man unabhängig von der Jahreszeit alles Obst essen kann? Das ganze Jahr Erdbeeren, Wein, Äpfel, Birnen und so weiter. Wo bleibt da die Vorfreunde nach dem monatelangen Verzicht?«
Rosi blickt nachdenklich über die Hecke in den Nachbargarten. »Das ist nicht das Problem. Erdbeeren können auch im Herbst schmecken – wenn sie denn unter der Sonne und nicht in einem holländischen Gewächshaus reifen. Die haben doch kaum Aroma und schmecken nach nichts.«
»Wie eure Schrippen. Viel Luft und noch mehr Krümel, wenn man hineinbeißt. Die haben auch keinen Geschmack.« Otto Siedler schüttelt sich, die Abneigung steht ihm ins Gesicht geschrieben.
»Jaja, du mit deinen Ostschrippen für fünf Pfennig das Stück. Das kann sich doch nicht rechnen.«
»Gewiss nicht. Aber sie schmecken.«
Auf der Terrasse hat Elli eingedeckt und ruft, dass der Kaffee fertig sei.
»Hast du den wieder mitgebracht?« Otto Siedler schaut seine Nichte fragend an. »Das sollst du doch nicht.«
»Westkaffee ist Westkaffee. Erstens schmeckt er besser als euer kosta, Rondo, Mona oder wie dieses Schrot heißt. Und zweitens ist er billiger. 125 Gramm kosta für 7,50 Mark – das sind 30 Mark fürs Pfund. Dafür zahle ich bei uns nicht einmal ein Zehntel.«
Die beiden schreiten über den Rasen wie über einen weichen Teppich. Otto wässert täglich, düngt regelmäßig und hält die Halme kurz. Der Rasen ist sein ganzer Stolz.
Die sonntägliche Kaffeetafel ist wie immer. Der Kuchen ist frisch gebacken und natürlich von Elli, der Duft des Kaffees überlagert aber den des Gebäcks. So sitzt man denn und schwätzt und schweigt, zumindest Otto sagt nichts. Irgendwann erhebt er sich und geht nach drinnen. Irgendwo auf der Welt findet immer ein Rennen der Formel 1 statt, das von der ARD übertragen wird. Das Röhren der Maschinen dringt bis nach draußen.
»Nicht so laut!«, ruft Elli, »wir verstehen unser eigenes Wort nicht.« Ihr Ton hat eine unangenehme Schärfe. Sie muss gesehen haben, dass Rosi bei ihrer heftigen Aufforderung leicht zusammengezuckt war, und meint, sich erklären zu müssen. Es sei nicht mehr viel mit ihm los, sagt sie, er gehe ihr zunehmend auf die Nerven. Im Garten kann er nicht mehr viel machen, und ein anderes Hobby habe er nicht.
Wie sie das meine, fragt Rosi ein wenig überrascht. Sie ist der festen Überzeugung, dass die beiden gut miteinander klarkämen. Wie ein altes Ehepaar eben.
Elli macht eine wegwerfende Handbewegung, als wolle sie damit sagen, das alles sei der Rede nicht wert. Doch die Nichte besitzt ein feines Gespür für Stimmungen und Verwerfungen und gibt sich damit nicht zufrieden. »Habt ihr euch gestritten?«
»Ach, Quatsch, nein. Wie kommst du darauf?«
»Nur so.«
»Nur so, nur so«, äfft die Tante sie nach. »Das kommt eben in den besten Häusern vor, dass man sich manchmal nicht mehr riechen kann. Das vergeht aber auch wieder. Bestimmt.« Und als müsse sie das bekräftigen, wiederholt sie: »Bestimmt!«
So gehen der Nachmittag und der Abend dahin. Als das letzte Stück Fleisch vom Holzkohlegrill verzehrt bzw. in Rosis Tasche verschwunden ist und die Dunkelheit sich langsam herniedersenkt, fährt der Wolga mit dem gelben Schild auf dem Dach vor. Rosi drückt die Tante zum Abschied, dann huscht sie durchs Gartentor hinaus, der Onkel folgt ihr und setzt sich auf den Beifahrersitz. »Tränenpalast«, sagt er dem Fahrer. Der stellt den Kilometerzähler auf null, denn Taxameter gibt es in der DDR nicht. Abrechnet wird nach gefahrenen Kilometern. Von hier bis zum S-Bahnhof Friedrichstraße sind es elf.
Die Tante steht am Gartentor und winkt, als sich das Taxi in Bewegung setzt. Rosi winkt zurück und atmet innerlich auf. Es ist immer wieder nett, aber es ist auch schön, wenn es vorüber ist. Viel hat man sich nicht zu sagen, und die Gespräche kreisen immer um die gleichen Themen. Gott sei Dank, vier Wochen hat sie erst mal wieder Ruhe.
Der Taxifahrer rollt die Blankenburger hinunter, biegt in die Grabbeallee ein, passiert das Rathaus Pankow und stößt dann in die Schönhauser, in deren Mitte die U-Bahn als Hochbahn verkehrt. Schließlich biegt er in die Wilhelm-Pieck-Straße, die auf die Friedrichstraße zuführt. Schon blinkt er links und brettert die einstige Berliner Vergnügungsmeile bis zum Bahnhof hinter der Weidendammer Brücke hinunter. Dort kreuzen sich S- und U-Bahn, und auch die Fernbahn hält hier an einem weißen Streifen, ehe sie weiter zum Bahnhof Zoo in Westberlin fährt.
Vorm Bahnhof steht seit 1962 ein gläserner Kasten, in dem die Ausreisekontrolle erfolgt. Draußen windet sich wie immer am Abend eine Warteschlange. Die Zurückbleibenden verabschieden sich dort von ihren Verwandten und Freunden, was der Abfertigungshalle ihren treffenden Namen gab.
Am Kopfende der Schlange ist ein Schalter, hinter dem ein Grenzsoldat sitzt, welcher als Erster einen Blick auf die Papiere wirft. Wer keinen Westpass oder als DDR-Bürger kein Ausreisevisum besitzt, wird hier bereits aussortiert. Wer gültige Reisedokumente hat, darf die Tür zum eigentlichen »Tränenpalast« passieren. Hinter der Pforte gehen einige Stufen in die Tiefe. Unten passiert man als Erstes den Zoll. Wer auffällt, darf seinen Koffer oder die Tasche auf einem der Tische öffnen. Danach geht es durch eine der vielen Schleusen, vorbei an einem Grenzer, der erhöht in einem Glaskasten sitzt. Der Durchgang links außen ist für Dienstreisende und Diplomaten. Die übrigen sind fürs Fußvolk bestimmt.
Rosi schiebt ihren Pass mit der gelben Zählkarte durch die Öffnung im Wachstand. Der Uniformierte legt die Karte beiseite, blickt aufs Passbild, dann durch die Scheibe, erneut in den Pass und lässt die obligatorische Aufforderung folgen: »Machen Se ma das linke Ohr frei.«