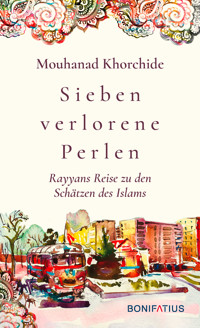Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Pilgern ist im Islam eine Selbstverständlichkeit. Mindestens einmal im Leben sollte jeder Muslim die Kaaba in Mekka umrundet haben. Doch wie sieht es eigentlich im Christentum aus? Um das herauszufinden, will Mouhanad Khorchide den Geheimnissen des Jakobswegs auf die Spur kommen. Er kauft sich ein Paar Wanderschuhe, setzt sich ins Flugzeug und macht erst einmal alles falsch. Denn das Pilgern nach Santiago de Compostela ist etwas ganz anderes als die Hadsch der Muslime. Humorvoll erzählt Mouhanad Khorchide von seinen Wegen und Irrwegen auf dem Camino, von Begegnungen und Gesprächen und davon, wie das Wandern auf dem Jakobsweg eine Reise ins eigene Ich wurde, die ihn nicht nur das Christentum, sondern auch den Islam noch einmal neu erleben ließ.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mouhanad Khorchide
Ein Muslim auf dem Jakobsweg
Pilgererfahrungen der anderen Art
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: geviert.com, Andrea Wirl
Umschlagmotiv: © naphtalina/GettyImages
E-Book-Konvertierung: Carsten Klein, Torgau
ISBN Print 978-3-451-39721-9
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83236-9
Inhalt
Wozu Wanderschuhe?
Die unerträglich laute Stille
Der Mensch, das Du und das Ich
Die Kraft der Dankbarkeit
Aus der Perspektive eines Baumes
Die Suche nach der großen Erzählung
Selbsterkenntnis oder der lange Weg, sich selbst zu lieben
Die Spiritualität des Wanderns
Mekka oder der Jakobsweg?
Reisen nach innen – Reisen zu Gott
Am letzten Tag
Auch das Scheitern gehört dazu
Dank
Über den Autor
Wozu Wanderschuhe?
Ich bin in Saudi-Arabien aufgewachsen und habe meine Eltern, die dort bis vor einigen Jahren lebten, oft besucht. Der Zugang zur Pilgerfahrt nach Mekka war daher für mich sehr leicht. Ich war mehrmals vor Ort, zu verschiedenen Zeiten und unterschiedlichen Anlässen. Und so konnte ich viele Erfahrungen und Eindrücke vom Pilgern im Islam sammeln. Pilgern im Christentum hingegen war für mich als Muslim eine fremde Welt, von der ich hier in Deutschland auch aus den Medien nur sehr wenig mitbekam. Im vergangenen Jahr hat sich das allerdings geändert.
Kurz vor den Pfingstferien erzählte mir eine Bekannte, dass sie vorhabe, zur Kathedrale in Santiago de Compostela zu pilgern. Dort befinde sich das Grab des heiligen Jakobus, eines der wichtigsten christlichen Pilgerziele. Das brachte mich auf eine Idee: Warum nicht mal etwas ganz anderes ausprobieren? Als Muslim an einer christlichen Wallfahrt teilzunehmen, wäre sicherlich ein spannendes Erlebnis. Da ich mich überarbeitet fühlte, könnte mich diese neue Erfahrung, die sicher auch eine große Herausforderung wäre, aus dem Alltagsstress herausholen und mir guttun. Die Pfingstwoche war vorlesungsfrei. Für mich als Dozent an der Universität bedeutete das eine fast terminfreie Woche. Und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren ohnehin im Urlaub, ich konnte also eine ganze Woche abwesend sein, ohne dass die Arbeit darunter leiden würde.
Und so entschied ich mich, nach Santiago de Compostela zu pilgern. Allerdings hatte ich absolut keine Ahnung, wie eine christliche Pilgerfahrt abläuft. Ich wusste nicht einmal, wo Santiago de Compostela überhaupt liegt. Schnell gegoogelt: Es ist die Hauptstadt der Autonomen Gemeinschaft Galicien und hat rund 96 000 Einwohner. Aha, es geht also nach Spanien. Ich buchte einen Flug dorthin, und zwar über Madrid, was etwa 600 Kilometer von meinem Ziel entfernt liegt – und für eine Woche später einen Rückflug. Ich war so naiv und ahnungslos, was die christliche Pilgerfahrt betraf, dass ich alles, was ich über die islamische Pilgerfahrt nach Mekka wusste, einfach auf mein neues Vorhaben projizierte.
Muslimische Pilger fliegen nach Jeddah, einer Stadt im Westen Saudi-Arabiens, und fahren anschließend mit dem Bus in etwa einer Stunde zum etwa neunzig Kilometer entfernten Mekka. In Mekka vollzieht man dann die Rituale der Pilgerfahrt. Diese beginnen mit der siebenmaligen Umrundung der Kaaba, dem schwarzen Würfel, der nach islamischer Überlieferung durch den Propheten Abraham und seinen Sohn Ismail erbaut worden ist.
Ähnliches erwartete ich auch bei der christlichen Pilgerfahrt. Ich würde in der Stadt Santiago de Compostela ankommen und dann zu der Kathedrale gehen, um dort bestimmte Pilgerrituale zu vollziehen – dachte ich zumindest. Ich hatte keine Zeit, mich vorher genauer zu informieren, wusste nicht, welche Rituale mich erwarten würden. Aber egal: »Ich werde mich einfach vor Ort informieren und mich irgendeiner Gruppe anschließen – genauso, wie es viele Pilger in Mekka machen«, sagte ich mir ganz optimistisch. Ich stellte mir vor, man würde zum Beispiel das Grab des heiligen Jakobus ein paarmal umrunden und bestimmte Gebete sprechen. Sollten sich Gebete um die Dreifaltigkeit drehen, würde ich sie für mich als Muslim einfach anders deuten, zum Beispiel im Sinne der unterschiedlichen Seiten von Gott.
Ja, Gott ist zwar nur einer, aber er überrascht uns Menschen mit seinen unterschiedlichen Facetten. Immerhin wird er im Koran als der Erste und dennoch Letzte, der Sichtbarste und dennoch Verborgenste beschrieben. Er ist transzendent, aber uns Menschen näher als die Halsschlagader (Koran 50:16). Trinität ist für mich daher nichts anderes als der symbolische Ausdruck dieser Vielfalt Gottes, sie steht aber auch für sein ewiges Interesse an uns Menschen, an der Beziehung zu uns, denn Vielfalt in Gott bedeutet, dass Gott so etwas wie eine innere Beziehung in sich selbst besitzt. Gott ist, wenn man das so sagen kann, ein Beziehungswesen.
Ich fand auch den christlichen Gedanken sehr interessant, wonach Gott als Mensch in unsere menschliche Welt gekommen ist und sich, indem er Mensch geworden ist, auf uns Menschen eingelassen hat. Wie ein mächtiger König, der aus freien Stücken entscheidet, auf seinen Thron zu verzichten, um als »normaler« Mensch eine Beziehung mit anderen einzugehen. Was für ein bescheidener Gott! Er demonstriert nicht Macht und Kontrolle, sondern Beziehungswillen zu uns Menschen und somit Liebe. Also sah ich absolut keinen Grund, warum ich ein christliches Gebet nicht mitsprechen sollte. Ich kann sogar das Vaterunser genauso gut wiedergeben wie die al-Fatiha, jene Sure, die wir Muslime in jeder Gebetseinheit wiederholen und die fast jeder Muslim auswendig kann.
Etwa eine Woche vor meiner Abreise rief mich meine Mutter aufgeregt an. Sie beklagte, dass ihr die goldfarbene Wolle zum Häkeln ausgegangen sei und sie nun die Tischdecke doch zweifarbig häkeln müsse: »Ob die versprochene Decke deiner Schwester trotzdem gefallen wird?«, wollte sie von mir wissen. Keine geeignete Wolle mehr zu haben, glich für sie einer Katastrophe.
»Mach dir keine Sorgen, Mama, die Tischdecke wird Maya auch zweifarbig sehr gut gefallen.«
»Das sagst du nur, um mich zu beruhigen, das finde ich nicht nett von dir.«
Mit viel Mut unterbrach ich ihren beginnenden Monolog zum Thema Häkeln beim Weltuntergang: »Mama, ich werde nächste Woche pilgern fahren.«
»Was ist los mit dir? Die Hadschzeit ist doch erst im Juli. Das ist erst in zwei Monaten.«
»Ich werde zum heiligen Jakobus pilgern.«
Meine Mutter erwiderte mit erschrockener Stimme: »Herr, vergib uns! Was für ein heiliger Jakobus? Das ist etwas Christliches, oder? Bist du jetzt zum Christentum konvertiert?! O Herr, ich bitte um deine Gnade! Bitte erzähl das deinem herzkranken Vater nicht, das würde ihn umbringen. Und mich bringst du auch gleich um.«
»Nein, Mama! Ich bin nicht zum Christentum konvertiert.«
Ich nuschelte leise, damit meine Mutter meinen frechen Kommentar nicht hörte: »Außerdem, selbst wenn, wo ist das Problem?«
Mit lauter Stimme fuhr ich fort: »Ich will als Muslim eine christliche Pilgerfahrt erleben.«
»Also bist du noch Muslim?«
»Ja, Mama, ich bin noch Muslim.«
»Gott sei Dank! Und du kommst auch als Muslim zurück! Bitte versprich mir das!«
»Ja, ja, ich werde mir Mühe geben.«
»Du weißt, Jesus ist ein Prophet und kein Gott!«
»Ja, Mama, Jesus ist nicht Gott.«
»Außerdem wurde er nicht gekreuzigt.«
»Okay, von mir aus, dann wurde er eben nicht gekreuzigt.«
»Mouhanad, ich meine das ernst, der Mann wurde wirklich nicht gekreuzigt!«
Wieder nuschelte ich leise: »Du warst nicht dabei, Mama, keiner von uns war dabei, woher willst du wissen, was wirklich Sache ist?!«
»Und Mouhanad! Noch etwas …«
Ich unterbrach an dieser Stelle das Telefonat, bevor ich durchdrehte: »Mama, wir hören uns, wenn ich zurück bin. Salam.«
»Salam, aber versprich mir …«
»Ja, Mama, ich bleibe ein Muslim.«
»Aber …«
Nichts aber. Ich habe nicht mehr gehört, was meine Mutter sagte. Irgendwie können meine Eltern es nicht richtig begreifen, dass ihr Sohn seit fast fünfzehn Jahren Professor der islamischen Theologie ist und sich seit dreißig Jahren intensiv mit dem Islam auseinandersetzt, weshalb er wohl doch ein bisschen Ahnung von dem Ganzen hat. Nein, Professor Khorchide ist und bleibt für immer der junge unbeholfene Mouhanad. Mein Vater denkt bis heute, dass meine Arbeit nur darin bestehe, Menschen zum Islam zu konvertieren. Jedes Mal heißt es am Telefon: »Bitte schau, dass du den Menschen erzählst, wie wunderbar der Islam ist, und dass er die einzig richtige Religion ist. Sie sollen den Islam annehmen, sonst werden sie in der ewigen Hölle landen. Und solltest du Fragen haben oder Hilfe benötigen, dann melde dich bei mir.« Das sagt ausgerechnet mein Vater, der kaum ein Buch über den Islam und auch den Koran nicht komplett gelesen hat.
Als vor etwa fünf Jahren mein gemeinsames Buch mit dem katholischen Theologen Klaus von Stosch zum Thema Jesus im Koran erschienen war, verstrickte ich mich unglücklicherweise in eine unangenehme Diskussion mit meinem Vater. Für ihn war klar: »Der Koran kritisiert ganz eindeutig und ohne Wenn und Aber den Glauben der Christen.«
»Aber Papa, so pauschal kann man das nicht sagen. Den Christen wird im Koran sogar die ewige Glückseligkeit versprochen. Was der Koran kritisiert, sind meist Dinge, die die Christen selbst kritisieren würden, zum Beispiel ein Drei-Gott-Glaube. Oder dass Jesus der biologische Sohn Gottes sei. Diese koranische Kritik hat nichts mit dem christlichen Glauben zu tun.«
»Doch, doch, Christen glauben an drei Götter, sie sind Polytheisten, das sagt der Koran und kritisiert es zugleich. Ja, und der Koran sagt, dass Gott keine Frau hat, wie kann er dann ein Kind gezeugt haben?«
»Siehst du, der Koran spricht von einem biologischen Zeugungsakt. Das entspricht doch nicht dem christlichen Glauben.«
»Doch, doch, der Koran irrt sich nicht, du hast nur keine Ahnung vom Christentum, Mouhanad.«
»Der Koran spricht offensichtlich von irgendwelchen christlichen Sekten oder von Fehlentwicklungen bei einigen christlichen Gruppierungen. Aber er macht sicher keine allgemeinen Aussagen über das Christentum und betreibt schon gar keine Pauschalkritik. Ich kenne keinen Christen, der an drei Götter glaubt. Schau mal, Vater, ich gebe dir ein anderes Beispiel: In Sure 9 Vers 30 heißt es, dass die Juden Gott einen Sohn namens Esra zugeschrieben haben. Aber es gibt keine Juden, die an so etwas glauben. Das, was der Koran hier kritisiert, sind bestimmt auch nur kleine Gruppen von Menschen, die sich selbst dem Judentum zuschreiben, aber an etwas geglaubt haben, das mit dem Judentum nicht vereinbar ist.«
»Mouhanad! Du willst jetzt nicht sagen, dass sich der Koran irrt, oder? Wenn es im Koran so steht, dann wird es so sein. Wenn dort stehen sollte, dass die Juden daran glauben, dass sie Esra zum Sohn Gottes genommen haben, dann werden sie dies auch so getan haben und tun!«
Spätestens an solchen Stellen schaltet sich zum Glück meine Mutter in die Gespräche ein, um durch irgendetwas, zuweilen auch Absurdes, abzulenken und eine Eskalation zu verhindern.
»Stimmt es eigentlich, dass Qaddafi doch noch lebt?«
Mein Vater, der immer politisch interessiert war, sprang aus dem Sessel: »Was?! Wo hast du das gehört? Gib mir schnell die Fernbedienung! Wann kommen die Nachrichten?«
Es dauerte danach Tage, bis mein Vater die Suche nach Qaddafis angeblichem Überleben aufgibt.
Wenn man diese Verhältnisse in unserer Familie kennt, kann man die Sorge meiner Mutter verstehen, dass mein Vater auch nur irgendetwas von meinem häretischen Pilgervorhaben erfährt. Schon sehr oft konnte ich beobachten, dass die Menschen im Orient in den Augen ihrer Eltern unmündige und unbeholfene Kinder bleiben, egal, wie alt sie sind. Es sind zementierte Hierarchien. Daher wird es, wenn es um die Demokratisierung dieser Länder geht, nicht viel bringen, die Spitze eines Regimes oder sogar das Regime selbst zu stürzen und es durch andere Akteure auszutauschen. Saddam Hussein, Mubarak, Qaddafi und viele andere wurden gestürzt, und auch der säkular ausgerichtete Schah Irans wurde 1979 durch die iranische Revolution verjagt. Doch die Alternativen, die dann an die Macht kamen, waren genauso problematisch, wenn nicht sogar problematischer. Denn die Strukturen der Unterdrückung sind längst in den untersten Ebenen dieser Gesellschaften verankert, bis in die Familien hinein. Es sind Strukturen, die den Menschen als selbstbestimmtes Individuum aus den Augen verloren haben. Althergebrachte Traditionen, Bräuche, bestimmte Vorstellungen von Geschlechterrollen und starre Hierarchien schreiben vor, was richtig und was falsch, was gut und was schlecht ist. Um eine Demokratisierung »von unten« etablieren zu können, muss es erst gelingen, diese Strukturen aufzubrechen. Das ist kein Akt von wenigen Jahren, sondern ein Prozess, der Generationen andauern wird.
Aber ich schweife ab, zurück zu meinem ambitionierten Vorhaben …
Am Wochenende vor der Abreise musste ich bei uns an der Universität Münster ein Seminar für Imame und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter abhalten, die im muslimischen Kontext beschäftigt sind und bereits im Berufsleben stehen. Eine Art Weiterbildungsmaßnahme. Im Verlauf des Studiengangs wurde deutlich, wie weit viele Imame in ihrem Denken und Sprechen über den Islam von der Lebenswirklichkeit der Menschen hier in Deutschland entfernt sind. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter waren hingegen stärker bemüht, diese zu berücksichtigen. Ging es zum Beispiel um sensible Fragen wie Homosexualität oder interreligiöse Heirat, wussten die Imame ganz selbstverständlich: »Wenn jemand zu mir kommt und meint, er sei homosexuell, dann sage ich ihm, dass dies im Islam verboten ist und er es deshalb sofort unterlassen muss, sonst droht ihm eine jenseitige göttliche Strafe. Und wenn eine muslimische Frau mich fragt, ob sie einen Nichtmuslim heiraten darf, dann mache ich ihr unmissverständlich klar, dass dies nicht geht. Der Islam verbietet muslimischen Frauen, nichtmuslimische Männer zu heiraten. Und so ist das Problem aus der Welt.« Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter hingegen protestierten bei solchen Antworten: »So einfach ist das nicht, Herr Imam. Es ist doch niemandem geholfen, wenn man ihm sagt, was in der Religion angeblich erlaubt ist und was nicht. Ein homosexueller Mensch wird nicht aufhören, homosexuell zu sein, nur weil er zu hören bekommt, dies sei verboten. Wir müssen die Menschen würdigen, so wie sie sind, wir müssen sie ernst nehmen und ihnen dabei helfen, Wege zu finden, wie sie zum Beispiel mit ihrer Homosexualität Anerkennung und Respekt in den eigenen Familien und in der Gesellschaft finden.«
So entwickelten sich jedes Mal spannende Diskussionen zwischen beiden Lagern. Am Ende waren die Imame stärker für die Wünsche und Neigungen der Menschen sensibilisiert, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter hingegen konnten die religiösen Anliegen der Imame besser verstehen. Diese Erfahrungen führten mich zu dem Schluss, dass Religion in der Ausbildung zur Sozialarbeit einen viel größeren Stellenwert bekommen sollte. Und die Sozialarbeit müsste sich neu definieren, indem sie sich auch als Impulsgeberin für eine kritische Auseinandersetzung mit religiösen Fragen versteht. Dies teilen aber nicht alle, die in der Sozialarbeit tätig sind. Gerade Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die mit weniger religiösen Menschen zu tun haben, können nicht nachvollziehen, wieso wir von Religion als Ressource in der Sozialarbeit reden und wieso sie sich überhaupt mit Religion auseinandersetzen müssen.
Schon wieder, der Orientale in mir schweift immer wieder ab von der eigentlichen Erzählung, weshalb ich mich jetzt disziplinieren und wieder auf meine Pilgererfahrungen konzentrieren werde.
Das Wochenendseminar begann am Samstagmorgen und endete am Montag, dem Tag meiner Abreise, um zwölf Uhr. Um 16 Uhr sollte mein Flieger in Düsseldorf starten. Ich hatte also kaum Zeit, um mich auf die Reise vorzubereiten, und so überließ ich alles dem Schicksal. Lediglich am Freitagnachmittag hatte ich in die Google-Suche eingegeben: »Vorbereitung auf Pilgern nach Santiago de Compostela.« Ich hoffte auf den einen oder anderen Tipp, um nicht komplett ins kalte Wasser springen zu müssen. Als Ergebnis erhielt ich zunächst sehr viele Reiseanbieter, die günstige Hotels für Pilger organisieren. Mein Hotel hatte ich aber bereits gebucht. »Vergessen Sie nicht, gute Wanderschuhe mitzunehmen«, lautete eine Empfehlung. »Wanderschuhe? Wozu?«, fragte ich mich. Aber gut. Am Samstag besorgte ich mir während der Mittagspause in einem Sportgeschäft in der Münsteraner Innenstadt die Schuhe. »Vielleicht muss man das Grab des heiligen Jakobus ähnlich wie die Kaaba in Mekka in großem Abstand mehrfach umrunden, deshalb die Wanderschuhe«, grübelte ich in völliger Naivität. Um sie einzulaufen, erschien ich am Sonntag und Montag mit meinen Wanderschuhen zu besagtem Kurs. Eine Teilnehmerin sprach mich in der Pause darauf an:
»Gehen Sie nachher noch wandern, Herr Khorchide?«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Weil Sie Wanderschuhe tragen«, sagte sie lachend.
»Ach so, woran haben Sie das denn erkannt?«
»An den dicken Sohlen, die sind typisch für Wanderschuhe, weil sie die Schritte gut dämpfen.«
In dem Moment wurde ich sehr verlegen. Nicht nur, weil ich offensichtlich keine Ahnung von Wanderschuhen oder überhaupt von Schuhen hatte. Ich besitze lediglich zwei Paar derselben Marke und Farbe, die ich abwechselnd trage und traditionell jedes Jahr neu kaufe – und das, seitdem ich in Münster lebe, also seit dreizehn Jahren. So muss ich mir nie Gedanken über Schuhe machen. Übrigens gehe ich mit fast allen Dingen des alltäglichen Lebens so um: einfach die gleichen Hosen, Hemden und Jacken und dieselben Essensrituale. Vielleicht war ich auch deshalb so verlegen, weil ich nicht ausgerechnet vor einer Gruppe von Imamen und muslimischen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern erzählen wollte, dass ich vorhatte, eine christliche Pilgerfahrt zu machen. Schnell erfand ich eine Begründung, die die Bedeutung meines Vorhabens ein wenig relativieren und mich vor ideologischer Kritik bewahren sollte:
»Ja, ich möchte die Möglichkeiten eines interreligiösen Pilgerns untersuchen und schaue mir dafür eine christliche Pilgerfahrt genauer an. Ich pilgere also nicht wirklich, sondern sehe mich vielmehr in der Rolle des Beobachters.«
Warum war ich verlegen? Weil ich meinte, mich als Muslim für eine christliche Pilgerfahrt rechtfertigen zu müssen. Ich wusste selbst nicht mehr genau, was mich zu dieser kurzfristigen Entscheidung bewogen hatte. Vielleicht war es einfach meine Neugierde, vielleicht aber auch ein innerer Drang, dem Alltagsstress zu entfliehen. Oder war es eine verborgene Sehnsucht nach einer intensiven Erfahrung der anderen Art? Ich kann es nicht sagen.
Gegen 21 Uhr kam ich in Santiago de Compostela an. Da war ich nun und wollte direkt in die Kathedrale gehen. Der Haupteingang war verschlossen. Aber ich sah viele Menschen, die sich auf dem großen Platz vor der Kathedrale versammelt hatten. Einige fotografierten, andere unterhielten sich, und viele lagen einfach nur erschöpft am Boden. Man hörte sehr viele Sprachen, und ich spürte: Hier sind Menschen aus aller Welt. Es glich ein wenig den Bildern, die ich auch aus Mekka kannte. Nur ist dort die Heilige Moschee 24 Stunden am Tag geöffnet, und man sieht zu jeder Tages- und Nachtzeit Menschen, die beten oder die Kaaba umrunden. Hier auf dem Platz vor der Kathedrale betete niemand. Man hatte eher den Eindruck, als handele es sich um Touristen, die vor der Kathedrale entspannt den Abend genießen wollten. Ich dachte mir nichts dabei und spazierte in die Menge, in der Hoffnung, ich würde jemanden Deutsch, Englisch oder Arabisch sprechen hören, um mich über die Details der Pilgerfahrt zu informieren. Eine Gruppe junger Leute, die sich auf Deutsch unterhielten, stand plötzlich neben mir.
»Entschuldigt bitte, ich bin eben erst angekommen und habe gehofft, in die Kathedrale gehen zu können. Wisst ihr, ab wann sie morgen wieder geöffnet ist?«
»Zuerst gratulieren wir dir. Du siehst gar nicht so erschöpft aus wie wir. Wir sind gestern angekommen.«
Merkwürdig. Wieso sollte ich von einem Flug von Düsseldorf über Madrid nach Santiago de Compostela erschöpft sein?
»Mein Flug war ganz angenehm, ich bin von Düsseldorf mit einem Zwischenstopp in Madrid hierhergeflogen. Eure Anreise scheint länger gedauert zu haben, woher seid ihr?«
»Ach so, du bist gar kein Pilger, du bist als Tourist hier. Wir sind Pilger und vor neun Tagen von Sarria gestartet und, wie gesagt, erst gestern hier angekommen. Morgen fliegen wir dann zurück.«
Ich verstand gar nichts. Wieso waren sie in Sarria gestartet und flogen gleich am nächsten Tag wieder zurück? Ich fragte erstaunt: »Ihr pilgert also nur heute in Santiago de Compostela, und morgen geht es schon zurück nach Deutschland?!« Sie schauten sich irritiert an, als würden sie sich fragen: »Was ist denn mit dem los?!«
Eine junge Frau aus der Gruppe setzte noch einmal an: »Wir sind schon den Pilgerweg von Sarria aus gegangen, also sind wir fertig mit dem Pilgern. Wir waren zehn Tage unterwegs, voll anstrengend.«
Langsam begann ich zu verstehen: »Bitte entschuldigt meine blöden Fragen. Ich dachte wirklich, man pilgert hier in Santiago de Compostela, ähnlich wie bei Muslimen in Mekka, wo man pilgert, indem man bestimmte Rituale vollzieht.«
Spätestens jetzt hatte die Gruppe verstanden, dass sie es mit einem ahnungslosen Möchtegernpilger zu tun hatten: »Wie heißt du?«
»Mouhanad. Ich bin Muslim und wollte mal eine christliche Pilgerreise machen. Dafür bin ich heute hier angekommen.«
»Schau mal, Mouhanad«, sagte die nette junge Frau geduldig. »Santiago de Compostela oder, besser gesagt, das Grab des Apostels Jakobus in der Kathedrale ist das Ziel eines langen Pilgerwegs. Dieser beginnt eigentlich in Frankreich in den Pyrenäen und ist etwa 800 Kilometer lang. Dafür würde man um die vierzig Tage benötigen. Wenn man als Pilger gelten will, der den Jakobsweg gegangen ist, muss man mindestens die letzten hundert Kilometer auf dem Jakobsweg gegangen sein. Man erhält dann sogar eine offizielle Urkunde. Darum starten viele – wie wir – in Sarria.«
Erst jetzt begann ich zu verstehen. Mir wurde klar, warum immer wieder von einem Pilgerweg beziehungsweise vom Wandern nach Santiago de Compostela die Rede war. Anders als bei der Pilgerfahrt nach Mekka stehen nicht die Kathedrale, nicht das Grab des Apostels, nicht irgendwelche Rituale im Mittelpunkt, sondern der Weg selbst ist das Ziel. Jeder Mensch gestaltet dabei seine eigene, ganz individuelle Art, den Weg zu bestreiten. Und endlich begriff ich, was es mit den Wanderschuhen auf sich hatte. Meine Neugier war aufs Neue geweckt.
Ich stornierte die für die nächsten Tage gebuchten Übernachtungen in Santiago de Compostela und beschloss, den Pilgerweg zu gehen, allerdings in umgekehrter Richtung. Statt von Sarria nach Santiago de Compostela zu pilgern, wollte ich von Santiago de Compostela nach Sarria wandern. Keine schlechte Entscheidung, denn wie ich feststellen sollte, konnte ich gerade durch diese umgekehrte Pilgerrichtung sehr viele Pilger treffen, die mir entgegenkamen, und mit einigen von ihnen kam ich ins Gespräch. Jede Person, mit der ich sprach, hatte eine eigene Geschichte und ein eigenes Motiv für ihren Weg nach Santiago de Compostela. Anders als bei der mir vertrauten Pilgerfahrt nach Mekka, in der ich mir immer Sorgen machte, alle Bewegungen und alle Rituale richtig zu absolvieren, geht es hier um eine individuelle Reise nach innen. Ich hatte sogar den Eindruck, dass das Grab des Apostels für kaum jemanden wirklich von Interesse war. Es ging den Menschen viel mehr um die Reise zu sich selbst.
Die unerträglich laute Stille
Los ging es! Am ersten Tag meiner Pilgerreise stand ich, bestens motiviert und sportlich angezogen, schon um sieben Uhr am Startpunkt. Meine fünftägige Tour konnte beginnen. Am Vortag hatte ich sogar ein T-Shirt mit dem Schriftzug »Der Weg ist das Ziel« gefunden – und natürlich sofort gekauft. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir noch keine Gedanken über diesen Slogan gemacht, Hauptsache, ich trug ein Pilgershirt unter der Jacke. Jetzt hing der schwere Rucksack auf dem Rücken, und auch die Wanderschuhe saßen perfekt. Sie sahen gar nicht schlecht aus, und ich genoss die zusätzlichen fünf Zentimeter Größe. Ich steckte meinen Notizblock und einen Stift in die Seitentasche des Rucksacks und machte mich auf den Weg. In den Pausen, so war mein Plan, würde ich meine Begegnungen und Gedanken notieren.
Um den Weg zu finden, folgte ich dem Ratschlag des netten Mannes von der Hotelrezeption: »Sie werden auf dem Boden in kurzen Abständen eingravierte beziehungsweise gemalte blau-gelbe Muscheln sehen. Man nennt diese Muscheln die Jakobsmuscheln. In ganz Europa dienen sie als Wegweiser. Die gelbe Muschel, meist auf blauem Grund, weist den Jakobspilgern den Weg und lässt außerdem erkennen, durch welche Städte und Ortschaften der Jakobsweg führt.«
Meine Neugier war geweckt: »Und warum ausgerechnet eine Muschel?«
»Als die Leiche des Jakobus auf dem Seeweg nach Spanien überführt wurde, ritt ein junger Ritter dem Schiff entgegen. Das Pferd scheute beim Anblick des heiligen Leichnams, und der Ritter versank im Meer. Jakobus, so wird erzählt, rettete den Mann auf wundersame Weise. Und als der Ritter wieder auftauchte, war er übersät von Muscheln. Seitdem gilt die Muschel als Schutzsymbol und Erkennungszeichen der Pilger. Es ist die Jakobsmuschel.«
Das ist sicherlich eine von vielen Legenden, dachte ich mir. Und bei uns Muslimen ist es nicht anders. Man sieht die Pilger in Mekka, wie sie versuchen, den kleinen schwarzen Stein zu berühren, um dadurch Segen zu erlangen. Dieser schwarze Stein ist mit Silber umhüllt und in der südöstlichen Ecke der Kaaba platziert. Die Kaaba selbst ist der große schwarze Würfel, den man als Pilger siebenmal umrundet. Erbaut wurde sie laut dem Koran vom Propheten Abraham und von dessen Sohn Ismail. Und bereits zu vorislamischer Zeit pilgerten die Menschen nach Mekka und umrundeten dabei die Kaaba siebenmal gegen den Uhrzeigersinn. Allerdings beteten sie damals nicht nur den einen Gott im Himmel an, sondern auch weitere Figuren, die sie aus Steinen bauten und als Götter verehrten. Der Prophet Mohammed rief sie zum Monotheismus, sie sollten nur zu einem Gott im Himmel beten und zu ihm pilgern.
Der Legende nach ist der kleine schwarze Stein vom Paradies herabgefallen, weswegen viele Pilger vom Wunsch erfüllt sind, ihn zu berühren oder zu küssen. Allerdings kann bei mehreren hunderttausend Pilgern der Versuch, zum schwarzen Stein zu gelangen, lebensbedrohliche Ausmaße annehmen. Das musste ich, als ich im Jahre 1997 von Wien aus nach Mekka pilgerte, am eigenen Leibe erfahren, obwohl ich damals gar nicht vorhatte, den schwarzen Stein zu berühren. Allerdings kam ein Mitglied nach dem anderen meiner Pilgergruppe zu mir und erzählte stolz, wie er es zum schwarzen Stein geschafft hatte. Jeder begann seinen Bericht mit: »Dank Gottes Gnade wurde es mir ermöglicht, den schwarzen Stein zu berühren.« Das setzte mich unter Druck. Wobei man sich diesen Druck selbst macht: »Wenn es Gottes Gnade ist, die es ermöglicht, dann muss ich mir beweisen, dass auch ich von dieser Gnade erfasst bin. Gott wird es sicherlich auch mir erlauben und ermöglichen, den schwarzen Stein zu berühren.«
Obwohl ich damals mit 27 Jahren ein junger, starker Mann war, hatte ich bei meinem Versuch, zum schwarzen Stein zu gelangen, das Gefühl, von allen Seiten erdrückt zu werden und keine Luft mehr zu bekommen. Schon bei der Vorbereitung auf die Pilgerfahrt warnte man uns: »Sollte dir beim Umrunden der Kaaba etwas auf den Boden fallen, deine Uhr oder dein Geld, dann komm bloß nicht auf die Idee, es aufzuheben. Der Strom Hunderttausender Pilger wird nicht für dich stehen bleiben, er geht weiter, und du bist in wenigen Sekunden unter den Füßen Zehntausender.« Und in der Tat merkt man beim Umrunden der Kaaba, wie die eigenen Füße manchmal den Boden nicht mehr berühren und man dennoch mit auf der sich bewegenden Menschenwelle schwebt.
Eine der bekanntesten Legenden, die man schon in der Grundschule hört, ist die Erzählung, dass zwei Engel dem Propheten Mohammed, als er fünf Jahre alt war, die Brust öffneten, sein Herz herausnahmen und es in einem Eimer Wasser wuschen, weshalb der Prophet ein reines Herz hatte. Schon damals ärgerte ich meinen Religionslehrer mit einer kritischen Rückfrage: »Wie kann aber der Prophet Mohammed für uns Muslime ein Vorbild sein, dem wir folgen sollen, wenn er auf diese wundersame Weise ein reines Herz bekommen hat, wir jedoch hart an uns arbeiten müssen, um unseren Charakter und unser Gewissen zu läutern? Um ein Vorbild zu sein, hätte er ebenfalls hart an sich arbeiten müssen.« Mit solchen Fragen habe ich einige meiner Religionslehrer zur Verzweiflung getrieben: »Mouhanad, das ist eine Geschichte, die der Prophet selbst über sich erzählte. Hier gilt es, alles so zu akzeptieren, wie der Prophet es verkündet hat.«