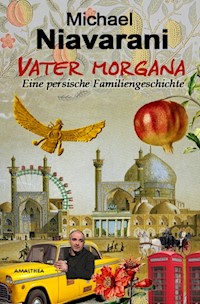Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Es erwartet Sie eine lange Nacht der Geschichten und wahnwitzigen Fakten über uns Menschen, die wir eines Tages von den Bäumen gestiegen und seither wild entschlossen sind, die Welt zu verbessern. Eine Reise durch das Elend der Existenz und die Narrheiten, die wir anstellen, um es zu ertragen. Der Versuch, ein für alle Mal zu klären, ob das Leben eine Tragödie oder eine Komödie ist. Da will eine Witwe nicht vom Leichnam ihres Mannes lassen, ein Narr seinen Herzog von der Melancholie heilen und ein König eine Reise zu Gott unternehmen. Freunde werden sich nach langer Zeit wiedersehen, ohne zu wissen, dass es ihr letztes Treffen sein wird. Ich werde Ihnen ein paar persönliche Geheimnisse über meine Liebe zu Shakespeare und Rosalinde verraten. Und Sie werden meinen entzückenden Badehüttennachbarn vom Neusiedler See kennenlernen."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Niavarani
Ein Trottel kommt selten allein
Bildnachweis
KHM-Museumsverband (42, 256, 340), Bildvorlagen aus dem Archiv des Amalthea Verlages (48, 64, 88, 89, 230), Bridgeman Images (74), Österreichisches Staatsarchiv/Haus-, Hof- und Staatsarchiv (75), IMAGNO/Austrian Archives (111, 146), Erich Lessing/picturedesk.com (312), Science Source/PhotoResearchers/picturedesk.com (317)
Aus dem Privatbesitz von Michael Niavarani:
Sonnenuntergang am Neusiedler See (10)
Thesaurus Pauperum. Einn fürtrefliche und volkomne Haußapoteck / gmeiner gbreuchlicher Artzney / zu ieden leibsgebrechen / für all getrewe leibärzt / fürnemlich aber für dz armlande volck / unnd gemeynen man. Von Hieronymo Braunschweig antaggeben. Franckfurt Chr. Ege. 1537 (282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290)
Alt- und Neues Wien, Oder Dieser Kayserlich- und Erz-Lands-Fürstlichen Residenz-Stadt Chronologisch- und historische Beschreibung Von den mittleren- Biß auf gegenwärtige Zeiten. Anderer Theil. Aus verschiedenen bewehrten Auctoribus, und andern sicheren Nachrichten, zusamm getragen, und mit mehreren Kupfern herausgegeben; Von P. Mathia Fuhrmann. Wien/Linz 1739 (296, 297, 298, 299, 300)
Der Verlag hat alle Rechte abgeklärt. Konnten in einzelnen Fällen die Rechteinhaber der reproduzierten Bilder nicht ausfindig gemacht werden, bitten wir, dem Verlag bestehende Ansprüche zu melden.
Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at
© 2017 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker/OFFBEAT
Umschlagabbildungen: Vorderseite: Der Hofnarr Stanczyk (1480–1560)
© IMAGNO/Austrian Archives. Rückseite: © Jan Frankl
Lektorat: Martin Bruny
Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
Gesetzt aus der Goudy Old Style 11,25/14,5 pt
Gedruckt bei Christian Theiss GmbH, St. Stefan im Lavanttal
ISBN 978-3-99050-066-8
eISBN 978-3-903083-67-7
Inhalt
INächtliche Begegnung, unter anderem mit einem Igel
IIAgrippina, die Witwe von Ephesus
IIINächtliche Begegnung, bei der es zur Obduktion eines Witzes kommt
IVNarrheiten
VNächtliche Begegnung auf der Schaufel des Todes
VIUm Gottes willen
VIINächtliche Begegnung mit einer grauen Zukunftsvision
VIIIDie Doppelgänger
IXNächtliche Begegnung mit einem schwarzen Huhn am Kopf
XAus Liebe zu Shakespeare
XINächtliche Begegnung, diesmal sehr kurz
XIIDie letzten 24 Stunden
XIIIAm nächsten Morgen
Danke!
Das ist ein hässliches Gebrechen,wenn Menschen wie die Bücher sprechen.Doch reich und fruchtbar sind für jedendie Bücher, die wie Menschen reden!
Oscar Blumenthal, 1897
I
Nächtliche Begegnung, unter anderem mit einem Igel
Wie so oft fiel es mir schwer, einzuschlafen. Selten kommen Schafe an mein Bett, die gern wissen würden, wie groß ihre Zahl ist. Schäfchenzählen. Ich habe es versucht. Davon werde ich jedoch noch wacher. Es hat auf mich eine ähnliche Wirkung wie ein doppelter Espresso. Ich möchte unbedingt wissen, wie viele Schäfchen es insgesamt sind. Ist es eine kleine Herde oder eine wahre Völkerwanderung von Schäfchen? Außerdem komme ich regelmäßig durcheinander, weil sie natürlich herumlaufen, wie sie wollen, und ich manche doppelt zähle. Dann muss ich von vorne beginnen, und im Handumdrehen ist es sechs Uhr früh.
Schäfchen besuchen mich, wie gesagt, kaum, wohl aber ganze Herden von Gedanken, die sich damit beschäftigen, was ich tagsüber alles erledigen hätte sollen. Wo sind diese Gedanken am Nachmittag, wenn ich sinnlos auf der Couch liege und mich durch die nachmittägliche Ideenlosigkeit des Fernsehens zappe? In der Nacht aber, da melden sie sich. Eine eigenartige Form liegender Geschäftigkeit: hellwach und hundemüde. Was genau steckt hinter einer solchen Eigenart, worin liegt der evolutionäre Vorteil, wenn man nicht einschlafen kann und mitten in der Nacht eine ganz klare Liste von zu erledigenden Dingen vor Augen hat, die einem den ganzen Tag nicht einmal im Traum eingefallen wären? Leider kann man sich nicht zum Einschlafen zwingen, wie man sich zum Beispiel zum Fasten oder Sporteln zwingen kann. Das gelingt zwar auch höchst selten, aber das Einschlafen unterliegt grundsätzlich nicht unserem Willen. Schade eigentlich.
Diesmal waren es jedoch keine unerledigten Aufgaben, die mich heimsuchten, sondern erste Sätze. Dummerweise hatte ich ein Buch mit Interviews großer Schriftsteller neben meinem Bett liegen. Ich wollte noch ein wenig darin lesen, war jedoch viel zu müde. Ich schlug das Buch auf, und die Augen fielen mir zu. Sehr verschwommen konnte ich nur noch einen einzigen Satz lesen: »Das Wichtigste für ein gutes Buch ist der perfekte erste Satz.«
Ich war einfach zu müde. Schon im Dahindämmern klappte ich das Buch wieder zu, legte es neben mein Bett, knipste die Lampe aus, drehte mich zur Seite – und war hellwach. Ich brauche für mein neues Buch den perfekten ersten Satz. Alles hängt davon ab. Der grandiose Einstieg! Und plötzlich tauchten aus meinem Unterbewusstsein oder wer weiß woher erste Sätze auf:
Von Alkohol und Kokain gezeichnet, griff der Oppositionsführer zur Waffe und schoss mit einer Spritzpistole auf den Bundeskanzler.
Aufgeregt öffnete er der Prostituierten die Wohnungstür und konnte es nicht fassen: Er stand seiner Tochter gegenüber.
Nach dreiundzwanzig Jahren Reise durch unsere Galaxie landete die amerikanische Raumkapsel Hope endlich auf dem Planeten XCFN377; nach wenigen Stunden sandte sie das erste Bild zur Erde: Unter einem roten Stein sah man ganz deutlich ein iPhone hervorlugen.
Von der Kugel getroffen, sank sie zu Boden, es wurde dunkel um sie, und plötzlich ging sie durch einen Tunnel auf das weiße Licht zu, von wo sie eine Stimme hörte: »Ich kann schon das Kopferl sehen!«
Es war sein erster One-Night-Stand. Er lag gefesselt auf dem Bett, und als er sah, wie die feste, sportliche Blondine mit dem großen Adamsapfel im Bad ihre Perücke abnahm und nach dem Messer griff, war ihm klar, dass es auch sein letzter war.
Nachdem sie miteinander geschlafen hatten, zog sie ihr Hochzeitskleid hastig wieder an und stieg aus dem Auto, nicht ohne Robert vorher zu sagen: »Ich hab die Pille abgesetzt. Ich liebe dich, wir sehen uns nach den Flitterwochen!«
Von Satz zu Satz wurde es mir unmöglicher, an Schlaf zu denken. Also schlich ich vorsichtig aus dem Schlafzimmer unserer kleinen Badehütte, ohne das Licht anzumachen, um meine Frau nicht zu wecken. Mein rechtes Schienbein und das Abstelltischchen hielten so viel Rücksicht für übertrieben. Sie stießen gegeneinander. Meine Frau schreckte auf. Ich hielt kurz den Atem an. Sie schlug ihre Augen auf, ich flüsterte eine Entschuldigung, sie drehte sich murrend zur Seite und schlief gleich wieder ein.
Schuldbewusst nach allen Richtungen arbeitete ich mich bis auf die Terrasse vor, setzte mich an den Gartentisch und zündete mir eine Zigarette an – noch immer in völliger Dunkelheit, um nicht auch noch die Nachbarn zu wecken. Kein leichtes Unterfangen, denn burgenländische Badehütten sind sehr soziale Wesen. Sie stehen gerne eng beieinander und treten vorwiegend in Kolonien auf. Vermutlich damit ihnen im Winter nicht so kalt ist, wenn sie verlassen in der Gegend herumstehen. Sie sind auch alle miteinander verwandt. Zumindest sehen sie einander sehr ähnlich. Nein, sie sehen einander nicht ähnlich, sie gleichen einander wie ein Ei dem anderen. Es kann bereits in leicht angetrunkenem Zustand vorkommen, dass man erst im Bett im Schlafzimmer draufkommt, man hat die falsche Hütte betreten. Aber auch nur, weil man der eigenen Frau zärtlich über die Wange streicht und feststellt, sie trägt den gleichen Vollbart wie der Nachbar.
Unsere Kolonie jedenfalls steht am Neusiedler See. Es war ein Uhr nachts, und ich versuchte, leise zu atmen. Plötzlich ein lautes Rascheln im Gebüsch. Das musste unser befreundeter Igel sein. Er kommt gelegentlich, um an den Küchenabfällen zu naschen. »Auch nachtaktiv«, murmelte ich halb anerkennend, halb ängstlich. Ob er wohl zu mir kriechen und sich mit seinen Stacheln an meinen Beinen reiben würde? Da fiel mir noch ein guter erster Satz ein.
Irren ist menschlich, dachte der Igel und sprang von der Bürste.
Nur in Unterhose und T-Shirt, hatte ich nicht wirklich Angst vor dem Igel, aber ein Gefühl des Unbehagens hatte sich breitgemacht. Licht kam nicht infrage, ich wollte kein Gespräch mit einem geweckten Nachbarn riskieren. Der Igel machte zunehmend seltsame Geräusche. Ein leises, pfeifendes Krachen war zu hören. War das ein Furz? Mein Gott, warum muss denn der Igel so furzen? Noch einer. Und ein dritter! Schon hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ich hätte heute Nachmittag den angeschimmelten Karfiol nicht einfach so ins Gebüsch werfen dürfen. Jetzt hat er davon gefressen und muss furzen. Armes Tier!
Wenige Sekunden später zündete sich der Igel eine Zigarette an. Ich wusste nicht recht, wie man auf einen furzenden, rauchenden Igel in dunkler Nacht am besten reagiert, darüber hatte ich noch nichts in einer Universum-Sendung gesehen. Also räusperte ich mich, ganz leise.
Da kam der Igel ungeniert mit seiner Zigarette in der Hand hinter der Gartenhecke hervor und entpuppte sich als mein Nachbar Andreas. Mir fiel kein Stein vom Herzen.
Andreas ()
Kannst du auch nicht schlafen?
Ich ()
Nein. Ich rauche noch eine!
Ich hab mich schon gewundert. Ich dachte, es ist der Igel.
Ja, ich auch.
Kein Wort über den Furz. So gut kannten wir einander noch nicht. Es reichte gerade zum Du.
Hast du das öfter?
Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin den ganzen Tag hundemüde und dann in der Nacht hellwach.
Kenn ich. Geht mir genauso.
Woran das wohl liegen mag? Ich denke, bei mir ist es der Lebensrhythmus des Theatermenschen. Die höchste Konzentration des Tages habe ich um zwanzig Uhr, wenn die Vorstellung beginnt. Und ich mach das seit meinem siebzehnten Lebensjahr.
Vielleicht bin ich auch Theatermensch und weiß es gar nicht.
Nach einem bemühten Lachen von uns beiden geriet die Konversation ein wenig ins Stocken. Und was machen zwei Männer, wenn sie nicht wissen, worüber sie reden sollen? Sie trinken.
Soll ich dir ein Bier holen?
Nein danke, ich … Oder ja, ich schau einmal, ob wir noch eines im Kühlschrank haben. Soll ich auch ein bisschen Käse und Salami mitbringen?
Kein Problem, ich hab mir ein zweites mit heraus genommen. So spät soll man ja nichts mehr essen.
Er hatte wohl damit gerechnet, noch länger nicht schlafen zu können. Er reichte mir seine zweite Flasche Bier. Ich fuchtelte damit etwas seltsam durch die Dunkelheit, im verzweifelten Versuch, anzustoßen, ohne anzustoßen. Wir wollten ja keinen Anstoß erregen. Andreas prostete unbestimmt in die Gegend …
Friede den Hütten!
Und Krieg den Gelsen!
Der Weg zum Mund war dann kein Problem. Während wir das kalte Bier genüsslich die Kehle runterlaufen ließen, dachten wir wohl beide daran, dass unser Trinkspruch dem vermeintlichen Furz des Igels an Peinlichkeit um nichts nachstand.
Woran arbeitest du gerade? Wieder ein neuer Shakespeare?
Er wusste offenbar mehr über mich als ich über ihn. Ein Gefühl, das mir grundsätzlich nicht fremd, aber dennoch nicht immer angenehm ist. Ich versuche stets, im Kontakt mit Menschen, die mich von der Bühne oder vom Fernsehen kennen, normales, antiprominentes Verhalten an den Tag zu legen. Ich stelle mich auch neuen Menschen immer vor. Manchmal führt das zu einem Missverständnis. Sie denken dann, ich glaube, sie wüssten nicht, wer ich bin, und mein Versuch, wie ein normaler Mensch zu wirken, macht mich erst recht zu einem arroganten Promi.
Nein, nein – momentan kein Shakespeare. Ich hab vor Kurzem mit meinem neuen Buch begonnen.
Ah! Worum geht’s?
Alles Mögliche. Kurzgeschichten.
Und wovon handeln die?
Breit gefächert.
Ich hatte gerade keine Lust, ihm meine Ideen zu erläutern. Es war noch etwas Zeit bis zum Abgabetermin, und ich hatte sehr viele Einfälle, wusste aber noch nicht, wie mein neues Buch tatsächlich aussehen würde. In Wahrheit wusste ich über mein neues Buch noch gar nichts. Außer, dass ich zu viele Einfälle hatte. Vielleicht konnte ich deswegen nicht schlafen, Theatermensch hin oder her. Zahlreiche Geschichten und Figuren rumorten in meinem Kopf, wollten irgendwie hinaus, wollten frei sein. Nur um gleich wieder zwischen zwei Buchdeckeln begraben zu werden.
Ohne Frage, die Nacht würde schlaflos werden. Also wäre es vielleicht gar keine so schlechte Idee, die eine oder andere Geschichte meinem Nachbarn zu erzählen, zu schauen, wie weit sie tragen, ob sie überhaupt was taugen. Zu meiner Frau könnte ich sagen, ich hätte die ganze Nacht gearbeitet, und sogar ich selber würde mir das abnehmen. Aber irgendwie war mir nicht danach. Mein Nachbar nahm mir jedoch die Entscheidung ab.
Soll ich dir einen Witz erzählen?
Nein. Um Gottes willen. Bitte nicht.
Wieso, du bist doch Komiker.
Eben. Das ist schrecklich. Das ist, wie wenn man einem Koch ein Rezept vorliest. Oder einem Astronauten erzählt, dass man sich so schwerelos fühlt, wenn man einen Joint geraucht hat. Ich kenne einen Gehirnchirurgen, der ist bei dem Film Hannibal während der Szene, in der der Kannibale dem Opfer den Kopf aufsägt und das Hirn isst, vor Langeweile eingeschlafen.
Wie traurig. Ich meine, worüber lacht dann ein Komiker? Wie kann man einen Komiker erheitern?
Schwer, sehr schwer. Da gibt es eine Geschichte von einem italienischen Harlekin, einem Clown aus dem 18. Jahrhundert: Carlino – ein großer Star in Paris, 1783 gestorben. Er war ein hypochondrischer Melancholiker, dessen einziger Grund, sich nicht umzubringen, seine Angst vor dem Sterben war. Er hat über vierzig Jahre lang die Menschen zum Lachen gebracht. Eines Tages hörte Carlino, in Paris sei ein neuer Arzt angekommen. Er suchte ihn unverzüglich auf, in der Hoffnung, dieser könne ihn von seiner Not befreien. Der Arzt erkannte den großen Spaßmacher nicht, und weißt du, welchen Rat er ihm gegeben hat? Ihm sei nur eine Methode gegen die schwarze Galle bekannt, mit der schon Erfolge erzielt worden seien: ausgiebiges Lachen. Er solle doch zu Carlino in die Vorstellung gehen, und zwar so oft wie möglich. Darauf sagte der todtraurig: »Das würde ich ja gerne machen, aber ich selbst bin ja dieser Carlino.«
Mein Gott, das ist ja rührend.
Rührend? Das ist herzzerreißend!
Also pass auf: Der Witz. Ein Mann kommt nach der …
Ich erzähl dir lieber etwas über mein Buch!
Also schön – aber danach der Witz …
Schauen wir einmal. Wir müssen ja irgendwann auch schlafen gehen … Also, der Titel wird lauten: Ein Trottel kommt selten allein.
Mein Freund musste lachen.
Warum kommt ein Trottel selten allein?
Diese Frage möchte ich gerne an den Anfang stellen, da mir nichts leichter fällt als ihre Beantwortung. Und zwar mit einem Sprichwort. Normalerweise sind mir Sprichwörter ja suspekt und lösen bei mir den unwiderstehlichen Drang aus, sie zu verdrehen, ihren Sinn, der oft als Handlungsanweisung mit der Autorität von Jahrhunderten daherkommt, zu verballhornen oder umzudrehen. So kam es ja auch zum Titel meines letzten Buches: Der frühe Wurm hat einen Vogel. Sprichwörter werden gerne auch Volksweisheiten genannt, und die Weisheit des Volkes ist ein weites Feld, das …
… wir jetzt nicht beackern wollen. Die Nacht ist finster genug.
… das meist brachliegt, hätte ich sagen wollen. Du hast natürlich recht. Ich habe mich ein wenig verrannt, aber Sprichwörter ärgern mich, und wenn sie auch oft einen Kern von Wahrheit enthalten mögen: Für den Einzelfall sind sie wenig hilfreich. »Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht«, zum Beispiel, hilft mir persönlich gar nicht weiter, weil ich trotzdem keine Antwort auf die Frage bekomme, wie weit ich mit meinen Scherzen gehen darf oder wann ich mit dem Trinken aufhören soll, wenn ich (der Krug) auch nach dem siebenten Gang zum Brunnen (in dem Fall Bier) noch nicht (er-)breche.
Ja, oder: »Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.« Das stimmt meines Erachtens überhaupt nicht, sonst hätte sich ja Brutus selbst erstechen müssen und nicht Julius Caesar.
Sprichwörter sind eigentlich sinnlos. Es gibt nur ein einziges, das meiner Meinung nach seine Berechtigung hat: Das englische Sprichwort: »Für jeden Trottel findet sich ein noch größerer Trottel, der ihn bewundert.« Es sagt alles und lässt keine Frage offen. Ein Trottel kommt also selten allein, da er einen noch größeren Trottel gefunden hat, der ihn bewundert. Und so marschieren die zwei selbstzufrieden und von sich überzeugt durch das Leben. Das Erstaunliche daran ist, dass sich trotz der enormen und stetig steigenden Anzahl von Trotteln immer noch für jeden einzelnen Trottel ein größerer Trottel findet, der seinerseits wiederum von einem noch größeren Trottel bewundert wird. Was uns zu Einsteins Aussage über das Universum führt: »Zwei Dinge sind unendlich«, sagte er, »das Universum und die menschliche Dummheit. Bei Ersterem bin ich mir nicht ganz sicher.« So ungefähr möchte ich einsteigen in das Buch.
Aha. Ja, ja … Der Mensch ist also nicht die Krone der Schöpfung?
Eher die Kronen Zeitung der Schöpfung.
Kennst du Diogenes?
Den Verlag?
Den Philosophen.
Nicht persönlich. Was weiß ich über ihn? Er hat in einem Fass gelebt und … Er ist tot. Wie übrigens die meisten Philosophen.
Das mit dem Fass ist eine Legende. Er muss aber ein alter Grantler, ein Misanthrop erster Güte gewesen sein, führte ein sehr einfaches Leben und hat im Grunde als Obdachloser auf der Straße gelebt. Man sagt, er habe vielen Menschen seine Verachtung gezeigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er dieses Leben ohne Besitz ganz freiwillig lebte, aber er hat angeblich, als Alexander der Große vor ihn trat und sagte: »Sag mir, was du wünscht, und ich werde dir deinen Wunsch erfüllen«, nur geantwortet: »Geh mir aus der Sonne!« Er hat also von den Menschen und ihrem zivilisierten Leben nichts gehalten.
Und doch hatte er einen großen Streit mit Platon. Platon, der seinerseits von Ideen mehr hielt als vom Menschen, hat den Mensch folgendermaßen definiert: »Der Mensch ist weiter nichts als ein federloses Tier auf zwei Beinen.« Platon hat für diese Aussage in der von ihm in Athen gegründeten Philosophenschule große Zustimmung bekommen. Das hat den Menschenverächter Diogenes dermaßen geärgert, dass er am nächsten Tag einen Hahn gerupft und ihn den Schülern Platons vor die Nase gehalten hat mit den Worten: »Das ist Platons Mensch.« Offensichtlich war er der Meinung, dass da doch mehr dahintersteckt.
Auf jeden Fall hat er Platon komödiantisch übertrumpft, und das gefällt mir natürlich sehr. Aber können wir heute wesentlich mehr sagen über uns Menschen? Wir sind Säugetiere, und unsere Ahnen und nächsten Verwandten sind Affen, so viel ist gewiss. Vielleicht sollten wir ganz von vorne anfangen. Auf der Erde entsteht Leben. Wie das genau passiert ist, wissen wir bis heute nicht. Möglicherweise aus einem Haar in der Ursuppe. Es kommen die Einzeller, dann die Mehrzeller, dann die Wirbellosen, dann die Wirbeltiere, dann die Insekten, dann die Dinosaurier, dann die Vögel, dann die Säugetiere, und plötzlich ist da ein Wesen, das ein so großes Gehirn hat, dass es darüber nachdenken kann, was es ist. Vor zweihunderttausend Jahren taucht der Homo sapiens auf. Und da muss sich doch einer das erste Mal gedacht haben: Sag einmal, was mach ich da eigentlich?
Wahrscheinlich war der Moment in der Nacht.
Ja! Er konnte nicht schlafen, ist aus seiner Höhle oder noch wahrscheinlicher von seinem Schlafplatz auf einem Baum heruntergekrochen, hat sich hingesetzt und gedacht: Was soll das alles. Wozu lebe ich?
Und plötzlich hat ein Igel gefurzt.
Hast du das auch gehört?
Ja. Unglaublich, dass die so laut furzen können.
Diesen Augenblick muss es in unserer Geschichte gegeben haben. Und zwar am Übergang vom Tier zum Menschen, wo wir aus dem träumerischen tierischen Dasein ins menschliche Bewusstsein gewechselt haben. Und dieses erste Wesen, das sich als Mensch gefühlt hat, das also zwischen sich und den anderen Arten eine Kluft gespürt hat, das sozusagen unseren Ur-Sprung über diese Kluft hinweg gewagt hat, dieses Wesen muss, wenn wir es nicht als Trottel bezeichnen wollen, früher oder später bemerkt haben, wie mühselig und sinnlos seine Existenz ist, und sich gefragt haben: Was soll das alles? Was machen wir da? Jeden Tag derselbe Trott. Wir stehen auf, sammeln Beeren, dann versuchen wir ein Schwein zu fangen, dann essen wir es, dann gehen wir schlafen, dann stehen wir wieder auf, und die einzige Erleichterung unseres Daseins verspüren wir, wenn wir das mühsam besorgte Essen im Gras hockend hinten, nachdem es eine wundersame Verwandlung erlebt hat, wieder loswerden. Und selbst das geht nicht immer ohne Plage. Wenn dieses Wesen, das jetzt plötzlich wert auf den Titel Mensch legte, das einzige Mitglied seiner Sippe war, das sich diese Fragen gestellt hat, dann hat es sich auch noch gedacht: Warum bin ich nur von Trotteln umgeben?
Hat er denn gar keinen Trost gehabt, der neue Mensch?
Wie denn? Er hat ja noch nichts gewusst. Es gab ja noch gar nichts. Keine Musik, keine Religion, keine Literatur. Die Menschen waren ganz allein mit ihrer Sippe. Zu anderen Sippen gab es vermutlich kaum Kontakt, und wenn, dann haben sie einander nicht verstanden. Sie haben sich in erster Linie gefürchtet. Vor allem vor dem Wetter, das jederzeit mit einem Gewitter überraschen konnte, vor den Löwen, von denen sie gejagt und getötet werden konnten, vor den Fremden der anderen Sippe, die sie nicht verstehen konnten. Und sie waren traurig. Sie haben die Menschen, die sie liebten, die ihnen Geborgenheit gaben, die nach ihrer Sippe rochen, einen nach dem anderen verloren. Eines Tages lagen sie tot da, und sie wussten nicht, warum.
Darum haben sie eines Tages die Götter erfunden.
Ja, weil ihr Gehirn bereits groß genug war, um sich vorzustellen, dass es jemanden geben muss, der raschelt.
Hä?
Alle anderen Lebewesen laufen davon, wenn sie es im Gebüsch rascheln hören. Sie wittern Gefahr und erstarren oder flüchten oder greifen an, je nach Größe und angeborenem Instinkt. Wir Menschen aber haben ein Gehirn entwickelt, das sich vorstellen kann, dass da jemand raschelt. Wir Menschen waren die Ersten auf diesem Planeten, die sich beim Rascheln im Gebüsch gedacht haben: Moment! Wer raschelt denn da? Seid’s ihr deppert? Es ist vier in der Früh!
Und darum gibt es die Religion?
Wir suchen den großen Raschler! Wir sind seit damals, seit zweihunderttausend Jahren, auf der Suche nach dem Verursacher. Und irgendwann haben wir ihn nicht nur für das Rascheln und den Regen und den Sonnenschein verantwortlich gemacht, sondern auch dafür, dass unsere Kinder sterben, dass wir krank werden und so weiter. Und wir haben uns Sachen ausgedacht, um ihn für uns einzunehmen, ihn zu besänftigen, das Unheil von uns abzuwenden. Opfer, Gebete und strenge, wie wir meinen, gottgefällige Regeln.
Und wie passt da jetzt der Trottel dazu?
Ganz einfach: eine Mutation. Irgendwann hat die Evolution den ersten Trottel hervorgebracht. Wo und wann genau, lässt sich schwer sagen, aber es muss recht bald gewesen sein.
Und der Trottel stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit seiner Existenz gar nicht.
Doch.
Aber was unterscheidet ihn dann von den anderen?
Dass er glaubt, die Antwort zu wissen. Der Trottel ist immer im Besitz der Wahrheit. Diese hält er für einzig, ultimativ und nackt – auch wenn sie ihm zuliebe oft Lederhosen trägt. Und noch etwas zeichnet den Trottel aus: Er findet das Leben schrecklich und unerträglich, beschwert sich aber darüber, dass es einmal zu Ende sein wird.
Beschreibt das nicht auch uns beide?
Ich habe nie gesagt, dass wir zwei keine Trottel sind.
Das heißt, dein Buch hat etwas Autobiografisches.
Ein Rascheln in der Hecke. Wir hielten kurz inne, lauschten andächtig dem Raschler und fuhren flüsternd fort.
Der Igel.
Wahrscheinlich.
Wir fürchten uns nicht und laufen nicht davon.
Ein wenig fürchte ich mich schon …
Wovor?
Dass er wieder furzt.
Mein Nachbar, inzwischen mein nächtlicher Freund, lief rot an. Das spielte aber keine Rolle, denn ich konnte es in der Dunkelheit nicht erkennen.
Das ist ja erstaunlich, wie stark Igel furzen können.
Wir unterschätzen die Tierwelt immer wieder.
Jaja.
Der Hase und der Igel, das ist doch so eine Fabel …
Kenn ich. Also … den Titel. Ich weiß nicht genau, worum es da geht.
Ich auch nicht. Ich kenne nur ein Gedicht über den Igel.
Ah. Sehr schön.
Der Löwe saß auf seinem Thron von Knochen
Und sann auf Sklaverei und Tod.
Ein Igel kam ihm in den Weg gekrochen;
»Ha! Wurm!«, so brüllte der Despot,
Und hielt ihn zwischen seinen Klauen,
»Mit einem Schluck verschling ich dich!«
Der Igel sprach: »Verschlingen kannst du mich,
Allein du kannst mich nicht verdauen.«
In Gedichten bin ich sehr schlecht. Aber ich stell mir gerade eine Igelgeburt vor. – Ich kann keine Gedichte auswendig.
Schillers Glocke?
Nein. Um Gottes willen. Höchstens so Scherzgedichte:
Zwei Knaben steigen auf den Gletscher,
der eine matsch, der andere mätscher,
da sprach der Mätschere zum Matschen:
»Jetzt miaß ma wieda owehatschen!«
Sehr schön.
Zwei Knaben saßen auf einer Bank,
der eine roch, der andere stank.
Da sprach der, der roch, zu dem, der stank:
»I setz mi jetzt auf a andre Bank.«
Keineswegs von mir als Anspielung auf den Furz des Igels gedacht, stellte sich gleichwohl diese Wirkung ein. Eine etwas seltsame Pause, gerade lange genug, dass sich jeder seinen Teil denken konnte, aber nicht lange genug, um eine weitere Unterhaltung ins Stocken zu bringen. Wir saßen also mitten in der Nacht auf einer Terrasse am Neusiedler See, trugen einander Gedichte vor, und es war uns nicht peinlich. So fasste ich Mut, noch mehr über mein neues Buch zu plaudern. Die Stimmung war lockerer geworden. Namentlich meine Theorie über die Evolution des Menschen lag mir am Herzen, und so kam ich wieder auf den Homo sapiens zurück. Ich hatte keine korrekten Jahreszahlen parat, deshalb holte ich mein iPhone, um im Bedarfsfall googeln zu können.
Wir sind also aus den Affen hervorgegangen. Wir Menschen. Präziser: Wir sind Affen. Wir gehören zu den Affenartigen. Für manche ein Schock, für viele aber nur das Offensichtliche.
Klarer Fall, das erkennt man schon daran, dass wir uns gelegentlich gehörig affenartig benehmen.
Es ist nicht so, dass unsere Vorfahren einmal Affen waren. Im biologischen Sinn sind wir immer noch Affen. Wenn man das menschliche Genom mit dem der Affen vergleicht, so ergibt sich folgende Analyse: Der Schimpanse ist mit uns näher verwandt als mit dem Orang-Utan. Der genetische Abstand zwischen Schimpanse und Mensch ist kleiner als der genetische Abstand zwischen Schimpanse und Orang-Utan. Und amerikanische Forscher haben jetzt auch noch herausgefunden: Der genetische Abstand zwischen Orang-Utan und Donald Trump ist null.
Ich erntete Gelächter und war zufrieden.
Was ich natürlich nicht in mein Buch schreiben werde, denn diese Aussage ist eindeutig Orang-Utan-feindlich.
Ist es eigentlich sehr schwer für einen Komiker, ernst zu bleiben?
Schwer nicht, aber sinnlos. Also, weiter. Irgendwann im Laufe der Entwicklung gab es einen Affen, der war der Vorfahre von uns und von den Schimpansen. Unsere gemeinsame Urhoch zehn Großmutter. Von da an sind wir allerdings getrennte Wege gegangen, wir und die Schimpansen. Wir in Richtung Zivilisation und Atombombe, die Schimpansen in Richtung Affenkäfig.
Und die große Frage ist nun: Wann ist der erste Trottel auf dieser Erde erschienen? Wer war der erste Depp und wann? Das ist sehr schwer zu beantworten. Die Wissenschaft ist sich hier nicht einig.
Ein interessantes Phänomen allerdings könnte uns auf die Spur bringen. Alle Menschen, die heute leben, stammen von einer Population von zweihunderttausend Individuen ab. Das ergab der weltweite Vergleich unseres Genoms. Wenn dem so ist, dann muss es auch einen kulturellen Beweis dafür geben, nicht nur einen biologischen. Nun, jetzt kann man sagen, wir alle bauen Häuser, haben eine Sprache, verhalten uns im Grunde sehr ähnlich, wenn nicht überhaupt komplett gleich, nur eben auf unterschiedlichen kulturellen Oberflächen. Das heißt, es muss auch in unseren verschiedenen Sprachen mindestens ein Element geben, das universell ist. Einen Satz, den alle Menschen auf der ganzen Welt verstehen, ohne ihn übersetzen zu müssen. Denn wenn diese zweihunderttausend Individuen in irgendeiner Form miteinander kommuniziert haben, und das müssen sie, sonst hätten sie nicht überlebt, dann muss etwas aus dieser Zeit übrig geblieben sein. Ein Wort, eine Phrase, ein Satz, der uns alle miteinander verbindet und beweist, dass wir Brüder und Schwestern sind. Und ich habe – nach langem Forschen – diesen Satz gefunden. Ein Satz, der ohne Übersetzung in China, England, Afghanistan, Schweden oder sonst wo auf der Welt verständlich ist. Und dieser Satz lautet: »Wie bitte?« Allerdings nicht in dieser komplexen Form, sondern in seiner ursprünglichen Erscheinung: »Hä??«
Hä??
Genau.
Das versteht man überall?
Ja! Du kannst in Kasachstan irgendwo im Wald auf einen Menschen treffen – wenn du »Hä??« sagst, weiß er sofort, was du meinst. Du kannst in New York an irgendeiner Universität einen Professor anschauen und »Hä?« sagen – er weiß sofort, was los ist. »Hä??« ist der universelle Satz der Menschheit. Unser Markenzeichen.
Später haben sich verschiedene Sprachen herausgebildet, und es wird heute in jeder Sprache ein wenig anders ausgesprochen: »Hä??« auf Deutsch. »Huh??« auf Englisch. »E??« auf Spanisch. Aber es ist immer diese eine kleine Silbe. Es ist eben nicht so, dass es in einer Sprache »Hä??« heißt und in einer anderen »Loxatlotu??«, nicht wie bei Car und Auto, sondern es ist immer eine Variation von »Hä??«. Der Homo sapiens, der weise Mensch, besitzt ein universelles sprachliches Merkmal seiner Art: den Ausruf »Hä??«. Und warum ist das so? – Weil er ein Trottel ist. Weil wir von einer Gruppe von Urmenschen abstammen, die durch die Steppe gewandert ist und deren Gehirn groß genug war, um ihre eigene Existenz zu hinterfragen. Und die Frage lautete: »Hä?« Als sie die erste Sonnenfinsternis sahen, sagten sie: »Hä??« Als sie sahen, wie der Blitz in einen Baum einschlug und der Wald brannte, schauten sie einander ängstlich an: »Hä??« Als sie im Gebüsch ein Rascheln vernahmen, war ihre Reaktion: »Hä??«
Wow. Ist diese Erkenntnis von dir?
Nein. Das stand in einem Buch, und in der Süddeutschen Zeitung war ein Artikel darüber, aber ich werde in meinem Buch natürlich behaupten, dass ich da selber draufgekommen bin. Ich werde auch behaupten, dass ich einem zweiten universellen Überbleibsel aus unserer Urhorde auf der Spur bin. Noch viel spannender und sozusagen das Komplementärstück zum »Hä??«. Aber das werde ich erst im übernächsten Buch behaupten. Darüber brauchen wir jetzt also nicht reden.
Viel spannender, aber wir reden nicht darüber? Danke für das Vertrauen …
Weil’s kompliziert ist. Weil es das Komplizierteste überhaupt ist.
Sex?
Was soll bitte daran kompliziert sein? – Nein: das Lachen. Eines der rätselhaftesten Phänomene, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt. Es ist nämlich genauso universell wie das »Hä??«.
Das Schwein macht bei uns quiek, quiek; oink, oink macht das angloamerikanische Schwein, röf röf röf oder ui ui das ungarische und soch, soch das walisische. Das Bellen von Hunden oder das Quaken von Fröschen wird in den einzelnen Sprachen verwirrend unterschiedlich wiedergegeben. Das Lachen hingegen wird in allen Sprachen der Welt, ganz gleich aus welcher Sprachfamilie, mit einer Variante von haha, hehe oder tee hee beschrieben. – Das hab ich auch in einem Buch gelesen, ist also genauso wenig von mir und daher glaubwürdig.
Hä?? und haha …
Ja! Ratlosigkeit, Rätsel, Angst einerseits und befreiendes Lachen andererseits. Hä?? und Haha, Tragödie und Komödie, Trauer und Freude, Tod und Leben …
Nette Theorie, aber wir waren gerade dabei, uns auszumalen, wie das alles konkret vor sich gegangen ist in unseren Anfängen.
Ich hab ja gesagt, in meinem übernächsten …
Unsere Vorfahren sind also völlig ahnungslos durch die Steppe geirrt, haben einfach nichts kapiert, und von Zeit zu Zeit haben sie sich darüber zerkugelt?
Ja, so ist die Unterhaltungsbranche in die Welt gekommen. Hätten wir das auch geklärt.
Noch einmal: Wir stammen also von denen ab, die durch die Steppe mäandert sind, nichts kapiert haben und das lustig gefunden haben?
Erschreckend, nicht wahr?
Und doch haben wir unglaubliche Dinge zustande gebracht. Schau dir doch unsere Zivilisation an. Wir haben beispielsweise eine Zauberflöte hervorgebracht.
Wir? Doch eher der Mozart. Ich war da leider nicht dabei.
Sagen wir, unsere Spezies hat die Zauberflöte hervorgebracht. Unsere Art bringt Individuen hervor, die so unglaubliche Dinge vollbringen können, wie die Zauberflöte zu komponieren.
Ja eh. Aber nur, weil einer von uns Urmenschen unbedingt das Krusperl von einem Schweinsbraten essen wollte.
Hä?
Hehe! Warum gibt es die menschliche Kultur, unsere Zivilisation? Weil wir das Feuer gezähmt haben. Und warum haben wir das Feuer gezähmt? Weil wir unbedingt die knusprige Haut von einem Schweinsbraten essen wollten.
Ich ersuche dich, etwas deutlicher zu werden!
Gut. Einer der wichtigsten Evolutionsschritte der Menschheit, der letztendlich zu den ersten Hochkulturen geführt hat: der Schweinsbraten. Dazu muss ich etwas weiter ausholen …
Natürlich, so ein Bratl braucht ja auch ein Zeitl, bis das Krusperl …
Hm, ich hätt uns doch was zum Essen holen sollen.
Mit diesen Worten war ich schon so gut wie unterwegs. Mein Freund hielt mich aber zurück.
Zuerst die Geschichte!
Dann verlieren wir keine Zeit! Vor hunderttausend Jahren waren wir noch nicht an der Spitze der Nahrungskette. Wir waren noch Futter, Beute für diverse Fleischfresser, weil wir keine geeigneten Waffen und das Feuer noch nicht im Griff hatten. Es muss eine schreckliche Zeit gewesen sein – von wegen früher war alles besser. Vor allem war unser Gehirn noch nicht komplex genug, um abstrakte Begriffe wie Angst, Liebe, Freude bilden zu können.
Wir haben diese Gefühle gespürt, aber konnten sie nicht verbal ausdrücken. Mangelnde Kommunikation bedeutete auch damals schon mangelnde Organisation. Vor fünfundvierzigtausend Jahren fingen wir plötzlich an, Boote zu bauen, erfanden Pfeil und Bogen, Öllampen und Nadeln, um damit Kleidung herzustellen. Was war passiert? Woher der plötzliche Intelligenzschub?
Ganz einfach: Wir haben Kochen gelernt. Sofort setzte ein Trend ein, den wir heute noch beobachten: Weg von den rohen, lebenden, in der Steppe herumlaufenden Fertigprodukten, hin zum gemeinsamen Happy Cooking. Vielleicht war eine Versorgungskrise der Auslöser – vor der letzten Antilope hatte sich eine lange Schlange gebildet. »Zweite Kassa bitte!«, schallte es durch die Steppe. Die Folge der allerorts einsetzenden Kochshows war auf jeden Fall leichter verdauliches Essen, dadurch ein kleinerer Darm, dafür aber ein größeres Hirn, durch die frei gewordene und entsprechend umgelenkte Verdauungsenergie. Der Weg für die Zivilisation war geebnet.
Wenn unser Darm rebelliert, erinnert er sich grollend an diesen Vorgang und erinnert unsere Kommandozentrale daran, was es heißt, Kontrolle abzugeben. Und wenn ich heute auf der Bühne Themen und Begriffe, die den Unterleib betreffen, verwende – es sind vor allem drei, aber im Moment fällt mir keiner ein –, werfen mir die Leute Unzivilisiertheit vor. Hängt alles mit diesem Energietransfer von unten nach oben zusammen.
Wir zähmten also das Feuer, bauten uns Waffen, vertrieben damit die Fleischfresser und fanden uns an der Spitze der Nahrungskette. Übrigens für mich die größte Errungenschaft von allen. Stell dir vor, wir wären immer noch Futter für irgendwelche Säbelzahntiger. Wenn du da einen schlechten Tag hast, ist nicht nur die Mobilbox voll und der Akku leer, du wirst auch noch am Weg ins Fitnesscenter von einem Rudel Fleischfresser angegriffen. Außerdem würden uns die ganzen Veganer und Tierschützer noch mehr auf die Nerven gehen: Lebe gesund, denn vergiss nicht, du bist wertvolles Futter für bedrohte Tiere!
Aber wie war das jetzt mit dem Schweinsbraten genau? Das würde mich interessieren.
Wir sind in der Steppe. Eine Gruppe von Urmenschen schläft in primitiven Holzverschlägen, die man leicht auf- und abbauen kann. Wir sind Nomaden, ziehen herum und suchen Nahrung. Wir sammeln Früchte. Wir jagen kleinere Tiere. Wir essen sie natürlich roh. Wir haben schon Faustkeile, mit denen wir das Fleisch zerteilen können. Wir reden miteinander.
Was reden wir?
Wir reden über die Gefahr. Im Hintergrund hören wir Weinen. Unsere Sippe betrauert den Tod zweier Kinder, die von Löwen gerissen wurden.
Wir können gegen diese Löwen nichts machen?
Nichts. Die Faustkeile sind zu klein, und außer ein paar Steinmessern und angespitzten Stöcken, mit denen wir in der Erde nach Knollen suchen, haben wir noch nichts zuwege gebracht.
Können wir die Löwen nicht erschlagen?
Wie denn?
Mit großen Steinen.
Bis der Stein geworfen ist, hat uns der Löwe längst an der Gurgel. Aber vor allem: Für ein Experten-Hearing zum Thema »Wie können wir uns am besten vor Löwen schützen?« ist unsere Sprache noch zu wenig ausgereift.
Wir sind fast noch Tiere?
Ja. Wir laufen die meiste Zeit durch die Steppe, den kleinen Schweinchen hinterher, die zu unserem Glück den Lebensraum mit uns teilen möchten.
Das Hantieren mit Feuer ist uns noch fremd?
Ja, wir essen die kleinen Schweinchen roh. Dazu trinken wir ihr Blut. Wir beginnen mit den weichen Innereien und delektieren uns besonders am Mageninhalt: halbverdauten Kastanien.
Die waren eine Spezialität. Der Mageninhalt des kleinen Schweinchens war dem Anführer des Clans vorbehalten.
Halbverdaute Kastanien?!?
Warum nicht? Dreihunderttausend Jahre später lassen wir Milch so lange schlecht werden, bis sie von selber steht und blauen Schimmel angesetzt hat.
Du hast recht. Ich frage mich übrigens seit Jahrzehnten, woran man eigentlich erkennt, dass Schimmelkäse schlecht ist? Kommt da ein anderer Schimmel und verdrängt den blauen? Egal. Warum jagen wir Urmenschen die kleinen Schweinchen? Weil sie uns besser schmecken als das Aas, das wir üblicherweise essen.
Wir essen Aas?
Was bleibt uns anderes übrig?!? Wir beobachten einige Löwen bei der Jagd. Wir sehen, wie sie eine Giraffe reißen. Was machen wir Menschen? Wir verstecken uns und sehen zu, wie sich die Raubkatzen den Bauch vollschlagen. Dann müssen wir noch warten, bis die Hyänen und Schakale sich über den Rest hergemacht haben, bevor wir nach den letzten Fetzen von essbarem Gewebe suchen können. Mit unseren Faustkeilen und Steinmessern brechen wir die Knochen auf, um an das herrliche Mark zu kommen.
Eines Nachts, es ist Sommer, es hat seit Monaten nicht geregnet, zieht ein mächtiges Gewitter auf. Ein lauter Knall schreckt uns auf. Am Rand der Steppe hat ein Blitz einen Baum gespalten, und wir erkennen Feuerschein, der sich rasend schnell durch das staubtrockene Gras frisst. Funken stieben durch die Gegend, und wir sehen, wie zahlreiche Tiere die Flucht ergreifen, selbst die gefürchteten Löwen. Uns bleibt auch keine Wahl. Ängstlich nehmen wir Reißaus, und sobald wir uns in Sicherheit wähnen, tun wir das, was wir immer in so einem Fall tun. Wir kauern uns eng aneinander und hoffen angsterfüllt, das Ungeheuer möge sich bald satt gefressen haben, sich zur Ruhe legen und nicht länger die Dunkelheit stören. So sind wir jahrtausendelang vor dem Feuer einfach davongelaufen und haben uns am nächsten Tag ein neues Jagdgebiet gesucht. Keiner ist je auf die Idee gekommen, an den Ort des Feuers zurückzukehren; alles ist schwarz, verkohlt, mit Asche bedeckt und unbewohnbar. Alles Essbare vom Feuer verzehrt. Niemand hat sich je dafür interessiert, wie es im Wald wirklich aussieht, wenn das Feuer vorbei ist.
Bis eines Tages, als es wieder so ein Feuer gibt, ein mutiger Halbwüchsiger, vielleicht sind es auch zwei – ja, es sind zwei Jünglinge, soeben geschlechtsreif geworden, die zu dem abgebrannten Waldstück zurückgehen. Sie müssen gerade den Initiationsritus über sich ergehen lassen. Abgesondert von der weiterziehenden Sippe sind sie dazu gezwungen, sich alleine durchzuschlagen, ehe sie zum nächsten Vollmond wieder in die Gemeinschaft zurückkehren dürfen, nunmehr als Männer. Die Ausnahmesituation, in der sie sich befinden, beflügelt die Neugier.
Aber Tausende Halbstarke vor ihnen in der gleichen Situation sind nicht auf diese abwegige Idee gekommen!
Zwei Pioniere! Die ersten Abenteurer! Mein Gott, vielleicht kehren sie auch nur zurück, um zu sehen, ob die Fuchsfamilie, mit der sie sich als Buben angefreundet haben, den Brand überlebt hat.
Ein bisserl Romantik hat noch keiner Geschichte geschadet, aber warum nicht gleich Bambi?
Ha! Weil der Fuchs – ganz im Gegenteil zum Reh – einen Bau unter der Erde bewohnt und sich für zwei helle Burschen die Frage ergibt, ob das ausreichend Schutz vor dem Feuer bietet.
Jugend forscht, ich verstehe.
So kommen wir nie zu unserem Schweinsbraten. Aus jetzt! Sie nähern sich also dem Wald … Oder dem, was bis vor Kurzem ein Wald war und …
Wenn ständig einer zurückfragt, funktionieren Geschichten nicht, genauso wenig wie Witze. Also hör mir bitte zu …
Sie nähern sich dem Wald. Sie riechen den Rauch. Es ekelt sie. Adrenalin steigt in ihnen hoch. Angst. Noch hat der Mensch nicht das heimelige, vertraute Gefühl, wenn er den Rauch von brennendem Holz riecht, noch bedeutet dieser Geruch Lebensgefahr. Doch unsere zwei mutigen Freunde werden von Neugier einerseits und von Sorge um die Füchse andererseits getrieben. Sie müssen gegen ihren Instinkt ankämpfen. Sie müssen sich zwingen, nicht wegzulaufen, wie der Rest der Sippe. Sie sind tapfer. Vielleicht halten sie sich an den Händen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit halten sich zwei Freunde an den Händen.
Sie brauchen Namen. Wir müssen ihnen Namen geben.
Haben sie wahrscheinlich gehabt. Einfache Namen. Der Mensch hat zu dieser Zeit schon Dinge benannt und ohne Zweifel sich selbst auch.
Sie heißen: Manu und Hoa!
Wieso?
Wieso nicht!?
Unsere beiden Helden, Manu und Hoa, die ersten Abenteurer der Menschheit, die erkunden wollen, was mit einem Wald passiert, nachdem ihn das Feuer gefressen hat.
Und die ihre geliebten Füchse wiedersehen wollen.
Eine dunkle Ahnung jedoch sagt ihnen: Das Feuer zu überleben, ist unmöglich. Alle Lebewesen, so denken sie, die nicht rechtzeitig die Flucht ergriffen haben, werden von den Flammen vertilgt. Es gibt keinen Beweis dafür, noch nie hat jemand gesehen, was mit einem Tier passiert, wenn es im Feuer war, aber das Wort für Tod, das Wort, das sie verwenden, wenn einer aus ihrer Sippe leblos am Boden liegt oder von einem Löwen gefressen wurde, ist dasselbe Wort, das sie für Feuer verwenden: Ennochá. Wie sollen die Füchse überlebt haben, wenn Ennochá hier war? Sie stehen vor der verbrannten Erde. Es dampft und glimmt und kracht und zischt. Es hat geregnet. Hannia. Das Wasser, das vom Himmel fällt, nennen sie Hannia. Dasselbe Wort verwenden sie, wenn ein Junges zur Welt kommt. Ihre bisherige Erfahrung hat sie gelehrt, dass Wasser Leben und Feuer Tod ist. Hat Hannia Ennochá schon niedergerungen? Der Regen den Brand gelöscht?
Ihnen wird heiß. Das Zischen einzelner Glutherde, die sich gegen die nassen, verkohlten Baumstämme durchzusetzen versuchen, verunsichert sie. Schläft Ennochá nur? Hoa deutet Manu, still zu sein, um Ennochá nicht zu wecken. Sie treten vorsichtig auf den aschigen Boden und versuchen, all die zischenden und dampfenden Stellen zu umgehen. Ängstlich lassen sie ihre Blicke von Glutnest zu Glutnest schweifen. Das Zischen und Dampfen erinnert sie an das Schnarchen der Alten, von deren Schlafplatz sie immer möglichst Abstand halten. Sie wundern sich über die verkohlten Leiber einiger Tiere. Was hat Ennochá aus ihnen gemacht?
Unsicheren Schrittes gehen sie in die Richtung, wo sie ihre Füchse vermuten. Da dringt Hoa ein Duft in die Nase, wie er ihn noch nie zuvor gerochen hat. Das ist kein beißender Rauch, kein ekelerregender Geruch nach Asche und Ruß, den Ennochá überall zurücklässt. Er weiß nicht, woher er stammt. Von keiner Blume, keinem Kraut, keiner Beere, auch nicht den Ausscheidungen von Tieren. Es ist ein ganz eigener Geruch. Angenehm, fast erbaulich einladend, unbekannt, aber Glück verheißend. Er fragt sich, was hier so wunderbaren Duft verströmt, und folgt seiner Nase, bis er vor einem dunkelbraunen Etwas zu stehen kommt, das sich von der schwarzen Umgebung deutlich abhebt. Es ist die Quelle des Wohlgeruchs. Hoa bedeutet Manu, stehen zu bleiben. Beide beugen sich vor und erkennen ein von Ennochá nur halb verdautes kleines Schweinchen. Hoa tippt es vorsichtig mit einem verkohlten Stöckchen an, ob noch Leben in ihm ist. Es verströmt gerade seine Lebensgeister, scheint ihm, und er kann sie über seine Nase in sich aufnehmen. Das macht ihn mutig, und er will es anfassen. Er verbrennt sich die Finger. Um den Schmerz zu lindern, steckt er sie schnell in den Mund und leckt sie ab. Das wirkt Wunder wie nie zuvor. Statt Schmerz ein Glücksgefühl, das die Menschheit nie wieder verlassen wird: der Geschmack von Schweinsbratenkrusperl!
Mir rinnt das Wasser im Mund zusammen.
Unserem jungen Helden auch. Ihm wird plötzlich klar: Ennochá hat aus dem blutigen, zähen Schwein eine herrlich schmeckende Sache gemacht. Er beugt sich wieder hinunter, reißt ein Stück Fleisch mit Kruste heraus und stopft es sich in den Mund. Seine Zähne bringen den harten Teil der Kruste zum Knacken, das warme Fett schmilzt auf der Zunge. Noch kauend schiebt er saftiges, zartes, weiches Fleisch nach und ist überwältigt von dem neuen Hochgefühl. Ein Kitzeln, ein Vibrieren, und dann noch die Wärme, die er im Magen spürt. Als ob er von innen erleuchtet würde. Manu sieht die Begeisterung seines Freundes und tut es ihm gleich. Sie hören nicht mehr auf zu essen, bis sie vor einem Häufchen Knochen sitzen. Sie rülpsen mehrmals laut. »Das Beste war das Krusperl«, sind sie sich einig.
Zur Zeit des Vollmonds kehren sie zurück zu ihrer Sippe, und man spottet über sie. Keine Jagdabenteuer, keine wilden Geschichten von Kämpfen mit Tieren oder den Geistern der Ahnen haben sie zu erzählen, sie reden die ganze Zeit über das Essen. Als Männer hätten sie zurückkommen sollen, nicht als Haubenköche. Die weibliche Jugend wendet sich enttäuscht ab.
Bis zum nächsten Gewitter …
Jawohl, bis zum nächsten Gewitter, als es wieder Schweinsbraten mit Krusperl gibt. Hoa und Manu gehen auf die Suche und bringen reichlich davon mit. Die Wirkung ist überwältigend. Sie sind die Helden.
Ich verstehe! Es ist die Initialzündung unserer Zivilisation. Von da an wollen alle Schweinsbraten mit Krusperl essen und sind somit gezwungen, die Willkür des Feuers zu zähmen. In ihrer Vorstellung hat Ennochá nicht mehr ausschließlich mit Tod zu tun, er kann von nun an auch Lebensgeister wecken. Man muss nur verstehen, damit umzugehen.
Genau. Aber das dauert noch einige Tausend Jahre. Es ist eine unruhige Periode, voller Spannungen. Die Menschen leben im Zwiespalt. Einerseits fürchten sie Blitz und Donner wie eh und je, andererseits sehnen sie das Feuer herbei. Die Schweinsbraten Now!-Bewegung hat regen Zulauf. In der Folge kommt es sogar zu Schweinsbraten-Revolten. Die abstrusesten Ideen tauchen auf; einer redet von Streichhölzern und erntet ein kollektives »Hä??«. Nach Jahrtausenden leerer Versprechen steht dem Volk nicht der Sinn nach blöden Scherzen.
Da werden durch einen einmaligen Zufall – das hat es vorher nie gegeben und nachher auch nie wieder – die beiden klügsten und tapfersten Menschen zu Anführern ihrer Horde.
Es ist circa fünfzehntausend Jahre nach Manu und Hoa, den Entdeckern des Schweinsbratens, die Sprache ist schon etwas komplexer, und sie leben bereits in größeren Verbänden.
Weil das Volk rebelliert, müssen sie etwas unternehmen.
In einer alten Geschichte, die immer dann auftaucht, wenn die Sehnsucht nach Schweinsbraten am größten ist, geht es um einen Berg, der Feuer spuckt und an dessen Flanken heißes, zähes, glühendes Blut talwärts fließt, das alles, was sich ihm in den Weg stellt, in Flammen aufgehen lässt. Die Leute fantasieren von einem Feuerberg. Not macht erfinderisch.
Unsere beiden Helden können aber bereits in der Möglichkeitsform denken. Sie sind ja die Klügsten. Was wäre, wenn es einen solchen Berg tatsächlich irgendwo gäbe?
Sie nehmen die Geschichte ernst und machen sich auf die Suche nach dem Feuerberg. Sie sind nicht nur die Klügsten, sie sind auch die Tapfersten.
Ein Moment der Stille zwischen mir und Andreas. Wir sahen einander in die Augen, und es war klar: Ab diesem Augen-Blick waren wir beide die klugen und tapferen Anführer, die schon unterwegs sind, das Feuer zu finden und es zu überlisten. Klug und tapfer – diese Rolle war uns auf den Leib geschrieben. In uns wuchs die unstillbare Begierde, dreihunderttausend Jahre in die Vergangenheit zu reisen und durch die Steppe Richtung Vulkan zu wandern. Andere Kinder wollten Indianer, Astronauten oder Cowboys sein. Wir beide waren schon lange keine Kinder mehr. Wir wollten Urmenschen sein, verantwortlich für die größte Errungenschaft der Menschheit.
Wir werden uns ganz nah an den Strom aus heißem Blut heranwagen müssen.
Es ist lebensgefährlich.
Ich weiß. Wir werden drei Holzstöcke in den heißen Blutstrom tauchen. Sie werden zu brennen beginnen. Und dann bringen wir unserem Volk das Feuer.
Wird Ennochá tatsächlich mit uns kommen?
Schmunzelnd bot mir Andreas eine Zigarette an, und ich gab ihm – Feuer!
Wir werden uns bemühen. Zunächst aber werden wir so etwas wie ein religiöses Erlebnis haben. Die Mächtigkeit und Gewalt des Feuerberges übersteigen unsere bescheidenen Verstandeskräfte bei Weitem, das laute Grollen im Inneren des Berges, das Zischen, der Feuerschein und die Dämpfe aus der heißen Erde überwältigen unsere Sinne vollkommen. Wir kommen uns ganz klein vor und halten den Vulkan für ein lebendes Wesen beziehungsweise einen Gott, dem wir das Feuer heimtückisch rauben müssen.
Wir haben also ein schlechtes Gewissen, aber es gelingt uns. Wir sind die Helden, wir bringen unseren Leuten das Feuer.
Ja, allerdings müssen wir noch zwei Mal umkehren und neues Feuer nehmen.
Wieso? Was ist passiert?
Wir gehen mit den drei brennenden Ästen durch die Steppe und werden zwei Mal vom Regen überrascht. Das Feuer erlischt. Also gehen wir jedes Mal zurück.
Tief verunsichert, da uns scheint, irgendetwas möchte nicht, dass wir uns des Feuers bemächtigen. Der Regen ist unsere Strafe.
Völlig richtig. Wir vermuten hinter jeder Ecke einen Verursacher.
Und wir reden darüber, ob es denn klug sei, das Feuer einfach so jedem Erstbesten zu überlassen. Wir machen uns zu den Hütern des Feuers.
Was unsere Macht als Anführer stärkt. Denn nur wer von uns beiden das Feuer bekommt, kann sich einen knusprigen Schweinsbraten machen. Und wer ist das? Alle, die uns sympathisch sind, und ein paar, die plötzlich besonders nett zu uns sind. Kurz nach der Zähmung des Feuers entstehen also die ersten gravierenden sozialen Unterschiede.
Und um an Schweinsbraten zu kommen, fackeln wir einen Wald nach dem anderen ab.
Wie bei jeder neuen Erfindung dauert es einige Zeit, bis wir sie zur Perfektion gebracht haben. Es setzt eine lange Periode des Waldsterbens ein, aus Gier nach dem Krusperl.
Halt, damit will ich nichts zu tun haben. Ich distanziere mich. Ich spiele nicht länger die zwielichtige Rolle des Feuerbringers.
Aber du bist ein Held!
Ja, ein tumber Tor, der keinen Gedanken an die Folgen seiner Heldentat verschwendet. Außerdem: Hat die Entstehung der Zivilisation nicht eher mit unserem Sesshaftwerden zu tun als mit der Zähmung des Feuers?
Natürlich! Und warum wurden wir sesshaft? Weil wir etwas angebaut haben. Und was haben wir angebaut?
Getreide.
Und was haben wir daraus gemacht?
Brot?
Auch. Was noch?
Bier?
Das Bier erblickt das Licht der Welt. Nach Tausenden von Jahren will der Mensch endlich ein Bier zu seinem Schweinsbraten.
Was für ein heiliger Moment. Prost!
Auf die Urmenschen!
Andächtig nahmen wir einen Schluck Bier. Es war wie ein Gottesdienst.
Langsam begreift der Mensch nun, wie man Schweine zubereiten kann, ohne einen ganzen Wald abzufackeln – indem er sie züchtet und am Spieß dreht. Mit der Sesshaftwerdung beginnt die Viehzucht und damit die gesamte Zivilisation der Menschheit. Und wem verdanken wir das?
Dem Schweinsbraten und dem Bier.
Ohne Schweinsbraten und Bier kein Shakespeare, Mozart, Schiller, Goethe, keine Denkmäler, keine Museen, keine Handys, kein Computer … nichts.
Also sind wir Menschen doch keine Trottel.
Aber freilich. Die größten Trottel. Was ist denn das Resultat unserer Zivilisation? Wir zerstören den Planeten. Wir produzieren Tonnen von Plastik, die ins Meer gelangen und dort Lebewesen verenden lassen. Noch schlimmer: Das Plastik kann nicht abgebaut werden, wird nur zerkleinert zu mikroskopisch kleinen Teilchen, die von Meerestieren aufgenommen werden. Diese wiederum werden von den Fischen gefressen, die dann wir essen. Unsere Fische sind voll mit Plastik, das auch unser Körper nicht abbauen kann. Die Meere sind in einem Ausmaß mit Plastik und Schwermetallen belastet, dass Fisch mittlerweile zum Ungesündesten gehört, was man essen kann. Der Fisch ist derart verseucht, da kann man sich gleich ein Billa-Sackerl panieren.
Das ist natürlich vertrottelt.
Und ob! Es entspricht aber unserem Instinkt, dem Genuss nachzujagen, koste es, was es wolle. Tun wir etwas dagegen? Nein, im Gegenteil, wir stehen erst am Anfang. Hast du schon einmal gesehen, wie ein 3D-Drucker funktioniert? Im Spritzverfahren wird flüssiger Kunststoff Schicht für Schicht aufgetragen, bis wir ein Auto aus Plastik haben, das in einer Garage aus Plastik in einem Haus aus Plastik steht. Wer das alles nicht mehr aushält, kann sich eine Kalaschnikow aus Plastik ausdrucken. Es scheint unsere Bestimmung zu sein, unsere zweite Natur. Wir wollen Plastik, wir produzieren Plastik, wir werden zu Plastik. Vermutlich, weil wir dann unsterblich sind und nicht mehr in der Erde verrotten müssen. Aus. Punkt.
Und das soll alles in dem neuen Buch vorkommen?
Keine Ahnung. Ich habe ja noch nicht zu schreiben begonnen, aber das wäre eventuell ein gutes Thema. Zuerst der Urmensch, dann der zivilisierte Umweltzerstörer: Vom Urmensch zum Plastikmenschen.
Langweilig. Hat jeder schon gehört und nervt nur: Plastik ist bequem, und du willst es uns wegnehmen? Hast du kein besseres Konzept für dein Buch?
Ich weiß nicht? Ich halte Konzepte generell für übertrieben. Mein Kollege Otto Schenk, mit dem ich gemeinsam einen Abend gemacht habe, hat mir dazu eine Geschichte erzählt: Ein Wiener Boxer, kein besonders guter, eher so der Typ aggressiver Vorstadtstrizzi, wurde vor einem seiner wichtigsten Boxkämpfe gegen einen Meister seines Faches in einem Interview gefragt, wie er ihn denn zu besiegen gedenke. Er antwortete: »I hab a Konzept.« Darauf der Interviewer: »Ja, aber Ihr Gegner hat eine starke Rechte.« Er: »Der kann ruhig a starke Rechte haben, aber i hab a Konzept.« Der Interviewer: »Ihr Gegner ist ein Meister der Deckung.« Er: »Der kann ruhig a Meister der Deckung sein, aber i hab a Konzept.« Der Interviewer: »Sehr spannend. Was ist denn Ihr Konzept?« Er: »I hau eam in die Goschn.«
Wir durften nicht laut losbrüllen, kehrten daher die Lachattacke nach innen, was nicht leicht war bei dieser gut vorbereiteten, aber ansatzlosen Punchline.
Wenn der Boxer nur halb so gut ist wie sein Konzept, ist er unschlagbar.
Wir hatten aber nicht nur den Boxer vor unserem geistigen Auge, sondern vor allem Otto Schenk, wie er die schlagende Pointe setzt, die noch jeden Zuschauer umgehauen hat. Topfit und mit großem Trainingsvorsprung, den er weidlich zu nutzen weiß, attackiert er an solchen Abenden sein Publikum, das sich seinerseits gezwungen sieht, die Treffer körperlich wegzustecken: durch Lachen. Otto ist Weltmeister in allen Klassen.
Wir jedenfalls waren angezählt, groggy, nahe am K. o. Wir brauchten eine Stärkung. Noch immer vor sich hin glucksend, holte Andreas zwei weitere Bier aus seiner Hütte, und ich brachte Salami und Brot auf unsere Terrasse. Erst halb zwei Uhr nachts, hatten wir beschlossen, noch eine Kleinigkeit zu essen. Darauf ging ich noch meinen Laptop holen, denn ich wollte Andreas zeigen, dass ich doch nicht ganz ohne Konzept war.
Schau. Es soll – das ist jetzt zwar kein Konzept, aber doch ein roter Faden –, es soll vor jeder Geschichte ein Gemälde stehen.
Modern oder klassisch? Abstrakt oder konkret?
Konkret, klassisch, historisch … Vielleicht ein modernes, aber nicht mehr als eines.
Kein Freund der modernen Kunst?
Nicht unbedingt. Aber schau, hier. Das wäre doch was für das Buch.
Ich klickte mich durch meinen Laptop.
Für die erste Geschichte?
Nein, nur ein Beispiel. Dazu hab ich gar keine konkrete Geschichte, obwohl es doch Bände spricht. Aber ich finde, das Gemälde sollte unbedingt hergezeigt werden. Es hat so was traurig Echtes. Hier ist es:
Wie grauenvoll.
Vermittelt es nicht haargenau die Stimmung einer langjährigen, unbefriedigten Beziehung?
Niemand würde heutzutage in einem Lokal seiner Frau auf den Busen greifen.
Das verbietet der Anstand. Klar. Aber die Stimmung ist doch hervorragend getroffen. Ein ganz normales Pärchen, seit fünfundzwanzig Jahren zusammen, verbringt einen gemeinsamen Nachmittag. Das Gemälde heißt übrigens Liebespaar in der Herberge.
Liebespaar?
Liebespaar. Heutzutage müsste man es Liebespaar nach einem Besuch bei Ikea nennen.
Das wäre doch eine wunderbare erste Geschichte – wie es dazu kam, dass die beiden so misslaunig, aber doch intim, ja fast mit sexueller Spannung, zumindest von seiner Seite, im Hinterzimmer einer Taverne sitzen.
Da muss schon einiges passiert sein. Mehr als die übliche Langeweile einer langjährigen Beziehung, meinst du?
Unbedingt. War vielleicht Ehebruch im Spiel?
Selbstverständlich! Eine der am weitesten verbreiteten menschlichen Dummheiten. Weil wir nicht für die Monogamie gemacht sind. Wir kämpfen auch hier gegen das Tier in uns.
Was war aber jetzt die Geschichte der beiden? Ich bin neugierig!
Keine Ahnung. Aber ich will das Buch nicht mit erotischen Pikanterien beginnen. Das birgt die Gefahr, die Leserschaft nach dieser Geschichte zu verlieren, da sie die am weitesten gehende Enthüllung menschlicher Abgründe schon hinter sich hat. Was soll denn nach einer Sexgeschichte noch kommen? Nein, nein. Ich werde die Sexgeschichte am Beginn versprechen, ankündigen und dann gegen Ende erzählen. So baut sich zumindest ein kleiner Spannungsbogen auf.
Du kannst sie mir ja jetzt erzählen und dann im Buch erst am Schluss schreiben.
Das stimmt.
Ich würde zu gerne wissen, wer von den beiden wen betrogen hat.
Schau sie dir doch an, die zwei. Sie macht einen traurigen Eindruck, gleichzeitig hat ihr zu Boden gesenkter Blick etwas von Reue. Sie schaut drein, als ob sie irgendeine Idee gehabt hätte zu einer Sache, die dann nicht so ausgegangen ist, wie sie das gehofft hat.
Er kann aber auch bedeuten: Warum muss mir der jetzt auf den Busen greifen?
Bedeutet er auch. Sie bereut irgendetwas und ärgert sich gleichzeitig über ihren Mann.
Und er sieht drein, als ob er sagen möchte: Das passt schon! Alles wieder gut! Wir haben die Sache überwunden, es ist nichts passiert!
Ja, aber was?
Weiß ich nicht, ist dein Buch.
Auf diese Geschichte kommen wir später zurück. Das Buch wird, wie viele andere Bücher auch, mit einem Zitat beginnen. Auf der ersten Seite, schön rechtsbündig und am besten kursiv:
Möglicherweise ist nur eine einzige Frage, die menschliche Existenz betreffend, von Bedeutung, ob nämlich das Leben eine Komödie oder eine Tragödie sei. Alles Weitere ergäbe sich aus ihrer Beantwortung.Aristophanes, 398 vor Christus, Komödiendichter
Kluger Mann, der Herr Aristophanes.
Komödiendichter im antiken Griechenland. Sehr erfolgreich.
Und woher ist das Zitat? Gibt es Tagebücher von ihm?
Nein, von ihm sind nur einige Stücke überliefert. Das Zitat ist …
Aus einer seiner Komödien?
Aus meinem Kopf. Ich habe es erfunden.
Aha. Und warum ist es dann »von Aristophanes«?
Weil es dann von größerer Bedeutung ist, als wenn ich es gesagt hätte. Außerdem kann ich mich ja nicht selber zitieren in meinem eigenen Buch.
Das ist Betrug.
Ich denke, es ist legitim, da er es gesagt haben könnte. Ich betätige mich sozusagen nur als Bauchredner, und was soll ein Komödiendichter denn anderes vom Leben denken? Und ist es nicht wahrhaftig die einzig bedeutende Frage?
Wenn du die Leute beeindrucken willst, dann musst du einen Philosophen zitieren oder ihm das Zitat unterschieben. Behaupte, es wäre von Platon.
Das könnte auffliegen, Platons Sämtliche Werke sind leicht zugänglich und weit verbreitet.
Erstens weiß man nie bei so antiken Philosophen, ob nicht doch noch irgendwelche Fragmente von verloren geglaubten Werken aufgetaucht sind, und zweitens gibt es sicher niemanden, der alles von Platon gelesen hat und sich dann auch noch alles gemerkt hat.
In unserem Jahrhundert vermutlich nicht, da hast du recht. Zur Hochblüte der Philologie im 19. Jahrhundert aber sehr wohl.
Was ja – ich darf das sagen? – genau das Kennzeichen von Halbbildung ist.
Ja, bei mir ist das ganz seltsam. Ich bin zwar kein Lehrer, aber trotzdem halbgebildet. Ich halte das wirklich für die entscheidende Frage für uns Menschen: Komödie oder Tragödie? Wie sehe, empfinde, erlebe ich mein Leben? Warte, da fällt mir ein anderes Zitat ein, das auch infrage kommt, diesmal nicht von mir.
Ich huschte in die Badehütte, kramte aus meinem Rucksack ein Büchlein hervor, das ich antiquarisch erworben hatte, und suchte nach der unterstrichenen Stelle, um sie Andreas vorzulesen.
»Darüber sind, wenn nicht die Gelehrten, so doch die Verständigen einig, dass die Erde nichts weniger als ein Eden, dass das ›goldene Zeitalter‹ der Freiheit, des Friedens und der Freude wie in der Vergangenheit, so auch in der Zukunft nur ein Ammenmärchen, dass die Natur unerbittlich und erbarmungslos, dass unser Menschenleben mit seiner jämmerlich unbehilflichen Kindheit und seinem einsamen, gebrechlichen Alter, mit seinen Krankheiten und seinen Torheiten, mit seinen zahllosen Niederträchtigkeiten, Schurkereien und Freveltaten, mit seinen ruhelosen Wünschen und unzulänglichen Befriedigungen, mit seinen boshaften Verkettungen und seinen wehvollen Trennungen, mit seinen Luftspiegelungen des Ehrgeizes, mit den Verführungen des Reichtums und den Demütigungen der Armut, mit allen seinen Sorgen, Mühen, Schmerzen, geknickten Hoffnungen und bitteren Erfahrungen, sogar mit seinem sogenannten Glück, seinen flüchtigen Genugtuungen und seinen täuschungsvollen Genüssen – ja, dass diese Erde mit allem, was darauf, nichts als eine grenzenlose Nichtigkeit, nichts als eine schnöde Prellerei, ein niederträchtiger Schwindel sei.«
Ich komme gleich, ich hole nur einen Strick, damit wir uns aufhängen können. Von wem ist das?
Johannes Scherr, 1817 bis 1886, Kulturhistoriker und Spaßbremse auf jeder Cocktailparty.
Kein gutes Zitat, viel zu negativ.
Aber doch im Grunde – ich meine alles in allem – sehr zutreffend. Diese Worte werden die meisten Menschen unterschreiben, außer sie kommen gerade von einem Lachyoga-Seminar.
Abgesehen davon ist es zu lang und altmodisch geschrieben.
Ich kann es ja adaptieren. Ich denke, ich werde das Zitat meinem Buch voranstellen, ein bisschen vereinfacht:
»Das Leben ist scheiße!«Frei nach Johannes Scherr,1876, Kulturhistoriker
Besser. Das hat Rock ’n’ Roll, das geht runter wie Butter.