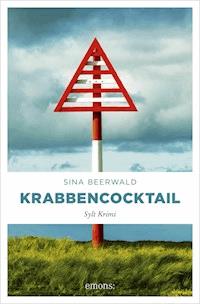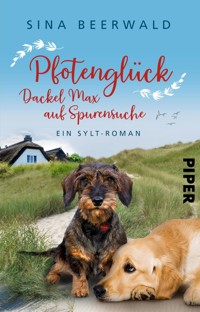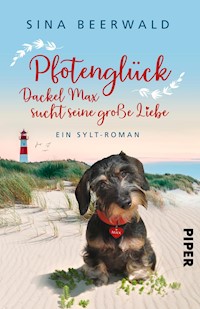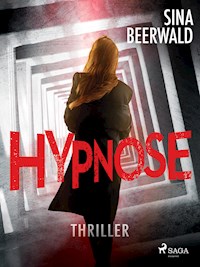Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Familie ist, wenn man trotzdem lacht: Der heitere Feelgood-Roman »Ein Weihnachtsmann zum Verlieben« von Sina Beerwald jetzt als eBook bei dotbooks. Sind denn jetzt alle im Adventschaos verrückt geworden? Vor Sarahs Tür steht ein attraktiver Kerl mit Rauschebart und behauptet, der Weihnachtsmann zu sein! Angeblich hat er das Christkind bei einem Schlittenunfall aus Versehen vom Himmel geholt und nun soll Sarah aushelfen, sonst war's das mit Weihnachten. Als ob sie nicht schon genug Probleme hätte: Schließlich hat ihr Mann sie gerade mitsamt den Kindern sitzenlassen. Doch ausgerechnet der verrückte Fremde kommt bei ihrer Familie sehr gut an, was auch an seinem verflixt leckeren Backrezept für Zimtschnecken liegen könnte. Und ganz allmählich beginnt Sarah, ihm seine wilde Geschichte zu glauben, denn er scheint sich nur am Nordpol und nicht in ihrer Welt auszukennen. Aber wie soll ausgerechnet sie nun Weihnachten noch retten? Ein zauberhafter Hygge-Roman mit finnischen Backrezepten für alle Fans von »Schöne Bescherung« und der Wohlfühlreihe »Weihnachtsgeschichten am Kamin«. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der turbulente Roman »Ein Weihnachtsmann zum Verlieben« von Sina Beerwald erschien bereits unter dem Titel »Hauptsache, der Baum brennt«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sind denn jetzt alle im Adventschaos verrückt geworden? Vor Sarahs Tür steht ein attraktiver Kerl mit Rauschebart und behauptet, der Weihnachtsmann zu sein! Angeblich hat er das Christkind bei einem Schlittenunfall aus Versehen vom Himmel geholt und nun soll Sarah aushelfen, sonst war's das mit Weihnachten. Als ob sie nicht schon genug Probleme hätte: Schließlich hat ihr Mann sie gerade mitsamt den Kindern sitzenlassen. Doch ausgerechnet der verrückte Fremde kommt bei ihrer Familie sehr gut an, was auch an seinem verflixt leckeren Backrezept für Zimtschnecken liegen könnte. Und ganz allmählich beginnt Sarah, ihm seine wilde Geschichte zu glauben, denn er scheint sich nur am Nordpol und nicht in ihrer Welt auszukennen. Aber wie soll ausgerechnet sie nun Weihnachten noch retten?
Über die Autorin:
Sina Beerwald, 1977 in Stuttgart geboren, veröffentlichte bereits zahlreiche Bücher, darunter auch historische Romane und Sylt-Erlebnisführer. Sie ist Preisträgerin des NordMordAward und des Samiel Award. Ihre Romane »Die Strandvilla« und »Das Dünencafé« wurden für die Shortlist des LovelyBooks Leserpreises nominiert. 2008 wanderte sie mit zwei Koffern und vielen Ideen im Gepäck auf die Insel Sylt aus und lebt dort seither als freie Autorin.
Die Website der Autorin: sina-beerwald.de/
Die Autorin auf Facebook: www.facebook.com/sina.beerwald
Die Autorin auf Instagram: www.instagram.com/sina_beerwald/
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2023
Dieses Buch erschien bereits 2018 unter dem Titel »Hauptsache, der Baum brennt« bei Knaur.
Copyright © der Originalausgabe 2018 Knaur Verlag
Ein Imprint der Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-948-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Ein Weihnachtsmann zum Verlieben«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sina Beerwald
Ein Weihnachtsmann zum Verlieben
Roman
dotbooks.
Kapitel 1
Entweder ich habe bei unserem Mädelsabend gestern doch zu viel getrunken, oder mir hat jemand was ins Sektglas gemischt. Wie auch immer, jedenfalls hat gerade eben in aller Herrgottsfrühe der Weihnachtsmann bei mir geklingelt. Der echte Weihnachtsmann – zumindest behauptet er das.
Schlaftrunken lehne ich mich an den Türrahmen, der sonst auch weniger schwankt, und ziehe den Gürtel meines Bademantels enger. An Heiligabend hätte ich mir so eine Aktion ja noch gefallen lassen – mit einem großen Sack voller Geschenke im Schlepptau. Aber heute ist der zweite Dezember.
»Volltreffer!«, ruft der Rauschebart, und seine ernste Miene wird zu einem Sechser-im-Lotto-Strahlen. »Sie sind die Richtige!«
»Ahm, und wofür, bitte?« Ich ziehe die Stirn in Falten, was meine Kopfschmerzen augenblicklich verstärkt. Er zögert seine Antwort so genussvoll hinaus, dass ich glaube, bei einem Gewinnspiel den Hauptpreis gewonnen zu haben.
Allerdings habe ich nirgendwo mitgemacht. Ziehen die Staubsaugervertreter neuerdings im langen roten Mantel durch die Gegend?
Vorsorglich lege ich meine Hand auf die Türklinke. Wenn der es wagt, mir was verkaufen zu wollen ... Aber vielleicht habe ich ja auch mal Glück. Das könnte ich als Mutter von zwei pubertierenden Kindern und gerade frisch getrennt von meinem Mann, der vor vier Wochen Knall auf Fall bei seiner Arbeitskollegin – natürlich deutlich jünger als ich mit meinen zweiundvierzig Jahren und ohne Schwangerschaftsandenken – eingezogen ist, gerade ganz gut gebrauchen.
Er breitet die Arme aus, so als hätte er mich nach einer langen Reise endlich gefunden.
»Sie sind das neue Christkind!« Seine Begeisterung kennt keine Grenzen, während meine hochgeschraubte Erwartungshaltung einem »Sie haben eine Heizdecke gewonnen«-Gefühl weicht.
Er klopft auf das Türschild, weil ich in seinen Augen noch nicht ganz überzeugt scheine. Ich nenne es eher Fassungslosigkeit darüber, wie jemand sonntagmorgens um sechs so dreist sein kann.
»Sarah Christkind! Sie sind es! Das neue Christkind. Und was für schöne Engelslocken Sie haben. Sie könnten nur etwas blonder und ordentlicher gekämmt sein, aber das macht nichts, das bekommen wir hin.«
Ich ziehe die Augenbrauen hoch. Um diese Uhrzeit ist mein Nervenkostüm noch sehr, sehr dünn – insbesondere, wenn ein durchgeknallter Weihnachtsmann vor mir herumturnt, während ich noch völlig neben mir stehe.
»Ihnen geht s ja wohl zu gut! Was soll der blöde Scherz? Ich bin nicht das Christkind, ich heiße nur so. Das ist wie bei Ihnen, Sie sind ja auch nicht der Weihnachtsmann. So, und jetzt lassen Sie mich und meinen Kater gefälligst in Ruhe!«
Ich hätte wissen müssen, dass sein Fuß schneller in der Tür ist, als meine sektgetränkten Synapsen schalten können.
»Das ist kein Scherz. Und natürlich bin ich der echte Weihnachtsmann.«
»Natürlich«, seufze ich. Wenn überhaupt, dann ist der Weihnachtsmann alt und dick, aber der Typ vor mir ist noch keine fünfzig und stammt offenbar aus dem Portfolio einer Modelagentur, wie Jeff Bridges in seinen besten Jahren mit Rauschebart und unverschämt blauen Augen. Doch ganz gleich, wie gut er aussieht, mir können zurzeit sämtliche Männer gestohlen bleiben. Besonders solche merkwürdigen Typen um diese Uhrzeit.
»Was auch immer Ihr Problem ist, wir können gern darüber reden. Das ist mein Job, aber nicht sonntagmorgens.« Ich angle eine Visitenkarte unserer psychologischen Gemeinschaftspraxis vom Garderobenschränkchen, die sich im selben Haus befindet. »Rufen Sie morgen in meiner Praxis an und lassen Sie sich einen Termin geben.«
Der Rauschebart vom Laufsteg schüttelt den Kopf. »Ich habe kein Wir-müssen-darüber-reden-Problem. Das ist ein Wir- brauchen-Schaufel-und-Müllsack- Problem.«
»Ein ... bitte was?«
Aus seinen arktisblauen Augen weicht aller Glanz. »Ich ... ich habe das Christkind umgebracht ... « Die Worte fallen ihm schwer, und mir wird ganz anders. Was faselt der da? Oder anders gefragt: Was hat man dem armen Kerl eigentlich ins Bier gekippt? Seine breiten Schultern heben und senken sich wie unter einer schweren Last.
»Allerdings nicht mit Absicht, das müssen Sie mir glauben! Die Schlittenkollision war ein Unfall. Durch den Zusammenstoß ist das Christkind ohnmächtig geworden und vom Himmel gefallen. Ich wollte das wirklich nicht! Jeder denkt, ich hätte etwas gegen das Christkind, aber das stimmt nicht, Ehrenwort! Ich stehe jetzt nämlich ganz allein da – kurz vor dem Weihnachtsfest. Aber nun habe ich ja ein neues Christkind gefunden!«
Der Ernst, mit dem er seine Geschichte vorträgt, bringt mich fast zum Lachen. Immer wieder phänomenal, was eine kranke Seele mit einem Menschen machen kann.
Anstelle einer Antwort kritzle ich ein paar Zahlen auf einen Zettel. Die Nummer des sozialpsychiatrischen Diensts, genau für solche Notfälle gedacht.
Der Typ sollte mit der Behandlung nicht mehr bis morgen warten. »Rufen Sie da an. Die sind jederzeit erreichbar und haben von solchen ... Unfällen schon öfter gehört. Dort sind Sie an der richtigen Adresse.«
»Nein, das bin ich bei Ihnen. Sie sind meine Rettung – ach, was sage ich, die Rettung des Weihnachtsfests! Sie müssen mir helfen!«
Wenn das hier noch länger so weitergeht, muss ich in eigener Sache dort anrufen – weil ich so langsam nur noch rotsehe, was sicher nicht an seinem Mantel liegt.
»Ich, Sarah Christkind, muss gar nichts, außer dringend zurück ins Bett! Und Sie lassen mich gefälligst in Ruhe!«, schmettere ich dem Spinner entgegen. Erst die Worte, danach die Tür.
Wieder allein, atme ich tief durch, fahre mir durch die schulterlangen Locken und frage mich, ob das gerade wirklich passiert ist oder ich vielleicht in einem merkwürdigen Traum stecke. Mein Kneiftest beweist mir, dass ich mich mitten in der Realität befinde – wenn auch noch nicht ganz wach, weil ich gerade mal drei Stunden Schlaf hatte.
Wenn ich das meinen Freundinnen erzähle – die lachen sich kaputt. Warum passieren eigentlich immer nur mir solche komischen Sachen? Durch meinen Berufsalltag könnte ich ganze Bände mit kuriosen Geschichten füllen, aber so was habe ich dann auch noch nicht erlebt.
Nun schaltet sich doch mein Gewissen ein, und ich frage mich, ob ich ihn in diesem Zustand abweisen durfte, wenn das nicht nur ein blöder Scherz war – allerdings frage ich mich das nur vom Flur bis ins Schlafzimmer.
Oder besser gesagt: nur so lange, bis es erneut klingelt. Sturm klingelt.
Wie um alles in der Welt mache ich diesem sturen Rauschebart begreiflich, dass ich nur zufällig Locken habe und mit Nachnamen Christkind heiße – und dass er nicht der echte Weihnachtsmann ist, sondern einen echten Dachschaden hat, um es mal ohne Umschweife zu sagen.
Zu diesem Zeitpunkt ahne ich noch nicht, dass das für die nächsten knapp 24 Tage mein kleinstes Problem sein würde.
***
Als ich gegen Mittag beschließe, aus dem Bett zu kriechen und meinen Kater und damit auch mich an die frische Luft zu setzen, kann ich über die frühmorgendliche Begegnung bereits lachen. In meinem zehnjährigen Berufsleben sind mir schon einige skurrile Typen und sämtliche psychoneurotischen Störungen untergekommen – aber noch keiner hat sich für den Weihnachtsmann gehalten und dabei auch noch geglaubt, das Christkind umgebracht zu haben.
Die Wintersonne blendet mich, als ich aus dem Schatten unseres schönen Altbaumehrfamilienhauses auf die ruhige Seitenstraße am Kaiserplatz trete, wo die Glocken der gegenüberliegenden St.-Ursula-Kirche den Mittag einläuten. Ein Spaziergang auf meinem Lieblingsweg durch den Englischen Garten an der Isar entlang wird mir bestimmt guttun. Also Sonnenbrille aufsetzen und hoffen, dass die Kopfschmerzen besser werden.
Bis die Kinder heute Abend nach Hause kommen, muss ich wieder fit sein. Meine Pubertiere sind heute zum ersten Mal seit der Trennung übers Wochenende bei ihrem Vater und damit auch bei seiner neuen Flamme. Ich bin gespannt, was sie erzählen. Hoffentlich hassen sie dieses Weibsstück.
Für solche Gedanken sollte ich mich eigentlich schämen, aber ich tue es nicht. Dafür liebe ich meinen Mann noch zu sehr, und selbst wenn in unserer Ehe das einzig Aufregende nicht mehr die Nächte, sondern die Diskussionen mit unserer 13-jährigenTochter und dem 15-jährigen Sohn waren, hatte sie kein Recht, mir meinen Mann auszuspannen. Natürlich sagt mir mein Verstand, dass dazu immer zwei gehören, aber mein Herz ignoriert das.
Den Weihnachtsmann kann ich nicht ignorieren. Noch weniger seinen prächtigen Schlitten samt der Rentiere auf der verschneiten Grünfläche vor der Kirche, wo sich auch der Spielplatz befindet.
Doch der ist wie leergefegt, weil sämtliche Kinder und Erwachsene entweder die Tiere streicheln, in der Kutsche sitzen oder den Weihnachtsmann belagern, der mit großen Gesten gerade von seinem Leben erzählt.
Wow, eine ganz schön interessante Form der dissoziativen Störung, denke ich fasziniert. Könnte aber auch eine aus dem bipolaren Formenkreis sein. Er wäre nicht der Erste, der Haus und Hof im Glauben an eine andere Identität versetzt – und dabei alles verliert, vor allem sich selbst.
Dem Mann muss dringend geholfen werden – oder doch besser mir?, kann ich mich gerade noch fragen, nachdem er mich entdeckt hat, seine Geschichte abrupt unterbricht, die Arme in die Luft wirft und durch den Kreis seiner irritierten Zuhörerschaft auf mich zustürmt.
»Na, endlich ausgeschlafen?« Er will mich zum Schlitten hinüberziehen. »Kommen Sie, die Fahrt geht los!«
»Sie lassen mich jetzt sofort los!«, schreie ich wutentbrannt und zugegebenermaßen leicht panisch. Angesichts der irritierten Blicke seiner zahlreichen Anhänger komme ich mir allerdings ziemlich bescheuert vor. Bestimmt habe ich jetzt ein paar Kinderseelen verstört, und die Erwachsenen halten mich wohl für verrückt. Darunter auch meine Nachbarn. Na super.
Ich wende mich ab und beschleunige meinen Schritt in Richtung der großen Querstraße, ohne mich noch einmal umzudrehen.
Wie es aussehen muss, dass mir ein Rauschebart im roten Mantel auf der Herzogstraße hinterherrennt und dabei immer wieder »Christkind, warte doch« ruft, kann ich mir auch so ausmalen.
Wir kommen der Fußgängerampel an der Kreuzung Wilhelmstraße näher, und ich hoffe, dass sie gleich auf Grün springt. Er keucht, als wäre er einen Kilometer gesprintet.
Gute Chancen, ihn abzuhängen. Kondition gleich null, obwohl er keinen Bauch hat.
Grün!
»Wo wollen Sie denn hin?«, höre ich ihn noch relativ dicht hinter mir rufen.
Ja, wo will ich denn eigentlich hin? Möglichkeiten gibt es genug. Direkt zur Polizei, um ihn wegen Belästigung anzuzeigen, ihn in die nächste psychiatrische Notaufnahme bringen – oder, wenn das so weitergeht, mich selbst einliefern lassen.
Ein gemütlicher Winterspaziergang ist jedenfalls in so weite Ferne gerückt wie der Mond, auf den ich ihn am liebsten schießen würde.
Ein lang gezogenes Hupen. Gedankenriss. Reflexartig greife ich nach dem Weihnachtsmannmantelgürtel.
Gerettet.
»Mein Engel!«, ruft der Weihnachtsmann, dessen Gesichtsfarbe vom Bart nicht mehr zu unterscheiden ist. »Fast wäre ich überfahren worden.« Er zieht mich in seine Arme, und mir steigt der Geruch von Holzfeuer und Tannennadeln in die Nase. Der Duft von Abenteuer und Romantik – ziemlich erotisch. Aber dagegen bin ich immun – glaube ich zumindest.
»Bei allen Wichteln, nun habe ich Ihnen mein Leben zu verdanken!
Ich seufze. Auch das noch. Man sollte dem Schicksal nicht dazwischenpfuschen. Es hätte so einfach sein können. »Machen Sie bei der nächsten Ampel gefälligst die Augen auf.«
»Ampel?«
Okay, zum Augenarzt kann ich ihn also auch noch bringen.
»Ganz schön viele Schlitten unterwegs«, stellt er fest und sieht sich dabei in alle Richtungen um, als könne ihn jeden Moment das nächste Auto erwischen. »Und was war jetzt mit dieser Ampel?«
»Sie war rot.«
»Was bedeutet das? Und woher wissen diese bereiften Schlitten, wann sie fahren dürfen und anhalten müssen, auch wenn keine, wie heißen die Dinger ... Ampeln da sind?«
Seine Unwissenheit spielt er so überzeugend, dass ich tatsächlich unsicher werde.
»Straßenverkehrsordnung?«, gebe ich zurück und schaue ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an.
»Straßenverkehrsordnung«, echot er und bricht sich dabei fast die Zunge. »So was haben wir am Himmel nicht. Über Deutschland gibt es ja auch nur zwei Kutschen. Gab es. Bei allen heiligen Rentieren, wie konnte der Unfall nur passieren? Ich wollte das Christkind nicht umbringen!« Zum Ende hin war er immer lauter geworden.
Eine Passantin, die mit einem Lächeln an uns vorübergegangen war, dreht sich erschrocken um.
»Seien Sie doch leise«, zische ich und ziehe den Weihnachtsmann weiter. Also doch besser auf dem direkten Weg seinen roten Mantel gegen eine weiße Jacke tauschen.
Er schlägt sich die Hand auf den Mund. »Natürlich, Sie haben recht. Wenn sich bis zum Nordpol herumspricht, dass ich das Christkind umgebracht habe, wird man mich ins ewige Eis verbannen, und es wird dieses Jahr kein Fest mit strahlenden Kinderaugen geben. Christkind, du musst mir helfen!«
»Das habe ich vor.«
»Und wie? Sie verstehen nicht, dass nur Sie das Weihnachtsfest retten können. Sie wollen einfach nicht begreifen, dass Sie das neue Christkind sind. Sie zweifeln an mir und an der ganzen Geschichte.«
Zweifeln ist noch harmlos ausgedrückt, denke ich und sage stattdessen: »Wir gehen jetzt in ein Haus, wo man Ihnen helfen wird. Ich kann das wirklich nicht leisten und fühle mich ehrlich gesagt etwas überfordert mit der ganzen Sache.«
»Verständlich. Man wird ja nicht jeden Tag Christkind, nur wenige Menschen hatten bislang diese Ehre, und es ist ein Job mit hoher Verantwortung – aber Sie schaffen das, ganz sicher. Die Einarbeitungszeit ist zugegebenermaßen etwas knapp, aber ich denke, es reicht, wenn ich Ihnen einen Crashkurs in Schlittensteuerung gebe.«
»Crashkurs?«, frage ich und runzle die Stirn.
»Oh, die Wortwahl war jetzt wohl etwas ungeschickt. Aber glauben Sie mir, nach ein paar Schlittenflugstunden sind Sie darin sicher.«
»Ich bin mir sicher, dass sich in dem Haus, in das ich Sie jetzt bringen werde, die Sache mit dem Christkind klären wird.«
Seine Miene hellt sich auf. »Ach, jetzt begreife ich! Sie meinen, da lebt eine Frau, die auch Christkind heißt und den Job machen würde? Eine Verwandte von Ihnen?«
»Eine Kollegin ...«, gebe ich mich vage. »Ihr Problem wird sich lösen, da bin ich ganz zuversichtlich.«
Wir erreichen die U-Bahn Haltestelle Münchner Freiheit, und mein Problem im roten Mantel bleibt abrupt am Eingang zur Rolltreppe stehen. »Ich soll in die Hölle hinunterfahren? Niemals!«
Hinter uns drängeln Leute, und mir bleibt keine Zeit für psychologisches Feingefühl. Ich packe ihn am Ärmel, ziehe ihn von der Rolltreppe weg und lotse ihn zur normalen Treppe.
»Ist das besser? Da unten ist nicht die Hölle, sondern eine gewöhnliche U-Bahn-Station, damit wir schnell an unser Ziel kommen, vertrauen Sie mir.« Ich reiche ihm meine Hand.
Nach kurzem Zögern ergreift er sie, und wir gehen wie ein Pärchen die Treppen hinunter.
»Schau mal, Mama, der Weihnachtsmann und das Christkind!«, ruft ein Mädchen, das die Rolltreppe hinauffährt.
Seine Anspannung weicht schlagartig, begeistert winkt er ihr zu, und die Lachfältchen um seine Augen fächern sich auf wie Sonnenstrahlen. Dieser Rauschebart hat einen unwiderstehlichen Charme, der auch auf mich wirkt, das muss man ihm lassen.
»Wir werden dir dieses Jahr ganz viele Geschenke bringen!«, ruft er dem Mädchen nach, dessen Augen strahlen.
Na, vielen Dank auch.
»Das war doch der beste Beweis!«, versucht mich der Weihnachtsmann zu überzeugen. Bei seinen folgenden Argumenten schalte ich auf Durchzug und richte den Blick auf die Anzeige, die die einfahrende U3 ankündigt. Beim Odeonsplatz müssen wir in die U5 zum Max-Weber-Platz umsteigen, insgesamt rund zehn Minuten Fahrzeit, aber dann haben wir es zum Klinikum meiner Wahl geschafft. Hoffentlich.
Denn mein Problem kreischt lauter als die Bremsen der Bahn, und nachdem sich die Türen geöffnet haben und die Menschen herausströmen, ist er keinen Schritt mehr zu bewegen. Ich fühle, wie er am ganzen Körper zittert.
»Was ist das für ein Höllengefährt? Da steige ich nicht ein!«
»Das ist eine stinknormale U-Bahn!«, verdeutliche ich ihm mit wachsender Ungeduld und somit jenseits aller psychologischer Lehrbücher. Gut, die leicht futuristisch anmutende Gestaltung mit blauen Lichtsäulen und knallgelber Wandfarbe ist ungewöhnlich, aber kein Grund zum Fürchten – jedenfalls nicht im Sinne von Angst. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten.
»Es stinkt hier, allerdings!«, kontert der Weihnachtsmann und macht sich mit einem Ruck von mir los. »Außerdem sind da drin viel zu viele Menschen, und es ist zu eng!«
Der hat wohl noch keine Rushhour erlebt, denke ich, da drin kann man ja Walzer tanzen.
Na bravo. Nun habe ich es also mit einem Typen mit dissoziativer Störung, Agoraphobie und Anthropophobie zu tun, der nun zusammengekauert auf der Wartebank am Gleis sitzt und sich die Ohren zuhält, als sich die Türen mit einem durchdringenden Warnton schließen.
Nachdem die Bahn losgefahren ist, höre ich aus seinem wimmernden Rauschebartnuscheln ein »Christkind, Hilfe« heraus.
Na dann, frohes Fest.
Ich lege ihm meine Hand auf die Schulter. Nun tut er mir wirklich leid. »Ich bin doch dabei, Ihnen zu helfen – nur müssen Sie auch mitmachen.«
Der Weihnachtsmann hebt den Kopf und lässt die Arme entkräftet in den Schoß sinken. In seinen hellblauen Augen glänzen Tränen. »Ich tue alles, was Sie sagen. Nur bringen Sie mich aus dieser Hölle raus. Ich drehe sonst durch. Das macht mir alles Angst. Hier ist es so furchtbar laut, stickig und dreckig.«
Dreckig? Ich habe selten einen so sauberen Bahnhof gesehen, doch seiner Körpersprache nach zu urteilen, scheint er echten Ekel zu empfinden. Mysophobie, setze ich auf meiner gedanklichen Liste dazu.
Stickig ist es hier unten wirklich, das bestätigt mir auch mein Kreislauf mit einem leichten Schwindelgefühl. Aber das kommt wohl auch vom Schlafmangel, außerdem habe ich noch nichts gegessen, und somit fährt der Sekt in meinen Adern ungehindert Achterbahn.
»Wir holen uns jetzt oben am Kiosk was zu essen und zu trinken – und dann gehen wir zu Fuß weiter.« Sind ja nur rund drei Kilometer und eine knappe Stunde zu Fuß. Aber wie war das noch gleich? Ich wollte doch einen Sonntagsspaziergang machen.
Der Rauschebart nickt und folgt mir, wenn auch sichtlich wackelig auf den Beinen, treubrav wie ein Hund, diesmal sogar auf die Rolltreppe – wo er auf einmal nicht mehr neben mir steht.
Die erste Stufe. Eine Gleichgewichtsfrage.
Er beantwortet sie mit rudernden Armen, einer schreckstarren Miene und einem Ausfallschritt nach hinten. Mein Herz saust mindestens genauso schnell zu Boden wie er, und ich beeile mich, die Rolltreppe entgegen der Fahrtrichtung zu ihm zu gelangen, um ihm aufzuhelfen.
Er scheint okay zu sein und jammert nur über sein Steißbein – und über fahrende Stufen.
»Wo ich lebe, gibt es kein solches Hexenwerk!«
»Natürlich, Entschuldigung«, sage ich im Versuch, mich auf seine Denkweise einzulassen, um seine Kooperation nicht zu gefährden. »Wir nehmen dann auch nach oben die normale Treppe.«
Der Rauschebart dankt es mir, mein Kreislauf nicht. Interessanterweise hat sich keiner der ans Tageslicht strömenden Passanten um den Unfall geschert, wer nach oben wollte, hat sich an uns vorbeigedrängelt. Das höchste der Gefühle war ein geringschätziger Schon-am-helllichten-Tag-besoffen-Blick. Wenn es nur das wäre.
So langsam zweifle ich daran, dass ich ihn überhaupt unfallfrei bis in die Klinik bringe. Während wir die Treppe hinaufsteigen – ich gehe, er keucht -, spiele ich mit dem Gedanken, die 112 zu rufen, damit sie ihn abholen, verwerfe die Überlegung aber im gleichen Moment wieder.
Niemals würde er in einen Krankenwagen einsteigen, stattdessen schon allein bei dessen Anblick die Flucht ergreifen.
Letzteres würde ich jetzt auch am liebsten tun. Meine Kräfte schwinden, und nur mein Helfersyndrom sorgt noch für Energie. Noch.
Oben angekommen, rinnt dem vermeintlichen Nordpolbewohner der Schweiß von der Stirn.
»Wollen Sie sich nicht vielleicht Ihren Bart abnehmen? Sie bekommen ja kaum Luft. Nicht dass Sie mir noch in Ohnmacht fallen.«
»Bitte was, den Bart?« Er sieht mich an, als hätte ich ihm vorgeschlagen, sich ein Bein auszureißen. »Der ist echt, fühlen Sie doch selbst!«
Ich kann nicht umhin, ihm in den schneeweißen Bart zu greifen. Es stimmt. Wie kann jemand in seinem Alter schon so weiß geworden sein? Denn nicht anders ist es mit seinen zum Zopf gebundenen Haaren. Das macht ihn jedoch nicht weniger attraktiv, ganz im Gegenteil, und mit seinem Rauschbart liegt er dazu noch voll im Trend.
»Dann ziehen Sie wenigstens Ihren langen Mantel aus. Sie schwitzen sich darin ja zu Tode.«
Obwohl sein skeptischer Blick Bände spricht, löst er ohne Widerspruch seinen schwarzen Gürtel. »Ich habe Ihnen versprochen, dass ich alles tue, was Sie sagen. Aber soll ich wirk...«
»Ein Exhibitionist!«, kreischt eine ältere Frau direkt hinter mir. »Polizei!«
»Um Gottes willen!« Ich stürze zum Weihnachtsmann hin und halte ihm dem Mantel zu. Wobei ich zugeben muss, dass mir gefiel, was ich in diesen zwei Sekunden gesehen habe. Peinlich berührt drehe ich mich zu der Alarmgeberin um, die bereits in ihr Handy tippt.
»Keine Polizei, bitte ...«, versuche ich sie zu beschwichtigen, obwohl das jetzt meine Chance wäre. »Das ... Ähm, das war nur ein Versehen, ein Missverständnis ... Kommt nicht wieder vor, nix für ungut, bitte ...«, stammle ich.
»Dann drehen Sie Ihre Pornos gefälligst woanders!«, schimpft sie und geht weiter ihres Wegs.
Puh! Ich überlege, ob ich mir statt eines Kaffees besser einen Schnaps holen sollte, und zwar einen doppelten.
»Warum tragen Sie denn um Himmels willen nix drunter?«, zische ich ihm zu, während er eilig wieder seinen Gürtel umlegt und fest verschließt. Auch dem Weihnachtsmann ist die Sache peinlich.
»Was soll ich denn drunter tragen?«, fragt er mit einer so glaubhaften Unschuld, dass ich fasziniert beschließe, mich intensiver mit dissoziativen Störungen auseinanderzusetzen oder in welchen Formenkreis auch immer man ihn nach einem ausgiebigen Test einsortieren würde. Sein Beispiel wäre direkt etwas für einen Fachkongress.
»Unterwäsche, zum Beispiel?«
»Sie meinen diese Zelte, die meine Mutter immer meinem Vater genäht hat und auch mir aufnötigen wollte? Ohne mich. Ich meine, am Nordpol und wenn ich auf Reisen bin, trage ich noch eine Hose drunter, aber Sie haben doch selbst gesagt, dass es allein schon mit dem langen Mantel zu heiß ist. Das ist doch kein Winter, hier herrschen ja Temperaturen wie bei uns in der Plätzchenbackstube.«
Wie aufs Stichwort knurrt mir der Magen. Und was der Weihnachtsmann drunter trägt, das soll gleich nicht mehr meine Sorge sein, sondern die der Klinik.
»Einen Kaffee und eine Butterbrezel, bitte«, bestelle ich am Kiosk. »Und Sie?«, wende ich mich an den Rauschebart, der mit gerunzelter Stirn das Sortiment studiert.
»Ein Schneehasenbrötchen, bitte.«
»Ein was?«, stutzt der Kioskbetreiber und lehnt sich weiter vor, als hätte er nicht richtig verstanden.
»Ein Schneehasenbrötchen«, wiederholt der Weihnachtsmann geduldig. »Wenn Sie das nicht haben, nehme ich ein einfaches Rentiersandwich, auch wenn ich dabei immer meinen Moralischen kriege.«
»Sie Witzbold sind ja schon um die Uhrzeitjenseits der Donnerkuppel. Vier zwanzig«, brummelt er in meine Richtung.
Ich reiche ihm meinen Schein rüber. Vielleicht hätte ich doch besser einen Schnaps bestellen sollen. Zuletzt habe ich vor vier Wochen einen getrunken, nachdem die Tür hinter meinem Mann und seinem Koffer ins Schloss gefallen war. Jetzt befinde ich mich wieder in einer Ausnahmesituation – dieses Mal nur leider mit einem Mann zu viel. Einem Weihnachtsmann.
Ich bestelle noch eine Brezel und ein Wasser für ihn und nehme das Wechselgeld entgegen.
»Was haben Sie mit dem Verkäufer denn da gerade ausgetauscht?«, fragt er mich, als wir ein paar Schritte gegangen sind.
»Geld?«
»Was ist Geld?«
»Das ist ... Lassen wir das.« Damit wäre auch geklärt, dass er keins in der Tasche hat. Passt ja auch ins Bild – nur nicht in meinen Plan. Das Taxi können wir also auch vergessen, weil ich für meinen Spaziergang nur die zehn Euro und meine Monatskarte eingesteckt habe.
Wollte ich nicht schon immer mal an der Seite eines Weihnachtsmanns durch den Englischen Garten spazieren? Immerhin gibt es dort nicht so viele Gefahrenquellen – nur viele Frauen in kurzen Winterröcken.
Wir nehmen den Weg am halb zugefrorenen Kleinhesseloher See entlang, auf dem die Enten in den Wasserlöchern in der Sonne ihre gemächlichen Runden drehen. Ente müsste man sein. Obwohl, zu Weihnachten auch nicht unbedingt.
Hoffentlich kann man diesen Winter hier wieder Schlittschuh laufen, das gehört für mich seit Kindertagen zu München wie das Oktoberfest. Während ich den Blick wieder auf den Weg richte, fällt mir auf, dass der Weihnachtsmann halb rückwärtsgeht.
»Hören Sie auf, der Frau so nachzustarren!«, raune ich.
Ertappt entschuldigt er sich und wendet sich augenblicklich nach vorn. Fast. Während er mit mir spricht, schielt er über die Schulter.
»In meinem Dorf leben nur Wichtel, meine Mutter und meine Großmutter ... Sie verstehen?«
Alles klar, denke ich mit einem innerlichen Seufzer, doch dann kommt mir eine zündende Idee, wie ich ihn von meiner Person als Christkind ablenken könnte.
In seinem Film leben seine Mutter und die Großmutter zwar am Nordpol und nicht in München, doch rein psychologisch betrachtet bedeutet die Erwähnung der beiden in diesem Zusammenhang, dass er in gutem Kontakt mit ihnen zu stehen scheint.
»Die beiden Damen wären doch geradezu prädestiniert, Ihnen als Christkind auszuhelfen. Sie kennen die Abläufe, können den Schlitten beladen, mit den Rentieren umgehen und so wei...«
»Es freut mich, dass Sie mich so langsam etwas ernst nehmen. Das Problem ist nur, meine Großmutter kann sich kaum mehr bewegen, sitzt nur noch im Sessel und näht Kleidung für die Wichtel.«
»Und was ist mit Ihrer Mutter?«
»Die hat Flugangst.«
Natürlich, was auch sonst.
»Sie zweifeln schon wieder an mir, das sehe ich. Warum glauben Sie mir nicht? Meine Mutter ist nur einmal in ihrem Leben geflogen. Keine zehn Rentiere würden sie noch mal in einen Schlitten bringen. Und was noch viel schlimmer ist, ich kann doch meiner Mutter nicht sagen, dass ich das Christkind umgebracht habe. Sie wird mich verbannen!«
»Das glaube ich nicht«, versuche ich auf ihn einzuwirken. »An Ihrer Stelle würde ich mich ihr anvertrauen.«
»Ausgeschlossen!«, ruft er.
Nach einer geraumen Zeit des Schweigens raunt er mir zu: »Haben Sie gesehen, die hübsche Brünette hat sich gerade nach mir umgedreht!«
Er will stehen bleiben, aber ich ziehe ihn weiter.
»Es spaziert nicht jeden Tag ein Weihnachtsmann durch den Englischen Garten.«
»Stimmt.« Er lässt den Blick ausnahmsweise mal von den Frauen auf den Chinesischen Turm schweifen, den wir gerade in Sichtweite haben. Dort findet der wohl romantischste Weihnachtsmarkt Münchens statt, der mir zurzeit so was von gestohlen bleiben kann, es sei denn, ich könnte beim Eisstockschießen das Foto meines abtrünnigen Manns auf einen Eisstock kleben.
Bislang habe ich diesen Weihnachtsmarkt fernab des Trubels geliebt, mit dem historischen Karussell, Omas Geschichtenstall und Opas Schreinerei, wo die Kinder etwas aus Holz fertigen konnten.
»Im Englischen Garten war ich tatsächlich noch nie. Aber ich glaube, die Frau hatte wirklich Interesse an mir.«
»Hmhm«, mache ich und denke mir meinen Teil. »Wie lange ist eigentlich Ihre letzte Beziehung her, wenn ich fragen darf?« Vielleicht ist eine Trennung ja der Auslöser seiner psychischen Störung.
»Oh, das ist schon lange her ... Eine hübsche Spanierin hatte sich mal in mich verliebt, nachdem sie mich beim Geschenkeausliefern ertappt hat. Da war ich noch jung und unerfahren, im doppelten Sinne. Sie konnte kaum glauben, dass es den Mann ihrer Träume wirklich gibt. Na ja, aber schon nach drei Monaten hat sie das Leben im hohen Norden nicht mehr ausgehalten. Und ansonsten ist es in meinem Alltag schwierig, eine Frau kennenzulernen. Da muss schon der Zufall zu Hilfe kommen, so wie mein Vater meine Mutter kennengelernt hat, als er in ihrem Kamin stecken geblieben ist. Ich weiß ja nicht mal, wie man eine Frau richtig anspricht.«
Dieser bildschöne Mann ist in seinem Wahn wirklich zu bemitleiden. »Jedenfalls nicht, indem man ihr nachstarrt. Werte wie Respekt und Höflichkeit zählen immer noch.«
Dazu gehört auch, dass man nicht sonntagmorgens bei einer wildfremden Frau läutet und sie zum Christkind erklärt, will ich noch sagen, aber da klingelt mein Handy, ich sehe den Namen meiner Tochter Lilly auf dem Display und bleibe stehen.
Wahrscheinlich haben meine Kinder genug von der neuen Frau an der Seite ihres Vaters und wollen jetzt sofort nach Hause. Dann hätte ich zwar noch ein Problem mehr, weil ich den Weihnachtsmann noch nicht los bin, es wäre mir allerdings ein inneres Fest, wenn das Wochenende ein Reinfall gewesen wäre.
Doch schon im nächsten Moment möchte ich Teller schmeißen, als meine Tochter mir überschwänglich mitteilt, dass Kathy – sie nennt sie also schon beim Kosenamen – so cool und hammernett sei. Deshalb wollten sie nur schnell ihre Schulsachen holen, um noch eine Nacht zu bleiben und morgen von dort aus in die Schule zu starten – zudem sei das ja auch viel näher als von uns aus. Das stimmt, selbst zu Fuß wären sie in zwanzig Minuten beim Rupprecht-Gymnasium, eine Zeit, die sie sonst mit der U- Bahn fahren. Angesichts unseres Nachnamens vielleicht nicht die beste Schulwahl, aber die Scherze unter den Mitschülern hatten sich bald gelegt, und nun kommt allein der Vorteil zum Tragen, dass diese Schule einen sprachlichen und einen mathematisch-technischen Flügel anbietet.
»Das kommt gar nicht infrage, Lilly«, erwidere ich harscher als gewollt.
Stille in der Leitung.
Währenddessen beobachte ich, wie eine schwarzhaarige Frau im hautengen Joggingdress vor dem Weihnachtsmann stehen bleibt, und höre von ihm Satzfetzen, die mit »verehrte gnädige Frau«, »holde Maid« und »wunderhübsches Fräulein« beginnen, was sie mit einem Lächeln quittiert. Und als er ihr auf ihre Nachfrage, warum er in meiner Anwesenheit mit ihr flirte, in vollem Ernst erklärt, dass ich ja nur das Christkind sei, lacht sie richtig.
»Ach bitte, Mama. Kathy hat so coole Musik, die wollen wir heute Abend noch hören, und sie hat Netflix.«
Und bestimmt keine Regeln, ergänze ich innerlich. Sie könnte ja fast die Schwester meiner Kinder sein.
»Wie gesagt, Lilly, kommt gar nicht infrage.«
Wieder Stille.
Dafür höre ich, wie die neue Flamme des Weihnachtsmanns ihm tatsächlich ein Treffen vorschlägt und ihm ihre Nummer geben will. Da er jedoch nichts zu schreiben dabeihat und offenkundig auch kein Handy, fragt sie ihn nach seiner Telefonnummer.
Der Weihnachtsmann hebt bedauernd die Schultern. »Dort, wo ich wohne, gibt es leider kein Telefon; und ich weiß nicht, ob ich morgen überhaupt noch da bin, ich bin derzeit sehr in Eile. Aber Sie können mir gern einen Brief schreiben. An den Weihnachtsmann, das kommt auf jeden Fall an. Und ich werde Ihnen ganz bestimmt zurückschreiben, nach Weihnachten habe ich wieder viel Zeit.«
»Du bist so gemein, Mama!«
»Ich bin nicht gemein, ich halte mich an das, was abgemacht war. Und das bedeutet, ihr beide seid heute um 19 Uhr zu Hause. Punkt.«
Aufgelegt.
Das fängt ja gut an. Nicht nur, dass sich meine Kinder mit der Trennung ihrer Eltern so schnell arrangiert haben, sie scheinen sich ja mit der neuen Situation schon sehr wohlzufühlen.
Das tut weh. Aber wahrscheinlich haben sie im Gegensatz zu mir schon länger mit einer Trennung gerechnet, da sie uns nur noch als gut aufeinander eingespielte Einzelkämpfer wahrgenommen hatten, längst nicht mehr als Paar. So gesehen haben sie nichts verloren, ja, sogar noch eine coole Freundin dazugewonnen.
Dafür bin ich jetzt die Böse. Ganz großes Kino. Ich werde allerdings einen Teufel tun und um des lieben Friedens willen noch mal anrufen und klein beigeben.
»Aber was haben Sie denn?«, ruft der Weihnachtsmann in meine Gedanken hinein. Es galt jedoch nicht mir, sondern seiner neuen Eroberung, die in einem Tempo davonjoggt, dass jedes Hinterherlaufen erfolglos wäre.
»Hab ich was Falsches gesagt?«
Angesichts seiner Unschuldsmiene kann ich mir ein Lachen gerade noch verkneifen. »Sie war bestimmt nicht die Richtige. Die werden Sie schon noch finden.«
»Das hoffe ich. Viel wichtiger ist ja auch, dass ich ein Christkind finde. Ich bin gespannt, wer das ist, wo wir jetzt hingehen – wobei keines so perfekt sein wird wie Sie.«
Innerlich mache ich drei Kreuze, als wir nach über einer Stunde endlich die Isar überqueren, in der Klinik ankommen und schließlich vor einem behandelnden Arzt stehen.
Der wiederum schaut mehr in seinen Computer als auf seinen Patienten, der ihm geduldig alle Fragen zur Person beantwortet und vertrauensvoll sein Anliegen vorgetragen hat.
»Jaaaa«, gibt der Arzt gedehnt von sich, während er weitertippt.
»Dann werden wir Sie mal stationär aufnehmen.«
»Was bedeutet das?«, fragt der potenzielle Patient und knetet die Hände im Schoß. »Ist das so eine Art Schwarzes Brett, wo mein Gesuch aufgenommen wird?«
»Das bedeutet, Sie werden ein paar Wochen bei uns bleiben, bis es Ihnen wieder besser geht. Ich werde Ihnen gleich ein Zimmer herrichten lassen, wenn Sie mit der Aufnahme einverstanden sind.«
Der Weihnachtsmann steht so ruckartig auf, dass sein Stuhl umfällt. »Ich bin nicht krank, mir fehlt nur ein Christkind – und in knapp 24 Tagen ist Weihnachten. Ich kann doch nicht über Wochen hierbleiben. Nicht mal einen Tag! Was wird denn sonst aus meinen Rentieren und der Kutsche?« Jetzt funkelt er mich an. Wütend und voller Verzweiflung. »Sie haben mir etwas anderes versprochen. Sie denken, ich hätte nicht alle Plätzchen in der Tüte, aber ich werde Ihnen schon beweisen, dass ich der echte Weihnachtsmann bin – und Sie das Christkind sind, das ich gesucht habe!«
Nach diesen Worten stürmt er aus dem Zimmer und ich ihm nach einem Schulterzucken des Arztes und dem freundlichen Rat, ihn schnellstmöglich wieder in die Klink zu bringen, hinterher.
Das soll er mal meinem Kreislauf sagen, der keine Lust auf diesen Wettlauf hat. Erst im Englischen Garten auf Höhe des Monopteros hole ich den Weihnachtsmann knapp ein.
»Verdammt, was haben Sie vor?«, schreie ich ihm zu. Doch er dreht sich nicht mal um, er scheint seine letzten Kräfte zu mobilisieren und rennt mit erstaunlichem Durchhaltevermögen weiter in die Richtung, aus der wir gekommen sind.
Zu mir nach Hause.
Kapitel 2
Wo ist er denn jetzt? Schon bei der Reitschule im Englischen Garten habe ich ihn aus den Augen verloren, bin jedoch davon überzeugt gewesen, dass der schräge Nordpolbewohner den Weg zu mir zurückfinden wird. Aber auf Münchens Straßen ist doch Verlass. Hurra, er hat sich verlaufen.
Ich drehe mich vor meinem Zuhause einmal um die eigene Achse. Ein paar Fußgänger schlendern sonntagsentspannt entlang der hübschen Jugendstilgebäude rund um die Ursulakirche.
Auf dem Spielplatz sind gerade zwei Mütter dabei, ihre beiden um die Schaukel in Streit geratenen Jungs voneinander zu trennen, was den Lärmpegel nur noch verschlimmert. Nein, nicht die Kinder heulen lauter, die durchaus in einem Alter sind, in dem sie das unter sich klären könnten – vielmehr schreien sich jetzt die Mütter an. Und da sie keine Einigung darüber finden, welcher Sprössling nun das Vorrecht haben soll, rauschen sie am Ende ihres Schimpfwörterrepertoires in unterschiedliche Richtungen davon – ihre Jungs im Schlepptau, die zum Besten geben, was sie gerade an neuen Ausdrücken gelernt haben.
Ich laufe einmal um die Kirche herum. Von den Rentieren und einem Schlitten keine Spur mehr. Wenn nicht die Nachbarn das Gefährt auch gesehen hätten, würde ich jetzt an meiner Zurechnungsfähigkeit zweifeln.
Manche Probleme lösen sich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes in Luft auf, wie schön. Der Weihnachtsmann ist mit seinem Schlitten davongeflogen und ... Moment, habe ich so einen Blödsinn gerade wirklich gedacht? Davongeflogen?
Okay, jedenfalls ist er verschwunden, und das ist, gleich wie, die Hauptsache.
Bevor die Kinder nach Hause kommen, sollte ich dringend noch etwas Schlaf nachholen. Morgen muss ich wieder fit sein, denke ich mit Blick auf das Schild an meiner Haustür, das auf die psychologische Gemeinschaftspraxis im ersten Stock hinweist.
Ich schaue die efeubewachsene Fassade hinauf bis zu den Sprossenfenstern im dritten Stock, wo bis vor vier Wochen die Welt noch in Ordnung gewesen ist – zumindest hat es da noch keine junge Arbeitskollegin mit prallen Brüsten gegeben, der ich am liebsten ein Furzkissen unter ihren festen Hintern schieben würde, sollte ich ihr jemals begegnen.
Das wäre jedenfalls noch eine der Taten, die mich nicht unmittelbar mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt bringen würden, doch wenn ich an diese Frau denke, dann kommt mir unwillkürlich ein mittelalterlicher Pranger in den Sinn, oder besser noch eine Vierteilung? Teeren und Federn?
Das würde ich am liebsten mit Oliver machen. Nie habe ich geglaubt, dass er zu der Sorte Mann gehört, die schwanzgesteuert handelt. Das hat er auch nicht, sagt mir mein Verstand. Er hat sich auf eine andere, sehr attraktive, Frau eingelassen, weil es zwischen uns in vielerlei Hinsicht nicht mehr gestimmt hat. Rechtzeitig miteinander zu reden hätte vielleicht geholfen, aber ich habe ja auch nicht das Gespräch gesucht, weil ich mich vor Problemen gefürchtet habe. Das ist wie mit Ärzten, die genau wissen, dass sie krank sind, sich aber nicht behandeln lassen.
Am Scheitern unserer Beziehung tragen wir beide Schuld. Mein Verstand weiß das, aber meine wunde Seele kommt besser damit klar, wenn die Neue eine böse Hexe, mein Ex schwanzgesteuert ist und ich das Opfer bin. Schwarz-Weiß macht das Leben einfacher, wenn das bunte Chaos herrscht.
Gedankenverloren schließe ich die Haustür auf und gehe die Stufen hinauf. Ziemlich sicher hat die Neue sogar mehr zu bieten als ihren Körper. Wahrscheinlich ist sie humorvoll, unternehmungslustig und liebevoll?
Eigenschaften, die Oliver sehr schätzt, die mir jedoch in den vergangenen Jahren leider verloren gegangen sind. Zumindest Oliver gegenüber. Dafür habe ich viele seiner Macken nur noch mit Galgenhumor ertragen, und das Einzige, was bei ihm abends noch aktiv war, ist sein Daumen auf der Fernbedienung gewesen.
Noch während der Beziehung habe ich mir immer die früheren Zeiten zurückgewünscht, aber mir fehlte zwischen Beruf und Kindern einfach die Kraft – und irgendwann auch die Motivation.
Zu viel hatte ich versucht, um das Familienleben in Gang zu halten, bis ich vor gut einem Jahr – im Angesicht des Weihnachtsstresses – sämtliche Bemühungen eingestellt habe.
Ganz bestimmt ist die Neue nicht so gestresst, sie hat ja auch nicht zwei Pubertiere im Haus. Und ihr gegenüber wissen sich Lilly und Lukas garantiert zu benehmen.
Ungekannte Eifersucht nagt an mir, wenn ich daran denke, wie meine Kinder Spaß bei Unternehmungen mit ihrem Vater und der Neuen haben.
Keuchend erreiche ich den dritten Stock – meine Kondition schafft es nur noch bis in den zweiten – und nehme mir vor, nicht nur mehr Sport zu treiben, sondern mich mehr meinen Kindern zu widmen. Damit werde ich anfangen, sobald sie heute Abend nach Hause kommen. Mit dem Sport kann ich auch morgen noch beginnen.
»Hallo, Christkind. Was sollte das vorhin? Sie wollten mich doch reinlegen.«
Die Stimme kommt von der Treppe hinter mir, die in den nächsten Stock fuhrt. Die Hand auf der Türklinke, bleibe ich erst starr vor Schreck stehen, dann wirble ich herum.
Da sitzt mein Problem, selbstüberzeugt mit verschränkten Armen, und funkelt mich an.
Vielleicht wäre doch jetzt der passende Zeitpunkt, mit meinem Sportprogramm anzufangen. Ich verspüre das dringende Bedürfnis, die Beine in die Hand zu nehmen und meine Sprintfähigkeiten auszutesten.
Doch damit scheint er bereits gerechnet zu haben, denn er stellt sich mir schneller in den Weg, als ich zu Ende denken kann.
Schmunzelnd greift er beidseits ans hölzerne Geländer und schüttelt den Kopf. »Sie haben vergessen, dass ich tagtäglich mit Rentieren zu tun habe. Das sind Fluchttiere, und ich kann auch Ihren Blick lesen.«
»Dann schauen Sie mir jetzt mal ganz tief in die Augen und hören Sie mir gut zu.« Meine Stimme klingt fest, und darüber bin ich froh. »Ich bin zwar Psychotherapeutin, aber da Sie mich stalken, hat meine Hilfsbereitschaft hier und jetzt ein Ende. Wer hat Sie überhaupt reingelassen? Gehen Sie dahin, wo Sie hergekommen sind, und zwar schnell, sonst rufe ich die Polizei. Und wagen Sie sich nicht noch einmal in meine Nähe.«
Bislang habe ich ihn zurück zum Nordpol gewünscht, nun erscheint mir der Arsch der Welt der bessere Ort zu sein.
Das Jeff-Bridges-Double zuckt mit den Schultern, ohne die Hände vom Geländer zu nehmen.
»Es tut mir leid, aber Stalking ist mein Job. Ich muss doch wissen, ob die Kinder brav gewesen sind und wann der günstigste Zeitpunkt ist, um ungesehen ins Haus zu gelangen. Und selbst wenn ich verschwinden wollte, könnte ich nicht. Mein Schütten ist weg. Wo haben Sie ihn denn geparkt?«
»Ich? Bin ich dafür zuständig?«
»Das weiß ich nicht. Normalerweise bin ich ja nur im Schutz der Dunkelheit unterwegs. Aber wenn Sie nicht wissen, wo mein Schlitten ist, dann hat ihn mir jemand gestohlen.«
»Sie haben mir gerade selbst erklärt, dass Rentiere Fluchttiere sind. Sie werden sich erschreckt haben und davongelaufen sein.«
»Das ist unmöglich. Ich habe das Leittier am Baum angebunden und die Handbremse vom Schlitten angezogen. Also ist mir mein Gefährt geklaut worden. Auch das noch! Jetzt habe ich ein Christkind gefunden, aber keinen Lieferschlitten mehr. Helfen Sie mir!«
Mein Geduldsfaden ist so gespannt wie der Bogen einer Zwille, in der aber nicht bloß eine Papierkugel, sondern ein Stein liegt.
»Ich bin nicht das neue Christkind!«, rufe ich. »Sie hören jetzt auf damit! Verschwinden Sie aus dem Haus! Sofort! Und lassen Sie sich behandeln.«
Nebenan geht die Tür auf, und die Nachbarin im Kittelschurz stemmt die Faust in die Hüfte. »Frau Christkind! So a Lärm am heiligen Sonntag! Missans sich mit Ihren Patienten im Treppenhaus unterhalten, haben S’ keine Praxis mehr?«
»Doch, aber die hat sonntags geschlossen«, gifte ich zurück. An den Weihnachtsmann zu glauben ist die eine Sache, mit der ich mir reichlich schwertue. Auferstehung ist das andere Thema, mit dem ich nicht viel am Hut habe. Und doch steht Else Kling scheinbar leibhaftig vor mir. Halb lange weiße Haare, ein Lippenstift, der mit dem roten Mantel meines Problems perfekt harmoniert, und ein Gesichtsausdruck, der an einen Pudel auf Drogen erinnert.
Jetzt erst bemerkt die Nachbarin, wer die Ursache für meine Lautstärke ist.
»Ach, mit dem Weihnachtsmann streiten Sie? Er wollte zu Ihnen, ich hab ihn reingelassen. Warum sind’s denn so grantig zu dem netten Herrn?«
»Das geht Sie ja wohl nichts an.«
»Sie san wohl überfordert seit der Trennung von Ihrem Mann? Die Kinder sind heute bei ihm, gell? Da gefallt’s denen bestimmt. Und ach so, jetzt verstehe ich, das ist Ihr neuer Freund. Das ging aber schnell. Und schon haben S’ Streit mit ihm?«
»Wir haben nur eine kleine Diskussion«, mischt sich jetzt der Weihnachtsmann ein, »weil sie mit ihrer neuen Rolle als Christkind noch Identifikationsprobleme hat, aber das ist ja ganz normal am Anfang. Nur ist jetzt auch noch mein Schlitten weg. Weihnachten ist in Gefahr, und zu Hause kann ich mich auch nicht mehr blicken lassen.«
Ich atme tief durch. Das Leben ist ein Irrenhaus, so viel ist mir längst klar – aber ich bin nicht die Zentrale.
»Also doch ein Patient«, sagt Else Kling und mustert argwöhnisch den rot bemäntelten Herrn, den sie eben noch so sympathisch fand. »Und den lassen Sie im Treppenhaus stehen? Der Mann braucht doch psychologische Hilfe.«
Wenn hier jemand Hilfe braucht, dann bin ich das, denke ich und schließe unter den Argusaugen von Else Kling die Wohnungstür auf.
»Folgen Sie mir«, sage ich mit dem Gefühl, soeben freiwillig in einen Rentierschlitten eingestiegen zu sein – mit verbundenen Augen. Wobei freiwillig der falsche Ausdruck ist.
»Nein, Sie waren nicht gemeint«, wehre ich die Nachbarin ab, die bereits einen Fuß über die Schwelle gesetzt hatte. »So eine Therapiesitzung ist ein vertrauliches Gespräch, das verstehen Sie doch sicher.«
***
»Sie wollen mich also therapieren? Da bin ich ja mal gespannt.« Jeff Bridges im Weihnachtsmantel lehnt sich mit einer Schulter an die Tür, überkreuzt die Beine und hakt seine Daumen in den Ledergürtel ein. So unsicher er gerade noch auf der Straße war, so selbstsicher wirkt er jetzt.
Er mustert mich von oben bis unten. »Sie sehen eher so aus, als bräuchten Sie einen Arzt.«
»Ich bin nicht das Problem!« Energisch schäle ich mich aus meiner dicken Jacke und kämpfe mit meinem blaugrauen Wollschal. Und mit mir selbst, weil ich dem Kerl gegenüber zwischen Angst, Faszination und einem Lachanfall schwanke.
»Aber Sie haben eins«, setzt er nach.
»Allerdings«, seufze ich.
»Na, sehen Sie, da sind wir uns doch einig.«
Noch vor zehn Minuten habe ich geglaubt, mein Problem losgeworden zu sein, und nun kommt es im Flur auf mich zu.
»Schuhe ausziehen!«, rufe ich reflexartig. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen, seit meine Kinder welche tragen. Nein, eigentlich schon, seit ich vor siebzehn Jahren mit Oliver zusammengezogen bin.
»Mantel anlassen!«, rufe ich.
»Wie jetzt? Schuhe aus, Mantel anlassen?« Er schaute an sich hinunter, und da scheint bei ihm der Groschen zu fallen. »Oh, Entschuldigung. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass ich mein sommerliches Reiseoutfit trage.«
»Ihr sommerliches ...« Ich unterbreche mich selbst. Es hat doch keinen Zweck. »Hören Sie, ich möchte nicht, dass Sie länger in meiner Wohnung bleiben. Ich war gerade nur gezwungen, Sie hereinzubitten.«
»Wissen Sie eigentlich, was Sie wollen?«, fragt er mit Blick auf seine bestrumpften Füße.
Ich atme tief durch. »Ich möchte ein Problem weniger haben.«
»Schon gut, schon gut. Ich habe mich zwar schon auf Kaffee und Korvapuusti gefreut, aber ich nehme es Ihnen nicht krumm, wenn wir uns nicht länger hier aufhalten. Wir haben ja auch keine Zeit zu verlieren.«
»Pusti ... was?«
»Kennt man das hier nicht? Das sind Zimtbrötchen mit Hagelzucker, neben Milchreis unsere Leib-und-Magen-Speise am Polarkreis. Wörtlich aus dem Finnischen übersetzt, bedeutet Korvapuusti eigentlich Ohrfeige.«
Kein Wunder, sind die Finnen so ein friedliebendes Volk, denke ich. Wenn das Gegenüber droht, ich verpasse dir gleich eine Korvapuusti, dann bekommt man doch keine Aggressionen, sondern einen Lachkrampf.
»Und warum haben wir keine Zeit zu verlieren?«
»Weil Sie jetzt Ihr Engelskleidchen anziehen, und dann gehen wir meinen Schlitten suchen. Wobei, ziemlichen Durst habe ich schon. Ob Sie wohl ein Glas Preiselbeersaft für mich hätten, bevor wir uns auf den Weg machen?«
»Wir gehen nirgendwohin!«
Betroffen und ratlos bleibt er vor mir stehen. Da ich nicht vollkommen herzlos erscheinen will, gehe ich in die Küche, um ihm ein Wasser zu holen. In der Flasche. To go.
»Aber gerade eben haben Sie doch noch gesagt, dass Sie sich nicht länger mit mir hier aufhalten wollen.« Er folgt mir in die große Küche, wo er vor den roten Holzfronten kaum mehr auffällt. »Wobei, wir sollten doch noch ein wenig an Ihrem Christkindlook arbeiten, bevor wir auf die Straße gehen.« Er legt den Kopf schräg und zupft mit kritischem Rudolph-Mooshammer-Blick ein paar meiner widerspenstigen Locken zurecht.
»Finger weg!«, rufe ich, und er zuckt erschrocken zurück. Wahrscheinlich ist er es gewohnt, dass andere Frauen sich ihm an den Hals werfen. Ich bin eher geneigt, ihm selbigen umzudrehen.
»Ich besitze nicht mal ein weißes Kleidchen, aber Sie brauchen dringend ein weißes Jäckchen!«
Erstaunt schaut er an sich runter. »Weiß? Nein, das steht mir nicht. Das lässt mich doch viel zu blass wirken. Aber für Sie werden wir dann eben jetzt ein Kleidchen besorgen.«
Das Einzige, was ich jetzt brauche, ist ein Stuhl – und zwar dringend. Erschöpft lasse ich mich am Küchentisch nieder und schirme die Augen mit der Hand ab.
Seit zehn Jahren behandle ich Patienten, die sich mit Sofakissen unterhalten, sich von Sonnenstrahlen verfolgt fühlen oder ihre Klamotten nicht mehr wechseln, weil ein Liliputaner in ihrem Kleiderschrank sitzt. Aber dieser Typ schafft es innerhalb weniger Stunden, mich in den Wahnsinn zu treiben.
»Nun verlieren Sie nicht gleich den Mut. Ein hübsches Kleid für Sie zu finden ist doch nun wirklich das kleinste Problem, das wir im Moment haben. Mehr Sorgen macht mir, dass Sie so blass um die Nase aussehen. Aber kein Wunder, Sie haben heute ja auch noch kaum was gegessen, oder?«