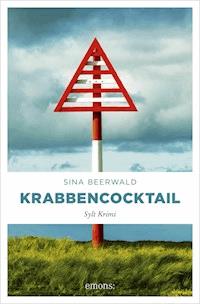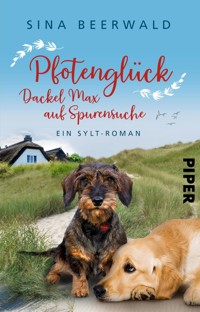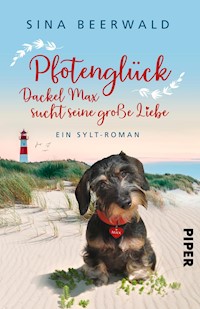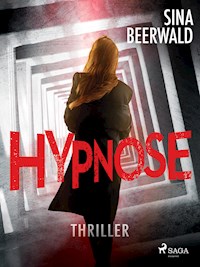8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sylt Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Leben auf Sylt? Ein Traum! Jedenfalls für das Rentnerpaar Frieda und Ernst Schmälzle. Da das Ersparte für ein Reetdachhäuschen jedoch nicht reicht, lassen sie sich mitsamt Spätzlespresse und Dackel Gustav auf dem Kampener Campingplatz nieder. Doch zwischen Gemeinschaftsdusche und Chemietoilette schwelen die Konflikte, und in der Ehe der Schmälzles beginnt es heftig zu kriseln - bis ein Platznachbar ermordet aufgefunden wird und Frieda die Unschuld ihres Mannes beweisen muss . . . Ein urkomisches Ermittlerduo zwischen Wattvilla, Wohnwagen und Whiskymeile.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Sina Beerwald, 1977 in Stuttgart geboren, hat sich bislang mit sieben erfolgreichen Romanen und dem Erlebnis-Reiseführer »111Orte auf Sylt, die man gesehen haben muss« einen Namen gemacht. 2011 wurde sie Preisträgerin des NordMordAward, 2014 erhielt sie für ihren Sylt Krimi »Mordsmöwen« den Samiel Award. Vor acht Jahren wanderte sie mit zwei Koffern und vielen kriminellen Ideen im Gepäck auf die Insel Sylt aus und lebt dort seither als freie Autorin.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Ein Projekt der AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur.
©2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Ralf Meyer, Sylt, http://flyfishing-sylt.de Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-959-2 Sylt Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Lauris
EINS
Heute ist der 6.Juli, der große Tag. Die Rollläden an unserem Reihenendhäusle in Bopfingen sind runtergelassen, und mein Mann packt das Ersparte in den Strumpf und unseren Dackel Gustav samt Spätzlespresse in das Heiligsblechle. Einen VolkswagenT1, den wir uns vor vierundvierzig Jahren zur Hochzeit geschenkt haben und der von meinem Ernst definitiv mehr gehegt und gepflegt wird als unser Eheleben. Zu meinem Leidwesen hat er, also mein Mann, im Alter definitiv mehr Macken ausgebildet als das rote Autoblech.
Eigentlich kann jetzt nix mehr schiefgehen. Eigentlich, denke ich.
Ein eigenes Reetdachhäusle in Kampen– das wäre für uns, Frieda und Ernst Schmälzle aus dem Schwabenland, ein Traum.
Gewesen.
Denn trotz Bausparvertrag hat es leider nur zum Reihenendhäusle in Bopfingen gereicht, in das nun unsere jüngste Tochter zu Weihnachten einziehen wird. Wir wollten zur Rente so gern auf Sylt leben, richtig inmitten der Schönen und Reichen. Aber was soll’s, der Schwabe an sich ist ja genügsam, und ein Hauch von Luxus weht überall auf der Insel, also: Los geht’s zum Kampener Campingplatz! Dort hat mein Ernst bis zum Herbst einen Dauerstellplatz ergattert. Vor Ort müssen wir uns dann noch um eine Überwinterungsmöglichkeit kümmern. Aber kommt Zeit, kommt Rat, es ist ja erst Anfang Juli.
»Hast du die Bibel dabei?«, fragt mich mein Mann, als wir unser Dörfle am östlichsten Zipfel von Baden-Württemberg hinter uns lassen und bei Aalen-Westhausen auf die Autobahn fahren.
Mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Ich habe an alles gedacht, wirklich an alles. Aber wie hätte ich ahnen sollen, dass mein Ernst auf seine alten Tage noch zum Kirchgänger wird? Mit dem Thema war er schon als Sechsjähriger durch, nachdem seine Eltern an einem Sonntag bei einem Autounfall ziemlich unbarmherzig ums Leben gekommen waren.
Seine Großmutter, bei der er fortan aufwuchs und die ich, Gott sei’s gedankt, nicht lange als Großschwiegermutter habe ertragen müssen, kommentierte damals dieses für meinen Mann epochale Ereignis, mit dem seine Kindheit ein abruptes Ende nahm, mit den Worten: »Wären deine Eltern am Vormittag in die Kirche gegangen, wie sich das für anständige Leute gehört, wäre der Unfall nicht passiert und sie würden noch leben.«
Von diesem Tag an wollte mein Ernst alles, nur nicht anständig sein und in die Kirche gehen.
So, und wie soll ich meinem Mann nun beibringen, dass ich, ausgerechnet ich, die immer an alles denkt, eben doch nicht an alles gedacht habe?
»Ernst, wie kommst du, um Himmels willen, auf so eine Idee? Ich weiß nicht mal, ob wir eine Bibel besitzen. Höchstens meine Konfirmandenbibel, die muss ich noch irgendwo haben. Wir könnten umdrehen und…«
»Frieda! Ich meine den Berger-Katalog. Die Bibel eines jeden Campers.«
Ich atme erleichtert auf, weil ich das fünfhundertvierzigseitige Einkaufsparadies meines Mannes natürlich nicht vergessen habe. Allerdings bin ich beunruhigt, wenn ich an unseren Sparstrumpf denke. Da wird nämlich bald nichts mehr drin sein, weil mein Ernst garantiert alle zwölftausend Artikel dieses Händlers zum Campen benötigt. Denn wo die Begeisterung für die unnützen, aber doch so praktischen Dinge des Lebens bei meinem Mann anfängt, hört seine schwäbische Tugend auf.
Genau achthundertvierundsiebzig Kilometer auf der A7 nach Norden liegen durch die geteilte Frontscheibe vor uns– und die Straßenkarte liegt aufgeschlagen auf meinem Schoß. Zur Sicherheit. Denn mein Ernst bringt es noch fertig, sich auf dieser schnurgeraden Strecke zu verfahren. Er ist wie dieser gute Moses, der vierzig Jahre lang durch die Wüste irrte, weil er auch nicht nach dem Weg fragen wollte.
Ich allein darf meinem Mann von der Beifahrerseite aus dezente Richtungshinweise geben– nur ja nicht zu laut oder zu aufgeregt vorgetragen–, und so fungiere ich als sein lebendiges Navi.
Und wenn mein Ernst sich trotzdem mal verfährt, ist das Auto schuld. Ja, richtig, unser T1 ist schuld. Denn nach unserer letzten Fahrt nach Frankreich– genauer: durch Paris– habe ich meinen Mann vor die Wahl gestellt: Entweder er besorgt ein Navigationsgerät oder ich die Scheidungspapiere.
Er zog tatsächlich los und kam nach vier Stunden wieder, allerdings ohne Navi. Dafür mit einem Blumenstrauß. Ich habe ihn vor lauter Schreck gefragt, ob ich zum ersten Mal den Hochzeitstag vergessen hätte. Tatsache war aber, dass mein Ernst es nicht übers Herz gebracht hatte, seinen Bulli mit so einem zwar wirklich nützlichen, aber eben neumodischen Frevel zu verschandeln.
Mein Verständnis siegte über meinen Groll, und so haben wir uns wieder versöhnt. Daher kommt es, dass unser Bulli seither der Sündenbock ist, wenn Ernst sich mal verfährt.
Glückselig lächelnd hält mein Mann das vibrierende Lenkrad umfasst und schaut auf das spartanische Armaturenbrett, das einzig die Geschwindigkeit anzeigt. Selbst das ist eigentlich überflüssig, da es unser Heiligsblechle gerade mal auf achtzig Kilometer pro Stunde bringt und wir kaum Gefahr laufen, eines dieser sündhaft teuren Fotos von einem modernen Wegelagerer zu erhalten.
Die musikalische Untermalung während der nächsten zehn, elf Stunden wird aus dem Heulen des Lüfterrads und dem tiefen Röcheln des Vergasers bestehen– ein Sound, bei dem mein Mann alle Beatles und Rolling Stones dieser Welt vergisst. Ich hätte ja lieber Radio gehört. Dann hätten wir nämlich auch die Verkehrsnachrichten mitbekommen.
Erstaunlicherweise zuckeln wir staufrei an Dinkelsbühl-Fichtenau und Feuchtwangen-West vorbei– Orte, die ich nur aus ebendiesen Meldungen kenne– und hoppeln im Rhythmus der Bodenwellen auf unserem orange-weiß bezogenen Doppelsitz weiter, bis mir zwischen Würzburg und Fulda beim Anblick unseres Dackels Gustav auf der Rückbank klar wird, dass der Erfinder des Wackeldackels wohl auch einenT1 gefahren haben muss.
Noch während ich voller Mitleid für unseren Hund überlege, wie ich meinen Mann zu einer Pause überreden könnte, heißt es vor Kassel: Stopp.
Nein, keine Rast. Stau. Und zwar von einem solchen Ausmaß, dass die Leute weiter vorn bereits ausgestiegen sind.
Hätte uns mal früher jemand sagen können, dass in NRW bereits die Sommerferien angefangen haben? Jetzt wissen wir es.
Während meinem Mann der kalte Schweiß ausbricht, besinne ich mich auf meine hausfraulichen Pflichten, denn es ist ohnehin Zeit fürs Mittagessen. Ich stelle einen großen Topf mit selbst gemachten Maultaschen auf den Gaskocher und den Klapptisch samt Stühlen auf den Grünstreifen neben den Fahrbahnrand. Es dauert nicht lange, bis sich, vom leckeren Duft angelockt, sämtliche Stau-Nachbarn zu uns gesellen und wir eine verschworene Schicksalsgemeinschaft bilden.
Auch Gustav findet dieses Picknick famos, denn für ihn fällt die eine oder andere Maultasche unter den Tisch, die er gierig verschlingt.
Als einer der Männer auf die Idee kommt, nach dem Essen noch ein leckeres Bierchen zu trinken, löst sich glücklicherweise der Stau und damit auch unsere Tischgemeinschaft auf.
* * *
Nach zwölf Stunden kommen wir schließlich in Niebüll an. Noch sind wir auf dem Festland, und der Ortsname klingt nicht gerade vertrauenerweckend, aber für Sylt-Liebhaber ist er ein Zauberwort, um dunkle Wolken aus staugeplagten Gemütern zu vertreiben.
Mir tut jeder Knochen einzeln weh. Obwohl, das stimmt nicht, meinen Hintern spüre ich gar nicht mehr. An der Auto-Verladestation des Sylt-Shuttles weiß ich dann jedoch wieder, warum ich die ganzen Strapazen auf mich genommen habe, auch wenn wir uns jetzt wieder in eine Schlange einreihen müssen. Von Kindesbeinen an und später zusammen mit meinem Mann habe ich mindestens einmal jährlich meinen Urlaub auf diesem wunderschönen Eiland verbracht. Es stimmt schon, was man über die Insel der Kontraste sagt: Entweder man liebt sie, oder man hasst sie.
Dieser herrliche, vom rauen Meer umspülte Sandknust, wo sich Sonne und dunkle Wolken im Minutentakt abwechseln können, hat einen spröden Charme. Er erschließt sich einem nicht auf den ersten Blick– allerdings habe ich mich in meinen Mann damals auch auf den ersten Blick verliebt. Vielleicht hätte ich besser hinschauen sollen. Aber ich war schon immer zu eitel, eine Brille zu tragen.
Dennoch, die Zeit hat uns zusammengeschweißt. Ihn mit seinem Bulli während Tausender Restaurierungsstunden und mich mit dem Putzlappen und den drei Kindern. Zeitweilig habe ich wirklich darüber nachgedacht, an der Garage eine Klingel samt seinem Namen anbringen zu lassen.
Trösten durfte ich mich immer mit einem Blick zum Nachbarn, der mit seinem Motorrad einen noch schlimmeren Fetisch pflegt. Heute Morgen etwa, als mein Mann sich vor unserer Abreise von ihm verabschieden wollte, hat der Herr Nachbar schon in aller Herrgottsfrüh in der Auffahrt mit Zahnseide die Chromteile seiner Harley poliert, wie Ernst mir brühwarm erzählte.
Das hatte ich gar nicht mitbekommen, obwohl mir doch sonst nichts entgeht. Muss wohl gewesen sein, als ich den Gehweg gesaugt habe. Ein gründlicher Abschied von der Kehrwoche musste sein, schließlich hat mich dieses Ritual beinahe ein halbes Jahrhundert lang begleitet. Ebenso wie der Traum, den mein Mann und ich immer gehabt haben: ein Leben auf Sylt. Und nun wird dieser Traum wahr.
»Heiligsblechle aber au, di send jo nemme ganz gscheid. Scho widder a Preiserhöhung. Des mach i ned mit!«, poltert mein Mann im schönsten Schwäbisch los, als er am Fahrkartenautomaten das Ticket lösen will. »Wird der Autozug jetzetle von Schdraßenäubern betrieben, oder wie isch des? Ich soll für fempfavierzig Minuten neunzig Euro zahlen und dazu noch zum Herrgott beten, dass das ruckelige Ding nicht ausm Gleisbett fliegt? Die haben den Shuttle doch bloß rot geschdrichen, damit man den Roschd ned sieht!«
»Beruhige dich«, sage ich und meine damit sowohl meinen Mann als auch Dackel Gustav, der das Geschimpfe seines Rudelführers mit heiser klingendem Gebell bekräftigt. »Sylt kann sich eben nicht jeder leisten, aber wir haben lange genug gespart, und außerdem müssen wir ja nur die Hälfte bezahlen, so bald wollen wir schließlich nicht zurück. Wenn überhaupt.«
»Nix da«, sagt mein Mann und fährt entgegen der Einbahnstraße durch ein hupendes Spalier wartender Autos und Campingmobile runter vom Shuttle-Gelände.
Sind ja auch bloß rund sechzig Kilometer und eine Stunde Fahrtzeit mehr bis zur dänischen Halbinsel Rømø. Von dort geht’s flott mit der deutlich günstigeren Autofähre nach List auf Sylt. Ganz schön clever, mein Ernst. Und scho wieder ebbes gschpart.
* * *
Unser Bulli wartet im Schiffsbauch auf uns, während wir an der Reling stehen und beobachten, wie die Insel näher kommt.
Unsere Insel.
Als Erstes erkennen wir die beiden rot-weißen Leuchttürme am Ellenbogen. Tiefblaues Wasser umspült die eigenwillige Form dieses nördlichen Inselzipfels. Der goldgelbe Sand der Dünenkette leuchtet in der Sonne, die Strände sind beinahe menschenleer, nur am nördlichsten Punkt stehen ein paar Spaziergänger.
Die Fähre steuert so langsam durch das Lister Tief an ihnen vorbei, dass wir den winkenden Leuten fast die Hand reichen können.
Im Königshafen sind heute wieder unzählige Kitesurfer unterwegs, und ich mache mit dem Handy ein Foto von den bunten Gleitschirmen vor blauem Himmel, um es unseren drei Töchtern zu schicken. Nur noch wenige Minuten, dann werden wir anlegen und bis zu unserem Lebensende auf Sylt ankern.
Hoffentlich. Jetzt, wo der Traum Realität wird, bekomme ich doch noch Angst vor der eigenen Courage. Ich meine, ich habe mir immer gewünscht, mehr Zeit mit meinem Mann zu verbringen, wenn die Kinder erst aus dem Haus und wir beide in Rente sind. Endlich konnte ich meinen Nebenjob als Putzfrau auf dem Polizeiposten in Bopfingen an den Nagel hängen, und mein Mann muss nicht mehr die gut hundert Kilometer zum Daimler-Werk nach Sindelfingen pendeln, wo er die vergangenen drei Jahrzehnte als Scheibenwischer-Konstrukteur gearbeitet hat. Ich dachte ja, Letzteres würde ihm irgendwann langweilig werden, aber man glaubt gar nicht, was man da für eine Wissenschaft draus machen kann. Jedenfalls bekommt mein Ernst nun eine ansehnliche Rente, die uns ein gutes Leben auf Sylt ermöglichen wird, auch wenn die Ersparnisse nicht für ein Reetdachhäusle gereicht haben– allein für eine Zwei-Zimmer-Wohnung hätten wir auf Sylt fünfhunderttausend Euro hinblättern müssen. Der Verkauf unseres Häusles in Bopfingen hätte aber gerade mal für eine Anzahlung gereicht, also wird unsere jüngste Tochter dort stattdessen mit Mann und Kindern einziehen. Und wir tauschen hundertzwanzig Quadratmeter Wohnfläche gegen zwanzig Quadratmeter Wohnwagen– immerhin plus Vorzelt.
Bei dem Gedanken daran bekomme ich leichte Beklemmungen und schaue meinen Ernst an, der seine Augen mit einer Hand gegen die Sonne abschirmt, um die Einfahrt in den Hafen zu beobachten. Seine ehemals dunklen Haare sind schütter und grau geworden, seine Brille ein Modell Stubenfliege aus den achtziger Jahren, und auch seine Kleidung stammt aus dieser Zeit. Immerhin ist das heute wieder modern und gibt ihm in seiner Sparsamkeit recht. Nur sein etwas dicker Bauch ist neueren Datums, doch wenn ich mal über seine Figur meckere, hält er mir vor, dass dieses Feinkostgewölbe mühsam erworben und bei meiner guten Küche schließlich kein Wunder sei. Seine Terence-Hill-Augen leuchten allerdings noch so unverschämt blau wie früher, und ich sehe darin manchmal wieder den Mann, in den ich mich vor einem halben Jahrhundert beim Tanztee Hals über Kopf verliebt habe, obwohl unser erster näherer Kontakt sein Fuß auf meinem war.
Mein Handy piepst. Tochter Nummer zwei wünscht uns von ihrem Arbeitsplatz in Birmingham aus eine gute Ankunft und schickt ein Foto von unserer süßen sechsjährigen Enkeltochter mit. Ich zeige es meinem Mann, der ein Handy besitzt, mit dem man tatsächlich nur telefonieren kann– was er jedoch höchst selten macht.
Nun könnte man meinen, mein Mann sei nicht sonderlich gesprächig, was so allerdings nicht stimmt. Man kann sich stundenlang mit ihm unterhalten, wenn man sich nicht daran stört, dass seine Antwort auf eine Frage erst nach ebendieser langen Zeit kommt und sein Wortschatz nur sechs Silben zu umfassen scheint: »Ha no«, »Ha gell« und »Ah wa«.
Aber so sind die schwäbischen Mannsbilder eben. Und nicht nur die. Eine Unterhaltung mit einem waschechten Nordfriesen läuft ähnlich ab. Darum versteht sich mein Mann mit den Syltern auch so gut, beide brauchen nicht viele Worte. Ein zackiges »Moin«, bei dem man die Hacken zusammenschlagen möchte, ist oft schon der Höhepunkt des Gesprächs, und wer mit einem ausschweifenden »Moin, Moin« grüßt, gilt als geschwätzig.
»Ach, wie wunderschön.« Ich seufze, während wir das Anlegemanöver beobachten. Im Lister Hafen herrscht um die bunten Holzhäuser herum wie immer reger Trubel, und ich kann unsere Insel schon riechen.
Gut, in erster Linie rieche ich natürlich den Duft von gebratenem Fisch von Jürgen Gosch, kurz Jünne, den wir schon seit 1972 kennen, als er in einem Anhängerwagen die nördlichste Fischbude Deutschlands eröffnete, aus der mittlerweile an gleicher Stelle ein wahrer Fischtempel und ein deutschlandweites Imperium geworden ist. An das Jahr erinnere ich mich deshalb noch so genau, weil es nicht nur unsere Hochzeitsreise und die erste Fahrt mit unserem Bulli war, sondern weil er, also mein Mann, sich bei Gosch auch jede Menge von der »einzig wahren Fischsuppe« schmecken ließ.
Was daran erinnernswert sein soll? Nun, da Jünne zu diesem Zeitpunkt noch keine Ausschankgenehmigung für Alkohol besaß, verbarg sich hinter dieser Position auf der Speisekarte ein Getränk für Eingeweihte, das Kultstatus erlangte: Brause mit Korn– im bunten Plastikschälchen serviert.
Mein Mann erreichte an jenem Tag einen Alkoholpegelstand, der legendär genannt werden muss.
»Ha gell«, stimmt mein Ernst zu und atmet genießerisch ein.
Die Fähre hat wie ein Haifischmaul ihren Bug geöffnet, und es wird Zeit, zum Auto zu gehen.
»Sollen wir uns nach diesen Strapazen zum Einstand erst mal ein richtig gutes Fischessen gönnen?«, frage ich meinen Mann, und Gustav bellt, als hätte er mich verstanden. Das Wort »Essen« kennt er mit Sicherheit.
Einen Versuch ist die Frage wert, obwohl mein Mann sonst nur zu unserem Hochzeitstag ein Restaurant betritt. Zu Hause schmeckt es nämlich mindestens genauso gut, kostet aber deutlich weniger, so seine Meinung.
Zu meiner Überraschung nickt mein Mann, und ich bin ihm dankbar, dass ich heute Abend nicht gleich wieder am Gaskocher stehen muss, schließlich haben wir nach der Ankunft noch genug andere Sachen zu tun. Manchmal kann mein dickfelliger Brummbär doch überraschend feinfühlig sein.
Wo fährt mein Ernst denn jetzt hin? Zum großen Hafenparkplatz direkt neben Fisch-Gosch muss man im Kreisverkehr doch die erste Ausfahrt nehmen, er jedoch fährt die zweite raus. Das fängt ja gut an. Einer von drei Kreisverkehren auf der gesamten Insel, und er schafft es, sich zu verfahren.
»Ernst, du hättest schon da hinten abbiegen müssen.«
Mein Mann schüttelt den Kopf, biegt bei nächster Gelegenheit links ab und hält auf einem Parkplatz an.
Ich runzele die Stirn. »Warum parkst du nicht am Hafen? Das wäre doch wesentlich näher gewesen.«
»Wohl kaum«, sagt mein Ernst und deutet auf den Eingang des örtlichen Supermarktes. »Auf sauer eingelegte Heringe mit Bratkartoffeln hätte ich heute Abend Lust, aber wenn es die nicht gibt, kannst du natürlich auch Lachssteaks kaufen, die sind in der Haushaltskasse zur Feier des Tages mit drin.«
Und scho wieder ebbes gschpart.
* * *
Gut, wenn mein Ernst das so will, dann werde ich heute Abend kochen– vor Wut. Als ich mit den beiden Einkaufstaschen zum Bulli zurückkomme, lasse ich mir davon aber noch nichts anmerken. Er wird seine Überraschung erleben, und nun muss ich doch grinsen, was er natürlich falsch interpretiert.
»Gibt es heute mein Lieblingsessen?«
»Ja, ich habe saure Heringe bekommen.« Den Rest der Wahrheit verschweige ich, die wird er noch früh genug serviert bekommen– im wörtlichen Sinn.
Die breit angelegte Hauptstraße schlängelt sich an verschiedenen Geschäften vorbei aus dem Ort hinaus, und da haben wir auch schon das nächste Highlight: einen wunderbaren Ausblick auf die Lister Wanderdünen und eine Vollbremsung mit unserem überladenenT1. Der vor uns fahrende Audi wollte sich spontan in die kleine, aber leider bereits überfüllte Parkbucht zwängen, um ein Foto zu schießen.
»Ja, Himmelherrgoddsakrament, kannsch du den Hendra von deim bleeda Scheisskarra ned schneller vo dr Schdroaß lupfa?«
Wenn ich vorhin erwähnte, dass der Wortschatz meines Mannes nur wenige Silben umfasst, so sind seine Flüche davon natürlich ausgenommen. Dabei hat er für schwäbische Verhältnisse sogar noch recht nett reagiert, so knapp, wie das war. Zum Glück ist nichts passiert.
Die Heidelandschaft muss just in diesen Tagen zu blühen begonnen haben, der Duft, der zu den Seitenfenstern hereinströmt, ist betörend. Das satte Lila wirkt prächtig vor der goldgelben Wanderdüne, und ich kann schon verstehen, dass an dieser Stelle so viele anhalten.
Ich nehme mir vor, bald auch mit dem Fotoapparat zurückzukommen, das Rad zu nehmen oder die zehn Kilometer sogar zu spazieren. Vorbei an der Vogelkoje und an den idyllischen und einsamen Buchten am Wattenmeer entlang. Die Strecke ist so wunderschön, die merkt man gar nicht in den Füßen, und zurück kann ich immer noch mit dem Bus fahren.
Der nächste Ort ist bereits Kampen. Erstes Erkennungszeichen aus dieser Richtung ist der Klenderhof, ein großes weiß getünchtes Anwesen mit dem charakteristischen Zipfelturm, im Volksmund auch Axel-Springer-Burg genannt, über dem mittlerweile eine Schweizer Flagge weht.
Gleich nebenan beginnt der Hobokenweg, Deutschlands teuerste Wohngegend, wo zehn Millionen für ein Haus ein echter Schnäppchenpreis sind. Tja, nichts für Normalsterbliche wie uns, ein Reetdachhaus schöner als das andere. An den Türen findet man nur selten ein Klingelschild– auf der berühmten Whiskymeile dafür jede Menge Prominenz und Dekadenz. Und es gibt, hinter knorrigen Bäumen versteckt gelegen, den Kampener Campingplatz.
Man mag es kaum glauben, doch keine hundert Meter vom Strönwai entfernt, wo Schönheit und Reichtum zur Schau gestellt werden– der Oldtimer frisch poliert, die Gattin beim Schönheitschirurgen restauriert–, existiert zwischen Gemeinschaftsdusche und Chemietoilettenentsorgungsstation ein Paradies für Sylt-Camper. Und genau dort wollen wir jetzt hin.
Ich kann es kaum erwarten, auf dem Campingplatz anzukommen. Mein Ernst hat nämlich eine Überraschung für mich. Vor zwei Wochen ist er allein mit dem Zug nach Sylt gefahren, um ein paar Formalitäten zu erledigen. Außerdem hat er sich vom ordnungsgemäßen Zustand und der wunderbaren Lage unseres Dauerstellplatzes überzeugen wollen, den wir nach Zuteilung bislang nur als Nummer auf einem Plan im Internet kannten.
Bei dieser Inspizierung kam mein Mann mit der Platzwartin ins Gespräch, die ihm ihren Wohnwagen mit Vorzelt zum Kauf anbot, zu einem Preis, den selbst mein Ernst als Schnäppchen einstufte– und das will was heißen.
Also rückte er von unserem ursprünglichen Plan ab, zunächst das Lager in unseremT1 aufzuschlagen, um vor Ort in Ruhe nach einem großen und top ausgestatteten Wohnwagen zu suchen, in dem man eben nicht nur den Urlaub, sondern auf Dauer einen möglichst komfortablen Alltag leben kann.
Mein Ernst platzte bei seiner Rückkehr fast vor Stolz über seinen Kauf, machte mir gegenüber jedoch ein großes Geheimnis daraus. Ich durfte nicht einmal Bilder sehen. Er sagte nicht mehr, als dass der Wohnwagen eine Aufbaulänge von zehn Metern habe, was in Campingdimensionen gesprochen ein Leben im Palast bedeutet, und das Vorzelt mit einem traumhaft hohen Umlaufmaß von fünfzehn Metern nur eine Saison lang aufgebaut gewesen sei, also praktisch wie neu. Für so ein Kunststoffdach– noch dazu von einer Markenfirma von bestem Ruf– zahlt man im Katalog rund viertausend Euro samt Gestänge, und kurzzeitig wurde mir angst und bange.
Erst als mir mein Mann hoch und heilig versprach, unser Budget nicht überschritten und insgesamt nicht mehr als zwanzigtausend Euro für diesen Wohnwagen ausgegeben zu haben, konnte ich wieder beruhigt schlafen und mich auf den großen Tag der Enthüllung freuen. Ein Moment, der nun gekommen ist.
ZWEI
»Ach, der Herr Schmälzle aus dem Schwabenland, da sind Sie ja!«, begrüßt die Platzwartin genau genommen nur mich und nicht meine Frau. Sie lacht dabei aus voller Kehle, dass das Namensschild über ihren üppigen Brüsten erzittert. Obwohl es erst zwei Wochen her ist, dass ich ohne meine Frieda hier war und dieser Dame um die fünfzig ebenso wie jetzt an der Rezeption gegenüberstand, kann ich mich partout nicht mehr an ihren Namen erinnern und diesen leider auch nicht ablesen, solange sie so lacht. Barbara… Beatrix… vergeblich. Ihr Dekolleté jedoch ist mir in guter Erinnerung geblieben– schließlich bin auch ich nur ein Mann.
»Ich habe extra auf Sie gewartet, Herr Schmälzle, obwohl ich schon Feierabend habe, es ist ja bereits nach achtzehn Uhr.«
Jetzt kann ich ihren Namen ablesen: Beate Schacht. Richtig, so hieß sie.
»Ha no«, sage ich. Was soll ich auch mehr dazu sagen? Wäre schließlich nicht notwendig gewesen, denn unsere Platznummer kennen wir, und eine Kurkarte brauchen wir heute Abend auch nicht mehr, ebenso wenig wie Hilfe beim Auffinden unseres Stellplatzes, da es auf diesem netten kleinen Campingplatz in den Dünen nur einen Hauptweg gibt, der im Halbrund wieder zur Rezeption zurückführt, sodass wir zwangsläufig an unserer Parzelle vorbeikommen müssen.
Meine Frau, die sich bislang etwas im Hintergrund gehalten hat, stellt sich neben mich, doch die blonde Dame hinter dem Tresen nimmt trotz Brille keine Notiz von ihr. Mit ihren wasserblauen Augen strahlt sie nur mich an.
»Herr Schmälzle, ich bin so froh, dass Sie den Wohnwagen gekauft haben. Das Schätzchen wird bei Ihnen sicher in den besten Händen sein. Er steht schon auf Ihrem Platz113. Kommen Sie, ich begleite Sie hin.« Noch immer sieht sie allein mich an.
Ich werfe einen Seitenblick auf meine Frau. Ihre Miene wirkt verschlossen. Hoffentlich denkt sie jetzt nichts Falsches. Ich kann schließlich nichts dafür, dass diese Beate Schacht mich so offenkundig nett findet. Zugegeben, ich finde ihre Oberweite ganz beeindruckend, und ja, wir haben auch einen Kaffee zusammen getrunken, nachdem ich den Tabbert gekauft hatte– weil sie die Verkäuferin war.
Ihr Herz hängt noch sehr an diesem Wohnwagen, das hat sie mir bei der Gelegenheit anvertraut, doch seit ihr Mann vor einem Jahr verstarb, bringt sie es nicht mehr fertig, den Wagen selbst zu nutzen, weil zu viele Erinnerungen dranhängen.
»Wir finden den Weg schon selbst, vielen Dank«, sagt meine Frau, freundlich wie immer, aber in einer Tonlage, bei der ich unwillkürlich in Deckung gehe.
»Machen Sie sich bitte keine Umschtände«, sage ich mit einem verbindlichen Lächeln und fühle mich ein wenig zwischen den Stühlen, als ich meiner Frieda hinausfolge.
Dieser Start war etwas unglücklich, vor allem, weil ich auf die gute Laune meiner Frau angewiesen bin. Schließlich hat sie den Wohnwagen noch nicht gesehen.
Wir holen Gustav aus dem Bulli, und mit jedem Meter, den wir über den Platz gehen, nimmt mein Unwohlsein zu. Ob sie meine Begeisterung für unser neues Zuhause teilen wird? Meine Frau sieht nachdenklich aus, und ich kenne sie gut genug, um zu wissen, dass ihr die Begegnung mit dieser Beate an der Rezeption nachgeht.
Ob sie ein wenig eifersüchtig ist? Dazu hätte ich ihr in all den Ehejahren keinen triftigen Grund gegeben, auch wenn es natürlich gelogen wäre, würde ich behaupten, wir hätten, gerade in jungen Jahren, wie ein Schwanenpärchen miteinander gelebt. Da gab es schon mal den einen oder anderen Flirt, aber nichts, was unsere Ehe ernsthaft gefährdet hätte. Und jetzt, in unserem Alter, besteht doch keine große Gefahr mehr, dazu ist man viel zu sehr aneinander gewöhnt.
Sicher, diese Beate Schacht ist ziemlich attraktiv, das kann ich als Mann wohl kaum bestreiten, und natürlich ist nicht zu übersehen, dass neben den Jahren auch unsere drei Kinder ihre Spuren am Körper meiner Frau hinterlassen haben, doch ich würde meine Frieda gegen keine andere Frau auf der Welt eintauschen wollen.
Appetit darf man sich holen, aber gegessen wird zu Hause, das ist mein Motto, auch wenn es in unserem Ehebett für mich seit Jahren nichts anderes mehr zu naschen gibt als Schokolade. Dabei besitzt meine Frau immer noch ihre Reize, lässt man mal außer Acht, dass sie ihre Dessous gegen Miederware getauscht hat.
Regelmäßig lässt sie sich ihre kurzen Haare rotbraun nachfärben, und der pfiffige Schnitt mit dem etwas längeren Deckhaar macht sie deutlich jünger, als die Fältchen in ihrem Gesicht verraten.
Dagegen bin ich mit dem Alter zugegebenermaßen etwas aus der Form geraten, aber so schlimm, dass wir wie Brüderchen und Schwesterchen miteinander leben müssten, ist das nun auch wieder nicht, finde ich.
Vielleicht muss ich mich einfach damit abfinden, dass nach drei Kindern und noch mehr Ehejahrzehnten die schönste Nebensache der Welt tatsächlich zur Nebensache wird.
Der Wind hat etwas zugenommen, über den Platz weht der allabendliche Grillduft, und die Camper rechts und links des Weges sitzen hinter ihren Windschutzen an den Tischen und lassen sich von der Sonne bescheinen, die jetzt, Anfang Juli, noch hoch über der Westdüne steht.
Am liebsten würde ich etwas Zeit schinden und mit meiner Frau zuerst zum Meer gehen, das man nach einem zehnminütigen Spaziergang über einen befestigten Weg durch die Dünenlandschaft erreicht.
Uns kommt ein Pärchen im Bademantel entgegen, die Kulturtaschen unter dem Arm, auf dem Weg zur Dusche. Wir grüßen freundlich und werden im Gegenzug neugierig beäugt.
Camper sind ja an sich meist nette und gesellige Zeitgenossen, doch so eine Platzgemeinschaft ist wie eine geschlossene Gesellschaft, zu der man erst einmal Zugang finden muss.
Jeder hat sich hier seine eigene kleine Welt eingerichtet, in einem Dorf, das zu Saisonbeginn wie aus dem Nichts entsteht, sobald die Wohnwagen im März aus den Scheunen in Morsum oder Keitum geholt werden und von den Bauern auf die entsprechenden Campingplätze gezogen werden. Ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus mobilen Behausungen, die so unterschiedlich sind wie die Charaktere, die darin leben.
Meiner Frieda wird es wahrscheinlich schnell gelingen, Anschluss zu finden, denn im Gegensatz zu mir ist sie recht gesprächig. Es könnte einzig und allein daran scheitern, dass sie zu eitel ist, ihre Brille zu tragen, und darum die Leute des Öfteren nicht zurückgrüßen wird, was diese ihr wiederum als Arroganz auslegen werden.
Die unmittelbaren Platznachbarn rechts von uns sind eine Kölner Familie, wie ich mir habe sagen lassen, die nur in den Ferien vorbeikommt.
Linker Hand wohnt ein ziemlich kauziger Typ in so einer Knutschkugel aus den sechziger Jahren. Er scheint auch äußerlich in diesem Jahrzehnt stecken geblieben zu sein und könnte der Bruder von John Lennon sein. Mit ihm hatte ich vor zwei Wochen eine kurze Begegnung, die sich auf ein »Moin« zur Begrüßung beschränkte.
Wir gehen an der kleinen Parzelle ebendieses John Lennon vorbei, die er mit einem Schiffstau und Pfählen umgrenzt hat. Dahinter macht der Weg eine leichte Linksbiegung, und dann stehen wir vor unserem neuen Zuhause.
Platz Nummer113 ist der beste Standort, den man nur haben kann. Der Blick geht nach Osten, das Vorzelt steht somit geschützt vor den üblichen Weststürmen, und durch die Bäume des angrenzenden kleinen Wäldchens haben wir sogar natürlichen Schatten. Da die Parzelle in der Kurve liegt, öffnet sie sich wie einV nach hinten und bietet somit nicht nur jede Menge Platz, sondern auch Schutz vor neugierigen Blicken.
»Wir sind da«, sage ich zu Frieda, nehme sie bei der Hand und mache mit der anderen eine präsentierende Geste.
»Was ist denn das?«, fragt meine Frau.
»Ähm, ein Wohnwagen?«
»Aber doch nicht unser Wohnwagen? Dieses alte Ding? In dieser undefinierbaren türkisgelbgrünen Farbe? Der ist doch bestimmt vierzig Jahre alt!«
»Siebenunddreißig Jahre. Baujahr 1978– das Geburtsjahr unserer jüngsten Tochter Marianne. Isch des ned schee?«
Meine Frau entgegnet nichts. Ich kann mich nicht erinnern, wann es ihr zuletzt die Sprache verschlagen hat. Aber vielleicht war das ja auch nur der erste Schock, und gleich freut sie sich, wenn sie ihn von innen sieht. Die Ausstattung ist nämlich wirklich tipptopp.
Ich halte meiner Frau den Schlüssel hin. In ihren rehbraunen Augen steht noch immer Fassungslosigkeit geschrieben.
»Ich weiß, Frieda, die Farbe ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, das stimmt, aber das ist die original Einbrennlackierung. Solche Karosserien aus glattem Alublech hat man heutzutage nicht mehr, aber das war noch echte Wertarbeit– da rostet nichts, und der Wagen ist bis in alle Ewigkeit regendicht. Bei neuen Wohnwagen regnet es doch schon nach drei oder vier Jahren rein, und dann finde mal das Leck– keine Chance. Einmal undicht, immer undicht. Das kann uns mit diesem Schätzchen nicht passieren.«
Meine Frau schaut mich an, als würde ich ihr gerade die Vorzüge eines Lebens auf dem Mars erklären.
Ich setze meinen bewährten Dackelblick auf, dem sie bis heute kaum widerstehen kann, und tatsächlich greift sie nach einem kurzen Moment des Zögerns nach dem Schlüssel und steckt ihn ins Schloss. Der Türgriff ist noch aus Metall gefertigt und glänzt wie neu.
»Die modernen Türdreher sind alle aus Plastik und brechen bei etwas stärkerem Druck gerne mal ab, das kann uns bei dem hier nicht passieren.«
»Aha«, sagt Frieda. In puncto Sprechfreudigkeit haben wir ausnahmsweise die Rollen getauscht.
Meine Frau öffnet vorsichtig die Tür, so als befände sich dahinter eine Rumpelkammer, aus der ihr alles entgegenstürzen könnte.
»Schau mal, der Wagen hat sogar eine zweiflügelige Eingangstür.« Ich greife an die linke Innenseite, löse einen Klappriegel und präsentiere ihr stolz das einen Meter breite Ergebnis. »Ist das nicht genial? Heutzutage muss man sich ja fast seitlich in einen Wohnwagen hineinschieben, wenn man wie ich etwas breite Schultern hat. Geh nur rein und schau dich um.«
Ich folge ihr auf dem Fuß, doch schon nach einem Schritt bleibt meine Frau stehen und starrt auf den Boden. Auf den geflockten Teppich, um genau zu sein. Alles sauber und gepflegt. Nur sollte sie nicht allzu lange auf das schwarz-weiße Muster mit dem Stroboskopeffekt schauen.
Und tatsächlich fasst sich meine Frau an den Kopf. Ich bin mir unschlüssig, ob ihr schwindlig geworden ist oder ob die Geste andere Gründe hat. Im Zweifel wohl beides.
»Keine Sorge, Laminat habe ich schon bestellt. Das hole ich morgen im Baumarkt ab. Kein Problem, das zu verlegen. Dann wirst du dich bald wie zu Hause fühlen.«
»Daheim habe ich keine so hässlichen Polsterbezüge.«
Immerhin, meine Frau hat mal wieder was gesagt. Nichts allzu Begeistertes, das gebe ich zu, doch wie wichtig ist bei einem echten Schnäppchen schon die Wahl der Polsterbezüge? Es gibt im Wohnwagen nur leider jede Menge davon. Links befindet sich eine große Rundsitzgruppe für acht Personen mit Tisch, und neben der kleinen Küchenzeile findet sich eine weitere Sitzgruppe für zwei Personen, die sich genau wie die große zum Bett umbauen lässt.
»Die Polster kann man neu machen«, sage ich um des lieben Friedens willen, obwohl ich der Meinung bin, dass man dieses original Siebziger-Jahre-Flair mit den ockerfarbenen, rotbraunen und grünen Streifen nicht leichtfertig zerstören darf. »Du suchst einen schönen Stoff aus und…«
»Vergiss es, ich setze mich nicht an die Nähmaschine. Das kann nur ein Polsterer ordentlich machen.«
»Ich glaube, im Tinummer Gewerbegebiet sitzt einer mit gutem Ruf, da werde ich morgen, nachdem ich beim Baumarkt war, gleich mal fragen.«
Wenn meine Frau den Kostenvoranschlag liest, wird selbst sie die Polster plötzlich schön finden– so hoffe ich. Und wenn das Laminat erst mal drin ist, beißen sich die Farben auch nicht mehr mit dem Teppich.
»Die Küche richte ich dir wie versprochen im Vorzelt ein, da ist eine vier Meter lange Arbeitsplatte kein Problem. Die Küchenzeile ist wirklich der einzige kleine Haken hier drin, die besteht ja nur aus Spüle, Zwei-Flammen-Herd und Minikühlschrank– damit musst du dich nicht herumschlagen.«
Und ich mich nicht damit, wie der Tabbert seine Gasprüfung besteht, denke ich. Den gelben Zettel wird er nämlich nicht mehr ausgestellt bekommen, es sei denn, ich tausche alle Leitungen im Inneren aus.
Kein Gas bedeutet allerdings auch keine Heizung. Zum Glück ist meine Frau gedanklich noch nicht so weit. Ein Radiator fällt flach, weil jeder auf dem Platz seinen eigenen Stromzähler hat und die Kosten nicht pauschal abgerechnet werden. Aber noch haben wir Sommer, somit kann ich die Lösung dieses Problems noch ein bisschen verschieben.
Kommt Zeit, kommt Rat. Wozu gibt es die Camping-Bibel?
Wenn ein Schwabe wie ich mal nichts auszutüfteln hat, wird ihm langweilig, und das ist wiederum für meine Frau auch nicht gut.