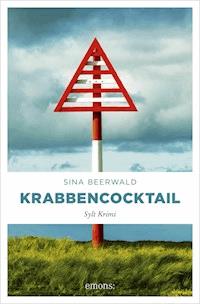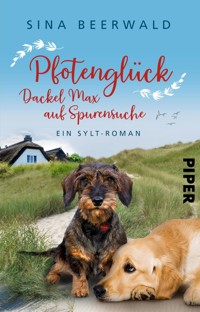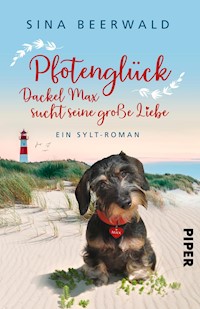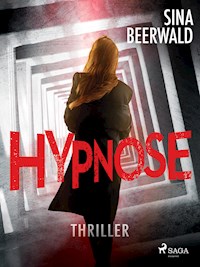9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Sie sind meine Muse. Sie sind die Muse des Teufelsgeigers.«
Wien, 1828: Bei ihrer Heirat mit dem Geigenbauer Paul von Sawicki hatte Sophie auf ein glückliches Leben gehofft, doch ihr Mann ist dem Alkohol verfallen. So arbeitet sie an seiner Stelle in der Werkstatt und kümmert sich um die beiden Kinder. Da taucht plötzlich der berüchtigte Violinist Paganini bei ihr auf und beauftragt sie mit der Reparatur seiner Guarneri del Gesù. Schon bald erkennt Sophie jedoch, dass der Teufelsgeiger eine Anziehung auf sie ausübt, der sie nicht entfliehen kann …
Eine junge Geigenbauerin und ihre verbotene Liebe zu dem größten Geigenvirtuosen seiner Zeit – hervorragend recherchiert und atmosphärisch erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Sophie von Sawicki beherrscht das Geigenbauhandwerk wie keine zweite. Seit ihr Mann in die Alkoholsucht gerutscht ist, übernimmt sie alle Reparaturaufträge selbst – natürlich im Geheimen, denn im Wien des frühen 19. Jahrhunderts ist es ihr als Frau nicht erlaubt, eine Geigenwerkstatt zu führen. Nebenher kümmert sie sich um ihre zwei Kinder. Doch dann bricht das Unglück über die Familie herein: Paul von Sawicki hat hohe Schulden angehäuft. Das Einzige, was sie jetzt noch retten kann, ist ein lukrativer Auftrag. Und plötzlich steht der berüchtigte Geigenvirtuose Niccoló Paganini vor ihrer Geigenwerkstatt. Seine geliebte Guarneri del Gesù muss repariert werden, er braucht sie dringend für ein Konzert am nächsten Tag, das die ganze Stadt in Aufruhr versetzt. Denn dem Italiener eilt das Gerücht voraus, er sei einen Bund mit dem Teufel eingegangen, so unfassbar sind seine Spielkünste. Sophie jedoch erkennt in ihm viel mehr als einen Virtuosen – und fühlt sich von dem vermeintlichen Teufelsgeiger so angezogen, dass sie nicht dagegen ankommt …
Über Sina Beerwald
Sina Beerwald, 1977 in Stuttgart geboren, hat sich bislang mit über zwanzig erfolgreichen Büchern, darunter historische Romane und Sylt-Erlebnisführer, einen Namen gemacht. Sie ist Preisträgerin des NordMordAward und des Samiel Award, zudem standen einige ihrer Titel auf der Shortlist des LovelyBooks Community Award, des größten deutschsprachigen Leserpreises. 2008 wanderte sie mit zwei Koffern und vielen Ideen im Gepäck auf die Insel Sylt aus.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Sina Beerwald
Die Muse des Teufelsgeigers
Historischer Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Zitat
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Epilog
Nachwort
Danksagung
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für Lauris
»Wo unser Denken aufhört, da fängt Paganini an.« (1829)
Giacomo Meyerbeer, Komponist (1791–1864)
Prolog
Italien, 1876
Sechsunddreißig Jahre nach Paganinis Tod
Die Vollmondnacht war wie geschaffen für ihren Plan. Nur der Nachtwächter war in den engen Gassen von Genua unterwegs und sorgte für Ruhe – von ihm durfte sie sich nicht erwischen lassen.
Auf altersmüden Beinen ging Sophie über das im Mondschein glänzende Kopfsteinpflaster des Hafenviertels, in dem sie die Neigung jedes Steins auswendig kannte. Nie hätte sie geglaubt, dass sie ihre geliebte Heimatstadt Wien verlassen und in diese heruntergekommene Hafenstadt ziehen würde, und doch hatte sie ihre zweite Lebenshälfte hier verbracht – weil sie ihrem Herzen gefolgt war.
Der Glanz der alten Zeiten mit seinem florierenden Hafen, den reichen Adelsfamilien und den schmucken Stadtpalästen war längst verblasst, verwahrloste Häuser standen dicht an dicht, manche mit winzigen Vorgärten hinter rostigen Eisentoren. Nur zwei Straßen in der gesamten Stadt waren überhaupt breit genug, dass eine Kutsche hindurchfahren konnte, diese Straßen lagen jedoch erst kurz vor ihrem Ziel, dem Palazzo Doria Tursi.
Manch einer, der sie womöglich aus einem Fenster heraus beobachtete, mochte den Kopf über sie schütteln. Eine alte Frau, nachts, auf unebenem Pflaster – doch ihr war kein Weg zu weit. Sechsundachtzig Jahre alt hatte sie werden müssen, bis sich ihr endlich diese Möglichkeit bot, inneren Frieden zu finden.
Im Zwielicht könnte ein Beobachter auf den ersten Blick annehmen, sie hätte einen Gehstock bei sich, aber dafür war dieser zu dünn, zu kurz und viel zu wertvoll, denn es war Paganinis Geigenbogen.
Vor sechsunddreißig Jahren war sie von Wien zunächst nach Nizza gereist, um sich an seinem Sterbebett von ihrem Geliebten zu verabschieden. Paganini hatte ihr diesen Geigenbogen zum Geschenk gemacht und einen letzten Wunsch an sie gerichtet: Er wollte in seiner Heimatstadt Genua beigesetzt werden, und sie sollte zu diesem Anlass ein letztes Mal auf seiner Geige spielen, die bislang außer ihm niemand in die Hand nehmen durfte. Danach sollte sein geliebtes Instrument, mit dem er seine Seele verbunden fühlte, nie wieder erklingen und stattdessen im Museum seiner Heimatstadt ausgestellt werden.
Es war alles anders gekommen. Ganz anders.
Erst gestern war ihr Geliebter in Parma, zwei Tagesreisen von Genua entfernt, in geweihter Erde bestattet worden – sechsunddreißig Jahre nachdem er gestorben war. Ja, fast vier Jahrzehnte hatte Paganini keine Ruhe gefunden – und das alles nur wegen dieses unseligen Priesters Caffarelli, der Paganini die letzte Beichte abgenommen hatte. Angeblich habe sich der Todgeweihte zum Teufel bekannt – eine Unwahrheit, denn Sophie wusste, dass Paganini damals aufgrund seiner Kehlkopftuberkulose kein Wort mehr hervorgebracht hatte und zu schwach gewesen war, um einen Stift zu halten.
Der Priester hatte jedoch darauf beharrt, dass es so gewesen sei, führte als Beweis an, dass man Paganini während seines fünfmonatigen Aufenthalts in Nizza nicht ein einziges Mal in der Kirche gesehen habe, und ließ auch den Einwand nicht gelten, dass der Kranke das Bett doch gar nicht mehr habe verlassen können.
Sophie seufzte tief. Mit all ihren sachlichen Widerlegungen hatte sie nichts gegen den Priester ausrichten können, dem es nach eigener Aussage in einem Akt göttlicher Gnade gelungen war, im letzten Moment den Satan zum Sprechen zu bringen, der sich vor allen Zeugen geschickt verborgen gehalten habe, und somit durfte mit Paganinis Leiche kein geweihter Boden beschmutzt werden. Auch auf privatem Grund wurde ein Begräbnis verweigert. Der Fall war sogar bis zum Papst vorgedrungen, der die Sache mit der Bitte um Prüfung an den Erzbischof von Turin weitergeleitet hatte, der daraufhin mit den kirchlichen Würdenträgern aus Nizza und Genua zusammengekommen war und sämtliche Zeugen anhörte. Es blieb bei dem kirchlichen Urteil: Kein christliches Begräbnis für einen Satansspross.
Und so kam es, dass Paganinis Sohn Achille von seinem vierzehnten Lebensjahr an mit einem Zinksarg an seiner Seite leben musste, in dem sich die einbalsamierte Leiche seines Vaters befand – und damit nicht genug. Achille hatte eine wahre Odyssee hinter sich gebracht, denn Schaulustige waren über Jahrzehnte hinweg auf den Nervenkitzel aus gewesen, einen Toten zu sehen, der mit dem Satan im Bunde gestanden hatte, und ließen nicht locker, ehe sie den Sarg in seinem Versteck aufgestöbert hatten.
Deshalb hatte Achille den Sarg an immer neue geheime Orte bringen müssen, bis die Kirche endlich ihr gnädiges Einverständnis gegeben hatte, dass Paganini beerdigt werden durfte. Ihr gottverdammtes Einverständnis. Anders konnte man das nicht bezeichnen, dachte Sophie bitter.
Nie hätte sie geglaubt, dass sie eines Tages so über die Kirche denken würde, aber was sollte man davon halten, dass Achille nach zahlreichen vergeblichen Eingaben anlässlich seines fünfzigsten Geburtstags erneut einen letzten verzweifelten Versuch unternommen und bei der Kirche anfragt hatte, ob es nach sechsunddreißig Jahren der Irrfahrt nicht genug sei, ob sein Vater nun endlich seine letzte Ruhe finden dürfe, und die Antwort so schnell wie überraschend gekommen war: Rom könne das Urteil aufheben, allerdings nur, wenn ein eindeutiges Zeichen der Reue des Verstorbenen vorgelegt werden könne. Da man sich der damit verbundenen Schwierigkeiten durchaus bewusst sei, so hieß es in dem Schreiben, würde man es als ein entsprechendes Zeichen werten, wenn eine Summe in Höhe der gesamten Honorare, die sich der Teufelsgeiger nachweislich mithilfe des Satans erspielt hatte, an die Kirche gespendet würde.
Über die Jahrzehnte mürbe geworden, hatte Achille ein Vermögen an die Kirchenkasse überwiesen. Trotzdem dauerte es ein weiteres Jahr, bis er den Bescheid erhielt, dass sein Vater nun beerdigt werden dürfe, sogar mit kirchlichem Segen nach katholischem Ritus, aber doch bitte aus Rücksicht auf die Gläubigen im kleinsten Kreis und in aller Stille, was selbstredend am besten nachts zu geschehen habe. Und so war es geschehen – ohne dass es Sophie möglich gewesen war, die Geige zu spielen, denn sie war lediglich im Besitz des Bogens.
Im Fackelschein war sie gestern dem Leichenzug gefolgt. Am Grab durfte jeder durch die Glasscheibe im Sarg einen letzten Blick auf Paganini werfen, dessen Leichnam gleich nach dem Tod konserviert worden war.
Sein Gesicht sah aus, als ob es aus Gips wäre, doch es war immer noch von schwarzen lockigen Haaren umrahmt, und es schien, als schliefe er einfach nur. Darauf war sie nicht vorbereitet gewesen, dass ihr Geliebter so lebendig wirken würde. Sie hatte sich vorgestellt, dass alles nur ein böser Traum gewesen war, dass er aufwachen und sie anlächeln würde, und eine Welle des Schmerzes hatte sie übermannt.
Wie gern hätte sie ein letztes Mal seine Hand gehalten und ihn um Verzeihung dafür gebeten, dass sie ihm seinen letzten Wunsch nicht hatte erfüllen können, denn seine geliebte Geige ruhte seit Jahrzehnten ganz nach Paganinis testamentarischem Wunsch im Palazzo Doria Tursi und wurde dort wie ein Schatz gehütet.
Achille hatte die Geige erst nach der Beerdigung ins Museum geben wollen, da er ahnte, dass er das Instrument andernfalls nicht mehr in die Hände bekommen würde. Wie recht er mit dieser Einschätzung gehabt hatte. Doch elf Jahre nach dem Tod seines Vaters, nachdem immer noch keine Bestattungserlaubnis erteilt worden war, hatte er dem berechtigten Drängen des Museums auf Erfüllung des Testaments nachgegeben, und so hatte Paganinis Geige, die Guarneri del Gesù, ihren Platz im Museum erhalten.
Es war der neuen Museumsleiterin nicht zu verdenken, dass sie den riskanten Transport des kostbaren Stücks über zwei Tagesreisen mit der Kutsche bis nach Parma zum Grab Paganinis verweigert hatte. Zudem hatte sie argumentiert, dass Paganini nicht schriftlich festgelegt habe, dass die Geige auf seiner Beerdigung ein letztes Mal gespielt werden solle – da könne ja jeder kommen und so etwas behaupten.
Wohl wahr, dachte Sophie resigniert, und natürlich hätte Paganini eine sechsunddreißig Jahre andauernde Odyssee in seinem Testament berücksichtigen müssen.
Auf Sophies Drängen hin war die resolute Frau plötzlich handzahm geworden und hatte ihr zugesichert, die Geige auf sicherem Weg nach Parma bringen zu lassen. Doch das war bloß eine Farce gewesen!
Unter Tränen hatte Sophie ihrem Geliebten am Grab versprochen, dass seine Geige ein letztes Mal erklingen sollte. Gezwungenermaßen nun eben nicht zu seiner Beerdigung, sondern auf eine verbotene Art und Weise.
Sie ging eine altvertraute Strecke. Es war ein Fußweg von einer Viertelstunde, den sie jahrelang gegangen war – von ihrer Wohnung im Hafenviertel, an Paganinis Elternhaus vorbei, zu ihrem Arbeitsplatz, an dem sie zuletzt als Museumsleiterin tätig gewesen war, während sie auf die Beerdigung ihres Liebsten gewartet hatte.
Solange sie noch die Leiterin des Museums gewesen war, wäre es kein Problem gewesen, dass die Geige ihren geschützten Raum hätte verlassen dürfen.
Als sie aus Altersgründen ihren Stuhl räumen musste, hatte sie den Schlüssel zum Museum in weiser Voraussicht nachmachen lassen und hütete ihn seitdem ebenso wie den Geigenbogen.
Heute sollte das Instrument ein letztes Mal zum Leben erwachen.
Was hatte sie schon zu verlieren? Selbst eine drohende Gefängnisstrafe würde sie nicht von ihrem Plan abhalten, denn sie hatte nicht mehr lange zu leben. Laut den Ärzten würde sie spätestens in drei Monaten sterben müssen, weil ihr Bauchraum mit Geschwüren überwuchert war. Man hatte sie mit Äther betäubt, um den vermeintlich einzelnen Störenfried, der ihr solche Schmerzen bereitete, zu entfernen, aber die Ärzte hatten nur entsetzt in ihren Bauch geblickt und ihn unverrichteter Dinge wieder zugenäht.
Seither war es ein stetiges Auf und Ab mit den Schmerzen, aber Sophie war kein Weg zu beschwerlich, um ihrem Geliebten seinen letzten Wunsch zu erfüllen.
Irgendwo inmitten des Armenviertels balgten sich zwei Katzen und stießen furchterregende Schreie aus. Der Vollmond wies ihr den Weg durch die dreckigen Gassen zu Paganinis Elternhaus. Es befand sich im Passo di Gatta Mora – im Gang der schwarzen Katze, und Sophie hatte sich des Öfteren gefragt, ob das ein Omen für sein Unglück gewesen war.
Sie blieb vor dem schmalen, windschiefen Haus mit der Nummer achtunddreißig stehen, das bloß deshalb nicht in sich zusammenfiel, weil es sich die Außenwände mit den anderen Gebäuden teilte, die hier in einer Reihe standen. An der bröckeligen Fassade prangte ein steinerner Bildstock zur frommen Anbetung – was für ein Hohn nach dem fast vierzig Jahre währenden Kampf gegen die Geistlichkeit, den sie nur gewonnen hatten, weil Paganinis Vermögen nun der Kirche gehörte.
Von einer plötzlichen Welle der Wut überrollt, hob Sophie einen Stein auf und warf ihn mit voller Wucht gegen das Bildnis.
Ohne mit der Wimper zu zucken, ging sie weiter. Das hatte gutgetan.
Je näher sie dem Palazzo kam, desto größer wurden die Häuser, doch die meisten Stadtpalais waren verlassen, die einst prächtigen Fassadenbemalungen verblasst, die Gärten mit Unkraut überwuchert, und die Statuen trugen Kleider aus Moos. Ställe und Remisen dienten den verbliebenen Einwohnern als Holzlager, ein Umstand, der von der Stadt geduldet wurde. Bei einem Haus an der Straßenbiegung lösten sich die Fenstergitter im Erdgeschoss aus dem porösen Mauerwerk, zudem war das wuchtige Holzportal aus den Angeln gefallen und wurde nur noch durch das mächtige Türschloss zusammengehalten.
Endlich erreichte Sophie die breite Strada Nuova, und es war, als tauchte sie in eine andere Welt ein. Hier, rund um den Palazzo Doria Tursi, gab man sich Mühe, die prunkvollen Paläste zu erhalten, schließlich wollte man aus den Rathausfenstern nicht auf das Elend der Stadt blicken.
Die breite Straße lag wie ausgestorben da, und Sophie hoffte, nicht auf den letzten Metern dem Nachtwächter in die Arme zu laufen. Genauso wenig wie dem alten Frederico, der seit Jahrzehnten wie ein Schlossgespenst durch die Museumsflure streifte und darauf achtete, dass dort kein Dieb sein Unwesen trieb. Obwohl Letzteres noch nie vorgekommen war, trug Frederico zu seinem eigenen Schutz stets eine Pistole bei sich.
Vor dem großen Eingangsportal, das zwischen den vielen vorgebauten Säulen erst auf den zweiten Blick auffiel, blieb Sophie stehen, schloss ihre Hand fester um den Geigenbogen, und griff mit der anderen in der Rocktasche nach dem Schlüssel.
Es war so still um sie herum, dass sie glaubte, man müsse in ganz Genua hören, wie sie den Schlüssel ins Schloss steckte und langsam drehte. Da sie den Punkt, ab dem die Angeln quietschten, genau kannte, öffnete sie das Portal nicht ganz, sondern zwängte sich hinein.
Die Säulen und Wände des Innenhofs waren aus Marmor, ebenso wie die zahlreichen Statuen, von denen sich Sophie beobachtet fühlte.
Nahezu geräuschlos ging sie in ihren Lederschuhen die breite Treppe in den ersten Stock hinauf. Das war doch anstrengender als gedacht.
Schwer atmend erreichte sie das obere Stockwerk und blieb dort für einen Moment stehen. Bloß kein unnötiges Geräusch machen, durch das sie sich verraten könnte. Sie warf einen prüfenden Blick entlang dem überdachten Rundgang, von dem einige Türen abzweigten. Soweit sie das im Mondlicht beurteilen konnte, war die Luft rein, also steuerte sie auf die Tür zu, durch die sie früher mehrmals täglich gegangen war, schloss auf und drehte den schwergängigen goldenen Knauf.
Ehrfürchtig betrat sie den zwölf Meter hohen Saal, an dessen Ende die Guarneri del Gesù ausgestellt war. Als einziges Ausstellungsstück.
Mondlicht schien durch die großen Fenster auf die Geige, die keineswegs in Samt gehüllt in ihrem Geigenkoffer ruhte, nein, sie hing auf Augenhöhe der Besucher in einer Vitrine.
Ihr Herz schlug schneller, als sie sich näherte. Es pochte so heftig, dass es schmerzte, und sie bekam es mit der Angst zu tun. Hatte sie sich körperlich doch zu viel zugemutet? Von der Aufregung mal abgesehen.
Da war sie. Paganinis Geige. Die Geige ihres Geliebten. Unverkennbar, denn anstelle eines Kinnhalters befand sich ein heller Fleck auf der Geigendecke – Paganini hatte stets ohne Kinnhalter zu spielen gepflegt. Außerdem war der Geigenhals länger als bei anderen Instrumenten, und wenn man das Griffbrett abnähme, würde sich dort der Name »Sawicki« finden. Ihren Vornamen hatte sie damals nicht einzugravieren gewagt. Sie sah sich wieder als junge Frau in der Geigenbauwerkstatt in Wien sitzen, immer mit der Angst im Nacken, dass ihr jähzorniger, betrunkener Eheherr hereinpoltern würde. Mittlerweile führten ihre beiden Kinder die Geigenwerkstatt weiter. Zu Hause in Wien wurde sie von niemandem dringend erwartet, ihre Kinder waren schon erwachsen gewesen, als sie zu Paganini ans Sterbebett gereist war. Wenn sie heute daran zurückdachte, wie sie als junge Frau an der Werkbank gesessen hatte, um das Einkommen der Familie auszugleichen, das ihr Eheherr versoff und verspielte, dann kam es ihr so vor, als ob das in einem anderen Leben gewesen sein musste.
Nach ihrer Ankunft in Genua hatte sie Monat für Monat entschieden, dass sich die weite Heimreise nach Wien nicht lohnte, weil die Kirche sicher bald ihren Segen für ein christliches Begräbnis gab, denn Paganini hatte viele Fürsprecher gehabt. Wer hätte geglaubt, dass es sechsunddreißig Jahre werden würden?
Nun war es so weit.
Atemlos schloss sie die Vitrine auf und nahm die Geige aus der Halterung. Sechsunddreißig Jahre des Wartens hatten ein Ende. Sie holte tief Luft, hob die Geige ans Kinn und setzte den Bogen an. Bis zu diesem Moment hatte sie nicht gewusst, was sie spielen sollte, doch nun begann sie wie von selbst eine Melodie, die nur zwei Menschen auf der Welt kannten. Paganini und sie.
Nicht nur Bogen und Geige waren wieder vereint. Erst jetzt wurde ihr schmerzlich bewusst, weshalb ihr Geliebter ihr gegenüber diesen letzten Wunsch geäußert hatte.
Heiße Tränen rannen ihr über die Wangen, sie tropften auf das wertvolle Holz, und doch war sie nicht in der Lage, ihr Spiel zu unterbrechen. Nicht, bevor das Stück, das Paganini für sie allein komponiert hatte, zu Ende war.
Sophie vernahm Schritte. Das musste der Nachtwächter sein. Sie hielt den Atem an, spielte jedoch weiter.
»Hände hoch! Umdrehen!«
Das war Fredericos Stimme.
Sie hatte nichts zu verlieren.
Mit geschlossenen Augen und voller Hingabe spielte sie die Molltöne der traurigen Melodie, die schon damals einen Abschied markiert hatten, dann ging sie zu den tanzenden Stakkato-Noten am Ende des Stücks über – die Vertonung einer fröhlichen Wiedervereinigung zweier Liebender.
Das Schicksal hatte andere Pläne gehabt.
Ihr Geliebter hatte recht behalten, dachte Sophie unvermittelt, während sie unter Tränen die letzten Töne spielte. Eines Tages würden sie wieder vereint sein. Damals hatte er, bereits von Krankheit gezeichnet, dieses Stück für sie komponiert und dann durch seinen letzten Wunsch sichergestellt, dass es diesen Augenblick geben würde. Diesen Augenblick, in dem sie sich wieder ganz nah sein würden, auch wenn die Brücke zwischen Leben und Tod sie noch trennte. Aber nicht mehr lange. Bald würde sie ihm folgen. Während sie den letzten, lang gezogenen Ton spielte, breitete sich eine tiefe innere Ruhe in ihr aus, und doch spürte sie nicht den erhofften Frieden in sich. Es lag ihr noch so viel auf dem Herzen.
»Frau von Sawicki?«, fragte Frederico. Seine Schritte kamen näher.
Sie drehte sich zu ihm um. »Ja, ich bin es.«
»Große Güte!«, rief Frederico. »Ich dachte schon, ich bekäme es kurz vor meinem Ruhestand noch mit einem Einbrecher zu tun! Was um alles in der Welt machen Sie hier?«
»Der Bogen und die Geige sollten ein letztes Mal vereint sein«, entgegnete sie leise. »Das war Paganinis Wunsch, den er am Sterbebett an mich gerichtet hat.«
»Dann ist das Paganinis Geigenbogen? Ich dachte, der sei verschollen?«
»Das soll die Nachwelt glauben, denn Paganini wollte sichergehen, dass nach mir niemand mehr sein geliebtes Instrument spielt. Deshalb hat er dem Museum die Geige vermacht und mir den Bogen.«
»Was für eine Ehre!«, rief Frederico. »Wie ist es denn dazu gekommen? Haben Sie Paganini gut gekannt? Darüber haben Sie nie ein Wort verloren.«
»Ach, das ist eine lange Geschichte«, sagte sie und seufzte. »Wenn ich Ihnen die erzähle, sitzen wir morgen früh noch hier.«
Frederico lächelte und blickte auf die Besucherstühle, die an der Wand in der Nähe der Vitrine aufgereiht waren. »Kein Problem. So lange geht mein Dienst ohnehin. Wir sollten nur rechtzeitig vor Sonnenaufgang verschwinden«, fügte er hinzu und schmunzelte. »Und wenn Sie mir die Geschichte bis dahin noch nicht zu Ende erzählt haben – ich habe alle Zeit der Welt.«
»Mir ist nicht mehr allzu viel Zeit vergönnt … Aber ich spüre, ich kann nur meinen Frieden finden, wenn ich meine Geschichte erzähle, das wird mir gerade bewusst. Für meine Kinder und Enkel sollte ich sie wohl sogar aufschreiben, aber wer weiß, ob ich das noch schaffe.«
Gedankenverloren ließ sie sich auf einen Stuhl fallen, legte die Geige in ihren Schoß und die Hände darauf, und dann erschienen ihr Bilder vor Augen. Davon, wie alles in Wien begonnen hatte, als sie noch eine junge Frau gewesen war.
Kapitel 1
Wien, am 27. März 1828
Als sie an diesem winterlichen, sonnigen Märzvormit- tag auf dem Rückweg vom Einkauf durch den späten Schnee am Dom vorbeikam, sah Sophie sich besonders aufmerksam unter den Passanten um, und warf nicht wie gewohnt einen ängstlichen Blick nach oben zu dem aus der Senkrechten geratenen Turm des majestätischen Stephansdoms.
Da war keine Sorge mehr um herunterfallende Mauersteine, stattdessen hoffte sie auf eine zufällige, wenn auch unwahrscheinliche, Begegnung mit dem besten Geigenspieler der Welt. Jenem auffällig dünnen, langhaarigen Mann in abgetragenem Frack und Zylinder, der unter anderem in der Mailänder Scala siebentausend Zuhörer verzaubert hatte – mit seinem wahrhaft unbegreiflichen Spiel schwierigster Sätze auf einer einzigen Saite, mit Sprüngen und Doppelgriffen in nie gekannter Geschwindigkeit und seiner täuschend echten Imitation von Tierstimmen.
Man munkelte, Niccolò Paganini habe seine Seele dem Teufel verschrieben, und damit nicht genug: Ihm eilte das Gerücht voraus, er habe seine frühere Geliebte eigenhändig erwürgt, um aus ihrem Darm eine Geigensaite zu fertigen. Jene vierte Saite, mit der er seinem Instrument Klänge entlockte, die kein menschliches Ohr je zuvor gehört hatte.
Dieser italienische Satansspross und Mörder sollte nun unbehelligt von allen Staatsorganen auf Einladung von Fürst Metternich auf einer kaiserlichen Bühne auftreten.
Es war, als hielte die ganze Stadt den Atem an.
Sophie wusste nicht so recht, was sie von den Gerüchten halten sollte.
Vor elf Tagen war der berühmte Virtuose mit der Kutsche in der verschneiten Stadt angekommen und hatte sich mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn in sein Quartier im Trattnerhof zurückgezogen. Seitdem gab es kein anderes Gesprächsthema mehr.
Sophie wechselte den schweren Marktkorb, in dem sich unter anderem ein Suppenhuhn befand, von der rechten in die linke Armbeuge. Ihre Anstrengung ballte sich in den Atemwölkchen, die sie in die kalte Luft stieß.
Auf dem Stephansplatz stellte sie den Korb ab, um neue Kraft zu schöpfen. Vernünftig wäre es, weiter um den Dom herum zu gehen, dann wäre sie gleich zu Hause, aber wenn sie schon mal hier war, könnte sie auch die andere Richtung einschlagen und gleich rechts um die Ecke in die Hauptflaniermeile Am Graben einbiegen. Bis zum Trattnerhof, der in der gleichnamigen Seitenstraße lag, wären es nur fünf Minuten. Vielleicht hatte sie Glück und erhaschte einen Blick auf den Virtuosen?
Es hatte sich schnell herumgesprochen, dass Paganini im größten Gebäude der Stadt, das einen ganzen Straßenzug für sich vereinnahmte, eine Wohnung angemietet hatte, und sie war versucht, sich eine Weile zu den Schaulustigen zu gesellen, die dort den ganzen Tag über darauf warteten, ihm zu begegnen. Vielleicht verließ er in genau diesem Moment das Haus, man konnte nie wissen, überlegte Sophie, wobei die Wahrscheinlichkeit bei nüchterner Betrachtung wohl recht gering war.
Proben hielt der Meister grundsätzlich für überflüssig, auch das Wiener Begleitorchester musste sich damit abfinden, mit Notenblättern vorliebzunehmen, auf denen nur die Orchesterstimme zu lesen war – Paganinis Soloparts waren lediglich als Striche markiert.
Sophie entschied sich mit aller gebotenen Vernunft für den Weg nach Hause. Ihr Eheherr würde fragen, wo sie sich so lang herumgetrieben hatte, auch die Zwillinge warteten auf sie – von der vielen Arbeit ganz abgesehen.
Also ging Sophie mit vorsichtigen Schritten weiter über die schneebedeckten, rutschigen Pflastersteine in Richtung ihres Zuhauses, wobei sie den Stephansdom zur Hälfte umrunden musste.
Auf Höhe der Verkaufshütte einer Wurstbraterin im Schatten des Steffls, wie die Wiener ihren Dom liebevoll nannten, blieb sie erneut stehen, stellte ihren Marktkorb ab und lockerte die schmerzende Armbeuge.
Vor dem gut besuchten Stand sprang ein Jagdhund bellend an den Beinen seines Herrchens hoch und forderte seinen Anteil an der Bratwurst. Der Geruch war verführerisch. Kurz dachte Sophie darüber nach, ihrem Hungergefühl nachzugeben und sich in die Schlange zu stellen, doch sie entschied sich dagegen. Sie musste wirklich zurück in die Geigenwerkstatt – die Einkäufe hatten schon genug Zeit in Anspruch genommen.
An der Hausecke gegenüber wurde sie auf eine Gruppe von fünf Männern vor der k. k. Lotto Collectur aufmerksam, wo man bereits seit 1752 Lose für die Lotterie erwerben konnte, wie die schmucke Beschilderung über der vertäfelten Flügeltür verriet. Die Herren in ihren pelzverbrämten Mänteln und schneebedeckten Zylindern waren in eine hitzige Diskussion verstrickt, in der immer wieder der Name Paganini fiel.
Da riss jemand über dem Ladengeschäft ein Fenster des stuckverzierten, dreistöckigen Hauses auf.
»Ruhe da unten, ihr Teufelsbeschwörer!«, schrie eine Frau mit rundem rotbackigem Gesicht. »Aus der Stadt jagen sollte man diesen Mörder und nicht mit Applaus bejubeln!« Wütend knallte sie das Fenster zu.
Die Männer schauten verdutzt drein und verfielen in brüllendes Gelächter.
Der Kleinste von ihnen, mit heller Hose bekleidet, öffnete den obersten Knopf seines Mantels und mühte sich, nach Luft ringend, um Fassung. »Das Tratschweib war wohl zu oft auf dem Markt. Hat Angst vor diesem harmlosen Hanswurst!«
»Trotzdem, ich werde das Konzert auf gar keinen Fall besuchen«, sagte der augenscheinlich Älteste in der Runde. »Ich bezahle doch keine sündhaft teure Eintrittskarte, um einem Mörder zuzuhören.«
»Ich will den Teufel leibhaftig sehen!«, rief der Größte unter ihnen, und stieß seinen eleganten Spazierstock in den Himmel.
Kopfschüttelnd wandte Sophie sich ab. Die Leute redeten viel, wenn der Tag lang war. Dennoch, ein Körnchen Wahrheit war immer dabei – oder waren es gar keine Gerüchte? Ein Teufel war er bestimmt nicht, das konnten nur jene glauben, die noch in mittelalterlichem Denken verhaftet waren – aber war er ein Mörder?
Mörder. Sophie schauderte.
In diesem Moment trat eine Kundin aus dem Lotterieladen, wobei man von ihr zuerst nur den roten breitkrempigen Hut mit Schleifenbändern sah, der ihr Gesicht verdeckte, als trüge sie Scheuklappen. Sie hängte sich ihren rot geblümten Beutel ans Handgelenk und schaute auf. Sophie konnte sich nicht schnell genug abwenden, da winkte ihr die blonde Frau auch schon erfreut zu. Jetzt musste sie die Begegnung mit ihrer Schwägerin in Kauf nehmen.
»Wie schön, dich wieder einmal zu treffen!«, rief Florentine und raffte im Näherkommen ihren Mantel samt knöchellangem rotem Kleid.
Sophie trat auf der Stelle und zog ihren schlichten dunkelblauen Umgang enger, durch den der Märzwind seine eisigen Dornen stach.
Auf gute Kleidung hatte ihre Schwägerin schon immer viel Wert gelegt, ganz gleich, ob ihr Mann Peter sich das leisten konnte oder nicht. Er war ebenfalls Geigenbauer, so wie sein Zwillingsbruder Paul, allerdings war er mit seiner Werkstatt längst nicht so erfolgreich. Dennoch hatte er ein gutes Einkommen und sicherlich hätte er mittlerweile viel Geld auf der hohen Kante, wenn Florentine es nicht mit vollen Händen zum Fenster rauswerfen würde.
»Ich habe ein paar Lose gekauft«, sagte Florentine und deutete kichernd auf ihren prall gefüllten, mit Rosen bestickten Handbeutel. Aus ihren grünen Augen blitzte der Übermut. »Man darf das Glück ja auch mal herausfordern.«
»Natürlich«, gab Sophie tonlos zurück, wohl wissend, wie sehr ihre Schwägerin das Leben auskostete.
Sie wirkte wie eines der Kleidermodelle auf den handkolorierten Modeblättern in der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode. In ihrem figurbetonten Mantel mit rot-beigefarbenem kariertem Muster zog sie verwunderte und spöttische Blicke auf sich. Sophie musste sich eingestehen, dass ihr dieses neuartige Karomuster recht gut gefiel. Nicht jedoch der üppige Hut aus rotem Atlasstoff, dessen ausfallende Krempe zusätzlich mit Tüllblumen und mit breiten Bändern verziert war, die unter dem Kinn zu einer großen Schleife gebunden waren – eine Kreation, die Sophie nie im Leben gegen ihre zurückhaltend ausgeformte, schlichte Haube tauschen wollte.
»Du bist blass, meine Liebe!«, rief Florentine unvermittelt aus, um das Gespräch fortzuführen. »Bist du krank?«
Sophie schüttelte den Kopf. »Es ist alles in Ordnung. Nur die übliche Anstrengung. Der schwere Korb. Und natürlich zehrt es auch an meinen Kräften, mich um die Zwillinge und den Haushalt zu kümmern.«
»Wie geht es meinen Patenkindern? Komm, ich begleite dich ein Stück, ich wollte ohnehin in deine Richtung.«
Sophie seufzte, als sie ihren Marktkorb anhob, was ihre Schwägerin sicherlich allein auf das Gewicht der Einkäufe zurückführte.
Florentine tat immer so, als ob sich die Zeiten nicht geändert hätten. Ja, früher, da hatten sie sich einmal gut verstanden, sie hatten sogar am gleichen Tag Hochzeit gefeiert, sich oft zu viert verabredet, oder die Zwillingsbrüder hatten zum Fachsimpeln in der Werkstatt gesessen, während sie sich mit Florentine im Kaffeehaus getroffen hatte. Dann kamen die Kinder. Bei ihr, nicht bei Florentine.
Bis heute hatte ihre Schwägerin keine Kinder, und obwohl sie ihre Eifersucht darüber nie offen zeigte, musste Florentine ihr doch bei jeder Gelegenheit unter die Nase reiben, dass sie das bessere Leben führte, die bessere Ehefrau und überhaupt der bessere Mensch war. Florentine kreiste stets um sich und ihr Leben – und wenn sie, so wie jetzt, nach ihren Patenkindern fragte, dann zeugte das nicht etwa von echtem Interesse, sondern davon, dass sie auf Informationen aus war, die ihr bei nächster Gelegenheit dazu dienten, nicht zuletzt ihre Schwägerin schlechtzureden.
»Nun sag, was machen meine lieben Kleinen?«, hakte Florentine nach, während sie dem ausladenden Straßenbogen nach rechts folgten und sich dabei dicht an den Geschäftshäusern hielten, um keinem der Fiaker in die Quere zu kommen, die mit hallendem Hufgeklapper an ihnen vorbeizogen.
»Die sind gar nicht mehr so klein. Die Zwillinge sind selbstständiger geworden, mit zwölf müssen sie das auch. Katerina freut sich sehr darauf, dass das Lernen bald ein Ende hat und sie in der Hauswirtschaft arbeiten darf, und Kristian sitzt mit Feuereifer über den Büchern und will später unbedingt die Werkstatt übernehmen.«
»Schön. Wer hätte das von den beiden gedacht. Und wie laufen die Dinge in der Werkstatt? Hat dein Mann viel zu tun?«
Wer hätte das von den beiden gedacht. Was für ein Ausspruch über ihre Kinder, die immer gut in der Schule gewesen waren, und für ihr Alter zudem sehr gut Geige spielten, dachte Sophie verärgert, aber aus Florentines Sicht war das alles natürlich nicht gut genug.
Und nun sollte sie auch noch über ihren Eheherrn Auskunft geben und darüber, wie die Geschäfte liefen. Wie sie diese Ausfragerei hasste. Was wollte Florentine denn hören? Es gab vier Geigenbauer in Wien, darunter zwei schlichte Reparaturwerkstätten und zwei mit dem Namen Sawicki, aber nur einer hatte sich mit dem exzellenten Nachbau von Stradivari-Geigen einen sehr guten Ruf weit über die Landesgrenzen hinaus erarbeitet – und das war ihr Eheherr: Paul von Sawicki.
Am liebsten hätte Sophie ihre Schwägerin stehen lassen, aber das würde nur dazu führen, dass Florentine sich, kaum zu Hause, bei ihrem Mann Peter beschwerte, und der würde kurz darauf bei ihnen auf der Türschwelle stehen und seinen Zwillingsbruder sprechen wollen, weil dieser ein freches Eheweib habe, dem man Manieren beibringen müsse. Das wollte sie auf jeden Fall vermeiden.
»Nun, wie soll ich dein Schweigen deuten?« Florentine hob ihre Hutkrempe mit spitzen Fingern an, damit sie sich nicht die Mühe machen musste, den Kopf zu drehen, um Sophie mit einem kritischen Blick zu treffen. »Laufen die Geschäfte etwa schlecht?« Florentines Stimme schoss am Ende des Satzes in die Höhe, und in gleichem Maße steigerte sich Sophies Wut.
»Ach, Florentine, wo denkst du hin? Mein Eheherr hat Aufträge en masse, fast, als wäre er der einzige Geigenbauer in Wien.« Diese Spitze musste sein, dachte Sophie und lachte künstlich auf. »Du kennst ihn ja. Er hat sich seinen Ruf hart erarbeitet und zur Strafe kann er sich jetzt vor hochrangiger Kundschaft kaum retten.«
»Wie schön«, entgegnete Florentine kühl. Sie wusste nur zu gut, dass ihr Ehemann Peter seinem Zwillingsbruder nicht das Wasser reichen konnte. Das war bislang auch kein Problem zwischen den Brüdern gewesen, denn Peter hatte nicht den Ehrgeiz und war zufrieden damit, wie seine Werkstatt lief. Florentine hingegen hatte sich noch nie mit etwas zufriedengegeben, das Beste war ihr nicht gut genug, und sie wollte vor allem immer noch mehr Geld, um sich mit noch mehr unnützem Tand zu umgeben.
Florentine wandte den Kopf zu den Schaufenstern und schien nach einem neuen Thema zu suchen.
»Sophie, sieh doch nur! Hier gibt es kleine Geigen aus Zuckerteig und Paganini-Brote in Geigenform.«
»Schön«, entgegnete sie einsilbig und überlegte fieberhaft, wie sie ihrer Schwägerin entkommen könnte, ohne unhöflich zu sein.
Das schien Florentine zu spüren, denn sie stellte eilig die nächste Frage: »Geht dein Mann mit dir zum Paganini-Konzert?«
»Nein, er hat keine gute Meinung über den Teufelsgeiger und will dem Konzert deshalb fernbleiben.« Das war zumindest ein Teil der Wahrheit, dachte Sophie, und alles andere ging Florentine nichts an.
»Mein Mann will aus demselben Grund nicht dorthin, das finde ich sehr schade, denn ich habe bereits Karten für übermorgen gekauft, und allein kann ich das Konzert nicht besuchen, das ziemt sich nicht. Aber du könntest mich begleiten, das wäre doch was!«
Seit wann scherte sich Florentine darum, was sich ziemte?, dachte Sophie, und gleich darauf ahnte sie es: Florentine wollte nichts unversucht lassen, den Kontakt zu ihrer Schwägerin wieder aufleben zu lassen. Was tat sie nicht alles, um Informationen zu sammeln … »Das ist eine nette Idee, Florentine, aber leider bin ich verhindert.«
»Ich lade dich ein.«
Da war sie wieder, die überhebliche Florentine, die so tat, als rühre Sophies Absage ausschließlich daher, dass es ihr am Geld mangelte.
»Nein, ich kann wirklich nicht.« Sophies Magen zwickte, wie immer, wenn sie in eine unangenehme Situation geriet.
»Die Karten haben fünf Gulden gekostet, nicht eben wenig, aber das kann ich mir leisten, mach dir keine Gedanken. Ich lade dich gerne ein!«
Von fünf Gulden könnte sie ihre Familie eine ganze Woche ernähren – wenn sie sparsam war, sogar zwei Wochen. Aber das war keine echte Großzügigkeit, Florentines Geste war reine Überheblichkeit, und deshalb würde sie einen Teufel tun und dieses Angebot annehmen.
»Ich habe zu viel zu tun, Florentine, wirklich!«
»Das ist doch kein Grund. Du wirst doch den Haushalt an dem Samstag für drei oder vier Stunden ruhen lassen können?«
»Und wer passt auf die Kinder auf? Soll ich vielleicht meinen Mann fragen?« Sie lachte über ihren eigenen Scherz, während Florentine ernst blieb.
»Die Kinder sind doch alt genug, um auf sich selbst aufzupassen. Ansonsten, wie wäre es mit deiner Nachbarin? Früher hat sie die Kinder doch auch gehütet? Und überhaupt, als die Kinder noch kleiner waren, habe ich dich viel öfter gesehen. Wann hast du zuletzt einen Kaffee mit mir getrunken?«
Sophie blieb ihr eine Antwort schuldig, obwohl sie es wusste. Das war ziemlich genau ein Jahr her.
An der nächsten Kreuzung wechselte Sophie den Korb umständlich von der einen in die andere Armbeuge und hoffte, dass Florentine sich nun endlich verabschiedete.
Doch ihre Schwägerin schien nichts dergleichen im Sinn zu haben, im Gegenteil, Florentine kam einen Schritt näher, wodurch sich Sophie regelrecht bedrängt fühlte. »Was ist los, Sophie? Früher hattest du trotz der kleinen Kinder und des Haushalts oft stundenlang Zeit.«
»Früher! Ja, früher!«, brach es aus ihr heraus, dann fuhr sie gefasster fort: »Die Zeiten haben sich geändert, Florentine. Es gibt viel zu tun, das habe ich dir eben erklärt. Und aus diesem Grund muss ich jetzt auch nach Hause.«
»Ich komme mit, ich habe Zeit, gemeinsam haben wir die Hausarbeit schnell erledigt.«
Es war unfassbar, dachte Sophie, wie Florentine sich aufdrängte. Ihre Schwägerin führte doch etwas im Schilde. Wahrscheinlich interessierte sie sich für den Zustand des Haushalts, weil sie später darüber lästern und sich selbst besser fühlen wollte. Womöglich war Florentine aber auch an einem Blick in die Geigenwerkstatt interessiert, oder besser gesagt an einem Blick ins Werkstattbuch und auf die Namen der Auftraggeber.
»Du weißt, dass Paul nicht gern Leute im Haus hat. Mein Eheherr braucht seine Ruhe zum Arbeiten. Das ist nicht gegen dich gerichtet.«
»Sophie, irgendetwas stimmt doch nicht. Ich kenne dich nun schon fast fünfzehn Jahre, aber nicht nur du ziehst dich zurück, auch dein Mann meidet seit Längerem jeglichen Kontakt zu seinem Bruder.«
»Wie gesagt, die Arbeit«, entgegnete Sophie knapp. »Nehmt es nicht persönlich. Ich muss jetzt auch wirklich nach Hause. Es war schön, ein Stück mit dir zu gehen. Wir sehen uns bestimmt mal wieder beim Einkaufen.«
»Ich hoffe nur, dass du glücklich bist!«, rief die Schwägerin ihr hinterher.
»Natürlich bin ich glücklich!«, antwortete Sophie laut über die Schulter, das letzte Wort presste sie durch ihre eng gewordene Kehle, was man ihrer Stimme prompt anhörte. Sie hustete, um ihre Schwägerin glauben zu machen, sie habe sich verschluckt.
Eilig verschwand Sophie in der nächstbesten Gasse. Dort warf sie einen Blick zurück, ob Florentine ihr auch wirklich nicht folgte, dann blieb sie stehen und atmete tief durch.
Der Duft von frischen Backwaren umfing sie. Auch hier war eine Bäckerei, die kleine Geigen aus Zuckerteig und Paganini-Brot anbot. Ihren Kindern würde sie mit diesem Naschwerk eine große Freude machen, dachte Sophie, ihr Ehemann jedoch hielt wirklich überhaupt nichts von dem Kult um diesen Musiker, der ihm zutiefst suspekt war. Wenn sie mit solchen Devotionalien nach Hause käme, würde sie von ihrem Mann eine Tracht Prügel kassieren.
Allein beim Gedanken an den Schmerz schossen ihr die Tränen in die Augen. Sie blinzelte sie weg und beschloss, den Umweg über die Blutgasse zu nehmen, an deren Ende sie auf die Gasse stieß, in der ihr Zuhause lag. Der Abzweig in die Domgasse, in der das aschgrau gestrichene Haus lag, in dem Mozart vor rund vierzig Jahren für kurze Zeit gelebt hatte, verschwand hinter einem wässrigen Schleier. In der schmalen Gasse kam ihr niemand entgegen, niemand sah die Tränen, die auf ihren Wangen mit den Schneeflocken verschmolzen.
Auch Anna Röhberg schien nichts zu merken. Die fünfundfünfzigjährige, kinderlose Nachbarin kam ausgerechnet in diesem Moment aus der Haustür und grüßte freudig.
»Sophie, wie schön, dich zu sehen! Da wohnt man sich gegenüber und begegnet sich kaum. Wie geht es dir? Ich muss noch zum Metzger. Du warst ja schon einkaufen, wie ich sehe«, sagte sie. Frau Röhberg war klein und wirkte immer gut gelaunt. Sie war mit einem Schuster verheiratet, der genau so klein und ebenso nett war. Er hatte schon oft die Schuhe der Kinder ausgebessert und kein Geld dafür annehmen wollen. Stattdessen hatte er stets um einen Apfelstrudel mit Vanillesoße gebeten, den seiner Meinung nach keiner so köstlich zubereiten konnte wie Sophie. Das gab auch Anna Röhberg neidlos zu, die von sich selbst behauptete, zwei linke Hände für Mehlspeisen zu haben, obwohl sie in Wien geboren war – und mit diesem neuartigen Strudelteig stand sie erst recht auf Kriegsfuß.
Entdeckt hatte Sophie das Rezept in dem Universalkochbuch von Anna Dorn, das im vergangenen Jahr Furore gemacht und schnell in sämtlichen Wiener Haushalten Einzug gehalten hatte, da Anna Dorn das erklärte Ziel verfolgte, möglichst günstig zu kochen – sei es schmackhafte Hausmannskost oder für die feine Tafel.
»Ja, ich habe ein paar Besorgungen gemacht«, gab Sophie mit freundlicher Zurückhaltung Auskunft. Ihr war gerade einfach nicht danach, mit irgendjemandem zu reden.
»Unangenehmes Wetter für März, nicht wahr? Wie geht es der Familie?«
»Sehr gut, vielen Dank! Ich erzähle dir ein andermal mehr, ich muss jetzt dringend rein.«
»Die Hausarbeit erledigt sich nicht von selbst, das kenne ich.« Anna Röhberg lächelte und zeigte dabei ihre beneidenswert weißen Zähne. »Hast du nicht Lust, heute Abend mit deinem Mann und den Kindern zu uns zum Abendessen zu kommen? Es gibt Rouladen! Und angesichts dieser trostlosen, nicht enden wollenden Wintertage würde uns allen doch ein bisschen Unterhaltung ganz guttun. Die Männer könnten über das Weltgeschehen debattieren, wir würden es uns mit unseren Stickereien am Feuer bequem machen, und für deine Zwillinge finden wir sicher ein schönes Spiel!«
»Heute Abend? Wirklich sehr gerne, aber meine Kinder müssen wegen einer Magenverstimmung das Bett hüten, und da möchte ich sie nicht allein lassen.«
Anna machte ein betroffenes Gesicht. »Hoffentlich nichts Ernstes?«
»Nein, nein. Es geht ihnen schon wieder besser, aber für einen Besuch sind wir noch nicht aufgestellt.«
»Ja, dann gib doch Bescheid, wenn es den Kindern wieder gut geht, meine Einladung steht. Wir haben schon so lange keinen geselligen Abend mehr miteinander verbracht – das war immer sehr nett.«
»Ja, das stimmt«, entgegnete Sophie. Sie rang sich ein Lächeln ab und kämpfte mit einem schweren Schlucken gegen den Kloß in ihrem Hals an, damit ihre Stimme keinen traurigen Unterton bekam. »Vielen Dank für deine Einladung. Ich werde mich melden.«
»Und wenn ich sonst irgendwas tun kann …«
»Nicht notwendig«, entgegnete Sophie viel harscher, als sie gewollt hatte.
Anna stutzte und blickte enttäuscht drein.
»Ich werde gern auf dein Angebot zurückkommen, falls ich Hilfe benötige«, schob Sophie nach, weil ihr nichts ferner lag, als die liebe Nachbarin zu brüskieren.
»Dann bin ich ja beruhigt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.«
»Danke, den wünsche ich dir auch.«
Schnell kehrte Sophie ihr den Rücken, damit Anna die wieder aufsteigenden Tränen nicht sah und schloss mit fahrigen Bewegungen die Haustür auf, dann zögerte sie.
Nein, sie zögerte nicht, sie zauderte.
Es ist dein Zuhause, redete sie sich gut zu, und dann setzte sie den Fuß über die Schwelle.
Kapitel 2
Sophie hängte den Umhang neben die Tür, tauschte die nassen Stiefeletten gegen ihre gefilzten Hausschuhe, durchquerte den Flur und vermied es dabei, auf jene Dielenbretter zu treten, die knarrten.
Sie hielt kurz inne und warf einen prüfenden Blick die Treppe hinauf. Im oberen Stockwerk war es ruhig.
So leise wie möglich stellte sie den Marktkorb in der Küche ab, fast geräuschlos räumte sie die Waren auf und begab sich anschließend in die Werkstatt, die auf der anderen Seite des Flurs gegenüber der Küche lag. Dort würde sie ihren Eheherrn mit Sicherheit nicht antreffen.
Sie lenkte ihre Schritte zur Werkbank, die an einem der beiden Fenster zum Innenhof stand, weil dort das meiste Licht einfiel. Dennoch dachte Sophie täglich darüber nach, die Werkbank umzustellen, denn nichts war so schlimm wie das Gefühl der Angst, die ihr jedes Mal den Rücken hinaufkroch, wenn ihr Eheherr unvermittelt hinter ihr stand, weil sie sein Kommen in ihrer Konzentration nicht gehört hatte.
Die Feilen, Sägen, Schnitzmesser und Stechbeitel an der Wand schrien förmlich danach, benutzt zu werden, doch sie fühlte sich wie gelähmt. Zu viele Gedanken gingen ihr durch den Kopf.
Aufträge gab es wahrlich genug, das war gegenüber ihrer Schwägerin nicht gelogen gewesen: An dem Seil, das über die gesamte Länge des Raumes vor den beiden Fenstern zum Innenhof gespannt war, hingen fünf Geigen zur Reparatur. Das Wintersonnenlicht spielte mit den Farben der Lackierungen und entlockte ihnen einen Hauch von Orange und schimmernden Rottönen.
Zudem wartete da noch der halbfertige Bau eines neuen Instruments für den Musiker Johann Strauss. Noch war es ohne Lackierung, eine sogenannte weiße Geige.
Die Schutzlosigkeit, die ein solches Instrument ausstrahlte, löste in Sophie stets den Wunsch aus, diesen Zustand so schnell wie möglich zu ändern, nur leider war sie mit den anderen Aufträgen bereits drei Wochen im Verzug.
Zu ihrem Glück hatte Strauss es nicht unbedingt eilig, er war der Meinung, dass gut Ding Weile brauchte, und hatte lediglich um Lieferung des fertigen Instruments in die Rofranogasse gebeten, da er als aufstrebender Musiker zu beschäftigt sei, um es selbst abzuholen. Zu viele Auftritte rund um Wien mit seinem eigenen Orchester, für das er im vergangenen Jahr die Verantwortung übernommen hatte. Noch dazu zwei kleine Kinder im Haus, so dass seine Frau ebenfalls keine Zeit habe. Dafür habe Sophie ja sicher Verständnis, und eine Lieferung sollte schließlich kein Problem sein.
Sophie seufzte. Sie hoffte, dass der Nachmittag ausnahmsweise ohne Zwischenfälle verlaufen würde. Immerhin hatte es vergangene Woche ein paar glückliche Stunden gegeben, und es überkam sie das dringende Bedürfnis, diese Geige, an der sie seit drei Monaten arbeitete, zu vollenden: die Schnecke ausstechen, die Wirbel einpassen, das Griffbrett herstellen, den Saitenhalter und den Steg schnitzen und anpassen, die Stimme setzen – doch das war einfacher gesagt als getan. All diese Schritte würden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Wenn es nach ihrem Eheherrn ginge, bis vor einem Jahr selbst ein hochgeschätzter Meister seines Fachs, sollte sie für den Neubau einer Geige nicht länger als drei Monate benötigen. Es seien ja schließlich nur rund fünfhundert Arbeitsschritte bis zum fertigen Instrument.
Ihre zaghaften Rechtfertigungsversuche, er selbst sei der Grund für die Verzögerungen, schmetterte er stets mit einer Handbewegung ab. Mit einer Handbewegung, die auf ihre Wange zielte.
»Wo warst du?«
Sophie zuckte zusammen. Sie war so in Gedanken versunken gewesen, dass sie seine Schritte nicht gehört hatte. Mal wieder.
Aus dem Augenwinkel beobachtete sie ihren Mann, wie er sich rechts und links am Türrahmen festhielt. Sie verfluchte sich dafür, so unaufmerksam gewesen zu sein.
Paul trug seinen weiten, gürtellosen Morgenmantel. Schwankend suchten seine schmutzigen, nackten Füße das Gleichgewicht, sein helles Hemd spannte ihm über dem dicken Bauch, und die Hauskappe saß schief auf seinen strähnigen, dunklen Haaren. Sie musste ihm nicht ins Gesicht sehen, um zu wissen, dass es rot angelaufen war.
So stand er vor ihr, jener vierzigjährige Mann, der einst schlank und gepflegt gewesen war und sich zu den besten Geigenbauern Wiens hatte zählen können.
»Ich hab dich was gefragt, Sophie.« Undeutlich holperten die Worte über seine Lippen.
»Entschuldige.« Sie wandte sich von ihm ab, studierte die Beschriftungen der dicht nebeneinanderstehenden Flaschen und Tiegel im Eckregal. »Leinöl« und »Weingeist« waren kaum mehr zu entziffern, und plötzlich erschien ihr nichts dringlicher, als die Aufkleber zu erneuern.
»Du wars lang weg«, nuschelte er.
»Es tut mir leid, die Straßen sind glatt, ich musste langsam gehen.«
Ihr Eheherr bemühte sich, deutlicher zu sprechen. »Deine Arbeit erledigt sich nicht … nicht von selbst, während du … während du spassieren gehst. Die Aufträge hier dulden keinen Aufschub.«
»Du …«, setzte sie zu einer Widerrede an, dann kniff sie die Lippen zusammen und knetete ihre Finger im Schoß.
»Was wolltest du sagen, meine Liebste?«
Hinter ihrem Rücken hörte sie seine Schritte näher kommen. »Nichts, gar nichts«, beeilte sie sich zu versichern.
»Du wills nich mit mir reden?« Er blieb nahe hinter ihr stehen, und kurz darauf spürte sie seine raue Hand an ihrer Wange. »Hab ich dir jemals was getan? Du bis doch mein Ein und Alles.«
Vorsichtig, jede ruckartige Bewegung vermeidend, drehte Sophie den Kopf zur Seite, um seiner Berührung auszuweichen. Ihre Wange brannte in Erinnerung an das letzte Mal, als er zugeschlagen hatte, alles in ihrem Inneren schrie nach Flucht.
»Was is? Haste es nich nötich, mit deinem Eheherrn zu reden? Binnich für dich eine Last? Nichts mehr wert? Nur noch Dreck?«
Sie wollte antworten, doch es war, als drücke ihr jemand die Kehle zu.
Paul packte sie an der Schulter, drehte sie grob zu sich herum und drückte ihr Kinn nach oben, so dass sie ihren Kopf in den Nacken legen musste. Fast war es eine zärtliche Geste, so als wolle er ihr einen Kuss geben, doch der Druck seiner Finger verstärkte sich, als er weitersprach: »Isses das, ja? Denkst du das? Bin ich ein Säufer, der in der Gosse verrecken soll, lieber heute als morgen? Denkst du das?«
»Nein«, presste sie hervor und machte sich auf dem Hocker klein. Sein fester Griff zwang ihren Kopf in eine schmerzhafte Position, es fühlte sich an, als hinge sie am Galgen.
»Nein?«, fragte er.
Mit geschlossenen Augen versuchte sie, den Kopf zu schütteln.
Abrupt ließ er sie los. »Gut, dann will ich dich nich länger stören.«
Kurz darauf hörte sie seine schweren Schritte auf der Treppe, und noch während sie sich, mit einer Hand den Nacken reibend, zur Werkbank umdrehte, fiel die Kammertür im oberen Stockwerk mit einem Knall zu.
Sophie ließ ihren Atem hörbar entweichen, sie versuchte den Schmerz in ihrer Seele zu verdrängen. Sie musste dankbar dafür sein, dieses Mal so glimpflich davongekommen zu sein.
Der Hass auf ihren Mann war größer als ihre Angst und half ihr, ihren inneren Schutzwall zu verstärken. So leicht würde sie sich nicht unterkriegen lassen.
Ihre Mundwinkel zuckten, wie zu einem Lächeln, als sie sich erhob, um aus dem Eckregal die Zutaten für die Herstellung des Geigenlacks zusammenzusuchen.
Sie ging hin und her und brachte die Behältnisse zur Werkbank: Körnerlack, Kolophonium, Mastix in Tränenform, Gummi Elemi, Campher und Alkohol waren das Geheimnis – ihre eigene Mischung.
Über all die Jahre, in denen sie von ihrem Mann in die Kunst des Geigenbaus eingewiesen worden war – weil sie ihn als Arbeitskraft nichts kostete –, hatte sie diese Mixtur heimlich kreiert, immer wieder am Mengenverhältnis geschraubt, mit dem Ziel, ihren Geigen den perfekten Klang zu entlocken.
Niemand wusste von ihrer Erfindung, auch Paul glaubte, sie halte sich streng an seine Vorgaben. Doch es war ihre Rezeptur, dieses Wissen gehörte ihr allein, es war ihr kleiner, kostbarer Besitz, den sie wie ihre Kinder gegen alles auf der Welt verteidigen würde.
Sie beugte sich über die Werkbank, auf der die Waage stand, legte einen Riegel Körnerlack in die Schale, beobachtete das Pendel und gab noch ein paar Bruchstücke der Masse dazu, die man aus den Zweigen jener im Orient heimischen Bäume gewann, deren Rinde die weibliche Lackschildlaus angestochen und damit zum Ausfließen gebracht hatte.
Das Gewicht pendelte sich bei einhundert Gramm ein. Solange sie ihren Händen etwas zu tun gab, rückten ihre Probleme in die Ferne. So war es auch jetzt, als sie den Körnerlack in die Mörserschale gab und sie beim Zerkleinern gegen den zähen Widerstand des Harzes arbeiten musste.
Schweiß trat ihr auf die Stirn, zwischendurch vergaß sie sogar das Atmen, aber sie gönnte sich erst dann eine Pause, als genügend pulverisierte Substanz entstanden war.
Die anderen beiden Harze, jeweils einhundert Gramm Kolophonium und Mastix-Tränen, ein tropfenförmiges Harz aus der Rinde des begehrten Mastix-Pistazienbaums, ließen sich leichter zerkleinern.
Als sie das Behältnis mit der Aufschrift »Campher« öffnete, schlug ihr ein durchdringender, eukalyptusartiger Geruch entgegen. Die grauweiße Masse fühlte sich fettig an, und das Messer teilte das zähe Stück mit etwas Druck.
Sie gab den zerkleinerten Campher mit den anderen Zutaten in eine leere Literflasche. Auch die sechsundzwanzig Gramm Gummi Elemi, ein fenchelähnlich riechendes, gelbliches Ölbaumharz, schnitt sie in Würfelchen, und zum Abschluss zerstieß sie Marienglas in so kleine Stücke, dass auch diese durch den Flaschenhals passten.
Dann schüttelte sie alles gut durch und füllte die Literflasche zu Dreiviertel mit Weingeist auf.
Erleichtert über den gelungenen, weil ohne Störungen verlaufenen Arbeitsgang, verkorkte sie das Vorratsgefäß und stellte es in das Regal neben dem Ofen, damit die Wärme den Auflösungsprozess beschleunigte und sie in ein oder zwei Tagen mit dem Filtrieren der Flüssigkeit beginnen konnte.
Da vernahm Sophie Schritte. Wie angewurzelt blieb sie stehen.
Nicht schon wieder, dachte sie. Paul geht sicher nur in die Küche, auf der Suche nach Alkohol, er kommt nicht noch einmal in die Werkstatt, redete sie sich ein.
Zu keiner Bewegung fähig wartete sie ab.
Nach einer Weile hörte sie wieder Schritte auf der Treppe, danach wurde es still. Ihre Anspannung ließ nur langsam nach, dennoch lenkte sie ihre Konzentration auf das, was sie als Nächstes zu tun hatte: Sie musste die Farbe für den Lack anrühren.
Mit dem Mörser zerkleinerte sie das in Stangen gelieferte Drachenblut, ein ziemlich phantasievoller Name für den aus molukkischen Palmen gewonnenen Farbstoff, und goss das dunkelrote Pulver in einer zweiten Flasche mit Weingeist auf.
Als sie erneut Schritte hörte, blieb ihr keine Gelegenheit zu reagieren.
»Störe ich?« Paul lächelte, seine blauen Knopfaugen betrachteten sie ruhig und zugewandt. Er mühte sich um Versöhnung.
In dieses Lächeln hatte sie sich vor fünfzehn Jahren verliebt, doch seither war viel passiert. Zu viel.
»Was woll… wolltest du vorhin sagen, Sophie?«
Diese Art Gespräch war gefährlich, wenn er getrunken hatte, das wusste sie. Aber da er sie schon fragte – wenn er sich ein Mal für ihre Belange interessierte, war jetzt vielleicht doch der richtige Moment.
»Paul, ich schaffe das alles nicht mehr allein«, sagte sie schnell, ehe der Mut sie wieder verließ.
»Das mag sein. Aber ein Gesell… ein Geselle kommt nich infrage. Dann mach meine… meinet… meinetwegen eine Pause.«
»Dann bleibt die Arbeit liegen. Das Auftragsbuch quillt über …«
»Aber dir … geht esnich gut, das sehe ich doch.«
»Das siehst du?«, fragte sie bass erstaunt.
»Ja, natürlich. Du biss blass. Hast dunkle Ringe unter deinen wunner… hübschen braunen Augen. Und du biss dünn geworden.«
Sophie wollte etwas sagen, er ließ sie jedoch nicht zu Wort kommen.
»Wenn du so weitermachst, sind deine wun… deine wunderbaren Kurven bald verschwunden, für die ich dich immer so geliebt hab. Du pflegst dich nicht mehr, deine Haare sind uno… unordentlich hochgesteckt. Wann hast du sie suletzt gewaschen? Du weißt, wie sehr mir der gollne Schimmer in deinen dunkelblonnen Haaren immer gefallen hat.«
Die Tränen blieben ihr als Kloß im Hals stecken. Was fiel ihm ein, ihr Aussehen zu bemängeln? Bei dem Anblick, den er abgab?
»Paul … ich …«
»Was ist los? Traust du dich nich, mit mir zu reden? Sprich! Stotter nich so rum!«
»Ich … es ist nur … ich möchte dich bitten, mir zu helfen … in der Werkstatt. So wie früher …« Sophie zog unwillkürlich den Kopf ein. »Ich kann nicht mehr.«
»Du wills aufgeben?«
Sophie presste die Lippen aufeinander. Tränen traten ihr in die Augen. Keinesfalls durfte sie ihm Vorwürfe wegen seiner Trunkenheit machen.
»Sophie? Du willsdoch nich etwa aufgeben? Unsere Familie? Alles aufgeben?«
Er ahnte also, was in ihr vorging. Und tatsächlich würde sie am liebsten aufgeben – aber das war keine Lösung.
»Nein, ich will nicht aufgeben. Aber ich bitte dich inständig darum, weniger zu trinken und mich zu unterstützen.«
»Unnerstützen? Bekommst du nicht jede Woche dein Marktgeld von mir? Mehr als genug? Was verlannst du denn noch? Mit meinen zitternden Händen kannich nich mehr arbeiten, das weißt du genau. Und du weißt, wassdu vor Gott versprochen hast. In guten wie in schlechten Zeiten. Das hast du versprochen! Versprochen! Bisass der Tod uns scheidet, jawohl! Aber wenn du nich mehr willst, bitte: Die Tür ist offen. Du kannst jederseit gehen.«
Wohin denn?, wollte Sophie schreien. Wohin?
»Ich halte dich nich auf.« Mitten im Satz machte er kehrt. »Die Ennscheidung liegt bei dir.«
Sophie blieb fassungslos zurück. Sie ließ sich auf den Hocker fallen und starrte die Tür an, durch die ihr Eheherr verschwunden war.
Steh auf, befahl sie sich selbst. Steh auf und geh, jetzt ist deine Gelegenheit. Er lässt dich gehen.
Nein. Es war nur ein Spiel. Er hatte wieder gewonnen. In diesem Spiel würde er immer der Sieger sein, denn es war ihr unmöglich, sich von ihm zu trennen.
Hier, in diesem Haus, hatten die Kinder einen Vater und ein Dach über dem Kopf, hier lebte der Mann, dem sie Treue bis in den Tod gelobt hatte, und an dieses Versprechen würde ihr Eheherr sie erinnern – selbst wenn er sie dafür bis ans Ende der Welt verfolgen lassen müsste.
Schließlich existierte er nur noch durch sie. Er arbeitete mit ihren Händen, dachte mit ihrem Kopf und ging mit ihren Beinen. Mit jedem Schritt, den sie tat, saugte er die Kraft aus ihr heraus, was sie erschreckend gleichgültig hinnahm.
Ihr war ohnehin kein langes Leben auf Erden vergönnt, in diesem festen Glauben lebte sie seit ihrer Kindheit – warum auch immer. Vielleicht, weil sie als Kind so oft krank gewesen war, oder weil ihre Eltern so früh gestorben waren und sie bei ihrer Tante in der Josefstadt aufgewachsen war, die ihr ständig gesagt hatte, dass sie es im Leben zu nichts bringen werde.
Vor fünfzehn Jahren hatte sie beim Schlittschuhlaufen auf der Donau Paul kennengelernt. Er hatte ihr nach einem Sturz aufgeholfen, sie hatte sich Hals über Kopf in ihn verliebt, und an diesem Tag war das Glück in ihr Leben eingezogen. Ein Glück, von dem sie immer geglaubt hatte, dass es ihr nicht zustünde – und tatsächlich war das ja auch so, denn seit rund einem Jahr lebte sie in der Hölle.
Tagaus, tagein hoffte sie auf Gottes milden Ratschluss, dass er ihren Eheherrn zu sich rufen und der Tod sie endlich scheiden würde. An Flucht, mitten in der Nacht, während ihr Ehemann seinen Rausch ausschlief, hatte sie dennoch schon oft gedacht.
Es war bei dem Gedanken daran geblieben.
Unterdessen hörte sie, wie die Kinder von der Schule heimkehrten und im Flur auf ihren Vater trafen. Vor ihrem geistigen Auge sah sie ihre Zwillinge erschrocken innehalten.
Besser, sie ging nicht dazwischen. Es würde sich alles von selbst regeln. Den Kindern hatte er noch nie Gewalt angetan.
Tatsächlich kamen ihre Zwillinge kurz darauf in die Werkstatt, und sie hörte ihren Eheherrn über die Treppe zurück ins obere Stockwerk poltern.
Katerina gab sich betont fröhlich, wohingegen Kristian mit den Tränen kämpfte.
Es schnürte ihr die Kehle zu, als sie in die grünbraunen Augen ihres Sohnes sah, denn es war wie ein Blick in den Spiegel. Beide Kinder sahen ihr sehr ähnlich, nicht nur ihre schmalen Gesichter, auch die runde Augenform, die dichten Wimpern, die schlanken Nasen und die weichen, leicht aufgeworfenen Lippen waren wie bei ihr ausgeprägt. Nur ihre dunklen, fast schwarzen Haare hatten die Kinder vom Vater geerbt.
Sophie nahm die beiden wortlos in die Arme. Ihre Tochter machte sich steif, während ihr Sohn sich der Umarmung hingab und gar nicht mehr loslassen wollte.
»Nun, Kinder, erzählt, wie war es in der Schule? Habt ihr allein gearbeitet oder wieder voneinander abgeschrieben?« Natürlich war es ein liebevoller Tadel. Die Zwillinge konnten ohnehin nicht mehr lange im Klassenzimmer nebeneinandersitzen, da Katerina in eineinhalb Jahren in einem Haushalt in Stellung gehen würde. Kristian hingegen sollte eine Lehre im Geigenbau beginnen, durch verschiedene Meisterwerkstätten ziehen, um später die Werkstatt seines Vaters zu übernehmen.
Nur zu gut wusste Sophie, wie unwohl sich Katerina mit der ihr zugedachten Rolle fühlte, denn auch ihre Tochter wollte die Welt bereisen und alles über die Kunst des Geigenbaus lernen. Vor allem aber wollte sie niemals heiraten und lieber allein leben. Aber so war das eben leider als Frau. Es war gesellschaftlich nicht vorgesehen, dass man seinen Träumen folgte, da bedeuteten Haus, Hof und gesunde Kinder das große Glück. Und das war ja auch richtig so. Doch es gab noch mehr auf der Welt, was glücklich machte.
»Jeder hat für sich gearbeitet, Frau Mutter, und wir haben nur Hausaufgaben in Geographie«, sagte Kristian leise.
Im oberen Stockwerk polterte es erneut, und ein Fluchen erklang.
»Habt ihr Hunger?«, fragte Sophie, um Ablenkung bemüht.
Erwartungsgemäß kam ein einstimmiges »Ja, Frau Mutter« von den Kindern, und Katerina fügte mit ebenso leiser Stimme wie ihr Bruder hinzu: »Dürfen wir vielleicht eine süße Mehlspeise haben?«
»Morgen gibt es Apfelstrudel, den Teig muss ich erst noch vorbereiten, aber was haltet ihr jetzt von Eierkuchen mit Vanillesoße?«
Die Kinder machten Luftsprünge, vermieden es jedoch laute, freudige Ausrufe von sich zu geben. Sie waren es so gewohnt.
Es war schön, ihre Kinder lachen zu sehen.
»Was haltet ihr davon, wenn wir morgen Nachmittag zum Prater gehen?«, fügte sie hinzu.
»In den Vergnügungspark?« Kristian machte große Augen.
»Dürfen wir dort Karussell fahren?«, fragte Katerina.
Sophie lächelte. »Wenn ihr euch dafür noch nicht zu alt fühlt, gebe ich gern ein paar Groschen aus. Aber die Optica Nova und die mechanischen Vögel sind ja auch spannend. Und wenn es weiter so schneit, nehmen wir den Schlitten mit.«
»Danke, Frau Mutter«, rief Katerina, die sich nun doch zu einer Umarmung hinreißen ließ.
»Sie sind die Beste!«, fügte Kristian hinzu und umarmte sie noch einmal.
»Ihr erdrückt mich ja«, rief Sophie und lachte verhalten. Wann hatte sie überhaupt zuletzt laut gelacht, fragte sie sich. Es war höchste Zeit, das nachzuholen, und morgen war die Gelegenheit dazu.
Arbeit hin oder her – sie durfte nicht zulassen, dass ihr Leben nur noch aus Angst und Wehmut bestand. Dagegen musste sie etwas unternehmen. Und morgen wollte sie den ersten Schritt tun. Einen großen, einen sehr großen Schritt, aber sie war wild entschlossen, ihn zu gehen.
Jetzt jedoch rief die Pflicht. »Während ich die Eierkuchen mache, sorgt ihr bitte in der Werkstatt ein bisschen für Ordnung, ja?«