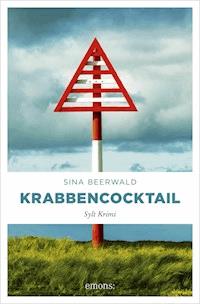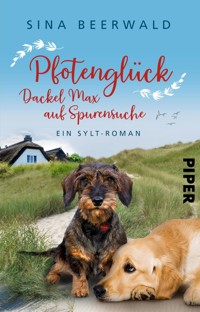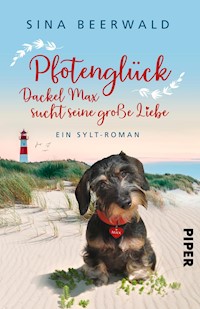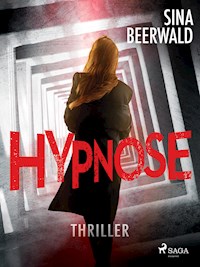Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Stuttgart Thriller
- Sprache: Deutsch
Es ist einer der heißesten Tage des Jahres, als die Stuttgarter Journalistin Tessa Steinwart eine Leiche am Ufer des Neckars findet. Ein junges Mädchen, nackt in ein weißes Bettlaken gehüllt, mit Rosenblättern bedeckt und mit Zeichen eines jahrelangen Martyriums. Niemand scheint sie zu kennen, niemand zu vermissen. Kurz darauf geraten Tessa und ihr kleiner Sohn ins Visier des Mörders. Er scheint alles über sie zu wissen – und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder zuschlagen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sina Beerwald, 1977 in Stuttgart geboren, wanderte vor acht Jahren mit zwei Koffern und vielen kriminellen Ideen im Gepäck auf die Insel Sylt aus und lebt dort seither als freie Autorin. Seitdem sind neun erfolgreiche Romane und der Erlebnisführer »111Orte auf Sylt, die man gesehen haben muss« erschienen. Sie ist Preisträgerin des NordMordAward und des Samiel Award.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Ein Projekt der AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur.
©2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: shutterstock.com/GongTo Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-084-3 Stuttgart Thriller Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Lauris
I think to myself I’m the sad clown…smiling reluctantly…but crying behind the iron curtain.
Draconian– »The empty stare«
»So ist das Leben«, sagte der Clown mit Tränen in den Augen und malte sich ein Lächeln ins Gesicht.
Verfasser unbekannt
Prolog
Es war ein Versehen. Du solltest nicht sterben, ehrlich.
Du warst ein so liebes und hübsches Mädchen. Große hellblaue Augen und rabenschwarze Haare, ein Strasssteinchen an deinem süßen Näschen– und deine vollen Lippen, die du so lange zu einem Schmollmund verzogen hast, bis ich dir deinen Wunsch erfüllt und das Piercing zu deinem vierzehnten Geburtstag gestochen habe. Jeden Blutstropfen habe ich sorgsam von deiner reinweißen Haut getupft, jeden Tag habe ich die Stelle, die sich entzündet hatte, mit Salbe behandelt. Mein kleines Schneewittchen.
So habe ich dich immer genannt.
Heute hättest du wieder Geburtstag gehabt. Zärtlich berühre ich ein letztes Mal deine Wange. Im Vollmondlicht wirkt dein bleiches Gesicht gespenstisch. Gespenstisch schön. Es sieht so aus, als würdest du schlafen.
Du warst ein Kind der Nacht und glücklich, wenn du den Vollmond sehen konntest. Ich weiß nicht, ob deine Augen das grelle Tageslicht überhaupt vertragen hätten. Die Sonnenstrahlen sind nicht gut für dich, habe ich dir immer gesagt, sie können dir regelrecht gefährlich werden.
Du hast mir geglaubt.
Krankheiten hast du, mein zerbrechliches Schneewittchen, so einige gehabt in deinem viel zu kurzen Leben. Und wenn ich dich getröstet habe, dann hast du gelächelt.
Du warst meine Sonne, du hast mir jeden meiner Tage erhellt.
Wie ein Baby liegst du zusammengekauert im Koffer vor mir, deine schlanken Beinchen eng an den Körper gepresst. Ich habe ein Laken um deinen dünnen Körper gewickelt und ihn mit Seilen zu einem festen Bündel verschnürt. Ein richtiges Fliegengewicht bist du, bringst nur sechsundzwanzig Kilo auf die Waage. Ich habe dir immer gesagt, dass du mehr essen musst, aber du hattest einen leicht reizbaren Magen. Immer wieder habe ich dich aufgepäppelt, du bekamst alles von mir zu essen, was du dir nur gewünscht hast, ist es nicht so?
Dein eigenes kleines Reich habe ich dir eingerichtet, mit allem, was sich ein Mädchen in deinem Alter nur wünschen kann. Du hattest einen Fernseher, die neueste Musik auf deinem iPod, jede Menge Bücher und einen Laptop, auf dem du Spiele machen konntest. Du hattest sogar ein eigenes Bad in deinem Zimmer. Internet oder ein Handy hattest du keines, aber es gab ja auch keine Freunde, mit denen du hättest chatten oder telefonieren können. Die brauchtest du schließlich nicht. Du hattest ja mich.
Und ich hatte dich. Doch nun hast du mich verlassen. Dein Herz hat einfach aufgehört zu schlagen. Das habe ich nicht gewollt, ehrlich. Du warst oft krank, du hattest viele Schmerzen, aber ich habe mich immer um dich gekümmert und deine Wunden versorgt, nicht wahr?
Ich beobachte die Strömung des Flusses, die schillernden Reflexionen des Mondlichts auf den sanften Wellen. Der Neckar fließt durch ein Betonbett mit hohen Ufermauern und macht kurz hinter der überdachten Holzbrücke einen sanften Bogen. Dort hinein schmiegt sich der Stadtstrand von Bad Cannstatt, wo in diesen warmen Augustnächten bis weit nach Mitternacht gefeiert wird.
Jetzt ist es still dort, zu mir dringt bis auf wenige Motorengeräusche von der ufernahen Bundesstraße her kein anderer Laut. Um diese Uhrzeit verirrt sich selten eine Person in diese Gegend zwischen dem Zoo und dem Stadtstrand.
Oft bin ich mit dir, mein Schneewittchen, in einer Vollmondnacht hierhergekommen. Das hat dir immer gefallen. Du wolltest etwas sehen von der Welt, und niemand sollte behaupten können, ich sei ein Unmensch, weil ich dich eingesperrt habe. Ich wollte dich nur vor jeder Gefahr bewahren.
Wir haben Papierboote gefaltet und aufs Wasser gesetzt, wir standen auf der Brücke, und ich habe dir die Sternbilder gezeigt und dir erklärt, wie die Schleuse funktioniert, die nur einen Steinwurf entfernt ist. Einmal ist uns dabei tatsächlich ein Mann begegnet, erinnerst du dich? Der hat irritiert geschaut, bis ich ihm erklärt habe, es sei dein größter Wunsch gewesen, als Gespenst verkleidet eine Nachtwanderung zu machen. Da hat er gelacht und uns noch viel Spaß gewünscht. Und den hatten wir. Du hattest kein schlechtes Leben, nicht wahr?
Nun ist es so weit. Ich muss mich für immer von dir verabschieden. Warum hast du mich verlassen? Davongeschlichen aus meinem Leben. Ohne Vorwarnung. Einfach so. Viel zu früh. Ich wollte bei dir sein, aber du bist gegangen, für immer. Du hast es nicht einmal für nötig gehalten, dich von mir zu verabschieden. Hast mich einfach zurückgelassen.
Wut und Trauer verbinden sich in meinem Inneren zu einem explosiven Gemisch, ich möchte schreien und kann es doch nicht.
Ich muss still sein.
Fassungslos bin ich über deinen Verrat, vor mir diese Welt zu verlassen. Du warst jung, fast noch ein Kind. Du solltest eines Tages mich zu Grabe tragen. Das war der Plan.
Ich hasse es, wenn die Dinge nicht nach Plan verlaufen. Zum zweiten Mal in meinem Leben. Fast fünfzehn Jahre lang hatte ich mich im Griff, und ich dachte, ich hätte meinen Frieden durch dich gefunden.
Ich binde dich an dem Sonnenschirmständer fest, den ich von zu Hause mitgenommen habe, lege dich als Bündel nahe an den betonierten Uferrand und schaue dir noch einmal ins Gesicht.
Du bist so rein, so unschuldig, mein behütetes Mädchen. Du warst mein Leben.
Ich hauche dir einen letzten Kuss auf die Wange, dann atme ich tief durch, schließe meine Hand um den jetzt gefüllten Plastik-Schirmständer und werfe ihn in die Tiefe. Dein Körper wird hinterhergezogen.
Als weißes Bündel treibst du auf der Wasseroberfläche, es sind nur wenige Sekunden, aber ich dachte, der Schirmständer würde dich gleich unter Wasser ziehen.
Mein Schneewittchen.
Es sind Sekunden eines Abschieds, die ich so nicht geplant habe.
Ich hasse dich. Ich liebe dich.
Eine Träne rollt aus meinem Augenwinkel. Ein fremdes Gefühl auf meiner Haut. Wie lange habe ich schon nicht mehr geweint? Es ist über fünfzehn Jahre her.
Deine Leiche wird man bald finden, denn idiotensicherer kann man die Stelle nicht auswählen. Entweder verfängt sich dein Körper in der Schleuse oder an der nahen Anlegestelle der Ausflugsschiffe, die weit in den Fluss hineinragt.
Mich jedoch wird die Kripo nicht aufspüren. Und sie werden auch nicht herausfinden, wer du bist, mein Schneewittchen. Diese Aufgabe wird zu schwierig für sie sein, sie werden auf ewig rätseln.
So will ich es. Denn: Strafe muss sein.
Wie ein Phantom werde ich jeden ihrer Ermittlungsschritte begleiten. Ich werde ihnen ganz nah sein, und trotzdem werden sie mich nicht sehen. Weil sie nicht sehen können, was sie nicht sehen wollen.
Dieses Mal wird mir ihre Blindheit eine Genugtuung sein. Dieses Mal wird sie mein Vorteil sein.
Sie werden nach einem Irren suchen, einem Psychopathen. Aber ich bin nicht krank. Ich nicht. Ich bin ganz normal. Vielleicht zu normal.
Als ich den Blick vom Fluss abwende, den leeren Koffer mit den bunten Aufklebern hinter mir herziehe und die Schönestraße entlang zurück zu meinem Auto gehe, weiß ich eines ganz genau.
1
Die WhatsApp traf genau in dem Augenblick ein, als Tessa nach ihrem langen Arbeitstag den Eingang des Zoos erreichte.
Wir sind noch bei den Seehunden, Julian kann sich nicht losreißen.
Kein Problem, schrieb Tessa zurück und rief sich dabei den Lageplan der Stuttgarter Wilhelma vor Augen. Vom Seehundbecken bis zum Ausgang hatte ihr dreijähriger Sohn mit seiner Tagesoma noch ein gutes Wegstück vor sich, und so, wie sie die beiden kannte, würde Julian den Zoo nicht ohne ein Eis verlassen. Gut eine halbe Stunde musste sie also bestimmt noch warten. Bin am Stadtstrand, setzte sie hinzu und schickte die Nachricht ab.
Die achthundert Quadratmeter Mittelmeerfeeling direkt am Neckar verschafften ihr das Gefühl, eine halbe Stunde so etwas wie Urlaub zu haben. Seit sie alleinerziehend war, hatte sie gelernt, die kurzen Pausen, die sie wirklich für sich allein hatte, umso mehr zu genießen. Sie brauchte nur daran zu denken, sich in einem der bereitgestellten Liegestühle niederzulassen, schon entspannte sich ihr Körper. Nach dem alltäglichen Wahnsinn im Newsroom der »Stuttgart aktuell« war das auch dringend notwendig.
Jetzt steckten ihre von der Wärme angeschwollenen Füße noch in schwarzen Pumps, die sie zum dunkelblauen Kostüm trug– Kleidungsvorlieben, die ihre leitende Position mit sich brachte. Am wohlsten fühlte sie sich jedoch in Jeans und flachen Schuhen. Bei der Vorstellung, ihre Zehen gleich in den Sand stecken zu können, kribbelte es an ihren Füßen.
Sie betätigte die Fußgängerampel und überquerte kurz darauf die stark befahrene Straße in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Wilhelma, wo sie gerade ausgestiegen war. Ihr Auto hatte sie auf dem Park-and-ride-Parkplatz außerhalb der Stadt stehen lassen.
Vielleicht konnte sie Julians Tagesoma noch zu einem Getränk einladen, sie wenigstens zu einem Glas Sprudel überreden. So einen genügsamen Menschen wie Frau Rose hatte Tessa in ihrem Leben noch nicht kennengelernt. Sie hatte noch dazu das große Glück, diese alleinstehende fünfundsechzigjährige Dame zur Nachbarin zu haben. Das war für sie beide ein Segen, denn Frau Rose kümmerte sich sehr gern als Ersatzoma um Julian. Sie hatte keine eigenen Kinder und somit auch keine Enkel.
Tessa überquerte die überdachte Holzbrücke und ging dabei absichtlich langsam, weil es im Schatten so angenehm war. Die drückende Hitze im Stuttgarter Kessel, der seinem Namen heute wieder alle Ehre machte, ließ sich am Neckar am besten aushalten. Noch besser bei einem Cocktail. Alkoholfrei, denn sie musste ja noch fahren.
Das Wasserrauschen der nahen Schleuse übertönte die Geräusche der Fahrbahn, und von der Brücke aus hatte sie eine schöne Aussicht auf die Anlegestelle der Neckarschiffe, wo die Leute Schlange standen. Auch drüben am Stadtstrand war einiges los, mit etwas Glück könnte sie jedoch noch einen freien Liegestuhl ergattern.
Als sie dort ankam, wurden tatsächlich zwei Liegestühle in vorderster Reihe zum Uferweg frei, und Tessa ließ sich mit einem wohligen Seufzer in einem davon nieder. Ihr Blick verlor sich auf dem Fluss, dessen Strömungsrichtung aufgrund der nahen Schleuse gar nicht so leicht auszumachen war. Die Wasserstrudel erinnerten sie daran, wie froh sie über die Ruhe war, die Frau Rose in das bisherige Alltags-Chaos gebracht hatte. Denn wo Tessa früher das Gefühl gehabt hatte, an tausend Stellen gleichzeitig sein zu müssen –bei der Arbeit, im Kindergarten, beim Arzt, beim Einkaufen–, da war nun Frau Rose zur Stelle. Und was hätte Tessa nur ohne sie getan, als sie von dieser fiesen Grippe heimgesucht worden war und sich deshalb drei Tage lang nicht um Julian kümmern konnte?
Auch heute war Julian wie jeden Mittag pünktlich von seiner Tagesoma aus dem Kindergarten abgeholt worden, wie immer hatten die beiden etwas Schönes unternommen, aber wehe, Tessa versuchte, sich in irgendeiner Form bei Frau Rose erkenntlich zu zeigen, dann reagierte diese gleich voller Entrüstung mit dem Argument, dass sie als Rentnerin doch ohnehin viel Zeit hätte und dass das alles eine Selbstverständlichkeit sei. Und so hatte sich Tessa an die Hilfsbereitschaft von Frau Rose gewöhnt, auch wenn sie dafür eine bittere Pille schlucken musste: Frau Rose war das wandelnde Klischee einer neugierigen Nachbarin. Neulich hatte sich Tessa ihr gegenüber gerade noch die Bemerkung verkneifen können, sie solle mit ihren Geschichten über die Hochhausgemeinschaft doch eine eigene kleine Zeitung gründen– in puncto Aktualität würde Frau Rose es problemlos mit jeder Nachrichtenagentur aufnehmen. Besser, dachte Tessa, sie hielt ihren Mund, am Ende würde Frau Rose den ironisch gemeinten Ratschlag noch in die Tat umsetzen.
Manchmal wünschte sich Tessa, dass es anstelle von Frau Rose einen neuen Mann in ihrem Leben gäbe. Die Welt um sie herum bestand nur aus Pärchen, so ihr Eindruck. Auch jetzt war wieder einer dieser Momente, in denen sie sich wie aussätzig fühlte. Ringsum verliebte Paare. Eines davon warf ihr auf der Suche nach einer Sitzgelegenheit einen missbilligenden Blick zu, der wohl den Ärger darüber ausdrücken sollte, dass sie sich erdreistete, einen Liegestuhl zu belegen, während der andere direkt neben ihr unbesetzt blieb– denn mit einem allein konnte niemand etwas anfangen.
So wie die Männerwelt offenbar nichts mit ihr anfangen konnte. Als alleinerziehende Mutter, noch dazu voll im Berufsleben stehend, schien sie eine abschreckende Wirkung zu haben. Umgekehrt hatte sie nach einigen Dates, bei denen sie sofort den Impuls verspürt hatte, die Beine in die Hand zu nehmen, die Hoffnung fast schon aufgegeben, dass es Mr.Right irgendwo geben würde.
Fast. Denn da gab es einen, der sie vor vier Wochen über Facebook angeschrieben hatte. Wobei Leander behauptete, sie habe ihm zuerst eine Freundschaftsanfrage geschickt, was aber nicht stimmte. Darüber, dass sich Facebook gern auch mal selbstständig machte, hatte sich ein lustiges Geplänkel entwickelt, das zu einer langen Nacht im Chat und dem Austausch der Telefonnummern geführt hatte.
Es kribbelte ein bisschen, wenn sie an ihn dachte. Aber was bedeutete das schon?
Tessa stellte ihren Liegestuhl in Blickrichtung zur Brücke, über die Frau Rose mit Julian kommen würde, und bestellte einen Cocktail. Einen »Swimmingpool«, alkoholfrei.
Der Kellner war gerade wieder weg, da klingelte ihr Handy.
In der Annahme, dass es Frau Rose sei, war Tessa kurz davor, dranzugehen, dann jedoch sah sie den Namen auf dem Display. Ein Name, der ihr einen regelrechten Stromstoß versetzte.
Philipp.
Lass mich einfach in Ruhe, dachte sie. Nicht jetzt und auch nicht später gehe ich ans Telefon.
Leider gehörte Philipp Steinwart zu jenen Männern, die in einer Beziehung erst dann aufwachten, wenn die Ehefrau ihre Sachen packte und die Scheidung einreichte. Letzteres hatte sie vor eineinhalb Jahren getan.
Schon während des Trennungsjahres hatte Philipp verschiedene Rückeroberungstaktiken ausprobiert. Zuerst versuchte er die Kavalierstour, mit Einladungen zum Essen oder ins Theater, mit all den Dingen, an die er in zwölf Jahren Beziehung nicht gedacht hatte. Als das nicht fruchtete, spielte er den hilflosen Mann und fragte sie wegen aller möglichen und unmöglichen Dinge um Rat. Mittlerweile fühlte sie sich von ihm regelrecht belagert und belästigt.
Sie hatte gedacht, dass sein Verhalten nur so lange andauern würde, bis er das Scheidungspapier vom Gericht in Händen hielt– eine vergebliche Hoffnung. Seine Anrufe hatten in den vergangenen Wochen massiv zugenommen, ebenso sein Auflauern vor den Redaktionsräumen der »Stuttgart aktuell« oder in der Nähe ihrer Hochhauswohnung. Sie war kurz davor, ihn wegen Stalkings anzuzeigen.
Er nannte es Zufall und lachte sie aus, wenn sie Angst zeigte.
Tatsächlich kam sie sich lächerlich vor, denn mit diesem Mann hatte sie schließlich rund ein Drittel ihres Lebens verbracht, er war kein fremder Psycho, den sie nicht einschätzen konnte. Im Grunde kannte sie Philipp in- und auswendig. Aber genau das war das Problem: Sie hatte eine zu genaue Vorstellung davon, wozu er aufgrund ihrer Zurückweisung fähig sein könnte.
Tessa ließ das Handy klingeln. Jedes Gespräch mit ihrem Exmann endete im Streit, auch wenn sie versuchte, vernünftig mit ihm zu reden und ihm seine Grenzen aufzuzeigen. Letztere zu akzeptieren war Philipps Sache nicht. Dieser Wesenszug machte ihn privat und beruflich zu einem siegesgewissen, durchsetzungsstarken und ehrgeizigen Menschen– alles Eigenschaften, für die sie ihn geliebt hatte, die nun allerdings ins gegenteilige Extrem umgeschlagen waren.
Sie nahm ihren Cocktail entgegen, bezahlte und legte das Handy entschlossen zurück in ihre Handtasche, damit sie gar nicht erst in Versuchung käme, sich doch noch mit ihrem Ex auseinanderzusetzen.
Es war müßig. Das sagte ihr der Verstand. Dennoch überfiel sie jedes Mal ein fieses Bauchgrimmen, wenn sie Philipp zurückwies, weil sie wusste, dass er sich nun erst recht etwas ausdenken würde, um sie noch mehr zu schikanieren.
Zeit dafür hatte er seit der Trennung vor nunmehr eineinhalb Jahren reichlich. Seit einigen Wochen war er zudem krankgeschrieben– aufgrund seines Alkoholkonsums, den er inzwischen so wenig im Griff hatte, dass man ihn nicht einmal mehr im Innendienst haben wollte. Eigentlich hatte er zur Kur fahren sollen, aber sie hatte nicht den Eindruck, dass er das in die Tat umgesetzt hatte. Wozu auch? Er hatte mit seiner Schikane gegen sie ja genug anderes zu tun.
Der Verdacht, dass er eine Geliebte haben könnte, war ihr ziemlich spät gekommen. Genauer gesagt erst nach einem Jahr, in dem er bereits sein Doppelleben geführt hatte. Seine Arbeit bei der Wasserschutzpolizei brachte nun mal unregelmäßige Dienstzeiten mit sich, und wenn er hin und wieder nicht erreichbar war oder nicht wie angekündigt zu Hause erschien, war das nicht ungewöhnlich gewesen– der Damenslip, den sie eines Tages in seiner Aktentasche gefunden hatte, hingegen schon. Ein billiger Trick der Geliebten, eine Ehekrise heraufzubeschwören, um Philipp vollkommen für sich haben zu können.
Tessa hatte jedoch nicht in ihrem Sinne reagiert und Philipp umgehend den Laufpass gegeben, sondern das Gespräch mit ihm gesucht. Sie waren übereingekommen, am Fortbestand ihrer Ehe arbeiten zu wollen.
Philipp hatte daraufhin die Fremdbeziehung beendet– das allerdings verwandelte die Geliebte in eine Furie. Sie reagierte mit nächtlichem Telefonterror, lauerte Philipp am Arbeitsplatz auf und folgte ihm schließlich wie ein Schatten. Das Verhalten dieser Frau bewirkte nicht, dass Philipp sich noch mehr von ihr distanzierte. Stattdessen versuchte er, mit ihr zu reden, um sie zur Vernunft zu bringen. So bekam sie ihn an den Wickel und damit auch wieder ins Bett.
An diesem Punkt war Tessa bewusst geworden, dass sie Philipp nicht mehr würde verzeihen können. Das einzig Gute, was ihr aus dieser Zeit geblieben war, war ihr Sohn Julian– für den sich Philipp seit der Trennung nicht mehr interessierte. Als wäre er nie Vater geworden.
Anfänglich war sie an seiner Haltung verzweifelt, aber sie konnte ihn ja nicht zwingen, seinen Sohn zu besuchen, und wenn es sie noch so sehr schmerzte. Philipp wusste das. Manchmal glaubte sie gar, er tat es genau deswegen. Um sie zu verletzen und von seinem Fehltritt abzulenken. »Projektion« nannte man das in der Psychologie, ein einfaches Prinzip der seelischen Entlastung: Er schob ihr die Schuld zu, weil sie sich schließlich von ihm getrennt hatte. Nur deshalb hatte er auch seinen Alkoholkonsum nicht mehr im Griff– weil sie ihm das hochprozentige Zeug ja auch persönlich einflößte, natürlich.
Was zwischen all diesem Mist nun zählte, war einzig und allein, ihrem Sohn eine gute Mutter zu sein. Wobei sie sich an Tagen wie heute kläglich fragte, wie sie das bewerkstelligen konnte, wenn eine andere Frau mit ihrem fast Dreijährigen in den Zoo ging, während sie arbeitete. Arbeiten musste. Und wollte. Damit fingen die Gewissenskonflikte an und mündeten nicht selten in Erschöpfungszuständen, wenn ihr alles über den Kopf wuchs.
Dennoch wäre sie nicht sie selbst gewesen, wenn sie sich nach einem Moment der Schwäche nicht doch jedes Mal wieder aufs Neue mit gesammelten Kräften den Problemen gestellt hätte.
An der Vergangenheit konnte sie nichts ändern, und sie war ohnehin ein Mensch, der im Hier und Jetzt lebte– wenn auch nicht frei von Zukunftsängsten. Aber wer hatte die heute nicht? Wegen Julian hatte sie sich entschlossen, ihre Selbstständigkeit als Journalistin aufzugeben, und sie konnte von Glück sagen, dass ihr ehemaliger Auftraggeber Werkmann sie ohne zu zögern als Ressortleiterin für Seite eins und zwei bei der »Stuttgart aktuell« fest eingestellt hatte.
Sie schloss die Augen, lauschte dem Rauschen des Wassers und wäre mit dem Glas in der Hand fast eingenickt, als sie auf einmal eine Stimme neben sich hörte.
»Da sind wir.«
»Mama«, rief Julian im selben Augenblick. Er kletterte ungestüm auf ihren Schoß, sodass sie gerade noch ihr Cocktailglas in Sicherheit bringen konnte, breitete seine Ärmchen aus und drückte ihr einen Kuss auf den Mund. Seine blonden, zusätzlich von der Sonne gebleichten Haare schauten vorwitzig unter einem Micky-Maus-Käppi hervor und waren an der Stirn verschwitzt. »Hab dich lieb, Mama. Julian auch lieb, Oma Dose mir Eis dauft, schon geesst!«
»Ein Eis hast du gegessen?«, fragte Tessa mit gespieltem Erstaunen und zwinkerte dabei Frau Rose zu, die durch Julians fehlerhafte Aussprache zu »Oma Dose« geworden war. Trotz seiner knapp drei Jahre war er noch kein sprachlicher Held, und auch die Kinderärztin war der Meinung, dass eine logopädische Behandlung angebracht wäre. Wieder ein Termin in der Woche mehr, zu dem Frau Rose ihren Sohn wie selbstverständlich an ihrer Stelle begleiten würde.
»Julian ist auf dem Rückweg hingefallen. Er hat leider mehr auf den frei laufenden Pfau geachtet, der keine zwei Meter neben uns spazierte, als auf seinen Weg und hat sich das Knie aufgeschlagen.« Während Frau Rose sprach, kam ein leicht böiger Wind auf, doch kein Härchen ihrer weißblonden eingedrehten Locken bewegte sich unter der dicken Taftschicht. Bei ihr hatte alles seine Ordnung, bis in die letzte Haarspitze.
»Ja, aua demacht. Oma Dose hoppala. Da!«
»Oje, ich habe gar kein Pflaster dabei, zeig mal«, sagte Tessa und half ihrem Sohn, die dünne Sommerhose über das Knie zu ziehen.
»Das habe ich schon erledigt«, sagte Frau Rose, und tatsächlich prangte ein tolles Kinderpflaster mit Tiermotiven auf Julians Knie. Nicht allein wegen ihrer selbstlosen und aufopferungsvollen Fürsorglichkeit erinnerte Frau Rose Tessa an Mrs.Doubtfire aus dem gleichnamigen Film mit Robin Williams, sondern auch aufgrund ihrer recht markanten, fast männlichen Gesichtszüge. Und als wollte Frau Rose die Filmfigur tatsächlich nachahmen, trug sie hautfarbene orthopädische Schnürschuhe zu einem braunen, knielangen Rock mit einer vermutlich aus den Sechzigern stammenden senfgelben Bluse, die jedoch beim derzeitigen Retro-Trend schon wieder modern war.
»Sie sind wirklich großartig«, entgegnete Tessa und fühlte sich neben Frau Rose wie eine Rabenmutter, denn sie würde niemals daran denken, Pflaster einzustecken, wenn sie mit ihrem Sohn unterwegs war.
Frau Rose reagierte nicht auf Tessas Lob, sondern schaute zum Ufer hinunter. Jetzt erst bemerkte Tessa die Unruhe um sie herum. Die Blicke der Umstehenden schienen von einem Gegenstand im Wasser wie magnetisch angezogen zu werden.
Etwas, das aussah wie ein Sonnenschirmständer, hatte sich an einem der Bootsanleger verfangen und schlug im Rhythmus der leichten Flusswellen gegen die Plattform. Daneben schwamm ein großer Stoffballen.
Unglaublich, auf welch schamlose Weise die Leute heutzutage ihren Sperrmüll entsorgen, dachte Tessa. Ein Grund zur Aufregung war das trotzdem nicht. Es würde sich schon jemand finden, der hinuntergehen und das Treibgut herausfischen würde.
Ungewöhnlich nur, dass sich gleich so viele darum kümmern wollten und ein Großteil der Leute bereits die schmale Ufertreppe hinunterdrängte, während andere wie elektrisiert dastanden.
Mit den ersten Schreien aus der Menge erkannte auch Tessa, worum es sich bei dem vermeintlichen Sperrmüll tatsächlich handelte: ein menschliches Stoffbündel. Lange schwarze Haare. Ein bleiches Gesicht.
2
Mit geschlossenen Augen stand Tessa unter der Dusche und ließ seit Minuten das kühle Wasser an ihrem Körper hinabperlen. Sie legte den Kopf in den Nacken, fuhr sich mit gespreizten Fingern mehrfach durch ihre kurzen blonden Haare und hoffte, dadurch die Bilder des Nachmittags aus ihrem Gedächtnis streichen zu können.
Das Gesicht des toten Mädchens, die gelblich weiße Haut und die bläulich verfärbten Lippen. Mit Sicherheit hatte die Leiche noch nicht lange im Wasser gelegen, sie war kaum aufgedunsen, das Mädchen hatte ausgesehen, als würde es nur schlafen. Das machte ihren Tod noch unbegreiflicher.
Und wieder lief der Film vor ihrem inneren Auge ab, die Szene, wie dieses verschnürte Bündel aus dem Neckar gezogen wurde. Sie sah die Rosenblätter, ein wahres Meer an roten Blütenblättern, in denen das tote Mädchen auf einem weißen Laken gelegen hatte. Ein Detail, das umso verstörender wirkte, je länger sie darüber nachdachte.
I wanna lay you down on a bed of roses… Unwillkürlich kam Tessa der Refrain dieses Bon-Jovi-Songs in den Sinn. Wie krank musste jemand sein, einem Mädchen so etwas anzutun?
Wie alt sie wohl war? Ihr Gesicht hatte wesentlich reifer gewirkt als ihr kleiner, dünner Körper. Nicht auszudenken, wie die Eltern jetzt leiden mussten. Wenn das ihr Kind gewesen wäre… eine grauenhafte Vorstellung. Ein Schmerz, dessen Trittspuren sie schon spürte, wenn sie auch nur an die Möglichkeit dachte.
Tessa stellte die Dusche aus. Hatte sie eben die Klingel gehört? Oder was war das für ein Geräusch gewesen? Es war doch schon bald Mitternacht. Sie warf einen prüfenden Blick auf das Babyfon auf dem Badschränkchen. Alles gut.
Sie horchte. Das Geräusch wiederholte sich nicht.
War es überhaupt da gewesen? Ja. Sie hatte dieses Sirren noch im Ohr.
Irritiert stieg sie aus der Dusche und zog sich nach kurzem Abtrocknen ihr dunkelblaues T-Shirt und ihre bequeme graue Lieblingshose an.
Barfüßig durchquerte sie den Flur. Zweieinhalb Zimmer, Küche, Bad, achtzehntes Stockwerk, so die nüchterne Beschreibung im Immobilienanzeiger– fünfundfünfzig Quadratmeter Wohlfühloase in ihren Augen.
Tessa ging ins Kinderzimmer und erkannte am ruhigen Atem ihres Sohnes, dass er schlief. Sie deckte Julian zu, weil er sich freigestrampelt hatte, strich ihm sanft über den Kopf. Von einer unvorsichtigen Bewegung würde er sofort wach werden. Er war kein Kind, das man im Schlaf einfach wegtragen konnte.
Nachdenklich ging sie zurück in den Flur. Vielleicht war es doch die Türklingel gewesen.
Sie schaute durch den Spion. Niemand war zu sehen.
Vielleicht war es Frau Rose, die den Schrecken des Nachmittags auch nicht so recht verdauen konnte, dachte sie, und trotz der späten Stunde darüber sprechen wollte. Möglich wäre das.
Bei zunächst vorgehaltener Türkette öffnete Tessa ihre Wohnungstür. Erst als sie sich halbwegs sicher fühlte, nahm sie den Schlüssel vom Haken und huschte über den langen Flur zur Wohnung von Frau Rose.
Dort klingelte sie. Zwei Mal kurz, ein Mal lang, aber die Nachbarin hatte ihre Klingel abgestellt. Also war sie doch schon schlafen gegangen. Zu oft passierte es, dass Besucher bei den unzähligen Knöpfen am Haupteingang versehentlich die falsche Klingel erwischten.
Merkwürdig, dachte Tessa, als sie sich, zurück in ihrem Wohnzimmer, auf die Couch fallen ließ. Vielleicht hatte sie sich ganz einfach verhört.
In diesem als »Asemwald-Siedlung« bekannten Hochhauskomplex –einem Wohnkosmos bestehend aus drei Hochhäusern aus den siebziger Jahren mit jeweils rund zwanzig Stockwerken– gab es zweitausend Einwohner und somit eben auch mal Geräusche, die man nicht einordnen konnte.
Gewöhnungsbedürftig war es allemal, hier zu leben, und dennoch würde sie mit keinem anderen Wohnumfeld mehr tauschen wollen, da der Asemwald wie ein eigenständiges Dorf funktionierte. Neben einem Supermarkt und einer kleinen Ladenpassage gab es hier auch einen Friseur, ein Schwimmbad, ja sogar einen Kindergarten.
Nicht zuletzt wegen der Infrastruktur hatte Tessa sich für diese Wohnung entschieden. Jedoch auch, weil Tom Trautner hier lebte, ihr bester Freund, ein Kripobeamter, mit dem sie erstmals auf einer Pressekonferenz vor sieben oder acht Jahren zusammengetroffen war. Letzteres im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hatte ihm vor Beginn der Veranstaltung durch ihr schwungvolles Eintreten die Tür vor den Kopf geschlagen.
Er war dort gewesen, um zu einem bestimmten Fall Auskunft zu geben. Allerdings hatte er im Moment des Zusammenpralls nur noch einen schwäbischen Fluch erster Güte herausbekommen.
Natürlich hatte Tessa ihn direkt nach der Konferenz im Krankenhaus aufgesucht und ihn um Entschuldigung gebeten. Da zum Glück noch einmal alles glimpflich ausgegangen war und er mit der genähten Platzwunde die Klinik sofort wieder verlassen durfte, hatte sie ihn nach Hause gefahren, und seitdem war ihr Kontakt stetig enger geworden.
Tom wohnte wie sie im achtzehnten Stockwerk, er allerdings schon seit zehn Jahren, und so hatte sie nach der Trennung von Philipp nicht lange gezögert, sondern die Gelegenheit ergriffen, eine freie Wohnung ein paar Türen weiter zu beziehen– mit dem beruhigenden Gefühl, immer einen guten Freund in ihrer Nähe zu wissen, denn selbst eine taffe Frau wie sie überfiel ab und zu der große Katzenjammer. Und wenn Tom eines konnte, dann war es, sie aufzumuntern.
Zudem half die Höhenlage dabei, nach Feierabend Abstand zu gewinnen oder, wie Tom es formulierte, »diesem Mördersumpf da unten zu entkommen«.
War Tom vielleicht vorhin an der Tür gewesen? Er hatte heute nach Dienstschluss noch vorbeikommen wollen, weil sie ihm am Abend geschrieben hatte, dass sie nach den Ereignissen jemanden zum Reden brauchte. Da es jedoch inzwischen nach Mitternacht war, hatte sie nicht mehr mit ihm gerechnet.
Natürlich durfte Tom aus beruflichen Gründen nicht über Details den Fall des toten Mädchens aus dem Neckar betreffend sprechen, schon gar nicht mit einer Journalistin.
Diese Problematik kannte sie noch aus der Zeit mit Philipp, in der sie berufliche und private Dinge immer streng getrennt und sie sich am Ende gar nichts mehr zu sagen gehabt hatten. Denn Philipps Devise im Umgang mit privaten Problemen war Schweigen gewesen. Da war Tom jedoch ganz anders. Oftmals sah er ihr direkt an, wenn etwas nicht stimmte, und sprach sie von sich aus darauf an. Tom erzählte auch von seiner Arbeit, gerade so viel, wie er sagen durfte und ihr zumuten wollte, aber sie fragte sich immer, wie er es schaffte, die schrecklichen Bilder nach Feierabend loszuwerden.
Sie dachte daran, ihre beste Freundin und zugleich Patentante von Julian noch einmal anzurufen. Aber Helen hatte sich vorhin bereits alles anhören müssen und lag sowieso immer schon um zehn im Bett. Beste Freundin hin oder her, sie würde sich für einen Anruf um diese Zeit schön bedanken. Vor allem, weil Helen bei Themen, die sich um ein Verbrechen drehten, eher zartbesaitet war.
Das hatte sich seit Schulzeiten nicht geändert, als sie beide heimlich »AktenzeichenXY« angeschaut hatten. Selbst das war für Helens Gemüt schon zu viel gewesen, sie war mit ihrem Lockenkopf immer tiefer hinter der Sofadecke verschwunden und hatte schließlich nur noch bei Licht schlafen wollen.
Als Tessa gerade nach der Fernbedienung greifen wollte, um den Fernseher zur Berieselung einzuschalten, erhielt sie eine WhatsApp. Zuerst wollte sie gar nicht auf ihr Handy schauen, weil sie nach den elf Anrufen von Philipp seit heute Nachmittag niemand anderen als ihn dahinter vermutete. Dann gab sie sich einen Ruck und nahm ihr Telefon vom Wohnzimmertisch.
Die WhatsApp war von Tom. Bist du noch wach? Bin jetzt endlich zu Hause.
Ja, schrieb sie zurück. Komm vorbei, wenn du noch willst.
3
»Puh, das war ein Tag heute.« Tom fuhr sich durch seine dichten, streichholzlangen braunen Haare, die vom Duschen noch leicht feucht waren und nun in alle Richtungen abstanden. So erinnerte er sie einmal mehr an Per Gessle, den Sänger und Gitarristen von Roxette. Gemeinsam könnten sie direkt als Banddouble durchgehen, bemerkten Freunde immer wieder scherzhaft, wobei Toms Musikgeschmack definitiv ein anderer war und Tessa sich längst nicht so hübsch wie Marie fand.
Tom hingegen könnte locker den Doppelgänger geben, er hatte sogar diese großen, strahlenden Augen, allerdings lag heute ein Schatten in seinem Blick, und um seinen Mund zeigten sich nicht die sonst üblichen Lachfalten.
Besonders wenn es sich bei den Opfern um Kinder oder Jugendliche handelte, das betonte er immer wieder, ging ihm sein Job als Kripobeamter an die Nieren, das würde jedem noch so hartgesottenen Ermittler so ergehen.
Bei der Umarmung hielt Tom sie länger fest als sonst. Die Frage nach dem Befinden entfiel– es genügte wie immer ein gegenseitiger Blick in die Augen.
»Hast du vorhin schon mal geklingelt?«, fragte Tessa, als sie sich von ihm löste.
»Ich? Nein. Ich bin vor einer halben Stunde nach Hause gekommen und war erst mal unter der Dusche.«
»Da war ich auch, als ich das Geräusch gehört habe.« Mit einer Handbewegung bat sie ihn herein und schloss die Tür. Dabei fiel ihr Blick auf seine schwarz-weiß gemusterten Hausschuhe. Erst bei genauerem Hinsehen erkannte man die Totenköpfe, ein Motiv, das sich auf vielen seiner persönlichen Gegenstände fand und eine Facette seines schwarzen Humors widerspiegelte, den sie sehr mochte. »Na ja, wahrscheinlich habe ich es mir nur eingebildet. Möchtest du was trinken?«
»Gern einen Kaffee– zum Runterkommen.« Er seufzte.
So selbstverständlich, wie er in seinen Hausschuhen in ihre Küche ging und zwei Tassen aus dem Oberschrank holte, könnte man meinen, er sei bei ihr zu Hause. Das gefiel Tessa. »Nur benimm dich nicht so«, hatte sie bei einer solchen Gelegenheit mal mit einem Augenzwinkern gesagt.
Sie legte ein Pad in die Maschine ein und ließ sich von Tom die Tassen reichen. Koffein wirkte bei ihr schon längst nicht mehr aufputschend. Ein Kaffee um diese Uhrzeit war keine Seltenheit, ebenso wenig, dass Tom nach Feierabend zu ihr kam. Auch für ihn war der Kaffee Lebenselixier und Ersatzdroge Nummer eins, nachdem er ebenfalls mit dem Rauchen aufgehört hatte.
Oft kochten sie zusammen oder saßen bei einer Flasche Wein auf der Couch, dann nahm er sie in den Arm, sie legte ihren Kopf an seine Schulter, und sie redeten über Gott und die Welt.
Die Couch machte dem Begriff »Wohnlandschaft« alle Ehre. Dicke gepolsterte Lehnen aus schwarzem Leder, der Bezug aus weinrotem Stoff mit beigefarbenen Streifen, herrlich bequem. Mit einem tiefen Seufzer ließ sich Tessa in die üppigen Kissen sinken. Leider nicht unter dem Vorzeichen eines entspannten Feierabends.
Gedankenverloren nippte sie an ihrem Kaffee. Nicht mal der wollte ihr heute schmecken. Tom schien es genauso zu gehen, denn er schob seine Tasse von sich weg.
»Na du?«, fragte er gedehnt.
Mit diesem für ihn typischen »Na du?« signalisierte Tom mit einfühlsamer Art sein Interesse, ohne große Fragen zu stellen.
»Ich denke immer wieder darüber nach«, sagte Tessa, »wie wohl die Eltern des Mädchens diesen Schock verkraften. Unvorstellbar grausam, sein Kind auf solche Weise zu verlieren.«
»Im Moment wissen sie noch gar nichts davon.«
Sie schaute auf. »Wie bitte? Warum das denn?«
»Tessa, du weißt, dass ich nicht viel dazu sagen kann. Wenn mal wieder was durchsickert und in der Zeitung steht, darf ich den Kopf hinhalten, weil meine Kollegen wissen, dass wir uns kennen.«
»Dann sag mir, was du sagen darfst. Ich muss darüber reden, sonst werde ich verrückt. Außerdem habe ich dein Vertrauen noch nicht ein einziges Mal missbraucht.«
»Ich weiß, dass du keine Sensationsjournalistin bist, die auf Teufel komm raus an Infos kommen will. Du machst das subtiler.« Er meinte das gar nicht böse, und sie wusste, worauf er anspielte. Bei ihren Redaktionskollegen war sie als zielstrebig und hartnäckig bekannt, darum setzte man sie gern auf schwierige Interviewpartner an.
»Frau Steinwart knackt jeden Panzer«, hieß es dann vom Chef, und meistens behielt er recht. Besonders Männer reagierten im gewünschten Sinne auf ihre empathische Art, mit der sie den Balanceakt zwischen Unaufdringlichkeit und Unbeirrbarkeit meisterte.
»Wir wissen noch nicht, wer die Eltern sind. Niemand scheint dieses tote Mädchen zu vermissen.«
»Meine Güte, was sind das denn für Eltern, die ihr Kind nicht vermissen?«
»Na ja, Kind ist relativ. Du hast das Mädchen ja gesehen. Sie war stark abgemagert und kleinwüchsig, deshalb wirkte sie jünger, aber nach den ersten Infos aus der Rechtsmedizin war sie wohl schon ein Teenager, so vierzehn oder fünfzehn. Nicht selten, dass die in dem Alter ausreißen oder mal eine Nacht wegbleiben. Oft wenden sich die Eltern trotz ihrer Sorge aus Scham nicht an uns, weil sie sich dann vielleicht ein Versagen eingestehen müssten. Sie hoffen ganz einfach, dass ihre Kinder von allein wieder auftauchen und nichts Schlimmes passiert ist– nach dem Motto: Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Wir wissen zudem nicht, wie lange das Mädchen schon verschwunden war.«
»Im Neckar kann sie jedenfalls nicht lange gelegen haben. Wasserleichen sehen anders aus, das weiß selbst ich.«
»Ja, das stimmt. Professor Wittenbrinck ist im Moment dabei, die Zeitspanne genauer zu bestimmen, innerhalb der das Mädchen gestorben ist, und wie lange sie vermutlich im Wasser lag. Möglich, dass sie zum Beispiel im Kofferraum eines Wagens über eine weite Strecke transportiert wurde, bevor man sie in den Neckar geworfen hat. Dann ist unter Umständen nicht nur eine deutschlandweite, sondern sogar eine internationale Fahndung fällig. Wir müssen alle Möglichkeiten in Betracht ziehen.«
Alle Möglichkeiten. Das war das Stichwort. Ihr Mund wurde trocken, und sie musste nun doch einen Schluck Kaffee trinken, damit sie die Frage herausbrachte. »Diese Rosenblätter… Rosen sind ja ein Symbol. Vielleicht auch für kranke oder… abartige Liebe. Ich meine, ist… ist das Mädchen missbraucht worden?«
Tom machte eine abwägende Geste. »Nach der ersten Inaugenscheinnahme des Leichnams gibt es einige Auffälligkeiten, über die ich im Moment noch nicht sprechen darf. Sagen wir mal so: Sie hat sehr viele Narben, größere und kleinere, allerdings keine äußerlich frischen Verletzungen. Wir wissen noch nicht, was zum Tod des Mädchens geführt hat. Eines jedoch hat Wittenbrinck bereits festgestellt: Es gibt keine Spuren eines sexuellen Missbrauchs.«
So ganz überzeugt war Tessa noch nicht. »Na ja, vielleicht hat sie sich nicht gewehrt, und es fand mit Kondom statt.«
»Auch das kann Wittenbrinck ausschließen. Das Jungfernhäutchen war nämlich intakt, auch an anderen Körperöffnungen fanden sich keine sexuellen Missbrauchsspuren.«
Tessa wollte gerade etwas entgegnen, als ihr Handy klingelte. Um diese Uhrzeit. Sie zuckte regelrecht zusammen.
Ein kurzer Blick aufs Display, und ihre Vermutung bestätigte sich.
4
»Sorry, aber dein Exmann spinnt doch wirklich. Philipp war echt mal ein guter Kumpel, jedenfalls als ihr noch verheiratet wart, aber bei dem, was du mir in letzter Zeit so erzählt hast, bin ich froh, dass wir auch beruflich nichts mehr miteinander zu tun haben, sonst käme ich nicht umhin, ihm mal so richtig die Meinung zu sagen. Was fällt ihm ein, dich weit nach Mitternacht anzurufen? Hat er es immer noch nicht begriffen?«
»Es ist sein zwölfter Anruf heute.«
»Ach du Scheiße. Der kennt ja wirklich keine Grenzen mehr. Oder ist es doch was Wichtiges? Vielleicht ist was passiert?«
»Er weiß, wie man eine WhatsApp schreibt, und das würde er auch tun, wenn es ihm darum ginge, mir etwas Wichtiges mitzuteilen. Nein, er will, dass ich ihn nicht vergesse. Ein Denkzettel. Oder Rachsucht, such es dir aus.«
»Dafür, dass du ihn verlassen hast? Das hat er ja wohl nicht anders verdient. So übel, wie er dich hintergangen hat.«
»Hör auf mit dieser Geschichte. Ich bin froh, dass ich auch mal an etwas anderes denken kann als an seine Geliebte.«
»Blockier doch seine Nummer, dann hast du deine Ruhe.«
»Wenn ich das mache, habe ich Angst, dass es nur noch schlimmer wird.«
»Lass dich von deinem Ex nicht kleinmachen. Du weißt, dass du stark bist.«
»Hm…«, machte Tessa.
Tom nahm ihre Hand und drückte sie fest. »Hey, ich glaube an dich. I’ll be at your side, remember? Immer. Und wenn’s ganz schlimm wird und du dich bei mir auskotzen willst– ich halte dir jederzeit den Eimer hin, das weißt du.«
Tessa musste lächeln. Dafür mochte sie Tom. Dafür, dass er tatsächlich immer für sie da war. Für die Leichtigkeit und das Glück, das er in ihr Leben brachte. Oder liebte sie ihn sogar dafür? Darüber war sie sich in letzter Zeit nicht mehr so ganz im Klaren.
Kürzlich, an einem dieser gemeinsamen Abende, hatte Tom sie sehr lange angeschaut und dabei wie beiläufig die Bemerkung gemacht, dass man sich in der Tiefe ihrer blauen Augen verlieren könne. Umgekehrt hatte sie zugegeben, dass man fast schon zwangsläufig in seinen grünbraunen Augen versinken müsse. Ein Skorpionblick. Geheimnisvoll und unwiderstehlich. Aber dieses Kompliment hatte er sofort zu Fall gebracht, indem er meinte, seine Augenfarbe ähnele ja wohl eher dem Wasser eines Tümpels, der kurz vor dem biologischen Infarkt stehe.
Dieses wechselseitige Spiel von Annäherung und Entfernung beherrschten sie mittlerweile in Perfektion. Denn nicht nur ihr fiel es schwer, Vertrauen in eine mögliche neue Beziehung zu fassen. Auch Tom hatte damit so seine Schwierigkeiten.
Schon früh hatte er seine Jugendliebe geheiratet, die beiden waren ein halbes Leben lang zusammen gewesen, und mittlerweile war die Trennung von ihr auch schon wieder fünfzehn Jahre her, doch seither hatte er sich mit keiner Frau mehr auf eine tiefere Beziehung einlassen können.
Wenn sie ihn nach den Gründen fragte, sprach er nicht darüber. Erklärte nur, dass sie zwar seine große Liebe gewesen sei, die Trennung aber zu lange her, als dass sie ihn jetzt noch belasten würde. Und wenn er sich seither auf keine Beziehung richtig eingelassen habe, sei die Richtige eben nicht dabei gewesen. Punkt. Die Mauer, gegen die sie jedes Mal prallte, konnte sie regelrecht spüren, aber auch akzeptieren. Er musste selbst bestimmen, wann er bereit war, darüber zu reden.
Eines hatten sie in jedem Fall gemeinsam: tiefe Verletzungen, weshalb sie sich auf der freundschaftlichen Ebene wohl beide am sichersten fühlten.
Tessa erwiderte den Druck von Toms Hand. »Mürbe macht mich Philipp trotzdem mit seiner Stalkerei. Aber das ist ja harmlos im Vergleich zu dem, was dem Mädchen passiert ist. Ich glaube allerdings, dass ihr den Täter schnell zu fassen bekommt.«
Tom runzelte die Stirn. »Weshalb?«
»Na ja, ich meine, wer so dilettantisch vorgeht und glaubt, dass ein Schirmständer als Gegengewicht den Körper des Mädchens dauerhaft am Grund des Neckars hält, der muss schon ziemlich blauäugig sein.«
»Umgekehrt. Ich glaube eher, dass der Mörder ziemlich gerissen ist.«
»Warum das denn?«
Tom ließ ihre Hand los. »Ich hoffe zwar, dass du recht behältst, allerdings bin ich jetzt schon lange genug bei diesem Mördersuchverein, zwölf Jahre, und mein Gefühl sagt mir, dass hier ein Typ dahintersteckt, der sich Aufmerksamkeit verschaffen will. Es könnte sich natürlich auch um eine Beziehungstat handeln, wenn der Täter zum Beispiel in das Mädchen verliebt war und sie rasend vor Eifersucht oder im Trennungsschmerz umgebracht hat und gleichzeitig unbewusst nicht wollte, dass sein schönes Mädchen als Wasserleiche entstellt wird. Ich denke aber, er wollte, dass die Leiche gefunden wird, und das sogar ziemlich schnell. Wenn dem so ist, müssen wir doppelt vorsichtig sein, mit welchen Informationen wir an die Presse gehen. Der Täter wird uns beobachten. Wir müssen ihn in Sicherheit wiegen, damit er nicht nervös wird, und können nur hoffen, dass wir ihm auf die Spur kommen, bevor er sich sein nächstes Opfer sucht.«
Die feinen Härchen auf Tessas Oberarmen stellten sich auf. »Sein nächstes Opfer? Du meinst, es könnte sich um einen Wiederholungstäter handeln? Einen Serienkiller?«
»Möglich. Ich glaube, dass wir einen unruhigen Sommer vor uns haben.«
Bei der Vorstellung bekam Tessa richtige Gänsehaut. »Was bringt dich zu der Annahme?«
Tom zuckte mit den Schultern und wandte seinen Blick ab. Sie kannte ihn gut genug, um an seiner Mimik zu erkennen, dass er ihr auswich.
»Tom, was gibt es, das du mir nicht sagen willst, kannst oder darfst? Da ist doch etwas.«
»Nein, nichts«, beteuerte er schnell. »Es ist nur
5
Drei Wochen zuvor
Er nennt mich Schneewittchen. Jeden Abend betritt er mein Zimmer.
Mein Reich. Meine Höhle. Mein Verlies.
Wenn ich mich mit dem Rücken auf den Steinboden lege, die Fersen gegen die Tür, die Arme nach hinten ausgestreckt, dann kann ich mit den Fingerspitzen die feuchte Wand berühren. Ich mache das jedes Mal, wenn der Raum auf mich zuwächst, wenn er so eng wird, dass ich mich davon überzeugen muss, dass die Wände noch immer im gleichen Abstand zueinander stehen.
Wenn sich der Schlüssel im Panzerschloss dreht und der Metallbügel mein Gefängnis freigibt, weiß ich, es ist Punkt zwanzig Uhr. Für mich das Zeichen, mich schnell auf mein Hochbett zu setzen, im Schneidersitz, den Rücken zur Tür, und meine Hände unter den Po zu schieben. Erst wenn er die dicke Stahltür von innen verriegelt hat, darf ich mich umdrehen.
Er trägt eine rote Perücke, eine weiße Maske mit einer schwarzen Träne auf der Wange, die den Mund freilässt, und ein buntes, an Armen und Beinen ausladendes Flickenkostüm, dazu schwarze Schuhe mit hochgebogenen Spitzen.
Aus dem Fernsehen weiß ich, dass andere Kinder Mütter und Väter haben– ich habe nur meinen Harlekin. Er ist sehr nett zu mir. Aber nicht lustig wie ein Clown.
Er hat diese schwarze Träne auf der Wange und sagt, er sei traurig, weil ich ihm so viel Kummer mache. Ich weine oft, bin ständig krank, und einmal habe ich versucht, wegzulaufen. Seither machen wir die Ausflüge zur Cannstatter Brücke nicht mehr.
Vor zwei, drei Jahren, ich muss ungefähr zwölf Jahre alt gewesen sein, habe ich mich zum ersten Mal gefragt, was wohl mit mir passieren wird, wenn mein Harlekin eines Abends fortbleibt.
Seitdem habe ich Angst.
Angst, dass er mich absichtlich vergessen könnte, weil ich nicht brav war, oder dass ihm etwas zustößt und er ins Krankenhaus kommt.
Für solche Fälle habe ich mir einen heimlichen Notvorrat an Früchteriegeln und Saftgetränken vom Mund abgespart. Gut versteckt liegt er hinter den Büchern in dem kleinen Schränkchen. Das reicht für zwei, drei Tage.
Aber was wäre, wenn er sterben würde? Dann würde es mich auch nicht mehr geben. Und deshalb ist es gut, dass mein Harlekin da ist. Denn solange er lebt, lebe auch ich.
»Wie geht es dir, mein Schneewittchen?« Seine Stimme klingt weich und kein bisschen bedrohlich. Ich kenne diese Stimme, seit ich denken kann. Sein Gesicht habe ich noch nie gesehen, aber er sagt, das müsse so sein.
»Gut«, antworte ich. Es ist gleichgültig, was ich sage, ich muss immer meine Medizin nehmen. Weil mein Herz krank ist. Sehr krank. Der Meinung ist mein Harlekin, und wenn er das sagt, dann stimmt es. Ich weiß nicht genau, was mein Herz hat. Manchmal stolpert es oder schlägt schneller, besonders nachdem ich die kleinen weißen Pillen genommen habe.
Der Harlekin holt den klappbaren Campingtisch und die Stühle aus der Nische zwischen Wand und Bett hervor, die karierte Tischdecke hat er immer dabei, und dann stellt er das Geschirr darauf. Es ist aus Plastik, weil ich kein Glas mehr in meinem Zimmer haben darf, seit ich letztes Jahr versucht habe, mir die Pulsadern aufzuschneiden.
In seinem Korb hat er verschiedene Behälter mit Essen, die er auf meinem Zweiplattenherd für uns warm macht. Der Harlekin kann gut kochen. Zumindest hat er mir einmal gesagt, dass er die Mahlzeiten selbst zubereitet.
Heute gibt es Kartoffeln, Gemüse und Rindfleisch. Wir essen immer gemeinsam, und er achtet darauf, dass ich genug zu mir nehme, weil ich oft keinen Appetit habe. Auch heute esse ich nur ihm zuliebe. Ich zerkaue das faserige Fleisch und habe das Gefühl, dass es in meinem Mund immer mehr statt weniger wird. Ich will schlucken, aber es geht nicht.
Ich hefte meinen Blick auf die schwarze Träne auf seiner Maske. Ich will meinem Harlekin keinen Kummer machen. Ich will nicht, dass er traurig ist und mich deshalb vielleicht eines Tages im Stich lässt. Ich schlucke. Ich würge.
»Kannst du wieder nicht essen?«, fragt mein Harlekin mit echter Besorgnis in der Stimme. In solchen Momenten entspanne ich mich und bin mir wieder sicher, dass er mich nie allein lassen und alles für mich tun würde.
»Doch, doch«, sage ich schnell, spieße noch ein Stück Fleisch auf meine Gabel, und dieses Mal rutscht es mir nach nur wenigen Kaubewegungen wie von selbst die Kehle hinunter.
Mein Harlekin lächelt, und ich bin glücklich.
»Darf ich heute Abend noch fernsehen?«, frage ich. Ich brauche Menschen und Stimmen um mich herum. Aber es ist auch ein Test, ob er mich wirklich mag. Er sagt, mir würde es an nichts fehlen. Ich hätte einen Fernseher, einen iPod mit der neuesten Musik, viele Bücher und einen Laptop, auf dem ich so lange Spiele machen darf, wie ich will. Das ist aber nur die halbe Wahrheit.
Normalerweise dreht der Harlekin die Sicherung raus, wenn er sich um einundzwanzig Uhr verabschiedet, weil ich genügend Schlaf bekommen soll. Dann ist es stockdunkel in meinem Verlies, erst am nächsten Morgen geht das Licht wieder an. Um Punkt halb neun bringt der Harlekin mir mein Frühstück.
Er schaut mich mit prüfendem Blick an. Wir wissen beide, dass er mir mit seiner Erlaubnis, noch ein bisschen fernzusehen, Strom für die ganze Nacht zubilligt. Dann kann ich anschließend auch noch Musik hören und lesen, bis ich, in eine andere Welt versunken, einschlafe und mich erst das Schlüsselgeräusch an der Tür wieder aufweckt. Denn sobald er sich abends von mir verabschiedet hat, kommt er grundsätzlich erst am nächsten Morgen wieder. Ich schließe daraus, dass sich mein Verlies nicht im Keller des Hauses befindet, in dem er wohnt.
»Also gut, du darfst fernsehen. Aber dann musst du jetzt auch ein liebes Mädchen sein.«
Er nimmt meinen Plastikbecher, gibt ein paar Löffel Pulver aus einer mitgebrachten Dose hinein und gießt Wasser dazu. Ich bekomme einen Brechreiz, wenn ich nur an den künstlichen Erdbeergeschmack denke, aber der Harlekin sagt, dass dieses Getränk gut für meinen Darm ist, weil ich mich wegen meiner starken Lichtempfindlichkeit ja nicht so viel draußen bewegen darf.
Also würge ich es hinunter.
Meistens dauert es nicht lange –heute habe ich noch nicht einmal fertig zu Abend gegessen–, dann muss ich schon auf die Campingtoilette. Sie steht in der Ecke meines Zimmers. Der Harlekin legt mir die Hand auf die Schulter, während ich mich unter Krämpfen winde.
Dann ist es vorbei, und ich setze mich mit Tränen in den Augen zurück an den kleinen Tisch. Es stinkt bestialisch in dem kleinen Raum, doch frische Luft bekommt man nur, wenn man in die Pedale der feststehenden Fahrradkonstruktion tritt, die den Lüftungsapparat bedient.
Mir ist der Appetit endgültig vergangen. Mein Harlekin stört sich nicht im Geringsten an dem Geruch, er isst weiter und wirkt zufrieden, weil mein Darm arbeitet und die Gefahr einer Verstopfung gebannt ist.
Und wenn es meinem Harlekin gut geht, geht es mir auch gut.
»Du musst noch deine Tablette nehmen«, sagt mein Harlekin, nachdem er die Portion auf meinem Teller auch noch aufgegessen hat.
»Muss ich wirklich?«, frage ich, obwohl ich weiß, dass Widerspruch zwecklos ist.
»Dein Herz ist krank, mein kleines Schneewittchen.« Er räumt das benutzte Geschirr in den Korb und bedeckt es mit der akkurat zusammengefalteten Tischdecke.
»Aber wenn ich die Tablette genommen habe, schwitze und zittere ich immer so, und mein Herz rast. Und gestern hatte ich so wahnsinnige Kopfschmerzen, dass ich es kaum ausgehalten habe. Vielleicht sollte ich lieber andere Tabletten bekommen.« Die Medizin vollkommen wegzulassen würde ich nicht vorzuschlagen wagen.
»Ich weiß, was für dich und dein Herz gut ist, mein kleines Schneewittchen. Oder vertraust du deinem Harlekin nicht mehr?«
»Doch, doch«, sage ich schnell, nehme die Tablette entgegen und schlucke sie hinunter.
Jetzt ist es auch nicht mehr wichtig, ob ich heute Nacht Strom habe. In spätestens einer Stunde werden die Nebenwirkungen eingesetzt haben, und ich werde zusammengekrümmt auf meinem Bett liegen und meinen Kopf festhalten, weil ich Angst habe, dass mir unter diesem wahnsinnigen Druck der Schädel platzt.
Mein Harlekin stellt Stühle und Campingtisch beiseite. Sein Besuch ist beendet. Es braucht nicht viele Worte zwischen uns. Die Abläufe sind stets gleich. Als ich schon auf dem Bett sitze und wieder die Position eingenommen habe, die er auch von mir verlangt, wenn er das Zimmer wieder verlässt, greift er noch einmal in seinen Korb.
»Ich lasse dir noch eine Tablette da, du kannst sie nehmen, wenn du die Kopfschmerzen nicht mehr aushältst. Es ist ein Schmerzmittel.«
»Vielen Dank«, sage ich. »Das ist sehr nett.«
6
Um halb acht stand Tessa in Bürokleidung in der Küche. Nach der fast schlaflosen Nacht konnte sie sich kaum auf irgendwelche Routinetätigkeiten konzentrieren, sie war schon eine halbe Stunde nach dem Aufstehen vollkommen gestresst, wie sollte das erst bei der Arbeit werden?
Ständig hatte sie dieses tote Mädchen vor Augen, die immer gleichen Fragen kamen ihr in den Sinn, und ihre Verunsicherung hatte sich nach dem gestrigen Gespräch mit Tom spürbar verstärkt.
Ein unruhiger Sommer… ein Serienkiller… Ob er mehr wusste, als er ihr gegenüber zugeben wollte?
Julian saß im Bob-der-Baumeister-Schlafanzug auf seinem Kinderstuhl, schaukelte mit den Beinen und war glücklich, dass er seinen Kakao heute mit dem Strohhalm trinken durfte. Sie wollte ihn gerade noch ermahnen, achtzugeben, dass der große Becher nicht umfiel– da war es auch schon zu spät. Und damit nicht genug, in diesem Moment klingelte es an der Wohnungstür.
Himmel!, dachte Tessa, hin- und hergerissen zwischen dem Impuls, zu öffnen, und der Notwendigkeit, der Überschwemmung auf dem Frühstückstisch Herr zu werden– während der Kakao zur Belustigung ihres Sohnes bereits auf seine Schlafanzughose tropfte. Mit dem Lappen wischte sie die gröbste Bescherung weg, ehe sie zur Tür eilte.
Frau Rose stand davor, hellwach und mit perfekter Lockenstabfrisur, bereit für den Tag.
»Guten Morgen, Frau Rose«, sagte Tessa mit einem leicht fragenden Blick.
»Ich weiß, es ist eine halbe Stunde vor der Zeit, aber ehe Sie zur Arbeit müssen und ich Julian in den Kindergarten bringe, wollte ich fragen, ob es Neuigkeiten über das unbekannte Mädchen gibt?«
»Nicht direkt«, wich Tessa aus. »Die Polizei weiß noch nicht, wer sie ist, es liegt keine Vermisstenmeldung vor. Aber kommen Sie doch herein.« Tessa sagte es mehr aus Höflichkeit. Es war zwar nicht so, dass die Nachbarin störte, ganz im Gegenteil, Frau Rose war ihr immer eine Hilfe– aber vielleicht war genau das das Problem. Zunehmend vermittelte sie ihr dadurch das Gefühl, allein gar nichts mehr auf die Reihe zu bekommen.
»Gott, wie furchtbar«, sagte Frau Rose und schloss die Tür hinter sich. »Gibt es denn schon Hinweise auf den Mörder? Was sagt die Spurensicherung?«
Tessa blieb noch im Flur stehen. Schließlich sollte Julian nichts von dem Gespräch mitbekommen, auch wenn er nicht viel davon verstand. »Herr Trautner hat kaum was gesagt… darf er ja auch nicht. Außer dass das Mädchen viele Narben hat, allerdings keine frischen Verletzungen. Und die Art, wie der Täter die Leiche abgelegt hat, deutet darauf hin, dass er sich Aufmerksamkeit verschaffen will. Tom glaubt, dass uns ein unruhiger Sommer bevorsteht, weil sich der Täter bald sein nächstes Opfer suchen wird.«
»Patsch, patsch, patsch.« Die quietschvergnügte Stimme kam aus der Küche, dazu hörte Tessa das passende Geräusch kleiner Kinderhände.
»Oh nein. Julian, nein!«, rief sie, ließ die Nachbarin stehen und stürzte in die Küche.
»Ein Schiff, Mama! Ein Piratenschiff! Bumm, bumm!«
Julians Frühstücksbrot lag inmitten eines Kakaomeeres auf seinem Teller, die Trauben hatte er als Kanonenkugeln drum herum verteilt– und nun wollte er offenkundig ein bisschen Seegang haben. Mit einer Unschuldsmiene wie Pumuckl und einer ebensolchen Frisur, nur in Blond und mit Kakaosträhnen, saß er strahlend vor seinem selbst gebauten Schiff.
»Julian! Was soll das?«, schrie Tessa ihn an, und schon im selben Augenblick tat es ihr furchtbar leid. Fassungslos betrachtete sie die Szenerie und wusste nicht, ob sie heulen oder lachen sollte– allerdings war ihr mehr nach Heulen zumute. Nicht weil das Chaos in der Küche besonders schlimm gewesen wäre, sondern weil sie so nah am Rand der Erschöpfung stand. Diese im wahrsten Sinne des Wortes wenigen Tropfen hatten das Fass zum Überlaufen gebracht.
»Lassen Sie nur, ich mache das schon«, hörte sie Frau Rose hinter sich sagen.
»Nein!«, rief Tessa und raufte sich dabei die kurzen Haare.
»Wie bitte?«, fragte Frau Rose irritiert.
Nun füllten sich ihre Augen tatsächlich mit Tränen. »Ich wollte sagen, vielen Dank.«
Frau Rose wandte sich Julian zu, der seine Tagesoma aus blauen glücklichen Kinderaugen ansah. Sie streichelte ihm über seine widerspenstigen Haare.
»Bist du satt?«, fragte sie, und er nickte. »Na, dann komm, mein kleiner Piratenkapitän, wir beide gehen jetzt mal ins Bad. Solange kann die Mama in Ruhe ihren Kaffee trinken und dein Frühstück für den Kindergarten fertig machen.« Frau Rose nahm Julian auf den Arm. Im Türrahmen drehte sie sich noch einmal um. »Und essen Sie bitte auch eine Scheibe Brot, Tessa. Sie sehen aus, als würden Sie jeden Moment umkippen.«
Mit hängenden Schultern, wie ein Kind, das gemaßregelt worden war, blieb Tessa zurück und schaute verloren auf den verdreckten Esstisch, so als könnte sie sich nur schwer daran erinnern, was man tun musste, um das Malheur zu beseitigen.
»Kümmern Sie sich nicht um den Tisch, das mache ich nachher. Essen Sie lieber was«, rief Frau Rose aus dem Flur.
Mit einem grimmigen Unwohlsein im Bauch schmierte Tessa sich ein Brot, weil sie mit Frau Roses überfürsorglicher Art einfach nicht zurechtkam. Durch die offene Badezimmertür hörte sie Julians glucksendes Lachen und Planschen. Sicher war er gerade dabei, das Bad zu fluten.
Kurz überlegte Tessa, der Wasserschlacht Einhalt zu gebieten, aber Frau Rose würde niemals kriegsähnliche Zustände hinterlassen und das Bad hernach sauberer aussehen als zuvor. Sie sollte sich wirklich ein Beispiel an Frau Rose nehmen. Mit ihren fünfundsechzig Jahren hatte sie tatsächlich die besseren Nerven.
Wozu überhaupt die Aufregung? Es ging doch nur um verschütteten Kakao oder Wasserpfützen auf den Fliesen. Das ließ sich doch alles wieder beseitigen.
Unvorstellbar hingegen, nie mehr das Lachen seines Kindes hören zu dürfen, drückende Stille in der Wohnung, keine vertrauten Kindergeräusche, nur unendliche Leere. Ein schwarzes Loch.
Ob das Mädchen aus dem Neckar mittlerweile identifiziert war und die Eltern von ihrem Schicksal erfahren hatten? Wenn sie an Toms ratloses Schulterzucken dachte, glaubte sie nicht so recht daran.
Mit den Gedanken bei dem toten Mädchen, kaute sie pflichtschuldig auf der Brotmasse in ihrem Mund herum.
Im Bad ging der Wasserhahn aus. Julian lachte weiter, weil er es tatsächlich lustig fand, wie Frau Rose ihm seinen Schlafanzug auszog. Wenn sie ihm dabei helfen wollte, war das immer ein mittleres Drama.
Diese verdammte Eifersucht auf Frau Rose nagte an ihr. Doch ohne die gute Nachbarin wäre sie vermutlich längst mit Burn-out in der Klinik gelandet. Und wahrscheinlich, so überlegte Tessa weiter, empfand sie bei aller Ambivalenz dennoch Sympathie für Frau Rose, weil diese ihrer Mutter so ähnlich war. Auch ihre Mutter hatte nie viele Worte gemacht, war immer für andere da gewesen und schien mühelos ihr Leben zu meistern. Dabei hatte sie es alles andere als leicht gehabt.
Als Tessa drei Jahre alt gewesen war, hatte ihr Vater die Familie wegen einer anderen Frau verlassen und sich bis zu seinem Tod vor ein paar Jahren auch nicht mehr für sie interessiert. So war sie mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, eine Geschichte, die sich nun leider für Julian wiederholte. Auch ihre Mutter hatte Kind und Arbeit unter einen Hut bringen müssen– allerdings hatte Tessa nie einen Moment der Schwäche bei ihrer Mutter erlebt. Bis zuletzt war sie eine Kämpferin gewesen– bis dieser übermächtige Gegner Krebs gekommen war und sie vor vier Jahren vor ihm kapitulieren musste.
Dabei wäre sie so gern in ihrem Leben noch Oma geworden. Ihre Mutter hätte Frau Rose in nichts nachgestanden, da war Tessa sich sicher. Vielleicht war Frau Rose ja ein Engel, den ihr ihre Mutter geschickt hatte.
»Tessa?«, hörte sie Frau Rose aus dem Badezimmer rufen. »Die Stelle am Knie, die Julian sich gestern aufgeschlagen hat, hat sich entzündet. Da muss was von meinem Wunderbalsam drauf.«
Frau Rose besaß für jedes Wehwehchen ein Wundermittel. Tessa hatte selbst schon irgendwelche Kräutertropfen von ihr verabreicht bekommen, die auch tatsächlich gegen ihre fiesen Magenschmerzen geholfen hatten.
»Haben Sie das Frühstück für den Kindergarten fertig und können kurz auf Julian achten?«
Tessa fühlte sich ertappt, weil sie in Gedanken versunken in der Küche herumgestanden hatte, und legte schnell einen Apfel auf das Schneidebrettchen. »Nein, leider noch nicht!«
»Kein Problem, dann nehme ich Julian eben mit zu mir rüber, während Sie die Dose fertig machen. Wir müssen ja gleich los. Ich lasse die Tür kurz offen, ja?«
»In Ordnung!«
Ein paar Minuten später lag ein Mix aus Äpfeln, Trauben und Karotten in der Plastikdose. Als Tessa noch ein Brot schmieren wollte, stellte sie fest, dass es für morgen nicht mehr reichen würde, sie musste Frau Rose bitten, welches zu kaufen. Da hörte sie auch schon wieder die Schritte der Nachbarin in ihrer Wohnung.
»Frau Rose? Wären Sie so nett, heute noch ein Brot zu besorgen?«, rief sie. »Wieder das mit den Sonnenblumenkernen, das schmeckt Julian so gut.«
Sie bekam keine Antwort.
»Frau Rose?« Tessa schaute aus der Küche in den Flur. Bad- und Kinderzimmertür standen halb offen.
In dem Moment trat Frau Rose mit Julian auf dem Arm durch die Wohnungstür, ihre große Handtasche am anderen Arm eingehängt. Die hätte sie ja nun wirklich nicht hin- und herschleppen müssen, doch das war typisch für Frau Rose, die wohl von ihrer eigenen Neugierde auf andere schloss.
Julian zeigte sofort auf sein Knie, auf dem ein neues Tiermotivpflaster klebte. »Da, Oma Dose demacht. Aua. Julian hat aua da.«