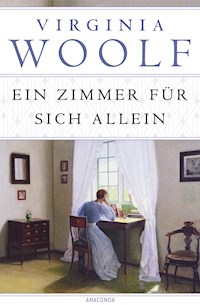
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Um schöpferisch tätig sein zu können, braucht es Freiraum zur Entfaltung, Spielraum für Gedanken und ganz simpel einen Rückzugsraum: ein Zimmer für sich allein. Außerdem Geld. Jahrhundertelang hatten Frauen nichts von alldem. Aus dieser Feststellung entwickelt Virginia Woolf in den 1920er-Jahren bahnbrechende Gedanken zur Poetik wie zum Geschlechterverhältnis. In ihrem berühmten Essay ergründet sie die Voraussetzungen weiblichen Schreibens und wirft ästhetische wie politische Fragen auf, die bis heute nichts an Aktualität eingebüßt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Virginia Woolf
Ein Zimmer für sich allein
Aus dem Englischen von
Christel Kröning
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Titel der englischen Originalausgabe: A Room of One’s Own (London: Hogarth Press 1929)
© 2020 by Anaconda Verlag,einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenAlle Rechte vorbehalten.Umschlagmotiv: Lars Jorde (1865–1939),»Frau am Fenster« (1899), Öl auf Leinwand,Foto © O. Vaering / Bridgeman ImagesUmschlaggestaltung: www.katjaholst.deISBN 978-3-641-27643-0V002www.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Ein Zimmer für sich allein
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Ein Zimmer für sich allein*
1. Kapitel
Aber, so mögen Sie sagen, es sollte doch um Frauen und Literatur gehen. Was hat das mit einem Zimmer, einem Raum für sich zu tun? Lassen Sie mich erklären. Als nämlich das Vortragsthema »Frauen und Literatur« an mich herangetragen wurde, setzte ich mich an ein Flussufer und fragte mich zunächst, was dieser Titel überhaupt bedeuten sollte. Er könnte schlicht ein paar Worte über Fanny Burney bedeuten, ein paar mehr über Jane Austen, dazu eine Würdigung der Brontës in ihrem verschneiten Pfarrhaus in Haworth, möglichst ein paar Bonmots über Miss Mitford, dazu ein ehrfurchtsvoller Verweis auf George Eliot, eine Bemerkung über Mrs Gaskell und dem Thema wäre Genüge getan. Doch auf den zweiten Blick erschien der Titel schon nicht mehr so einfach. Er könnte bedeuten, und vielleicht hatten Sie das auch so vorgesehen, »Frauen und ihre Besonderheiten« oder »Frauen und die von ihnen verfasste Literatur« oder »Frauen und die Literatur, die über sie verfasst wird« oder aber, alle drei Bedeutungen sind auf irgendeine Weise untrennbar miteinander verbunden und ich soll das Thema in genau diesem Lichte betrachten. Doch als ich über diese letzte Sichtweise, die mir auch als die interessanteste erschien, genauer nachdachte, erkannte ich schnell, dass sie einen fatalen Nachteil hatte. Denn wie sollte ich hierzu je ein Endergebnis vorweisen? Es wäre mir unmöglich, die meiner Auffassung nach höchste Pflicht beim Vortragen zu erfüllen, nämlich Ihnen nach der anberaumten Zeit einen Diamanten reinster Wahrheit zu überreichen, den Sie in Ihre Notizblätter gewickelt mit nach Hause nehmen und für alle Ewigkeit auf den Kaminsims stellen können. Alles, was ich Ihnen anzubieten habe, ist meine These zu einem einzigen, untergeordneten Punkt: Eine Frau muss Geld und einen Raum für sich haben, um Literatur zu verfassen. Und diese These lässt, wie Sie sehen werden, die Frage nach dem wahren Wesen der Frauen und dem wahren Wesen der Literatur unbeantwortet. Vor der Pflicht, dazu ein Ergebnis vorzuweisen, habe ich mich gedrückt. Frauen und Literatur werden, was mich angeht, ungelöste Probleme bleiben. Doch als kleine Wiedergutmachung will ich Ihnen zeigen, wie ich zu dem Standpunkt mit dem Geld und dem Raum gekommen bin, will Ihnen so vollumfänglich und offen wie möglich meinen Gedankengang dorthin nachzeichnen. Und während ich das tue, Ihnen also meine Ideen und Ansichten offenbare, werden Sie vielleicht feststellen, dass sie Rückschlüsse auf Frauen und Rückschlüsse auf Literatur zulassen. Wenn es um ein höchst kontroverses Thema geht – und das ist bei Geschlechterthemen immer der Fall –, kann man nie darauf hoffen, die Wahrheit hochzuhalten. Man kann lediglich erklären, wie es zu der Meinung kam, die man da hochhält. Man kann nur anbieten, dass jeder aus den Unzulänglichkeiten, den Eigenarten und der Vorurteilsbehaftung des Gehörten seine eigenen Schlussfolgerungen zieht. Und da hierbei die Erzählung mehr Wahrheit zu enthalten vermag als die Tatsache, möchte ich mir alle literarischen Freiheiten nehmen, um Ihnen von den letzten zwei Tagen zu berichten. Davon, wie ich, gebeugt unter dem Gewicht dieses mir auferlegten Themas, ebenjenes in meinen Gedanken hin und her bewegte, ihm innerhalb und außerhalb meines Alltags einen Sinn verlieh. Ich muss wohl kaum erwähnen, dass nichts des nachfolgend Beschriebenen real ist. Die University of Oxbridge ist eine Erfindung. Ebenso das Fernham College. »Ich« ist lediglich eine handliche Bezeichnung für jemanden, den es nicht gibt. Lüge um Lüge wird mir über die Lippen gehen, doch vielleicht werden die Lügen hier und da auch etwas Wahrheit enthalten. Es ist an Ihnen, diese Wahrheiten herauszulesen und zu entscheiden, ob sie des Aufhebens wert sind. Wenn nicht, dann ab damit in den Papierkorb und schon morgen haben Sie alles wieder vergessen.
Da saß ich nun also (nennen Sie mich Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael oder wie Sie wollen, das ist nicht wichtig) vor ein, zwei Wochen bei schönstem Oktoberwetter an einem Flussufer und verlor mich in meinen Gedanken. Unter dem besagten Joch – Frauen und Literatur –, unter der Last der Aufgabe, dieses heiße Eisen anfassen zu müssen, neigte sich mein Haupt gen Erde. Zu meiner Rechten und meiner Linken erglühte das Ufergebüsch so intensiv golden und purpurn, dass es fast zu brennen schien, und auf der anderen Seite des Flusses wiegten die Weiden in immerwährendem Jammer ihr Haar. Das Wasser spiegelte was ihm gefiel – den Himmel, die Brücke, das entflammte Laub –, und wenn ein Student durch die Spiegelungen hindurchgerudert war, schlossen sie sich hinter ihm wieder, als hätte es ihn nie gegeben. Ganze Tage hätte man sich an diesem Ort in seinen Gedanken verlieren können. Die Konzentration – um sie bei einem ungebührlich stolzen Namen zu nennen – hatte ihre Angelschnur ins Wasser geworfen, wo jene nun dann und wann zwischen den Spiegelungen und den Algen hin und her trieb, sich von der Strömung bald anheben, bald niederdrücken ließ, bis – Sie kennen den kleinen Ruck – die Zusammenballung einer Idee am Haken hing. Doch was lag nach behutsamem Einholen da im Grase? Ach, wie klein und unbedeutend war meine Idee! Solch ein Fischlein wirft der gute Angler wieder zurück, auf dass es fetter werde und eines Tages wert sei, gebraten und gegessen zu werden. Mit dieser Idee will ich Sie jetzt auch gar nicht weiter belästigen. Aber wenn Sie ganz aufmerksam sind, werden Sie sie im Folgenden noch aufscheinen sehen.
Jedenfalls teilte diese Idee, war sie auch noch so klein, die geheimnisvolle Natur ihrer Art und wurde, nachdem ich sie in den Geist zurückgeworfen hatte, mit einem Mal ungemein aufregend und wichtig, und scheuchte, indem sie wild umher und auf und ab schoss, gleich einen solchen Ideenschwarm auf, dass es mir unmöglich wurde sitzenzubleiben. Stattdessen fand ich mich hastigen Schrittes auf einem Rasenstück wieder. Und prompt erhob sich eine Männergestalt. Dass das wilde Gestikulieren dieses noch fernen Objekts in Gehrock und Frackhemd mir galt, begriff ich erst, als der Ausdruck von Schrecken und Empörung auf seinem Gesicht im Näherkommen immer deutlicher wurde. Mein Instinkt reagierte schneller als mein Verstand. Er war ein Pedell, ich eine Frau. Dort war der Fußweg, hier der Rasen. Auf den Rasen durften nur Studenten und Dozenten. Ich gehörte auf den Kiespfad. All dies ging mir binnen eines Augenblicks durch den Kopf. Nachdem ich meine Schritte zurück auf den Pfad gelenkt hatte, sanken die pedell’schen Arme in Frieden, seine Züge wiedererlangten ihre übliche Gefasstheit und abgesehen davon, dass es sich auf Rasen bequemer läuft als auf Kies, war kein größerer Schaden entstanden. Das Einzige, was ich den Studenten und Dozenten dieses Colleges vorwerfen konnte, war, dass sie beim Beschützen ihres seit dreihundert Jahren gehegten und gepflegten Rasens, mein kleines Fischlein in die Flucht getrieben hatten.
Aufgrund welcher Idee ich mich zu jenem unbefugten Betreten erkühnt hatte, wollte mir beim besten Willen nicht mehr einfallen. Stattdessen senkte sich, wie eine Wolke aus dem Paradies, die Gleichmut auf mich hernieder. Sollte es wahre Gleichmut geben, dann herrscht sie an einem prächtigen Oktobermorgen auf den Wegen und Plätzen der Oxbridge. Zwischen den altehrwürdigen Gebäuden war die raue Gegenwart wie fortgeschmirgelt. Mein Körper war ganz wundersam wie von einer schalldichten Glasvitrine umgeben, sodass mein Geist jeglichem Kontakt mit den Tatsachen enthoben zu sein schien (solange ich nur nicht wieder auf den Rasen tappte), und sich daher völlig frei jedwedem aus dem Moment geborenen Gedankenspiel hingeben konnte. Wie der Zufall es also wollte, erinnerte ich mich an einen Essay über einen Sommerferienbesuch in Oxbridge und damit an Charles Lamb – »Saint Charles«, wie einst Thackeray sagte, als er sich Lambs Brief vor die Stirn hielt. Tatsächlich ist wohl unter den Toten (so war mein Gedankengang) Lamb einer der genialsten. Einer, den man hätte fragen wollen: »Wie haben Sie nur Ihre Essays zuwege gebracht?« Diese Essays, mit denen selbst die Vollkommenheit eines Max Beerbohm noch übertroffen wird, dachte ich, weil bei Lamb die wilde Fantasie aufflammt, das grelle Licht des Genies, wodurch seine Texte zwar unvollkommen erscheinen, andererseits aber gekrönt sind von Poesie. Jedenfalls kam Lamb vor etwa hundert Jahren nach Oxbridge und schrieb natürlich einen Essay – der Titel will mir nicht einfallen –, einen Essay über ein Gedichtmanuskript von Milton, das ihm hier unterkam, Lycidas, glaube ich. Er schrieb über sein Entsetzen angesichts der Erkenntnis, dass anstelle jedes Wortes in dem ihm bekannten Lycidas auch ein anderes möglich gewesen wäre. Dass Milton dieses Gedicht auch ganz anders hätte gestalten können, kam ihm wie ein Sakrileg vor. Sodann rief ich mir die Zeilen ins Gedächtnis, die ich noch von Lycidas auswendig wusste, und machte mir einen Spaß daraus, zu überlegen, welche Worte Milton wohl geändert hatte und warum. Und plötzlich wurde mir bewusst, dass sich eben jenes Lycidas-Manuskript nur wenige hundert Meter von mir entfernt befand, sodass ich in Lambs Fußstapfen tretend die berühmte Bibliothek aufsuchen könnte, in welcher dieser Schatz verwahrt liegt. Und nicht nur dieser Schatz, so fiel mir ein, während ich den Plan schon in die Tat umzusetzen begann, sondern auch Thackerays Esmond, der als sein vollkommenster Roman gilt, obwohl er darin, wenn ich mich recht erinnere, teilweise unnötig gestelzt formuliert, und damit so wirkt, als hätte er den Schreibstil des achtzehnten Jahrhunderts nachahmen wollen. Es sei denn allerdings, jener Schreibstil wäre sein natürlicher gewesen, was ich leicht nachprüfen könnte, indem ich das Manuskript darauf untersuchte, ob die stilistischen Abweichungen zugunsten des Stils oder zugunsten des Inhalts entstanden sind. Dafür wiederum müsste ich allerdings erst einmal unterscheiden, was Stil war und was Inhalt, sodass … Doch da stand ich auch schon vor der Tür der berühmten Bibliothek höchstselbst. Ich muss sie wohl geöffnet haben, denn unverzüglich rauschte missbilligend, gleich einem himmlischen Wächter mit aufbauschendem Talar statt Flügeln, ein graumelierter, höflicher Gentleman heran, der mir im Fortscheuchen noch bedauernd zuraunte, dass Damen der Zutritt leider nur in Begleitung eines Collegemitglieds oder mit einem entsprechenden Empfehlungsschreiben gewährt sei.
Wird eine berühmte Bibliothek von einer Frau beschimpft, kümmert das eine berühmte Bibliothek nicht im Geringsten. Hoheitsvoll und unbewegt, mit all den Schätzen sicher im Innern verwahrt, schlummerte sie weiter selbstgefällig vor sich hin und würde, zumindest was mich anging, bis in alle Ewigkeit so weiterschlummern. Nie wieder würde ich jene Echos aufwecken, nie wieder dort um Gastfreundschaft bitten, so nahm ich mir vor, während ich zornig die Eingangstreppe hinunterstapfte. Doch es blieb noch eine Stunde bis zum Mittag, was also tun? Durch die Wiesen streifen? Am Fluss sitzen? Ganz ohne Zweifel herrschte das wundervollste Oktobervormittagswetter. Herbstlaub schwebte rot zu Boden und beides versprach angenehmen Zeitvertreib. Doch da drang Musik an mein Ohr. Kündigte irgendeinen Gottesdienst oder Festakt an. Hinter dem Kapellentor klagte die Orgel in den herrlichsten Tönen. So durchlauchtig klagte sie, dass selbst das große Leid der Christenheit eher nach der Erinnerung daran, denn nach dem echten Gefühl klang. Selbst das Weh der uralten Orgel schmiegte sich in die allgemeine Gleichmut. Ich empfand keinerlei Verlangen hineinzugehen, selbst wenn ich das Recht gehabt hätte, denn womöglich würde mich diesmal der Küster aufhalten und nach meiner Taufurkunde fragen oder nach einem Empfehlungsschreiben des Dekans. Schön sind diese alten Gebäude dennoch, und zwar von außen meist genauso wie von innen. Zudem war es eigentlich schon amüsant genug, die Gemeindemitglieder sich versammeln zu sehen, zuzusehen, wie sie gleich Bienen vor ihrem Stock hinein- und herauswuselten und sich am Eingang ganz geschäftig umherdrehten. Viele trugen Barett und Talar, einige sogar Pelzkragen, andere wurden im Rollstuhl herangefahren, und wieder andere schienen, obschon sie kaum über die Lebensmitte hinaus waren, in dermaßen absonderliche Winkel gequetscht und gefaltet, dass sie jenen großen Krebsen und Krabben glichen, die sich mit Mühe über den Sandboden eines Aquariums hieven. Während ich dies von dort beobachtete, wo ich mich an die Wand gelehnt hatte, kam mir tatsächlich die gesamte Universität wie ein Schutzgebiet für seltene Arten vor, die in freier Wildbahn auf dem Straßenpflaster von The Strand nicht die geringsten Überlebenschancen hätten. Alte Geschichten von alten Dekanen und alten Dozenten fielen mir ein, doch bevor ich den Mut für einen ordentlich lauten Pfiff aufgebracht hatte – denn der alte Professor […], so hieß es, brach bei jedem lauten Pfiff in Galopp aus –, hatte die ehrwürdige Gemeinde sich schon hineinbegeben. Das Äußere der Kapelle blieb. Bekanntermaßen kann man sie mit ihren hohen Fenstern und spitzen Türmen gleich einem Segelschiff, das immer reist und niemals ankommt, des Nachts hell erleuchtet noch aus meilenweiter Ferne von den Anhöhen erkennen. Einst, so lässt sich vermuten, war dieser Campus mit seinen ordentlichen Rasenflächen und seinen hoheitlichen Gebäuden samt Kapelle noch Marschland, auf dem das Gras wehte und die Wildschweinrotten nach Futter wühlten. Pferde- und Ochsengespanne, so dachte ich weiter, mussten die schweren Steine, in deren Schatten ich jetzt stand, aus fernen Ländern hergebracht haben, sodass sie unter unermesslicher Anstrengung einer auf den anderen gehoben werden konnten. Und dann mussten die Glasmaler ihr zerbrechliches Material herschaffen, und die Steinmetze waren jahrhundertelang dort oben beschäftigt mit Kitt und Mörtel, mit Schaufel und Kelle. Jeden Samstag musste jemand Gold und Silber aus ledernen Beuteln in mittelalterliche Hände schütteln, damit alle ihr abendliches Bier und vermutlich ihre Kegelrunde bekamen. Ein schier endloser Strom von Gold und Silber, so dachte ich, musste nach und nach in diesen Campus geflossen sein, damit weiter geliefert wurde und die Arbeiter weiter gruben und begradigten und Gräben legten. Doch es war das fromme Mittelalter und Geld wurde bereitwillig ausgeschüttet, um diese Steine auf ein sicheres Fundament zu stellen. Und während sie höher und höher wuchsen, schütteten immer mehr Könige, Königinnen und mächtige Adlige ihre Truhen aus, damit hier Hymnen gesungen und Studenten gelehrt werden konnten. Land wurde vergeben, der Zehnte gezahlt. Und als das fromme Mittelalter vorüber war und die Aufklärung begann, brach der Strom aus Gold und Silber nicht ab. Stipendien wurden gegründet, Lehrstühle finanziert. Nur floss das Geld nicht mehr aus den Truhen des Königs, sondern aus den Kassen von Kaufleuten und Fabrikanten, aus den Geldbörsen von Männern, die sich zum Beispiel in der Industrie ein Vermögen aufgebaut hatten und der Universität, an der sie ausgebildet worden waren, einen großzügigen Anteil für weitere Lehrstühle, Dozenturen und Stipendien vererbten. Daher die Observatorien und Bibliotheken, daher die glänzenden Gerätschaften in den Vitrinen der Laboratorien, wo einst das Gras wehte und die Wildschweinrotten nach Futter wühlten. Tief genug, so schien mir, während ich weiter über den Campus schlenderte, war das Fundament aus Gold und Silber gegossen worden. Das Pflaster lag eben und fest über dem wilden Gras. Bedienstete balancierten Tabletts auf dem Kopf und eilten geschäftig von Treppe zu Treppe. Farbenfroh bestückte Blumenkästen zierten die Fenster eines Zimmers, aus dem das gepresste Geplärre eines Grammophons drang. Zwangsläufig wurde ich wieder nachdenklich. Doch wo auch immer diese Gedanken hingeführt hätten, sie wurden unterbrochen. Die Uhr schlug zwölf. Es war Zeit fürs Mittagsmahl.
Schon sonderbar, wie gerne Romane uns glauben lassen, ausnahmslos jede Mittagsgesellschaft würde durch einen geistreichen Ausspruch oder eine weise Tat unvergesslich bleiben. Nur selten erwähnen sie dabei, was auf den Tisch kam. Die Konventionen des Romans schreiben vor, weder Suppe, noch Lachs oder Entenbraten zu nennen, ganz so, als hätten Suppe und Lachs oder Entenbraten keinerlei Bedeutung, als hätte noch nie jemand eine Zigarre geraucht oder ein Glas Wein getrunken. Genau mit diesen Konventionen werde ich hingegen brechen und mir die Freiheit erlauben, Ihnen von der Seezunge im tiefen Teller zu berichten, deren hellbraun gesprenkelte schneeweiße Sahnedecke mich an die Flanke eines Rehs erinnerte. Als zweiter Gang: Rebhuhn. Doch wer hier an einsame nackte Vögel denkt, irrt gewaltig. Zahlreich und in großer Vielfalt hielten sie Einzug und hatten ihr gesamtes Gefolge aus Soßen und Salaten dabei, die süßen und die würzigen hübsch nacheinander. Dazu Kartoffelscheiben, dünn wie Münzen, nur ungleich zarter. Und junger Kohl, feinblättrig wie Rosenknospen, nur ungleich saftiger. Und kaum waren die Bratvögel samt Gefolge verzehrt, stellte der diskrete Diener, der vielleicht eine sanftere Manifestation des Pedells vom Vormittage war, eine von Servietten umkränzte, puderbezuckerte Süßspeise vor uns hin, die »Pudding« zu nennen und sie dadurch mit Reis und Tapioka in Verbindung zu bringen, eine Beleidigung dargestellt hätte. In der Zwischenzeit waren die Weingläser ergilbt und errötet, geleert und aufgefüllt. Und sie erweckten allmählich etwa auf Hälfte des Rückgrats, im Sitz der Seele, nicht etwa das grell-elektrische Licht namens Scharfsinn, welches einem dann und wann zwischen den Lippen hervorspringt, sondern jenes weichere und urwüchsigere Glühen aus der Tiefe, jene bernsteingelbe Flamme des Gedankenaustauschs. Kein Grund zur Eile. Kein Grund zum Wetteifern. Kein Grund, jemand anders zu sein als man selbst. Wir kommen alle in den Himmel und van Dyck kommt mit. In anderen Worten: Wie schön das Leben war, wie reich es belohnte, wie schnell jeder Groll und jedes Grämen dahinschrumpfte, wie gut sich Freundschaft und die Gesellschaft der Artgenossen anfühlte, während man mit einer guten Zigarette in die weichen Kissen der Fensterbank sank.
Hätte dort ein Aschenbecher gestanden, hätte ich nicht stattdessen die Asche aus dem Fenster schnippen müssen, wäre alles ein klein wenig anders gewesen, denn dann hätte ich vermutlich nicht die schwanzlose Katze bemerkt. Doch der Anblick dieses gestutzten, kupierten Tieres, das da mit weichen Pfoten über die Grünfläche schlich, veränderte durch einen Zufallstreffer im Unterbewusstsein die Lichtstimmung für mich. Es war, als hätte jemand den Lampenschirm vom Fuß gestoßen. Vielleicht ließ die Wirkung des guten Rieslings nach. Auf jeden Fall schien mir, während die Manx-Katze mitten auf dem Rasen in einer Art innehielt, als stellte auch sie das Universum infrage, etwas zu fehlen. Etwas schien anders zu sein. Doch was fehlte? Was war anders? So fragte ich mich. Und um dies zu beantworten, musste ich mich aus dem Zimmer hinaus in die Vergangenheit denken, in die Vergangenheit vor dem Krieg, wo ich eine Mittagsgesellschaft in einem anderen Zimmer heraufbeschwor, in einem, das gar nicht weit entfernt war, nur anders. Völlig anders. Hinter mir plätscherten währenddessen geschmeidig, zwanglos und angenehm die Gespräche der zahlreichen jungen Gäste beiderlei Geschlechts dahin. Und als ich ihre Gespräche mit den soeben heraufbeschworenen verglich, bestand für mich keinerlei Zweifel, dass die einen Nachkommen der anderen waren, ihre rechtmäßigen Erben. In allem waren sie gleich geblieben, in nichts hatten sie sich verändert, außer – und hierbei horchte ich angestrengt weniger auf das Gesagte als vielmehr auf das Fließen und Wispern hinter dem Gesagten –, aber ja! Da war es, was anders war. Vor dem Krieg hätte man während einer Gesellschaft wie dieser genau die gleichen Unterhaltungen gehört, aber geklungen hätten sie anders, weil in ihnen damals etwas mitschwang, ein Raunen, das zwar keinen Sinn, aber eine Melodie mitbrachte, eine Spannung, die den Wert des Gesprochenen veränderte. War es möglich, dieses Raunen in Worte zu fassen? Mit Unterstützung der Dichter vielleicht. Ein Buch lag neben mir, das schlug ich auf und blätterte wie von selbst zu Tennyson. Und Tennyson sang:
Eine Träne liegt schillernd in der Sonne,
fiel von der Passionsblumenblüte am Tor.
Oh, sie kommt, meine Taube, meine Wonne.
Mein Leben, mein Schicksal tritt hervor.
Und die rote Rose ruft: »Bald ist sie hie, bald ist sie hie.«
»Sie ist spät«, klagt die weiße, die zarte.
Und der Rittersporn lauscht: »Ich höre sie, ich höre sie.«
Derweil die Lilie flüstert: »Ich warte.«
Raunten das die Männer während solcher Gesellschaften vor dem Krieg? Und die Frauen?
Mein Herz ist ein Vogel
In seinem Nest im Auenwaldessaum,
Ein mit reifer Früchte Zier
Schwer behängter Apfelbaum,
Ein perlmuttnes Muscheltier
Bei spiegelglatter See.
Mein Herz ist glücklicher denn je,
Denn meine Liebe kam zu mir.
Raunten das die Frauen während solcher Gesellschaften vor dem Krieg?
Der Gedanke daran, dass Gäste während solcher Gesellschaften vor dem Krieg dergleichen, und wenn auch nur lautlos, vor sich hin geraunt hatten, erschien mir so grotesk, dass ich laut auflachen und dies mit einem Fingerzeig auf die Manx-Katze erklären musste, die in der Tat ziemlich absurd aussah, wie sie da so ohne Schwanz herumhockte. War das arme Tier wahrhaftig ohne Schwanz auf die Welt gekommen? Oder hatte es ihn bei einem Unfall verloren? Die schwanzlose Katze ist, selbst wenn es einige von ihnen auf der Isle of Man geben soll, seltener als man denkt. Sie ist eine absonderliche Erscheinung, eher drollig als schön. Schon komisch, was für einen Unterschied so ein Schwanz macht – na, und so weiter, was man eben sagt, wenn eine Mittagsgesellschaft sich langsam auflöst und alle nach ihren Hüten und Mänteln greifen.
Diese hier hatte dank der Gastfreundschaft des Hausherrn bis in den späten Nachmittag gedauert. Der schöne Oktobertag neigte sich dem Ende und buntes Laub trudelte auf die Allee, die ich durchschritt. Tor um Tor, so schien es, schloss sich hinter mir mit sanfter Endgültigkeit. Zahllose Pedellmanifestationen schoben zahllose Schlüssel in gut geölte Schlösser. Man sicherte das Schatzhaus für eine weitere Nacht. Die Allee





























