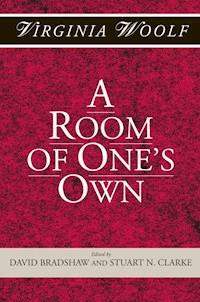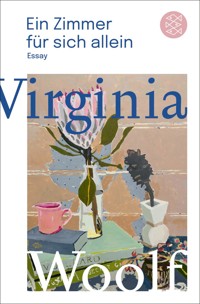
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein eigenes Zimmer« entstand aus zwei Vorträgen, die Virginia Woolf 1928 am Girton College in Cambridge hielt, und wurde zu einem ikonischen Essay feministischen Denkens, der bis heute nicht an Gültigkeit verloren hat. Von der Frage, warum eine Frau Geld und ein eigenes Zimmer haben muss, wenn sie schreiben will, über Autorinnen wie Jane Austen und die Brontë-Schwestern bis hin zur tragischen Geschichte von Shakespeares (fiktiver) Schwester Judith, ist und bleibt Virginia Woolfs vielleicht bekanntester Essay ein leidenschaftliches Plädoyer für weibliche Kunst, Kreativität und Unabhängigkeit in einer von Männern dominierten Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Virginia Woolf
Ein Zimmer für sich allein
Essay
Biografie
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Ein Zimmer für sich allein
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Anhang
Nachbemerkung
Ein Zimmer für sich allein
Dieser Essay basiert auf zwei Vorträgen, die in der Arts Society am Newnham College und im Odtaa am Girton College im Oktober 1928 gehalten wurden. Die Vorträge waren zu lang, um vollständig verlesen zu werden, und sind seitdem verändert und erweitert worden. Virginia Woolf [VW]
Odtaa ist der Titel eines Romans von John Masefield (1926) und ist ein Akronym von ›one damn thing after another‹.
1. Kapitel
Aber, werden Sie sagen, wir haben Sie gebeten, über Frauen und Literatur zu sprechen – was hat das mit einem eigenen Zimmer zu tun? Ich werde versuchen, es zu erklären. Als Sie mich baten, über Frauen und Literatur zu sprechen, setzte ich mich ans Ufer eines Flusses und begann zu überlegen, was die Worte bedeuteten. Sie könnten einfach einige Bemerkungen über Fanny Burney bedeuten; einige weitere über Jane Austen; eine Huldigung an die Brontës und eine Schilderung des Pfarrhauses von Haworth im Schnee; etwas Witziges, wenn möglich, über Miss Mitford; eine respektvolle Anspielung auf George Eliot; einen Hinweis auf Mrs Gaskell,[1] und man wäre fertig. Aber auf den zweiten Blick schienen die Worte nicht so einfach zu sein. Der Titel Frauen und Literatur könnte bedeuten, und so haben Sie ihn vielleicht gemeint, Frauen und wie sie sind; oder er könnte bedeuten, Frauen und die Literatur, die sie schreiben; oder er könnte bedeuten, Frauen und die Literatur, die über sie geschrieben wird; oder er könnte bedeuten, dass irgendwie alle drei untrennbar miteinander vermengt sind und dass Sie von mir erwarten, sie in diesem Licht zu betrachten. Aber als ich begann, das Thema in dieser letzten Weise zu betrachten, die am interessantesten schien, sah ich bald, dass sie einen entscheidenden Nachteil hatte. Ich wäre nie in der Lage, zu einer Schlussfolgerung zu kommen. Ich wäre nie in der Lage, die meinem Verständnis nach erste Pflicht einer Rednerin zu erfüllen – Ihnen nach einstündigem Vortrag ein Goldklümpchen reiner Wahrheit auszuhändigen, damit Sie es zwischen die Seiten Ihrer Notizbücher stecken und für alle Zeit auf dem Kaminsims aufbewahren. Ich kann Ihnen lediglich eine Meinung zu einer Nebensache anbieten – eine Frau muss Geld und ein eigenes Zimmer haben, um schreiben zu können; und das lässt, wie Sie sehen werden, die große Frage nach der wahren Natur der Frau und der wahren Natur der Literatur unbeantwortet. Ich habe mich vor der Pflicht gedrückt, in diesen beiden Bereichen zu Schlussfolgerungen zu kommen – Frauen und Literatur bleiben, soweit es mich angeht, ungelöste Probleme. Aber um das ein wenig wettzumachen, werde ich tun, was ich kann, um Ihnen zu zeigen, wie ich zu dieser Meinung über das Zimmer und das Geld gelangt bin. Ich werde in Ihrer Gegenwart so ausführlich und freimütig, wie ich kann, den Gedankengang entwickeln, der mich zu dieser Ansicht geführt hat. Wenn ich die Vorstellungen, die Vorurteile bloßlege, die dieser Behauptung zugrunde liegen, werden Sie merken, dass sie gewisse Auswirkungen auf Frauen haben und gewisse auf Literatur. Jedenfalls, wenn ein Thema höchst umstritten ist – und jede Frage zum Thema Geschlecht ist das –, kann man nicht hoffen, die Wahrheit zu sagen. Man kann nur zeigen, wie man zu seiner Meinung gelangt ist, welche es auch sei. Man kann seinen Zuhörerinnen nur die Gelegenheit geben, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen, während sie die Grenzen, die Vorurteile, die Abneigungen der Rednerin wahrnehmen. Die Erfindungen der Literatur enthalten in dieser Hinsicht wahrscheinlich mehr Wahrheit als Wirklichkeit. Ich schlage deshalb vor, Ihnen unter Ausnutzung aller Vorrechte und Freiheiten einer Romanschriftstellerin die Geschichte der zwei Tage zu erzählen, die meiner Ankunft hier vorausgingen – wie ich, niedergebeugt vom Gewicht des Themas, das Sie auf meine Schultern gelegt haben, es drehte und wendete und es innerhalb und außerhalb meines Alltags rumoren ließ. Ich brauche nicht zu sagen, dass Dinge, die ich gleich beschreiben werde, so nicht existieren; Oxbridge ist eine Erfindung; desgleichen Fernham;[2] »ich« ist nur ein zweckmäßiges Wort für jemanden, den es nicht wirklich gibt. Lügen werden von meinen Lippen fließen, aber es könnte ihnen vielleicht eine gewisse Wahrheit beigemischt sein; es ist an Ihnen, diese Wahrheit aufzuspüren und zu entscheiden, ob irgendein Teil davon bewahrenswert ist. Wenn nicht, werden Sie das Ganze kurzerhand in den Papierkorb werfen und vergessen.
Da war ich also (nennen Sie mich Mary Beton, Mary Seton, Mary Carmichael[3] oder wie immer es Ihnen gefällt – es ist vollkommen unwichtig) und saß vor ein oder zwei Wochen bei schönem Oktoberwetter am Ufer eines Flusses, in Gedanken versunken. Jenes Joch, von dem ich gesprochen habe, Frauen und Literatur, der Zwang, bei einem Thema, das alle Arten von Voreingenommenheiten und Leidenschaften weckt, zu einer Schlussfolgerung zu kommen, beugte meinen Kopf zu Boden. Zur Rechten und Linken standen Sträucher, golden und karminrot, glühten von der Farbe, schienen sogar verbrannt von der Hitze, dem Feuer. Weiter fort am Ufer weinten die Weiden in unablässiger Klage, das Haar um die Schultern. Der Fluss spiegelte von Himmel und Brücke und brennendem Baum, was ihm gerade gefiel, und als der Student sein Boot durch diese Spiegelungen gerudert hatte, schlossen sie sich wieder, vollständig, als hätte es ihn nie gegeben. Man hätte dort rund um die Uhr sitzen können, in Gedanken versunken. Die Gedanken – um sie mit einem stolzeren Namen zu belegen, als sie verdienten – hatten ihre Angelschnur in den Wasserlauf hinuntergelassen. Sie schwang, Minute um Minute, hierhin und dorthin zwischen den Spiegelungen und den Pflanzen, ließ sich vom Wasser heben und senken, bis – Sie kennen den kleinen Ruck – die plötzliche Verdichtung einer Idee am Ende der Angelschnur: und dann das behutsame Einholen und das sorgfältige Ausbreiten? Doch leider, im Gras ausgelegt, wie klein, wie unbedeutend sah da mein Gedanke aus; ein Fisch der Art, wie ihn ein guter Angler ins Wasser zurückwirft, damit er dicker werden kann und es sich eines Tages lohnt, ihn zu kochen und zu essen. Ich will Sie jetzt mit diesem Gedanken nicht behelligen, obwohl Sie ihn bei genauem Hinsehen in dem, was ich sagen werde, selbst finden können.
Aber wie klein er auch war, er besaß trotzdem die geheimnisvolle Eigenschaft seiner Art – in den Kopf zurückgesteckt, wurde er sofort sehr aufregend, und wichtig; und während er huschte und tauchte und hierhin und dorthin schoss, löste er solch einen Schwall und Tumult von Ideen aus, dass es unmöglich war, stillzusitzen. So kam es, dass ich in außerordentlicher Eile über eine Grasfläche ging. Augenblicklich erhob sich die Gestalt eines Mannes, um mir den Weg abzuschneiden. Anfangs verstand ich gar nicht, dass das Gestikulieren des seltsam aussehenden Ungetüms in Gehrock und Frackhemd an mich gerichtet war. Sein Gesicht drückte Entsetzen und Entrüstung aus. Instinkt, nicht Vernunft, kam mir zu Hilfe; er war ein Pedell; ich war eine Frau. Dies war der Rasen; dort war der Weg. Hier sind nur die Fellows und die Gelehrten zugelassen; mein Ort ist der Kies. Solche Gedanken waren das Werk eines Augenblicks. Als ich mich auf den Weg zurückbegab, sanken die Arme des Pedells herab, sein Gesicht glättete sich zu gewohnter Ruhe, und obwohl es sich auf Rasen besser geht als auf Kies, war kein großer Schaden angerichtet worden. Die einzige Beschuldigung, die ich gegen jene – welchem College auch immer angehörenden – Fellows und Gelehrten vorbringen konnte, war, dass sie zum Schutz ihres seit 300 Jahren unablässig gewalzten Rasens meinen kleinen Fisch verscheucht hatten.
Welche Idee mich zu so kühner Übertretung veranlasst hatte, wusste ich jetzt nicht mehr. Der Geist des Friedens senkte sich wie eine Wolke vom Himmel, denn wenn der Geist des Friedens irgendwo wohnt, dann in den Höfen und Gevierten von Oxbridge an einem schönen Oktobermorgen. Beim Schlendern durch jene Colleges, vorbei an jenen uralten Gebäuden, schien die Rauheit der Gegenwart fortgeglättet; der Körper schien in eine wundersame Glasvitrine eingeschlossen, die kein Geräusch durchdringen konnte, und der Geist, aller Berührungen mit der Wirklichkeit enthoben (es sei denn, man betrat wieder den Rasen), war frei, sich jeglicher Kontemplation zu überlassen, die mit dem Augenblick in Einklang stand. Wie der Zufall es wollte, weckte ein flüchtiger Gedanke an einen alten Essay über ein Wiedersehen mit Oxbridge in den großen Ferien die Erinnerung an Charles Lamb[4] – der heilige Charles, sagte Thackeray, sich einen Brief von Lamb an die Stirn haltend. Es ist wahr, unter all den Toten (ich gebe Ihnen meine Gedanken wieder, wie sie mir kamen) ist Lamb einer der sympathischsten; einer, den man gern gefragt hätte: Sagen Sie, wie haben Sie eigentlich Ihre Essays geschrieben? Denn seine Essays sind sogar denen von Max Beerbohm[5] überlegen, bei aller Perfektion, die diese haben, dachte ich, aufgrund jener Feuergarbe der Phantasie, jenes Blitzschlags der Genialität mitten hinein, der ihnen Mängel zufügt und die Vollkommenheit nimmt, sie aber mit Poesie bestirnt. Lamb besuchte also Oxbridge vor vielleicht hundert Jahren. Er schrieb einen Essay – dessen Titel mir entfallen ist – über die Handschrift eines Gedichts von Milton[6], die er hier sah. Vielleicht war es Lycidas, und Lamb schrieb, wie sehr es ihn erschreckte, irgendein Wort in Lycidas könnte anders gelautet haben, als es jetzt lautet. Der Gedanke, Milton könnte Wörter in diesem Gedicht geändert haben, erschien ihm wie ein Sakrileg. Das brachte mich darauf, meine Erinnerungen an Lycidas hervorzuholen und mich dem Ratespiel zu widmen, welches Wort Milton geändert haben könnte und warum. Dann fiel mir ein, dass eben jene von Lamb betrachtete Handschrift nur wenige hundert Meter entfernt lag, so dass man Lambs Schritten über den Innenhof hinweg folgen konnte bis in jene berühmte Bibliothek,[7] in der dieser Schatz aufbewahrt wird. Außerdem, erinnerte ich mich, als ich diesen Plan in die Tat umsetzte, wird in dieser berühmten Bibliothek auch die Handschrift von Thackerays Esmond aufbewahrt.[8] Die Kritiker behaupten oft, Esmond sei Thackerays gelungenster Roman. Aber das Affektierte des Stils, mit seiner Nachahmung des achtzehnten Jahrhunderts, stört einen, soweit ich mich erinnere; falls nicht etwa der Stil des achtzehnten Jahrhunderts der Thackeray naturgemäße war – eine Tatsache, die man überprüfen könnte, wenn man sich die Handschrift vornähme, um zu sehen, ob die Änderungen dem Stil galten oder dem Sinn. Aber dann müsste man entscheiden, was Stil und was Bedeutung ist, eine Frage die – aber hier stand ich tatsächlich vor der Tür, die in die Bibliothek selbst führt. Ich muss sie geöffnet haben, denn augenblicklich erschien, wie ein Schutzengel mit einem Geflatter schwarzen Talars statt weißer Flügel den Weg versperrend, ein abwehrender, silbriger, freundlicher Herr, der, indes er mich fort winkte, mit leiser Stimme bedauerte, dass Damen nur Zutritt zu der Bibliothek haben, wenn sie von einem Fellow des College begleitet werden oder ein Empfehlungsschreiben vorweisen.
Dass eine berühmte Bibliothek von einer Frau verflucht worden ist, bleibt einer berühmten Bibliothek vollkommen gleichgültig. Ehrwürdig und gelassen, all ihre Schätze sicher in ihrer Brust eingeschlossen, schläft sie selbstzufrieden und wird, soweit es mich angeht, ewig so weiterschlafen. Niemals werde ich jene Echos wecken, niemals werde ich wieder um jene Gastfreundschaft bitten, schwor ich, als ich im Zorn die Treppe hinunterstieg. Es blieb immer noch eine Stunde bis zum Lunch, und was sollte man damit anfangen? Über die Wiesen schlendern? am Fluss sitzen? Gewiss, es war ein wunderschöner Herbstmorgen; die Blätter flatterten rot zu Boden; beides versprach keine sonderliche Mühsal. Aber der Klang von Musik drang an mein Ohr. Ein Gottesdienst oder eine Feierstunde war im Gange. Die Orgel beklagte sich erhaben, als ich an der Kirchentür vorbeikam. Sogar das Leid der Christenheit klang in dieser heiteren Luft eher wie die Erinnerung an Leid als das Leid selbst; sogar das Stöhnen der uralten Orgel schien in Frieden eingehüllt. Ich hatte nicht den Wunsch, einzutreten, sollte ich das Recht dazu haben, und diesmal hätte der Küster mich vielleicht aufgehalten und mir meinen Taufschein abverlangt, oder ein Empfehlungsschreiben des Dekans. Aber das Äußere dieser prächtigen Gebäude ist oft ebenso schön wie das Innere. Überdies war es unterhaltsam genug, zuzuschauen, wie sich die Gemeinde versammelte, wie die Mitglieder hineingingen und wieder herauskamen, geschäftig am Portal der Kirche wie Bienen am Flugloch eines Bienenkorbs. Viele waren in Barett und Talar; manche hatten Pelzchen auf den Schultern; andere wurden in Rollstühlen hineingeschoben; wieder andere, obwohl nicht über die mittleren Jahre hinaus, schienen zu so eigentümlichen Gestalten geknifft und geknüllt, dass sie an jene riesigen Krabben und Krebse erinnerten, die sich mühsam über den Sand eines Aquariums schleppen. Als ich so an der Mauer lehnte, erschien mir die Universität in der Tat als ein Refugium, in dem seltene Arten bewahrt werden, die bald eingehen würden, wären sie dem Existenzkampf auf dem Pflaster der Strand[9] ausgeliefert. Alte Geschichten von alten Dekanen und alten Doktoren kamen mir wieder in den Sinn, aber bevor ich meinen Mut zusammengenommen hatte, um zu pfeifen – es wurde erzählt, dass beim Ertönen eines Pfiffs der alte Professor prompt in Galopp fiel –, war die ehrwürdige Gemeinde ins Innere gegangen. Das Äußere der Kirche blieb. Wie Sie wissen, sieht man ihre hohen Kuppeln und Spitztürme, wie ein immer dahinziehendes, niemals ankommendes Segelschiff, bei Nacht hell erleuchtet und meilenweit wahrnehmbar, bis weithin über die Hügel. Vermutlich war einst dieser Innenhof mit seinen glatten Rasenflächen, seinen wuchtigen Gebäuden und selbst der Kirche ebenfalls Sumpfland, wo die Gräser wogten und die Schweine wühlten. Pferde- und Ochsengespanne, dachte ich, mussten die Steine in Fuhrwerken von fernen Grafschaften hergezogen haben, und dann wurden in unendlicher Fronarbeit die grauen Quader, in deren Schatten ich jetzt stand, einer säuberlich auf den anderen geschichtet, und dann brachten die Maler ihr Glas für die Fenster, und die Maurer werkelten jahrhundertelang oben auf jenem Dach mit Kitt und Mörtel, Schippe und Kelle. Jeden Samstag musste jemand Gold und Silber aus einem ledernen Geldbeutel in ihre uralten Fäuste geschüttet haben, denn am Abend vergnügten sie sich vermutlich bei Bier und Kegelspiel. Ein endloser Strom aus Gold und Silber, dachte ich, musste unablässig in diesen Hof geströmt sein, damit immerfort die Steine kamen und die Maurer arbeiteten; ebneten und aushoben, gruben und drainierten. Aber es war damals das Zeitalter des Glaubens, und Geld wurde freigebig ausgeschüttet, um diese Steine auf ein tiefes Fundament zu setzen, und als die Steine aufgerichtet waren, floss weiteres Geld herein aus den Schatztruhen von Königen und Königinnen und Fürsten, um sicherzustellen, dass hier Choräle gesungen und Scholaren unterrichtet wurden. Ländereien wurden übertragen; Zehnte wurden bezahlt. Und als das Zeitalter des Glaubens vorüber und das Zeitalter der Vernunft gekommen war, floss derselbe Strom aus Gold und Silber immer noch; Fellowships wurden gegründet; Lehrstühle gestiftet; nur floss das Gold und Silber jetzt nicht mehr aus den Schatztruhen des Königs, sondern aus den Schatullen von Kaufleuten und Fabrikanten, aus den Geldbörsen von Männern, die, zum Beispiel, als Unternehmer ein Vermögen gemacht hatten und in ihren Testamenten einen großzügigen Teil davon zurückgaben, um weitere Lehrstühle, weitere Professuren, weitere Fellowships für die Universität zu stiften, an der sie ihr Handwerk gelernt hatten. Daher die Bibliotheken und Laboratorien; die Observatorien; die vorzügliche Ausstattung mit kostspieligen und empfindlichen Instrumenten, die jetzt auf Glasborden stehen, wo vor Jahrhunderten die Gräser wogten und die Schweine wühlten. Gewiss schien, während ich rings um den Hof schlenderte, das Fundament aus Gold und Silber tief genug; das Pflaster fest ausgelegt über den wilden Gräsern. Männer mit Tabletts auf den Köpfen gingen geschäftig von Treppenhaus zu Treppenhaus. Bunte Blumen blühten in Fensterkästen. Grammophonklänge schallten aus den Zimmern dahinter. Es war unmöglich, nicht zu überlegen – der Überlegung, welche es auch gewesen sein mag, wurde der Faden abgeschnitten. Die Uhr schlug. Es war Zeit, den Weg zum Lunch zu finden.
Es ist eine merkwürdige Tatsache, dass Romanautoren uns gerne glauben machen wollen, Lunchgesellschaften seien ausnahmslos denkwürdig, weil auf ihnen etwas sehr Witziges gesagt oder etwas sehr Weises getan wurde. Aber sie erübrigen selten ein Wort für das, was gegessen wurde. Es gehört zur Gepflogenheit des Romanautors, Suppe und Lachs und Ente nicht zu erwähnen, als wären Suppe und Lachs und Ente vollkommen unwichtig, als rauchte niemand je eine Zigarre oder tränke ein Glas Wein. Hier werde ich mir jedoch die Freiheit nehmen, mich über diese Gepflogenheit hinwegzusetzen und Ihnen zu erzählen, dass der Lunch bei diesem Anlass mit Seezungen in einer tiefen Schüssel begann, über die der College-Koch eine Decke aus weißestem Rahm gebreitet hatte, nur hie und da unterbrochen von braunen Flecken wie die Flecke auf den Flanken einer Damhirschkuh. Danach kamen die Rebhühner, aber wenn Ihnen dies ein paar kahle, braune Vögel auf einem Servierteller in den Sinn riefe, dann irrten Sie. Die Rebhühner, zahlreich und vielfältig, kamen mit all ihrem Gefolge der Soßen und Salate, der scharfen und der lieblichen, in geordnetem Fortgang; ihren Kartoffeln, dünn wie Münzen, aber nicht so hart; ihren Sprossenkohlköpfchen, aus Blättchen geformt wie Rosenknospen, aber saftiger. Und kaum waren der Braten und sein Gefolge abgetan, schon war der stumme Hausdiener da, vielleicht der Pedell selbst in sanfterer Erscheinungsform, und setzte uns eine von Servietten umkränzte Nachspeise vor, die sich zuckerrein aus den Wellen erhob. Sie Pudding zu nennen und so mit Reis und Sago in Verbindung zu bringen, wäre eine Beleidigung. Unterdessen hatten die Weingläser gelb aufgeleuchtet und karminrot aufgeleuchtet; waren geleert worden; waren gefüllt worden. Und so wurde allmählich mitten in der Wirbelsäule, die der Sitz der Seele ist, ein Feuer entzündet, nicht jenes harte, kleine elektrische Licht, das wir Esprit nennen, wenn es uns auf den Lippen tanzt, sondern das tiefere, feinsinnigere und unterirdischere Leuchten, die üppige gelbe Flamme geistigen Verkehrs. Kein Zwang zur Eile. Kein Zwang zu Geistesblitzen. Kein Zwang, irgendjemand anders zu sein als man selbst. Wir kommen alle in den Himmel, und van Dyck ist mit von der Partie[10] – mit anderen Worten, wie gut das Leben schien, wie süß seine Belohnungen, wie belanglos dieser Grimm oder jener Groll, wie bewundernswert Freundschaft und Gesellschaft Gleichgesinnter, indes man, sich eine gute Zigarette anzündend, in die Kissen des Sitzes am Fenster sank.
Wenn durch einen glücklichen Zufall ein Aschenbecher zur Hand gewesen wäre, wenn man mangels dessen nicht die Asche aus dem Fenster geschnippt hätte, wenn die Dinge ein wenig anders gewesen wären, als sie waren, man hätte sie vermutlich nicht gesehen, die Katze ohne Schwanz. Der Anblick dieses jäh endenden, kupierten Tiers, das auf leisen Pfoten über den Innenhof spazierte, veränderte durch einen plötzlichen Stoß des unbewussten Intellekts für mich das emotionale Licht. Es war, als hätte jemand eine Blende fallen lassen. Vielleicht ließ die Wirkung des vorzüglichen Rheinweins nach. Jedenfalls, während ich beobachtete, wie die Manx-Katze mitten auf dem Rasen stehen blieb, als stellte auch sie das Weltall in Frage, schien etwas zu fehlen, schien etwas anders zu sein. Aber was fehlte, was war anders, fragte ich mich, der Unterhaltung lauschend? Und um diese Frage zu beantworten, musste ich mich aus dem Zimmer hinausdenken, zurück in die Vergangenheit, bis vor den Krieg sogar, und mir das Muster einer anderen Lunchgesellschaft vor Augen halten, die in Zimmern gar nicht weit von diesen stattgefunden hatte; aber anders. Alles war anders. Indessen ging die Unterhaltung zwischen den Gästen weiter, die zahlreich und jung waren, die einen diesen, die anderen jenen Geschlechts; sie ging aufs Geratewohl weiter, sie ging angenehm weiter, ungehemmt, amüsant. Und während sie weiterging, hielt ich sie vor den Hintergrund jener anderen Unterhaltung, und als ich die beiden übereinander passte, hatte ich keinen Zweifel, dass die eine die Nachfahrin, die rechtmäßige Erbin der anderen war. Nichts hatte sich gewandelt; nichts war anders bis auf – hier lauschte ich mit großen Ohren nicht völlig dem, was gesagt wurde, sondern dem Raunen oder der Strömung dahinter. Ja, das war es – da war der Wandel. Vor dem Krieg hätten die Gäste auf einer Lunchgesellschaft wie dieser genau die gleichen Dinge gesagt, aber sie hätten sich anders angehört, denn zu jener Zeit wurden sie von einer Art Summgeräusch begleitet, das nicht deutlich, aber melodisch, aufregend war und die Worte selbst in ihrem Wert veränderte. Konnte man dieses Summgeräusch in Worte setzen? Vielleicht mit Hilfe der Dichter. Ein Buch lag neben mir, ich schlug es auf und blätterte eher zufällig zu Tennyson. Und hier fand ich Tennyson singen:
Von Passionsblumenranken am Tor
Rinnt eine Träne ins Moos.
Ah, sie kommt, die mein Herz sich erkor,
Sie kommt, mein Leben, mein Los.
Rotrose ruft: »Sie ist nah, sie ist nah«,
Weißrose weint: »Verspätet sie sich?«
Rittersporn lauscht: »Sie ist da, sie ist da«,
Lilie flüstert: »Gedulde dich.«[11]
War es das, was Männer auf Lunchgesellschaften vor dem Krieg summten? Und die Frauen?
Mein Herz ist wie ein Vogel heut’,
Dem dichtes Laub sein Nest umflicht;
Mein Herz ist wie ein Apfelbaum,
Dem jeder Ast von Früchten bricht;
Mein Herz ist wie ein Muschelhaus,
Das schwimmt im tiefdurchsonnten Meer,
Und noch viel froher ist mein Herz,
Mein Liebster kam zu mir daher.[12]
War es das, was Frauen auf Lunchgesellschaften vor dem Krieg summten?
Es hatte etwas derart Aberwitziges, sich Menschen vorzustellen, die so etwas auf Lunchgesellschaften vor dem Krieg auch nur leise vor sich hin summten, dass ich laut auflachte und mein Gelächter erklären musste, indem ich auf die Manx-Katze zeigte, die wirklich ein wenig absurd aussah, das arme Tier, ohne Schwanz, mitten auf dem Rasen. War sie tatsächlich so geboren, oder hatte sie ihren Schwanz bei einem Unfall verloren? Die schwanzlose Katze, obwohl es auf der Insel Man einige davon geben soll, ist seltener, als man denkt. Sie ist ein sonderbares Tier, eher kurios als schön. Es ist merkwürdig, welchen Unterschied ein Schwanz ausmacht – was man eben so sagt, wenn eine Lunchgesellschaft zu Ende geht und die Gäste sich ihre Mäntel und Hüte holen.
Diese hier hatte dank der Großzügigkeit unseres Gastgebers bis weit in den Nachmittag gedauert. Der schöne Oktobertag verblasste, und die Blätter fielen von den Bäumen der Allee, durch die ich ging. Tor um Tor schien sich mit sanfter Endgültigkeit hinter mir zu schließen. Unzählige Pedelle steckten unzählige Schlüssel in gut geölte Schlösser; das Schatzhaus wurde für eine weitere Nacht gesichert. Von der Allee gelangt man auf eine Straße – ich habe vergessen, wie sie heißt –, die einen, wenn man die rechte Richtung einschlägt, nach Fernham führt. Aber es blieb noch viel Zeit. Dinner gab es erst um halb acht. Nach solch einem Lunch kam man fast ohne ein Dinner aus. Es ist seltsam, wie ein Bröckchen eines Gedichts sich in den Sinn gräbt und die Beine veranlasst, im Takt dazu auf der Straße zu gehen. Diese Worte –
Von Passionsblumenranken am Tor
Rinnt eine Träne ins Moos.
Ah, sie kommt, die mein Herz sich erkor –
sangen in meinem Blut, als ich rasch nach Headingley ausschritt. Und dann, in das andere Versmaß umschaltend, sang ich, wo das Wasser vom Wehr aufgewirbelt wird:
Mein Herz ist wie ein Vogel heut’,
Dem dichtes Laub sein Nest umflicht;
Mein Herz ist wie ein Apfelbaum …
Was für Dichter, rief ich laut aus, wie man es in der Dämmerung tut, was für Dichter sie doch waren!
Wohl mit einer Art Eifersucht für unser eigenes Zeitalter fragte ich mich dann, so albern und absurd solche Vergleiche auch sind, ob man ehrlich zwei lebende Dichter nennen könnte, die jetzt so bedeutend wären, wie Tennyson und Christina Rossetti es damals waren. Offensichtlich ist es unmöglich, dachte ich, in das schäumende Wasser schauend, sie miteinander zu vergleichen. Der eigentliche Grund, warum jene Lyrik einen zu solchem Überschwang, solcher Verzückung hinreißt, ist, dass sie ein Gefühl feiert, wie man es früher hatte (auf Lunchgesellschaften vor dem Krieg vielleicht), so dass man leicht, in vertrauter Weise darauf anspricht, ohne sich die Mühe zu machen, das Gefühl zu überprüfen oder es mit einem zu vergleichen, das man heute hat. Aber die lebenden Dichter drücken ein Gefühl aus, das gerade erst entsteht und in diesem Augenblick aus uns herausgerissen wird. Man erkennt es anfangs nicht; oft fürchtet man es aus irgendeinem Grund; man beobachtet es scharf und vergleicht es eifersüchtig und misstrauisch mit dem alten Gefühl, das man kannte. Daher die Schwierigkeit der modernen Lyrik; und diese Schwierigkeit führt dazu, dass man sich nicht an mehr als zwei zusammenhängende Zeilen irgendeines guten modernen Dichters erinnern kann. Aus diesem Grund – dass mein Gedächtnis mich im Stich ließ – ging meiner Beweisführung aus Mangel an Material die Luft aus. Aber warum, fuhr ich fort, weiter auf Headingley zugehend, summen wir auf Lunchgesellschaften nicht mehr leise vor uns hin? Warum singt Alfred nicht mehr
Ah, sie kommt, die mein Herz sich erkor?
Warum erwidert Christina nicht mehr
Und noch viel froher ist mein Herz,
Mein Liebster kam zu mir daher?
Sollen wir dem Krieg die Schuld aufladen? Als die Kanonen im August 1914 zu feuern begannen, waren da die Gesichter von Männern und Frauen für einander so klar zu erkennen, dass die romantische Liebe den Tod fand? Ganz gewiss war es ein Schock (besonders für Frauen mit ihren Illusionen über Erziehung und