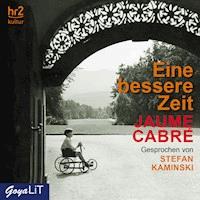11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Miquel ist keine zwanzig Jahre alt, als er den Bruch mit seiner Familie herbeiführt. Er will frei sein, will seinen Leidenschaften und Überzeugungen folgen. Die Textilfabrik, die seine Familie seit sieben Generationen reich macht, interessiert ihn nicht. Stattdessen beginnt er zusammen mit seinem Jugendfreund ein Studium der Literatur an der Universität in Barcelona. Doch schon bald zieht es die beiden jungen Männer aus Faszination für eine Frau in den antifranquistischen Untergrund, und sie laden eine Schuld auf sich, die nie mehr vergeht.
Eine bessere Zeit erzählt vom Aufbegehren gegen die eigene Familie. Es ist ein Roman über die Kraft der Traditionen, über den Glauben an das Schöne angesichts der verlorenen Zeit – sprachgewaltig orchestriert vom Weltbestsellerautor Jaume Cabré.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jaume Cabré
Eine bessere Zeit
Roman(Der Schatten des Eunuchen)
Aus dem Katalanischen von Kirsten Brandt und Petra Zickmann
Insel Verlag
Für Margarida
Männer in deinem Alter sind Wölfe,
ihr tragt nichts als die Zeit in eurem Blick.
Joan Margarit
… for we possess nothing certainly except the past.
Evelyn Waugh
Alban Berg
Inhalt
Erster Teil. Das Geheimnis des Aoristes
Erster Satz. Andante (Präludium)
Zweiter Satz. Allegretto (Scherzando)
Zweiter Teil. Dem Andenken eines Engels
Dritter Satz. Allegro (Cadenza)
Vierter Satz. Adagio (Choral: Es ist genug!)
Erster Teil
Das Geheimnis des Aoristes
Erster Satz
Andante (Präludium)
1
Viel später, als alles längst vorbei war, saß ich Júlias schwarzen Augen und ihrem makellosen Teint gegenüber und fragte mich, wann genau mein Leben die ersten Risse bekommen hatte. Der Gedanke überfiel mich unvermittelt, und sogleich fragte ich mich, was ihr wohl gerade durch den Kopf gehen mochte. Verstohlen sah ich sie an: Sie war in die Speisekarte vertieft und schwankte nach wie vor zwischen dem Filet und dem Entrecôte. Ein kurzer Rundblick hatte mir genügt, um festzustellen, dass das Restaurant ausgesprochen geschmacklos eingerichtet war. An welchem Punkt war die Sache aus dem Ruder gelaufen? Vielleicht schon vor vielen Jahren, an jenem regnerischen Freitag im Herbst — meine orientierungslose Phase war bereits überwunden —, als es kurz nach dem Essen läutete und mein Vater, der das sonst nie tat, aufstand und die Tür öffnete. Als hätte er Besuch erwartet. Hinterher haben wir es alle gemeinsam rekonstruiert: Er hatte auf dem Treppenabsatz gestanden und mit jemandem gesprochen, mit wem, wussten wir nicht. Im Hinausgehen hatte er noch gesagt, zu uns oder zu den Wänden, er sei gleich wieder da. Wir haben ihn nie mehr gesehen. Es regnete, und er hatte das Haus in Pantoffeln und Hemdsärmeln verlassen. In der Folgezeit sollte ich noch oft darunter leiden, dass ich nicht gemerkt hatte, wie wichtig dieses Klingeln gewesen war. Denn von den wenigen ausschlaggebenden Momenten unseres Lebens bekommen wir nichts mit, und hinterher verbringen wir den Rest unserer verzweifelten Existenz im sinnlosen Bemühen, sie wiederzuerlangen. Ich wohnte damals zu Hause, weil ich mich gerade von Gemma getrennt hatte.
Mein Leben ist voller solcher Schlüsselmomente, die mir wie Fische durch die Finger schlüpfen, derweil ich meine Zeit vor dem Fernseher vertrödele oder Kreuzworträtsel löse. Wie oft habe ich mir gewünscht, Teresas Lächeln vor dem Ritz zu vergessen. Es will mir nicht aus dem Sinn gehen und treibt mir noch heute die Tränen in die Augen. Vor der strahlend hell erleuchteten Hotelfassade hatte Teresa mir zugelächelt, und ich war wenige Schritte entfernt schwer atmend im Dunkeln stehen geblieben. Dann hatte sie sich abgewandt, immerzu lächelnd, und ich hatte dagestanden wie ein Ölgötze. Nein, daran wollte ich jetzt nicht denken. Ich musste mich konzentrieren, auf die Speisekarte und auf Júlias Entscheidung: Fleisch, aber welches, und mach schon, ich habe Hunger. Teresa jedoch, vor dem Ritz am Piccadilly, hatte nicht aufgehört zu lächeln. Schließlich schaute ich in die Karte, in der die Gerichte, schwülstig und literarisch ambitioniert, eher gepriesen statt beschrieben wurden. Und Júlia und ihre schwarzen Augen und ihre samtene Stimme üben eine Anziehungskraft auf mich aus wie ein bodenloser Brunnen, doch ich sehe mich nicht imstande, sie zu lieben, weil ich todmüde bin.
Im Grunde hatte alles vor wenigen Stunden damit angefangen, dass Júlia mich bat, mit ihr essen zu gehen, weil ich der Einzige sei, der ihr helfen könne. Nein, begonnen hatte alles morgens auf dem Friedhof während der Beerdigung. Seither bin ich am Grübeln. Ich hatte mich ein wenig abseits der Angehörigen gehalten, die von diesem unerwarteten Todesfall noch wie vor den Kopf geschlagen waren, und mich hinter einer dunklen Brille versteckt. Rovira hatte mich trotzdem entdeckt und war mir nicht mehr von der Seite gewichen. Es folgten Vertraulichkeiten, ein halbes Päckchen Camel lang. Dort auf dem Friedhof, bevor Rovira mich mit Beschlag belegte, war ich wie durch göttliche Eingebung zu der Erkenntnis gelangt, dass ich niemals den Mut aufbringen würde, die offizielle Version zu dementieren, der zufolge Bolós' Tod ein beklagenswerter, unerklärlicher Unfall gewesen war. Ich war der Einzige, der von der rätselhaften Nachricht wusste — »Ich bin's, Franklin. Sei auf der Hut, Simó, jemand ist hinter uns her« —, die er am Mittwochabend auf dem Anrufbeantworter hinterlassen hatte. Dann kam der Donnerstag mit seinen Ereignissen und am Freitag, als ich nach der Beerdigung wieder zu Hause war, der Anruf von Júlia und ihr Vorschlag, zusammen essen zu gehen.
Der angenehme Wind auf dem Friedhof hatte mich an einen anderen erinnert, an den wärmeren, doch von Angst erfüllten Wind am Berg Qurnat as-Sauda. Und ich hatte es praktisch achselzuckend hingenommen, dass ich, obwohl ich einmal so etwas wie ein Held gewesen war, jetzt hinter dunklen Brillengläsern Zuflucht suchen, den Ahnungslosen spielen und ja, ja, ein absurder, bedauerlicher Unfall sagen musste. Und bevor Marias fragender Blick mir die Fassung rauben konnte, hatte ich mich verdrückt.
Dann das Telefongespräch mit Júlia:
»Und die Bedingung wäre?«
»Dass ich das Lokal aussuchen darf«, hatte Júlia gesagt.
Ich dachte, das ist mir völlig egal. Auch ich bin allein, niedergeschlagen, verstört, habe Bolós im Kopf und Furcht im Herzen. Und ich bin ein solcher Feigling, nicht einmal Marias Blick auf dem Friedhof habe ich ausgehalten.
»Gern. Einverstanden. Wo führst du mich denn hin?«
»Verrate ich nicht. Ein sehr nettes Restaurant, eine Neueröffnung. Wir müssen uns ausführlich unterhalten, Miquel.«
»Über was denn?«
»Über alles, über Bolós. Ich muss den Artikel über ihn schreiben.«
»Welchen Artikel?«
»Hat Duran dir das nicht gesagt? Einen Nachruf, eine Hommage.«
»Lasst Bolós doch in Frieden.«
»Was ist los? Findest du das nicht gut?«
»Doch, fantastisch.« Ich gab mir ehrlich Mühe. »Ganz im Ernst.«
Ich konnte noch nie lügen, und Júlia merkte es sofort.
»Du findest es nicht gut.«
»Doch, natürlich. Aber was weißt du denn schon über Bolós?«
Jetzt war Júlia diejenige, die auf befremdliche Weise schwieg; auch sie war eine schlechte Lügnerin.
»Na ja, ich grabe mich durch die Archive und so.« Die Pause fühlte sich unbehaglich an, für sie und für mich. »Aber mir fehlen Informationen über seine Kindheit und Jugend, und du …« Sie räusperte sich. »Sag ja.« Und um mir die Zustimmung zu erleichtern: »Es ist ein sehr hübsches Lokal, die Steaks sind äußerst empfehlenswert, und du musst auf andere Gedanken kommen.«
Die Argumente waren unwiderlegbar, und ich erwiderte, perfekt, ich stehe ganz zu deiner Verfügung. Auf diese Weise würde ich nicht im Dunkeln auf dem Sofa liegen und an Teresa denken und an Bolós, an mich, an Teresa und an die Angst vor der heiseren Stimme am Telefon, die mir grässliche Strafen androhte, als wüsste sie nicht, dass die schlimmste Strafe die lebenslange Erinnerung an das vollgesogene Handtuch und die Fünfundzwanzig-Watt-Birne ist. Und an Teresa.
Júlia hatte mich um acht abgeholt und mir, statt ins Auto zu steigen, mit einem spitzbübischen Grinsen die Hand hingehalten: Sie wollte fahren. Sie wollte die Spannung steigern bis zum letzten Moment. Und da mich das Lächeln einer Frau wehrlos macht, vertraute ich ihr meine Autoschlüssel und mein Leben an, zwar ebenfalls lächelnd, doch voller Argwohn, weil ich ein katastrophaler Beifahrer bin. Außerdem weiß ich, dass Júlia eine leidenschaftliche Autofahrerin vom alten Schlag ist, die unablässig schwatzt, beidhändig gestikuliert, das Lenkrad vergisst, die Gangschaltung schrammen lässt, seufzt und ganz gelegentlich, fast widerwillig, auch mal dem Straßenverkehr ein wenig Beachtung schenkt. Ich stellte mich also innerlich darauf ein, eine Weile zu leiden, was sich dann aber doch arg lang hinziehen sollte, denn das nette Restaurant befand sich außerhalb Barcelonas. Die Ausfahrt Avinguda Meridiana war nicht allzu stark befahren, doch Júlias unangekündigte, grundlose, gleichsam poetische Spurwechsel drehten mir den Magen um. Meine tristen Gedanken jedenfalls waren wie weggeblasen, das zumindest musste man ihr zugutehalten.
»Willst du mir nicht verraten, wohin wir fahren?«
»Nein. Beschränk du dich darauf, die Rechnung zu bezahlen.«
»Wenn es dienstlich ist, lasse ich sie von Duran bezahlen.«
»Der wird nichts davon wissen wollen.«
»Das werden wir ja sehen.«
Sie legte mir die Hand aufs Knie und beließ sie dort. Ich … mit Júlia?
Energisch schoben wir uns auf der Autobahn nach Feixes zwischen die Fahrzeugkolonnen, die aus der Stadt hinauswollten. Ich muss ein ziemlich dummes Gesicht gemacht haben, verzückt von Júlias süßer Berührung, während ich auf die unterbrochene Linie starrte, auf der sie immer mit zwei Rädern entlangfuhr, um sich sicherer zu fühlen.
»Ich bin traurig.«
»Ich auch.«
»Was für ein tolles Paar wir abgeben.«
»Das Abendessen ist zu Ehren von Josep Maria.«
»Welchem Josep Maria?«
»Bolós.« Und mit einem viel geübten Wechsel der Tonlage: »Unglaublich, wie die Leute fahren! Hast du das gesehen?«
»Bolós war mein bester Freund«, erinnerte ich sie. »Wie wär's, wenn du mal in deiner Spur bleiben würdest?«
»Herrje, Miquel … Damit fang gar nicht erst an, hörst du?«
Wir schwiegen, ich betrachtete den Fluss Ripoll, der sich durch die Landschaft zog, und wünschte mir, für einen Augenblick vergessen zu können, wie Júlia mit den Verkehrsregeln umging.
»Weißt du, dass du mich geradewegs in meinen Heimatort bringst?«, sagte ich, vornehmlich, um das Schweigen zu brechen, das nun schon viereinhalb Kilometer anhielt.
»Ach, du bist gar nicht aus Barcelona?«
»Nein. Da lebe ich. Aber ich stamme aus Feixes.«
»Na, so was.«
Weitere achthundert Meter Schweigen.
»Sachen gibt's …«
Ich zwickte sie in die Wange, womit ich einen brüsken Spurwechsel verursachte.
»Ist schließlich kein Drama, nicht aus Barcelona zu sein.«
»Doch, schon. Muss hart sein.«
»Man verkraftet es recht gut.«
Sabadell blieb zu unserer Rechten zurück, und wir fuhren weiter geradeaus.
»Bist du väterlicher- oder mütterlicherseits aus Feixes?«
»Väterlicher-, großväterlicher-, großmütterlicher-, urgroßväterlicher- und urgroßmütterlicherseits. Die Wurzeln meines Vaters reichen Jahrhunderte zurück bis in die früheste Geschichte von Feixes.«
»Wow.«
»Was?«
»Wow, sage ich.«
»Wenn du wüsstest. Solltest du dich eines Tages stark genug dafür fühlen, kann ich dir den Stammbaum gerne zeigen. Wir waren eine Familie mit Vergangenheit und uns dessen auch bewusst.«
»Wart?«
»Waren.«
»Wie bei uns. Ich habe, wenn's hoch kommt, einen Opa gekannt.«
»Ich hatte bis vor ein paar Jahren noch einen Großonkel. Onkel Maurici. Ein sehr spezieller Typ.«
»Warum?«
»Darum. Er war hunderttausend Jahre alt, hatte ein Gedächtnis wie ein Elefant und war völlig durchgeknallt.« Ich warf ihr einen raschen Blick zu, um mich zu vergewissern, ob es sie interessierte, was ich erzählte. »Dieser Onkel, der war das schwarze Schaf.«
»Und er ging nach Amerika, stimmt's?«
»Nein. Alle haben ihn gehasst.«
»Du auch?«
»Nein. Ich nicht.«
Júlia schielte aus dem Augenwinkel zu mir herüber, während sie die Autobahnausfahrt nahm, ohne den Blinker zu setzen.
»Stellst du ihn mir mal vor?«, fragte sie, ohne zu merken, dass ihr Vordermann auf die Bremse trat.
»Er ist tot.« Wir bremsten, kurz bevor ich einen Herzschlag erlitt. »Fahr nicht so schnell.«
»Was?«
»Alles, was ich über meine Familie weiß, habe ich ihm zu verdanken, weil er jedes Stück Papier aufgehoben hat. Er wusste alles.«
»Alles?«
»Ja. In jeder Familie gibt es so eine wandelnde Chronik, oder nicht?«
»In meiner nicht. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt eine Familie sind.« Nachdem sie bereits abgebogen war, sagte sie: »Ich gehe mal davon aus, das ist keine Einbahnstraße.«
»Na ja … Das Verkehrszeichen bedeutet eigentlich Durchfahrt verboten, sollte für dich aber kein Hindernis sein.«
»Mist, wo stand das?«
»Wir sind schon vorbei.« Meine Stimme war dünn und gepresst, bis ich wieder atmen konnte. »Immer mit der Ruhe, jetzt ist es ja keine Einbahnstraße mehr.«
»Weißt du, ich krieg langsam Hunger.« Vor einer roten Ampel zögerte sie, entschied sich, bewogen durch meine fieberhaften Appelle, dann aber doch anzuhalten. »Jetzt sind wir gleich da, wenn ich mich nicht noch verfahre.«
Zu diesem Zeitpunkt sagte ich ihr weder, dass Onkel Maurici das letzte Jahr seines Lebens in einer Anstalt verbracht hatte, noch, dass ich ihn trotz allem, was geschehen war, liebte und er, außer meiner Mutter, der Einzige in der Familie war, mit dem ich lange, ausführliche Gespräche geführt hatte. Ich wusste nicht, ob ich Júlia diese Dinge jemals würde erzählen können.
Ehe ich mich versah, war sie bereits im Begriff, nach Gehör einzuparken. Die Zunge zwischen die Zähne geklemmt und hochkonzentriert, versuchte sie, die Stöße gegen den Wagen vor ihr möglichst sachte zu halten, und bekam gar nicht mit, wie ich nach Luft schnappte.
»Das ist das Restaurant?«
»Hm, hm.« Seufzer der Erleichterung. »Na, was hältst du davon?«
»Du bist eine begnadete Einparkerin. Ist das das Restaurant?«
»Ja, hab ich doch schon gesagt.«
Ich zog es vor, den Mund zu halten. Beim Aussteigen zitterten mir die Knie. Noch war es hell genug, und ich konnte nicht umhin, einen Blick auf den Erdbeerbaum zu werfen, der mächtig gewachsen und sehr gut gepflegt war. Ich ging näher heran, konnte aber die Worte, die Onkel Maurici in seinem langen letzten Brief an mich gerichtet hatte, nicht hören. Die Sonnenuhr befand sich an der Kletterrosenwand, nutzlos ohne Sonne, ohne Rosenstock, und ein Windhauch, der sich zwischen den Birken verfangen hatte, bewegte sanft die Zweige. Alles schien an seinem Platz zu sein.
»Wie findest du es?« Mit weit ausgestrecktem Arm, als präsentierte sie einen frisch geangelten Barsch, wies Júlia auf das Haus. Was sollte ich darauf antworten, denn meine liebe Júlia hatte mich ausgerechnet zu meinem Elternhaus gebracht, Can Gensana, wo ich geboren wurde und aufwuchs, wo ich geweint und geträumt hatte und dem ich, als die Zeit reif war, entflohen war. Mittlerweile war es schon etliche Jahre her, dass man meine Mutter mit der Nachricht erschreckt hatte, sie müsse ausziehen, das Haus gehöre ihr nicht mehr, und wir daraufhin alle ein bisschen den Verstand verloren. Denn nicht genug damit, dass mein Vater in Pantoffeln fortgegangen war und uns mit den Schulden, den unbezahlten Rechnungen und unserem Groll zurückgelassen hatte, zu allem Überfluss sollten wir nun auch noch unsere Erinnerungen einbüßen. Da stieg Onkel Maurici aus dem zweiten Stock in die Kletterrose. Can Gensana, siebzehnhundertneunundneunzig bis neunzehnhundertfünfundneunzig. Um ein Haar hätten wir es auf zwei Jahrhunderte gebracht. Ich komme mir vor wie Martin der Humane. Hier ruht Can Gensana wegen meiner Nachlässigkeit, verwandelt in ein groteskes Restaurant, das, um die Schmach noch zu steigern, in kunstvollen Buchstaben El Roure Vermell heißt, Die Rote Eiche.
»Hier, die Autoschlüssel, Miquel.«
»Was?« Nur mit Mühe kehrte ich in die Gegenwart zurück und folgte Júlia. Drei Stufen, Absatz, noch zwei Stufen. Die Visa-, MasterCard- und American-Express-Aufkleber an der Scheibe der Eingangstür machten das Ganze noch peinlicher. Wie aus dem Nichts tauchte ein Mann auf, der lächelte wie ein Maître und uns in meinem Haus willkommen hieß.
»Wir haben reserviert«, sagte Júlia, als gehörte sie zur Familie.
»Nein!«, protestierte ich entsetzt.
»Doch, doch …« Geduldig, pädagogisch, mit entwaffnendem Lächeln. Und zum Maître: »Auf den Namen Miquel Gensana.«
Sie zwinkerte mir zu. Stets bedachte sie die praktischen Details. Und obwohl wir waren, wo wir waren, dachte ich einen Augenblick lang, was hindert dich eigentlich, sie zu lieben und den Dingen im Übrigen einfach ihren Lauf zu lassen. Aber das ist schwierig, wenn einem so viele Dinge durch den Kopf gehen; vor allem natürlich Teresa, aber auch dieses Gefühl der Feigheit und der Angst, das die heisere Stimme am Telefon in mir ausgelöst hatte.
»Was ist? Gefällt es dir hier nicht?«
Ich wurde einer Antwort enthoben, weil sich der Maître anschickte, uns forschen Schrittes zu unserem Platz zu geleiten. Im Slalom folgten wir ihm zwischen den noch unbesetzten Tischen hindurch — die man in meinem Wohnzimmer, meinem Esszimmer und, ach!, in der Bibliothek aufgestellt hatte, alles ging obszön ineinander über —, als mich Júlias stimulierender Atem streifte und sie mir ins Ohr flüsterte, ich habe uns eine zauberhafte Ecke reservieren lassen, Miquel, direkt neben einem herrlich plätschernden Springbrunnen.
Man hatte den ungeheuerlichen Frevel begangen, in der Bibliothek, wo immer Onkel Mauricis Klavier bei den antiquarischen Büchern von Urgroßvater Maur dem Dichter gestanden hatte, einen scheußlichen Springbrunnen zu installieren. Ich war schon drauf und dran, den Maître zu beschimpfen, wurde aber zunächst davon abgelenkt, wie er Júlia beflissen den Stuhl zurechtrückte und sich kurz vor ihr verbeugte, während er mich vollkommen übersah. Dann entfernte er sich, wahrscheinlich, um Verstärkung zu holen. Und damit war die Gelegenheit verpasst.
»Gefällt es dir hier nicht? Sag schon, Miquel!«
»Doch, sehr.«
»Weil du so ein Gesicht machst, das Fleisch ist hier ausgezeichnet.«
»Dann sollten wir es probieren.«
Und wir begannen, die Speisekarte zu studieren. Das heißt, sie studierte sie für uns beide, denn meine Aufmerksamkeit war sofort von dem Logo des Restaurants gebannt, einer üppigen Eiche, die einem alten Stich nachempfunden war. Ihr Anblick rief mir den Stammbaum der Familie Gensana in Erinnerung, den ich zu Hause auf dem Schoß von Großmutter Amèlia oder später bei Onkel Maurici in der Anstalt gesehen hatte, wo er — mit noch ruhiger Hand — auf den Platz seiner richtigen Mutter, meiner Urgroßtante Carlota, deutete, der eine sehr romantische Geschichte widerfahren war. Oder auf den von Großvater Maur dem Dichter. Oder den von Urgroßmutter Josefina … Und sein Versprechen, den Wahren und Unbekannten Stammbaum der Familie zu erstellen.
»Ganz nett, was sie auf der Karte haben, oder?«
»Doch …« Ich überflog die Gerichte. »Von allem etwas, wie ich sehe.«
»Steak.«
»Was?«
»Hier muss man Steak essen.«
Ich konnte mich nicht entsinnen, dass man bei uns irgendetwas hätte essen müssen, wie bei den Juden oder freitags in der Fastenzeit. Bei diesem Gedanken grinste ich unwillkürlich, was für Júlia nicht leicht zu interpretieren war. Sie missverstand es prompt als Widerwillen und hob streng den Finger.
»Fleisch.«
»In Ordnung. Fleisch.«
Die Karte legte den Schluss nahe, dass diese Idioten das Restaurant zu einem angesagten Lokal machen wollten, für hippe Leute wie Júlia und ihre unausstehlichen Freunde. Trotz des dämlichen Namens.
Und ich, das Opfer. Ich konnte nichts weiter tun, als die Vergangenheit vor meinem inneren Auge Revue passieren zu lassen. Und zu denken, oh, wenn doch nur alles anders gekommen wäre; könnten wir doch bloß die Folgen unserer Handlungen besser absehen, den Spielzug noch einmal wiederholen, das Replay in Zeitlupe analysieren und die Stelle ausmachen, an der wir eine falsche Entscheidung getroffen haben und die Sache anfing schiefzugehen. Womöglich wäre absolute Klarsicht eine unerträgliche Qual. Oder das Sprungbrett in den Zynismus.
»Vielleicht ist es besser, nicht über die eigene Nasenspitze hinauszuschauen.«
»Was sagst du?« Júlia starrte mich an, als hätte ich den Verstand verloren.
»Entschuldige, ich …«
»Schon gut.« Sie senkte den Blick, dann richtete sie ihn wieder auf mein Gesicht. Júlias Augen sind sehr schön. »Fühlst du dich nicht wohl?«
»Doch, bestens«, schwindelte ich, während ich mir ein unbekümmertes Lächeln abrang. Júlia betrachtete mich besorgt. Sie wollte etwas sagen, zog es dann aber vor, den Mund zu halten. Mir war es nur recht, denn ich hatte soeben im Geist den Faden aufgenommen, der zu Bolós' Tod führte, und eingesehen, dass ich unmöglich herausfinden konnte, in welchem Moment ich mich anders hätte verhalten müssen, um jetzt nicht einen Toten auf dem Gewissen zu haben und heimgesucht zu werden von Gedanken wie dem auf dem Friedhof und der trostlosen Miene Marias, Bolós' Witwe, und diesem Ekel vor mir selbst, ehe mich Rovira angesprochen und über tausend andere Dinge geredet hatte. Doch wurde ich meine Schuldgefühle nicht los, weil ich so feige war, denn ich wusste sehr wohl, woran Bolós gestorben war. Wahrscheinlich wussten das nur sein Mörder und ich. Und Blauauge könnte womöglich eine Ahnung haben. Doch ich hielt mich hinter der dunklen Brille versteckt, bis Rovira mir ein Gespräch über Frauen aufnötigte, sein einziges Konversationsthema, seit er vor hundert Jahren die Soutane an den Nagel gehängt hatte.
»Ich nehme das Filet Mignon«, beschloss Júlia und gab es offenkundig auf, mich zu verstehen. Sie wirkte zufrieden mit ihrer Entscheidung. »Und du?«
In diesem Moment begriff ich, dass es mir in achtundvierzig Jahren nicht einmal annähernd gelungen war, mich von diesem seltsamen Gefühl der Reue zu befreien, von diesem tief verankerten, chronischen Gefühl. Das blutgetränkte Handtuch und die Fünfundzwanzig-Watt-Birne einmal beiseitegelassen. Mein Leben bestand aus lauter Etappen mit einem Anfang und einem Ende, und jedes Mal war es meine Seele gewesen, die zum Schluss draufgezahlt hatte. Und an Gott glaubte ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr.
»Und jetzt soll ich dir von Bolós erzählen.«
»Ja. Aber lass uns zuerst bestellen.«
»Hast du es eilig?«
»Überhaupt nicht.«
»Nur, über Bolós reden heißt über mich reden.«
»Gut. Über die Zeit, in der ihr euch am besten verstanden habt.«
Lustlos schaute ich in die Karte. Konnte ich Júlia das alles erzählen?
»Ich fühle mich so niedergeschlagen.«
Jetzt sah Júlia aus, als würde sie gleich die Geduld verlieren, und ich erschrak, denn nichts ängstigt mich so sehr wie der Zorn einer Frau.
»Suchst du dir jetzt mal langsam ein ordentliches Stück Fleisch aus?« Und tief gekränkt: »Ich fühle mich auch niedergeschlagen und reiße mich zusammen.«
»Du warst nicht mit Bolós befreundet.«
Sie legte die Karte auf den Tisch und bedachte mich mit einem kohlschwarzen Blick.
»Wirst du vielleicht imstande sein, mit mir zu essen? Mir bei diesem Artikel über deinen Freund zu helfen?«
»Ja, klar, ich …«
»Ja, klar, du …« Auf einmal war sie die Júlia von der Arbeit, zur Chefin geboren, aber auf einer niedrigeren Hierarchiestufe als ich. »Da strenge ich mich an, überlege mir ein schönes Lokal, reserviere uns einen Tisch, finde Zeit in meinem Terminkalender …«
Ich konnte ja nicht ahnen, dass es sich um eine so bedeutsame Sache handelte. Ich richtete meine Augen also aufmerksam auf die Karte, wie ein kleiner Junge, der fürchtet, vom gestrengen Blick seiner Lehrerin zermalmt zu werden. Júlia schwieg, verstimmt, wie mir schien, über meinen Mangel an Einsatzfreude.
»Ich nehme den Kabeljau.«
»Na, hör mal!« Jetzt war sie ehrlich empört. Sie sah aus wie Jeanne d'Arc. »Ich hab dir doch gesagt, dass ihre Spezialität hier das Fleisch ist!«
»Dann eben Fleisch. Ein Steak!«, sagte ich nachdrücklich und lächelte den Maître an, der wie aus dem Boden gewachsen wieder am Tisch stand, mit gezücktem Block und einer misstrauischen Grimasse, die mir ganz allein galt.
»Welches hätte der Herr denn bitte gern?«
»Keine Ahnung.« Aufs Geratewohl: »Das mit den zwei Saucen. Haben Sie schon notiert, was die Dame möchte?«
»Ja, der Herr, schon vor einer Weile.«
Diese Bemerkung fand ich unverschämt.
Die Verhandlungen waren hart. Aber es gelang uns, ein vernünftiges Menü zusammenzustellen, das vor allem Júlias Geschmack entsprach. Kaum hatte der Maître alle Sonderwünsche aufgenommen (das Fleisch noch blutig, kein Salz, den Salat à la Montpensier ohne Zwiebel) und sich verzogen mitsamt seinem Block, der mich, ich weiß auch nicht, warum, an einen Strafzettelblock erinnerte, attackierte mich Júlias Blick.
»Also, woran denkst du? Verrätst du es mir?«
»Zeit in deinem Terminkalender finden! Wie großspurig du manchmal bist!«
»Komm schon, lenk nicht ab. Was beschäftigt dich?«
Weil ich am liebsten losgeheult hätte, fing ich an zu lachen. Und durchquerte die Wüste zwischen uns, indem ich über den Tisch langte und sie in die Wange kniff. Die gescheite, resolute Júlia mit ihren kohlschwarzen Augen und Haaren und dieser zarten Haut, so jung, so beleidigend jung; meine große Unbekannte, denn wir hatten uns noch nie eingehender unterhalten. Weil es völlig undenkbar war, dass sie verstehen würde, warum ich so unschlüssig durchs Leben stolperte; weil ich zwanzig Jahre früher geboren wurde, aber unermesslich viel älter war als sie, weil mich Nostalgie und Gewissensbisse hinterrücks überfallen und verletzen konnten, und weil der Gedanke an den Tod sich wie eine feine Staubschicht über mein Gemüt gesenkt hatte. Und das hieß, dass ich nicht mehr jung war. Und einem Mädchen wie ihr das alles zu erklären, war schwierig. Wie es auch unmöglich war, ihr zu sagen, siehst du dieses Restaurant, Júlia? Es war mein Elternhaus. Hier, wo wir jetzt sitzen, befanden sich einmal die antiken Bücher eines Urgroßvaters von mir, der Dichter war. Maur Gensana, hast du mal von ihm gehört? Natürlich nicht. Wusstest du, dass uns dein geschätzter Maître mitten in die Bibliothek meiner Familie gesetzt hat? Die Bibliothek war ein magischer Ort. Und diese unsägliche Wasserfontäne, wo früher der Flügel meines Onkels stand, ist schlichtweg ein Affront gegen das bisschen guten Geschmack meiner Familie. Nein, nichts von alldem konnte ich ihr sagen, weil ich keine Lust hatte, vor Scham im Boden zu versinken. Aber irgendwie musste ich mich gegen Júlias Blick verteidigen.
»Einmal«, sagte ich in vielversprechendem Ton, »habe ich mich verliebt.«
»Ach.« Verblüfft hob sie den Kopf.
»Ja. Es war in einem Warenhaus. Ich stand auf der Rolltreppe, die nach oben ging, und sie fuhr auf der anderen nach unten. Groß, blond, wunderschön. Sie strahlte vor Schönheit, wenn du weißt, was ich meine?«
»Vage.«
»Wir sahen uns an. Sie durchbohrte mich mit ihrem Blick, und ich hielt stand. Bis wir aneinander vorbeifuhren.«
»Und dann?«
»Drehten wir uns beide um. Ihr Parfüm raubte mir die Sinne. Und wieder schaute sie mich durchdringend an.«
»Wer war das? Kenne ich sie?«
Ich nahm ein Stück Brot. Wahrscheinlich machte ich ganz verträumte Augen.
»Ich habe sie nie wieder gesehen. Es war eine Liebe, so flüchtig wie eine Sternschnuppe.«
»Warum erzählst du mir das, Miquel?«
Warum? Weil ich weder ein noch aus wusste. Weil ich im Begriff war, mit einer Frau zu Abend zu essen, in die ich ein bisschen verliebt war, von der gemunkelt wurde, dass sie mit mehreren Männern gleichzeitig ihre Spielchen trieb, und mit der ich noch nie versucht hatte, ein persönliches Gespräch zu führen. Nein, es war ausgeschlossen, dass wir im Bett landen würden. Ich habe ihr diese Liebesgeschichte nur zu Übungszwecken erzählt, weil ich sehr schüchtern bin, weil wir eben Bolós begraben hatten und weil dieser absurde Springbrunnen mitten in der Bibliothek sprudelte, wo Onkel Maurici, bevor man ihn einsperrte, viele stille Stunden damit verbracht hatte, Bücher durchzublättern, die Heiligen aufzuzählen, die er in manchen fand, in Familiendokumenten zu stöbern und Mompou oder Bach zu spielen. Oder Papierfigürchen zu falten. Ich war nervös, immerhin saß ich inkognito in meinem eigenen Haus, das sieben Generationen lang der Stammsitz der Familie Gensana gewesen war, in dem die Großväter Tons und Maurs und sämtliche Urgroßväter gelebt hatten und gestorben waren, wo mein Vater geboren, wo ich selbst geboren und groß geworden war, das Haus, das Zeuge meiner zweimaligen Flucht wurde. Und ich hielt mich in den vier Wänden auf, die den privatesten und intimsten Teil meines Lebens beherbergt hatten und voller Erinnerungen steckten.
»Gefällt dir dieses Lokal, Júlia?«
»Ja, doch.« Sie war wieder ruhiger. »Ich finde es sehr nett.«
Mein Haus war also nett. Zweihundert Jahre Familienleben, angefangen bei Antoni Gensana i Pujades, dem offiziellen Begründer der Sippe, Antoni Gensana I, dem Urahn, Ende des achtzehnten Jahrhunderts bis zum Ende des zwanzigsten, sieben Generationen Gensanas, die dieses Anwesen und die Geschichte bereichert und den Mauern ihre ehrwürdige Patina verliehen hatten, verdienten nach all den Strapazen das Attribut nett. Bemerkenswert.
»Ja, ich finde es auch nett. Weißt du, ob das mal ein Privathaus war?«
»Das glaube ich nicht. In so einem Haus kann man doch nicht leben.«
»Ach, nein?«
»Auf keinen Fall! Wenn nicht die Gespenster über dich herfallen, stürzen die Wände über dir zusammen. Und bestimmt ist es furchtbar kalt.«
Damit hatte sie recht. Und sie fügte noch hinzu:
»Wenn hier tatsächlich mal jemand gewohnt hat, müssen das äußerst seltsame, ziemlich dekadente Leute gewesen sein.«
Auch damit hatte sie recht. Ich hätte sie mit der Darlegung ihrer Vorurteile fortfahren lassen, aber sie sagte:
»Ich kenne die Eigentümer, weißt du?«
»Ach ja?« Sofort war ich auf der Hut. »Welche Eigentümer?«
»Von diesem Restaurant. Maite Segarra, die Frau von Manolo Setén, Ex-Frau, besser gesagt.«
»Ich komme gerade nicht drauf, wer das ist.«
»Der Innenarchitekt, Mann. Sag bloß, du …«
Ich zündete mir eine Zigarette an, während ich überlegte, von wem die Rede sein könnte. Und Júlia stürzte sich wie eine Elster auf das Feuerzeug von Isaac Stern.
»Wie hübsch.«
»Das ist schon alt.«
»Aber sehr hübsch. Wo hast du es her?«
»Ah, du meinst Setén, den Innenarchitekten!«
»Klar, den musst du kennen.« Sie war wieder bei ihrem Thema.
»Und wie kommt sie darauf, sich aufs Kochen zu verlegen?«
»Ihr war wohl langweilig. Pah, die macht hier bestimmt ein Schweinegeld.«
Ich vergewisserte mich, dass Júlia das Feuerzeug wieder neben das Päckchen legte.
»Nun ja, im Moment jedenfalls ist es ziemlich leer«, sagte ich, um irgendetwas zu sagen.
»Es ist noch früh. Wenn du magst, stelle ich dir Maite nachher vor.«
Ich sah Júlia zu, während sie ein Stück Brot kaute. Diese weißen Zähnchen, die ich schon so oft hätte küssen mögen. Warum konnte das Leben nicht diese Art von Wunder bewirken?
Ich wusste seit langem, dass es keine Wunder gab. Über das Leben und den Tod war ich zu wechselnden, stets vorläufigen Erkenntnissen gelangt. Beispielsweise der, dass es das Streben nach Ewigkeit ist, was den Menschen vom Tier unterscheidet, die uralte Sehnsucht nach der unerreichbaren Ewigkeit. Methoden gibt es diverse: vom Festhalten einer Figur auf einem Bild über das versessene Bemühen um Arterhaltung und die Überlieferung des eigenen Werkes bis zur durchaus feinsinnigen Erfindung der Religionen. Meiner Ansicht nach gibt es drei Formen der Verewigung, deren wir uns im Lauf der Menschheitsgeschichte bedient haben: Nachwuchs, die häufigste; Religion, die angesehenste; Kunst, die subtilste. Aber was soll aus einem sterilen Agnostiker wie mir werden? Vermutlich interessiere ich mich deshalb so lebhaft für Musik, die die einen komponieren und die anderen spielen; für die Lyrik eines unbekannten Dichters, die mir zu Herzen geht; für die Malerei, zu der ich nicht einmal im Traum fähig wäre. Vielleicht ist das der Grund, warum ich weine, wenn ich Mendelssohn höre, und mich in die Arme einer Frau stürzen muss, damit sie mir die Tränen trocknet. Und wenn ich meinen Alban Berg höre, dann gibt es niemanden auf der ganzen Welt, der mich trösten könnte. Und nur sehr wenige, die mich verstehen. Mein großer Kummer ist, dass ich weder Musiker noch Maler, noch Dichter geworden, sondern ein simpler, verfluchter Dilettant geblieben bin, mit viel Gespür zwar, aber kein Schöpfergeist. In der Schule war ich nie gut; mein Vetter Ramon rieb mir immerzu seine hervorragenden Noten unter die Nase, war schon mit vierundzwanzig Textilingenieur und half bereits seit zwei Jahren meinem Vater, die Fabrik in den Ruin zu treiben. Ich hingegen hatte mich zunächst für Naturwissenschaften entschieden und mit knapper Not die Hochschulreife geschafft, mich danach den Geisteswissenschaften zugewandt — wobei es mir weniger die sprachlichen Paradigmen und die Grundrissformen der Basiliken angetan hatten als vielmehr alles, was mit Versammlungen und dem Mai 68 und so zu tun hatte —, das Studium aber nach der Hälfte abgebrochen, weil die Revolution Vorrang hatte und Berta sehr hübsch war. Und als der Krieg zu Ende und Franco friedlich im Bett gestorben war, verliebte ich mich aufs Neue. Meine Ehe mit Gemma hielt zwei Jahre, zwei Monate, einundzwanzig Tage und dreizehn Stunden. Als ich wieder zu Hause einzog, zu meiner schweigsamen, traurigen Mutter, und mich fragte, ob ich etwas Neues anfangen sollte und wenn, dann was, stellte ich fest, dass ich siebenundzwanzig Jahre alt war und schon kein Wort mehr mit meinem Vater redete. Juan Crisóstomo Arriaga starb mit zwanzig. Ich fühlte mich wie ein Greis und konnte mich für nichts begeistern. Statt mir ein Flugticket zu kaufen und mir in Indien irgendein ausgefallenes Fieber zu holen oder mich wie ein Wilder zwischen die Schenkel williger Bekanntschaften zu stürzen, beschränkte ich mich darauf, ein Konzertabonnement für den Palau de la Música zu erstehen und das pralle Leben anderen zu überlassen, mal sehen, ob sie sich weniger dumm anstellten. Parkett, fünfte Reihe, genau in der Mitte. Und ich begann, ernsthaft zu studieren, las noch mehr und verliebte mich in die Schönheit. Jetzt, viele Jahre später, gibt es Leute, die mich für einen Weisen halten. Lächerlich, aber wahr.
»Was willst du denn über Bolós wissen?«
»Alles Mögliche. Persönliches. Geschichten aus seiner Jugend.«
»Du kanntest ihn überhaupt nicht, stimmt's?«
»Doch, natürlich. Du hast ihn mir doch selbst vorgestellt.« Verstohlen schaute sie sich um, als wollte sie von niemandem außer mir gehört werden, dann blickte sie mich fest an und fragte: »Wie fühlt es sich an, wenn ein so enger Freund stirbt?«
»Woher weißt du, dass Bolós und ich enge Freunde waren?«
»Was für ein Gefühl ist das?«
»Du weißt nicht, wie sich das anfühlt?« Ich sah sie aus dem Augenwinkel an, und sie kam mir sehr jung vor. »Dir ist noch keiner gestorben.«
»Nein. Ich habe keine Freunde.«
»Unsinn.«
»Nein, im Ernst. Nur befreundete Kollegen.« Und leiser: »Oder Liebhaber. Wie also fühlt es sich an?«
Ich musste lange überlegen. Zu lange. Als ich antwortete, mied ich ihre Augen, weil ich auch Teresa sah.
»Nichts, Júlia. Man weint einfach nur.«
2
»Ich wurde neunzehnhundertfünf in Feixes geboren, als Kind des Bürgers und Uhrmachers Francesc Sicart und seiner Ehefrau Carlota Gensana. Mein Vater, der eine mäßig große Erbschaft mit seinen beiden Geschwistern teilen musste, wonach sich sein Anteil auf praktisch null belief, hatte zum Überleben nur sein Handwerk, in dem er allerdings ausgesprochen geschickt war. Meine Mutter, Schwester des vortrefflichen Dichters Maur II Gensana des Göttlichen und Tochter des Abgeordneten Antoni II Goldmund Gensana, war wohlhabender und außerdem schön und besonnen; mein Vater hatte es schwer gehabt, sie zu bekommen; und ich habe es schwer, mich an sie zu erinnern.«
Dies erscheint mir ein sehr würdevoller Auftakt für diese Seiten, die ich jetzt anfange niederzuschreiben, während du, mein lieber Miquel II Gensana der Zauderer, für einige Wochen unterwegs auf irgendeiner deiner Reisen bist. Ich schreibe das alles für dich auf, weil ich sterben werde, schon bald und ohne die übliche Agonie, ganz im Sinne der Tradition aller Männer unserer Familie. Die einzige Unwahrheit in dieser Einleitung, die ich von Rousseau übernommen habe, bezieht sich auf den Beruf meines Vaters. Über alles andere, Miquel, magst du selbst richten, wenn dir danach ist.
Du kamst am dreißigsten April neunzehnhundertsiebenundvierzig zur Welt. Damals zog sich bereits diese feine Linie aus Hass durch meine Augen, eine Linie wie eine Angelschnur, straff und dünn, aber so stark, dass man damit, bei geeigneter Handhabung, jemanden enthaupten könnte. Damals war ich schon Maurici Ohneland der Verfemte, der niemals regieren wird, genau wie du. Bei deiner Geburt warst du blond und hattest blaue Augen. Meinen Finger, den ich in dein Fäustchen schob, hast du gepackt, als hinge dein Leben davon ab. Da war ich mir sicher, dass du gewiss nicht denselben Weg gehen wolltest wie dein Bruder und dich deshalb so fest an mich geklammert hast. Du warst der dritte Miquel meines Lebens. Deine Eltern gaben deinem Bruder den Namen Miquel aus schlechtem Gewissen. Und mit dir wiederholten sie das Ritual. Dein Name ist wahrscheinlich der einzige Krieg, den ich in dieser Familie, in der ich nun sterben muss, gewonnen habe. Doch damit sie dich so tauften, musste meine eine große unermessliche Liebe den brutalsten Schmerz erleiden, den man einer Liebe zufügen kann.
An dem Tag, an dem du geboren wurdest, duftete Can Gensana nach feuchter Erde. Wir hatten den regnerischsten Frühling des Jahrhunderts, wie man sich in Feixes erinnert. Der Geruch feuchter Erde, einer der ältesten Gerüche, die ein Garten verströmen kann, haftet mir im Gedächtnis und ist untrennbar mit deiner Geburt verbunden. Der Garten war eine Pracht, leuchtend, ein wenig zerzaust von dem vielen Regen, aber alles gedieh. Dein Vater, der ein Faible für unnütze Gesten hat, ließ einen Erdbeerbaum neben den Hauseingang setzen. Pere wusste nicht, dass es unklug ist, das Leben eines Menschen mit dem eines Baumes zu verknüpfen. Da ich es jedoch nicht verhindern konnte, fand ich mich damit ab, den Baum als Teil deines Lebens zu betrachten. Darum ging ich in derselben Nacht, in der er gepflanzt worden war, hinaus, grub an seinem Fuß ein Loch und verbarg darin, wie der Barbier von König Midas, das Geheimnis meiner Liebe, bevor es sich in die Wolken verflüchtigen konnte. Mag sein, dass ich aus diesem Grund jetzt den Mut habe, es dir zu offenbaren. Falls die raschelnden Blätter es dir an windigen Spätnachmittagen nicht schon zugeflüstert haben.
Die Männer der Familie haben mich immer gehasst. Mit Ausnahme deines Vaters, der in seiner Jugend mein bester Freund war. Die Frauen hingegen haben mich respektiert und verstanden, dass Mompou, Satie und Debussy viele Jahre lang mein einziges Glück gewesen sind. Wenn ich am Klavier saß, ließen sie die Tür der Bibliothek offen, nicht wie dein Großvater Ton, Antoni III der Fabrikant, möge er in der Hölle schmoren, der sie jedes Mal mit einer Grimasse zugemacht hatte.
Ich möchte nicht, dass Feldwebel Samanta das Heft von Tante Pilar findet. Ich werde es zwischen dem Bastelpapier verstecken. Und wenn du zurück bist von deiner absurden Reise wohin auch immer, um wen auch immer zu interviewen, wirst du es unter den Dokumenten in meinem Nachlass finden.
Ich weiß nicht, ob dies der richtige Zeitpunkt ist, über meinen Onkel zu sprechen, dachte Miquel.
3
Im Leben von Miquel II Gensana gibt es mehrere Wendepunkte, die in untrennbarem Zusammenhang mit Frauen stehen. So auch heute, da ich Júlia gegenübersitze und von Bolós erzählen soll, denn um über Bolós zu sprechen, muss ich über mich sprechen und mein Innerstes weiter nach außen kehren, als ich es mir je hätte träumen lassen — wahrscheinlich, weil ich Bolós so tief in meinem Herzen trage wie Rovira, sooft uns die Willkür des Lebens auch auseinandergetrieben und wieder vereint haben mag —, während ich geduldig darauf warte, dass man uns ein paar Oliven als Aperitif bringt. Wie langsam sie hier bei mir zu Hause sind. Solange es noch mein Zuhause war und ich darin wohnte, hielt ich mich am liebsten woanders auf und tat, als hätte dieses grandiose Anwesen mit meinem Leben nichts zu tun. So erklären sich auch meine Fluchten. Doch während ich zur Schule ging, blieb mir gar nichts anderes übrig, denn Miquels einsame Kindheit war bestimmt vom Hin und Her zwischen Schule und Elternhaus, Onkel Mauricis Büchern und seinen eigenen Hirngespinsten. Somit erinnerte er sich auch sehr genau an die wenigen Nächte, die er nicht in Can Gensana geschlafen hatte.
Im Bus sorgten wir für Krawall, wie es uns rechtlich zustand, ärgerten den Fahrer und machten uns heimlich über Pater Romaní lustig, der auf dem vordersten Sitzplatz thronte, wo heute, zwanzig Jahre später, die Reiseleiterinnen sitzen, in der Hand ein Mikrofon, und verkünden, hier rechts jetzt die Sagrada Familia, das Werk des weltberühmten Architekten Antoni Gaudí, und der Tourist mit der Hautfarbe einer gekochten Krabbe knipst die uralten Ruinen der Sagrada Familia, wahrscheinlich aus römischer Zeit, meinst du nicht auch, my darling?, doch my darling hört gar nicht hin, weil sie an ein Sahneeis denkt und nicht mehr weiß, ob es von Camy oder von Frigo war, dann sagt die Reiseleiterin, und hier in diesem Bus oder einem ähnlichen, noch klapprigeren, waren vor zwanzig Jahren Miquel II Gensana der Sinnierer und seine unzertrennlichen Freunde Rovira und Bolós zusammen mit weiteren vierzig Bengeln der zwölften Klasse des Jesuiten-Gymnasiums im Carrer de Casp unterwegs zum Exerzitienhaus von Hostalets, glücklich, weil in den nächsten drei Tagen niemand, nicht einmal der Mathelehrer, Hausaufgaben oder eine Klassenarbeit von ihnen verlangen oder sie ausschimpfen würde, wenn sie auf dem Flur zu laut gewesen waren, denn denkt daran, diese drei Tage dienen der inneren Einkehr, und die Einsichten, zu denen ihr hier gelangen mögt, können wesentlich wichtiger für euer Leben sein als sämtliche Studien, denen ihr euch in den nächsten Jahren widmen werdet. Und alle dachten, du kannst quasseln, so viel du willst, Hauptsache, drei Tage schulfrei, das ist das Einzige, was zählt. Und Pater Romaní, statt zu sagen, und hier zur Rechten Gaudí, nutzte die Fahrt, um weiter in seinem Brevier zu lesen.
Wir betraten das Exerzitienhaus durchs Hauptportal, schubsend und lärmend, während die Kecksten hinter dem Bus noch schnell die letzte Zigarette in Freiheit rauchten und vollmundig von Frauen redeten, die sie in Wahrheit nie gesehen hatten. Eine zurückhaltende, lächelnde Nonne begrüßte die beiden Priester (der andere war Pater Valero, unser Relilehrer) und zeigte ihnen was-weiß-ich-was. Kaum hatte ich die weiträumige Eingangshalle betreten, erkannte ich den Geruch dieser Art Häuser, eine Mischung aus sauberen Leintüchern, Lavendel, Schweigen, einem Hauch Bleichlauge und einem diffusen Aroma von Malzkaffee. Man brachte uns zu unseren Zimmern, der Wahnsinn, Rovira, Einzelzimmer, irre. Und Miquel setzte sich auf den einzigen Stuhl in seiner Zelle und stellte sich vor, er wäre ein Mönch. Zum Geruch des Hauses gehörte auch der dieses Zimmers, wo es roch wie daheim im zweiten Stock, dem Reich der Bediensteten, nach selten gelüfteten, sauberen, verwohnten Räumen. Und Hochwürden Michaelus Saecundus OSB betrachtete seine Umgebung: ein schmales Bett mit einer milchkaffeefarbenen, von zwei roten Streifen durchzogenen Decke, über dem Kopfende ein Kruzifix, das Kreuz seiner langen Büßernächte; ein Tisch mit einer biegsamen Klemmlampe, das Pult seiner ausgiebigen theologischen Studien; ein winziges Waschbecken, ein wurmstichiger Kleiderschrank und rote, abgenutzte Bodenfliesen, von denen die eine oder andere beim Drauftreten klackerte und mich womöglich in meiner Meditation stören würde. Ja. Er fühlte sich auf Anhieb so heimisch, als wäre er ein Leben lang dort gewesen, und bei dem Gedanken, wie schön es doch wäre, Priester zu sein, bekam er mit einem Mal Herzklopfen.
Es waren drei Tage der Besinnung unter Anleitung von Pater Romaní, der es fertigbrachte, die wahnsinnig durchdachten Meditationen von Sankt Ignatius in verdaulicher Form zu vermitteln; drei Tage Himmel, Hölle, Sünde, Großmut, Nächstenliebe, Anekdoten und Weisheiten des Evangeliums, Malzkaffee mit Milch, eine Menge Hülsenfrüchte, wenig Fleisch und gelegentlich eine Weile, in der wir uns austoben und hinter einem Ball herrennen durften. Rovira hatte keine Lust zum Fußballspielen und ging stattdessen allein unter den Zypressen spazieren. Auch Bolós spielte kaum, obwohl ich ihm andauernd in den Ohren lag, weil er lieber mit den Rauchern in der verbotenen Ecke bei den Waschräumen herumlungerte.
Als die Exerzitien vorüber waren, wusste ich, dass ich Priester werden wollte. Aus mehreren Gründen: Ich hatte meinen Weg erkannt, war erfüllt von Gelassenheit und Freude, zur Wahrheit gefunden zu haben, und fühlte mich verpflichtet, in aller Bescheidenheit anderen den rechten Weg zu weisen, die, aus Blindheit oder weil sie nicht das Privileg hatten, hier geboren zu sein, die Frohe Botschaft noch nicht vernommen hatten und vom Ich Bin Der Weg, Die Wahrheit Und Das Leben nichts ahnten. Ebenso sicher wusste ich, dass ich gleich nach meiner Priesterweihe Missionar werden und mir die schwierigste und entlegenste Mission suchen wollte, da wahre Großmut am besten mit einer ordentlichen Portion Heldentum verbunden sein sollte. Und seine Augen glänzten, und Michaelus richtete sich auf von der Erde; und als er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn gen Damaskus, und er war drei Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht. Etwas wie eine instinktive Scheu hinderte mich dennoch, Pater Barnades, der als unser geistliches Oberhaupt das objektive Resultat dieser drei glücklichen Tage der inneren Einkehr mit Pater Romaní überprüfen würde, in meinen Plan einzuweihen.
Ein Paar blaue Augen waren es, Augen von einem so schwindelerregenden Blau wie die Tiefen des Meeres, die Miquels felsenfesten Entschluss ins Wanken brachten, den außer ihm noch sechs Komma sieben Prozent seiner Klassenkameraden gefasst hatten, zwei Prozent weniger als im vorigen Jahr, denn die Zeiten werden immer schwieriger, und möge Gott uns schützen, aber der Tag wird kommen, an dem …
Die tiefblauen Augen gehörten einer Seejungfrau mit Beinen in der Uniform der Lestonnac-Schule, die ihre beneidenswerten Bücher immer fest an ihre keimenden Brüste drückte, entzückende Söckchen trug und mich, wie ich glaubte, sympathisch fand. Sie hieß Lídia. Und ich dachte, Herrgott, was für ein Mädchen, wo soll ich bloß den Mut hernehmen. Tagelang betete ich sie aus der Ferne an, das Herz klopfte mir bis zum Hals, und bevor es in tausend Stücke zersprang, wandte sich der Ex-Missionar Miquel an Bolós, einen großen Spezialisten.
»Nein, ich weiß wirklich nicht, wen du meinst.«
Also lauerten sie ihr auf, Bolós mit kaltem Expertenblick, und taten, als spazierten sie ganz zufällig den Carrer de Pau Claris auf und ab, ganz zufällig vor der Lestonnac, ganz zufällig um sechs Uhr nachmittags. Mein Ellenbogen in seinen Rippen:
»Da ist sie!«
»Da sind vier.«
»Die Hübscheste!«
»Sehr witzig.«
»Die mit den langen Haaren!«
»Verflucht, Gensana, zwei haben lange Haare.«
»Aber die andere ist potthässlich.«
Ehe sie sich in eine fruchtlose Erörterung der unterschiedlichen Aspekte weiblicher Schönheit verstrickten, wurde Miquel ein Fingerzeig des Schicksals zuteil.
»Die jetzt lacht. Siehst du? Sie hat mich angeschaut, stimmt's? Wie findest du sie?«
»Mmh …« Nachdenkliches Schweigen. »Tja.«
»Mmh, tja, was soll das heißen? Was hältst du von ihr?«
»Wenn ich ehrlich sein soll …«
»Natürlich! Ist sie nicht bezaubernd? Zum Sterben schön, oder?«
»Ich kann nichts Besonderes an ihr finden, Gensana.«
Miquel und Bolós sprachen drei Tage nicht miteinander. Solange unsere Freundschaft diese Wüste durchquerte, himmelte ich meine Geliebte an, folgte ihr auf Schritt und Tritt, wobei ich mich bemühte, meinen Fuß auf die Stelle zu setzen, die sie soeben mit dem ihrigen geweiht hatte, und seufzte aus tiefster Seele, während mein hehrer Traum, die Kameruner im Tschad zu Dem Weg, Der Wahrheit und Dem Leben zu bekehren, der Evidenz der Schönheit nicht standhielt und sich immer mehr verflüchtigte, obgleich ich mich jeden Tag in der Schulkapelle ernsthaft bemühte, die Flamme am Leben zu erhalten.
Ich hatte gerade mein sechstes Jahr im Gymnasium vollendet, als man in Barcelona davon sprach, die Straßenbahnen abzuschaffen, um den Autoverkehr dichter zu machen und die Luft mit dem öffentlichen Nahverkehr direkt zu verpesten. Oder vielleicht handelte es sich auch um eine späte Sühne für das schreckliche Ende Gaudís. Jedenfalls schloss ich das zwölfte Schuljahr ab, ohne in einem einzigen Fach durchzufallen. Ramió, Camós und Torres blieben sitzen, und im Vorbereitungskurs für die Universität (anderes Gebäude, wo man keinen demütigenden Schulkittel mehr tragen musste, offiziell rauchen durfte und sich dazu nicht wie Verbrecher im Klo zu verstecken brauchte, als erwachsen galt und sich der rückhaltlosen Bewunderung der unteren Klassen gewiss sein konnte) sah ich mich etwas anspruchsvolleren Mathematikaufgaben gegenüber, sodass jene tiefgründigen Augen von der Lestonnac bald an Leuchtkraft verloren, und es zweifellos idiotisch gewesen wäre, sich wegen eines Mädchens, dessen Name mir schon wieder entfallen war und das einfach zu schiefe Zähne hatte, die Pulsadern aufzuschneiden. Und wenn er, Murillo, Bolós und Rovira in die Spielhalle im Carrer Consell de Cent zum Tischfußball gingen (zu Hause erlaubten sie ihm inzwischen, einen späteren Zug zu nehmen), verschwammen die Probleme der Kameruner allmählich immer mehr, und wenn er sich zur Lösung einer mathematischen Gleichung — was nun einmal Vorrang hatte — in seinem Zimmer einschloss, waren sie vollends verschwunden.
Als wir das nächste Mal zum Exerzitienhaus fuhren, ging ich es nicht ganz so ernsthaft an, obwohl ich mir bezüglich dessen, woran ich Freude fand und was ich im Leben einmal machen wollte, aufrichtig Rechenschaft ablegte. Und ich gelangte zu einer wunderbaren Erkenntnis, denn machen, im eigentlichen Sinn machen, wollte ich überhaupt nichts im Leben. Und meine Seele Gott weihen, nun, was soll ich sagen. Es war eine Wohltat, sich von den Ketten zu befreien, die Saulus vor zweitausend Jahren gefesselt hatten, weil es auf der Welt viele blaue, schwarze, braune, honigfarbene und grüne Augen gab, so tief wie das Meer, und es war ein herrliches Gefühl, ihnen nicht aus professionellen Gründen entsagen zu müssen. Im Grunde fühlte sich Miquel der Ewige Zweifler feige, weil er dem Ruf des Herrn nicht entschlossen genug hatte folgen mögen, und in einem schwachen Moment sprach er mit Pater Romaní, zwischen zwei Lektionen in dessen Büro, und später, bei einer heimlichen Zigarette im Waschraum, auch mit Bolós.
»Wenn du berufen bist, wirst du dich niemals vor Gott verstecken können, mein Sohn. Denk an Jona.«
»Aber Pater, woher soll ich wissen, ob es Berufung ist?«
»Sei doch nicht blöd, Gensana. Die brauchen halt Priester, um den Laden am Laufen zu halten.«
»Schon gut, aber was ist, wenn ich wirklich berufen bin?«
»Der Ruf des Herrn ist nicht verpflichtend, mein Sohn. Wenn du ihn ignorierst, begehst du keine Sünde. Allerdings wirst du dich in dem Augenblick, in dem Er dich dazu aufgefordert hat, als nicht großherzig genug erwiesen haben.«
»Aber ich kann doch ein guter Mensch sein, Pater, ein guter Christ in meinem Tagewerk.«
»Die sind der Hammer, du! Romaní ist nur darauf aus, dir ein schlechtes Gewissen zu machen, weil du kein Mönch werden willst.«
»Nein, nein, niemand drängt mich zu gar nichts. Es zwingt mir auch keiner ein bestimmtes Studium auf.«
»Was würdest du denn gern studieren, mein Sohn?«
»Ich weiß es nicht, Pater.«
»Aber du hast doch nicht den blassesten Dunst, was du studieren willst!«
»Das musst gerade du sagen.«
Diese Tage der inneren Einkehr, organisiert von Pater Romaní SJ, aber geleitet von Josep Maria Bolós, Herzensfreund und Doktor im Lösen von Problemen anderer, erwiesen sich für mich als äußerst bereichernd. Doch kaum hatte Bolós mich überzeugt, dass man am besten alle Frauen der Welt lieben sollte, weinte er sich an meiner Schulter aus, weil ihm eine pechschwarze Mähne, die den Carrer de Casp entlanggeweht war, den Kopf verdreht hatte. Sie ging auf die Jesús-Maria-Schule, hieß Maria Victòria Cendra, wohnte im Carrer del Bruc, Ecke València, studierte Querflöte am Konservatorium, war sechzehneinhalb Jahre alt und fuhr in den Sommerferien nach Viladrau. Wenn Bolós ein Auge auf jemanden geworfen hatte, dann stellte er Nachforschungen an und informierte sich, das musste man ihm lassen; nicht wie ich, der ich mich darauf beschränkte, von einem unbestimmten Lächeln zu träumen, das schlimmstenfalls nicht einmal mir gegolten hatte.
Das Gerücht, dass die Straßenbahnen verschwinden würden, wurde immer lauter, immerhin könne eine Zugmaschine mit Anhängern nur dreihundert Passagiere befördern, ein Autobus dagegen bis zu neunzig, und Benzin werde stets billiger sein als Strom; es war Frühling, wenn die Mädchen noch sehr viel schöner sind, weil sie kurze oder gar keine Ärmel, keine Strümpfe und knappere Röcke tragen und begehrlicher atmen, wenn die Bäume mit tausend Grüntönen die Stadt verzieren und bald der Sommer kommt und mit dem Sommer die großen Ferien und mit den Ferien die Freiheit und, ach, wie ist das Leben schön, da war Miquel mächtig überrascht und Bolós sehr sauer, als Rovira ihnen bei einem Spaziergang unter den Akazien des Carrer de la Diputació mit feierlichem Getue mitteilte, dass er beschlossen habe, Jesuit zu werden und Mitte September sein Noviziat antreten werde. Sieh mal einer an, dachte ich, und das Erste, was ich von mir gab, war: Junge, Rovira, und was ist mit den Frauen? Doch Roviras Augen schweiften über diese Frage hinweg und blickten versonnen ins Weite, auf Den Weg, Die Wahrheit und Das Leben, und während Bolós verdrossen schweigend auf seinem Kaugummi herumkaute, fühlte ich mich klein und mickrig und beneidete Rovira, den heldenhaften Rovira, weil er mutig genug war, dem Ruf des Herrn Folge zu leisten. Nicht wie andere, die nach Feixes zurückkehrten und zu Hause kein Wort verloren über den Kameraden, der Priester wurde, denn zwischen Vater und Sohn tobte in diesem Moment ein harter Kampf, weil Miquel sich weigerte, die Industrieschule zu besuchen, die jeder Gensana, der es im Leben zu etwas bringen wollte, per Dekret zu absolvieren hatte. Und fortan bröckelte die Beziehung zwischen Vater und Sohn vor sich hin. Onkel Maurici lachte still in sich hinein, hütete sich aber, etwas zu sagen, weil er wusste, dass sein Miquel, sein einziger heißgeliebter Großneffe, sich zu einer anderen Art von Studien hingezogen fühlte. In Can Gensana kehrte wieder Ruhe ein, und auch wenn der Vater weiter grollte, herrschte Frieden. Und die Mutter seufzte erleichtert auf.
Für seinen ersten Tag an der Universität band Miquel eine Krawatte um und nahm einen viel zu frühen Zug. Ich traf mich mit Bolós auf dem Platz davor, und beide taten wir so, als wären wir weder nervös noch aufgeregt. Vermutlich gingen wir deshalb auf einen Kaffee in die Bar gegenüber und schielten gelegentlich aus dem Augenwinkel auf das Gebäude der Geisteswissenschaften, als fürchteten wir, es könnte uns davonlaufen. Auch Bolós trug Krawatte. Schweigend rührten wir den Zucker um, und Bolós zog eine Pfeife hervor, was sofort meinen Neid weckte. Damit machte schließlich jeder was her.
»Ich wusste gar nicht, dass du Pfeife rauchst.«
»Gemocht habe ich es schon immer.«
»Aber die ist neu, oder?« Nicht einmal seinen besten Freund verschonte Miquel mit seiner Bosheit. Er nahm ihm die Pfeife aus der Hand und drehte und wendete sie wie ein Sachverständiger.
»Ja, schon … Irgendwann muss man ja damit anfangen.«
In ihrer Nähe stand eine Gruppe junger Leute. Viele Mädchen. Und alle lachten, als würden sie sich schon ewig kennen und als wäre es das Normalste von der Welt, auf die Universität zu gehen. Keiner der Studenten trug Krawatte.
»Wir sind die Einzigen von unserer Schule, die sich für Geisteswissenschaften eingeschrieben haben, stimmt's?«
»Ja …« Bolós war vollauf damit beschäftigt, die Pfeife anzuzünden. Die Welt verschwand hinter einer spektakulären Wolke Amsterdamer, und ihm wurde ein wenig schwindlig. Nach zwei Zügen war die Pfeife erloschen.
»Sie ist dir ausgegangen.« Oh, Miquel, wie kannst du nur so ein Unmensch sein?
»Das merke ich selber, Mann. Was hast du gesagt?«
»Dass wir die Einzigen sind, die sich für Geisteswissenschaften entschieden haben.«
»Ja. Und Rovira, nicht?«
»Nein, Mann, der wird doch Novize.«
»Stimmt ja, du hast recht. Die Einzigen.« Und nach einem energischen Zug: »Der arme Kerl, was?«
»Nicht unbedingt. Er wird schon wissen, was er tut.«
Möglicherweise verfluchte sich Rovira just in diesem Augenblick, um Viertel nach acht an einem Morgen Anfang Oktober, und wiederholte nur immerzu, was zum Teufel hat mich geritten, wie konnte ich mich bloß auf diesen Zirkus einlassen, zur Hölle, was treibe ich hier, in dieser Soutane? Vielleicht empfing er aber auch gerade mit salbungsvoller Hingabe und Andacht die Heilige Kommunion und war von Glückseligkeit umflort und durchdrungen bis ins Mark. Keiner, guck dir das an, nicht einer. Keiner der Studenten in der Bar trug Krawatte.
»Alle vom sprachlichen Zweig sind bei Jura gelandet, außer mir.« Die Pfeife gab jetzt ein lästiges Geräusch von sich, aber sie qualmte.
»Und vom mathematischen habe nur ich mich für eine Geisteswissenschaft entschieden. Mann, Bolós, was blubbert denn da so?«
»Spucke. Ganz recht, du und ich, wir sind die einzigen Spinner.«
Wenn man das Recht zum Träumen hat, sollte man es auch ausüben. Miquel Gensana war während des Kurses zur Vorbereitung auf die Universität die meiste Zeit auf einem Meer von Zweifeln gerudert. Denn die Frage war ja nicht nur, ob er Priester werden, in den Himmel kommen und als Missionar dafür sorgen sollte, dass andere in den Himmel kamen, da waren obendrein die berechtigten Zweifel in Bezug auf die restlichen Dinge des Lebens, wie zum Beispiel, alle hübschen Mädchen umarmen zu können (eigentlich alle Mädchen, denn ich wusste, dass alle hübsch waren), endlich ohne Erstickungsanfälle rauchen zu lernen und darüber nachzudenken, ob Maschinenbauingenieur, Textilingenieur, Chemiker, Arzt, Anwalt, Architekt oder sonst was. Ich neigte am ehesten zu sonst was, auch wenn es mir Angst machte. Weil ich ganz sicher wusste, dass ich kein Maschinenbauingenieur, Textilingenieur, Chemiker, Arzt, Anwalt oder Architekt werden wollte, und althergebrachte familiäre Gepflogenheiten hinderten mich, dem ironischen Rat von Onkel Maurici zu folgen – dem einzigen Familienmitglied mit zwei Studienabschlüssen — und Kfz-Elektriker zu werden. Glaub mir, Miquel, wiederholte er ständig, damit kommst du zu Geld, kaum ziehst du den Rollladen hoch, rennt dir die Kundschaft die Bude ein. Hätte ich bloß auf ihn gehört. Aber mein Onkel sagte das nur, um meine Eltern und Großmutter Amèlia zu ärgern. Im Grunde war allen klar, dass kein Gensana um ein Universitätsstudium herumkam; ob er am Ende einen Titel hatte oder ein Beruf daraus wurde, stand dabei auf einem anderen Blatt. Das erleichterte Miquel die Wahl, denn Tätigkeiten wie die eines Schriftsetzers, Tischlers oder Zugführers konnte ich unbesehen streichen, erst recht Berufe wie Schäfer oder Verkehrspolizist. Doch trotz all dieser Hilfestellungen litt Miquel den ganzen Vorbereitungskurs lang unter dem Druck, nicht zu wissen, was er anschließend tun sollte. Bis Bolós eines Tages sagte, er habe gehört, es gebe auch Geschichte als Fach.
»Heißt das, man kann das studieren? Wie Architektur?«
»Ja.« Es war ein überzeugteres Ja, ohne Pfeife. Bis zur Universität war es noch lange hin.
»Das wäre doch toll, oder? Wir sollten uns mal genauer erkundigen, findest du nicht?«
Wir erkundigten uns und holten uns Rat in der Schule. Die Priester wunderten sich, dass zwei gesunde Jungen aus guter Familie keine Anwälte oder Architekten werden wollten, aber schließlich gaben sie uns Auskunft, und Bolós und Miquel ließen sich immatrikulieren. Bolós (Josep Maria Bolós der Unverzichtbare Freund) verbrachte den ganzen Sommer damit, seinen Freund (mich) im Lateinischen, das ich seit Jahren hatte schleifen lassen, wieder auf Stand zu bringen. Die Orientierungslosen drehen sich wie Brummkreisel, heißt es, und so fanden wir uns, nach wochenlangem res, rei, fero, fers, ferre, tuli, latum und Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam, am ersten Tag des Semesters, erwartungsvoll und übertrieben förmlich angezogen, vor dem Gebäude der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität von Barcelona ein, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, in dem wir uns dem Studium der Geschichte der Menschheit, ihren Sprachen und ihrem Denken widmen würden, im Bestreben, sie zu reformieren, zu erneuern und zu leiten.
»Ein Haufen Weiber hier, was?«
»Ja, wurde aber auch Zeit.«
Gewohnt, auf die Jagd nach Mädchen gehen zu müssen, verunsicherte es sie ein wenig, erfüllte sie jedoch zugleich mit Hoffnung, dass es hier von Mädchen nur so wimmelte. Damit betraten sie die Welt der Erwachsenen.
»Es ist heiß.«
Als erste Maßnahme öffnete Miquel verstohlen den Kragenknopf und lockerte seine Krawatte. Bolós, der mittlerweile halbwegs mit der Pfeife zurechtkam, tat es ihm unauffällig nach.
»Was ist? Gehen wir rein?«
Um acht Uhr siebenunddreißig Minuten und zwölf Sekunden am zweiten Oktober neunzehnhundertsechsundsechzig durchschritten Gensana und Bolós, zwei unerschrockene Abiturienten des Jesuiten-Gymnasiums, die die Frechheit besessen hatten, keine Juristen werden zu wollen, bangen Herzens, einen Kloß im Hals und den Schlips in der Hosentasche, das Tor zum Tempel der Weisheit.
4
»Weißt du, dass ich in dieser Irrenanstalt entdeckt habe, was ich bin?«
»Und was bist du, Onkel?«
»Der wahrhaftige Maurici Ohneland, Chronist des Windes, Erfinder von Wirklichkeiten, Ex-Musiker, Ex-Philologe, dein Ex-Onkel.«
»Mein Onkel bist du immer noch.«
»Nein. Jetzt bin ich Chronist. Ich kann nicht so viel auf einmal sein.« Und als wollte er sich entschuldigen, steckte er das letzte Stück Schokolade in den Mund und wisperte: »Du bist wie ein Sohn für mich.«
»Danke.«
»Ich bedaure es, keine Kinder zu haben.« Der Onkel versank in seinen Erinnerungen und blieb einige endlos lange Minuten stumm, bis er schließlich mit monotoner Stimme zu reden begann: »Ich bedaure, keine zu haben. Fast so sehr, wie es mich schrecken würde, welche zu haben. Ich empfinde ein Kind als eine biologische Form der Kontinuität, ein Bollwerk gegen die Vernichtung. Es ist wie die Komposition einer Sonate oder eines Sonettes. Über dieses Thema hatte ich mit deinem Vater gesprochen, ehe wir uns entzweiten. Er sagte, ja, Maurici, Kinder zu haben bedeutet Fortdauer, doch Nachkommenschaft ist unerbittlich und der Prozess des Verschwindens unaufhaltsam. Unabänderlicher als der Tod selbst. Vielleicht hatte er ja recht, dein Vater. Wer weiß noch, was Mama Amèlias Lieblingsfarbe war? Und dabei ist sie erst acht oder zehn Jahre tot. Oder zwanzig oder dreißig, ich weiß es nicht.«
»Fünf.«
»Was?«
»Großmutter Amèlia ist vor fünf Jahren gestorben.«