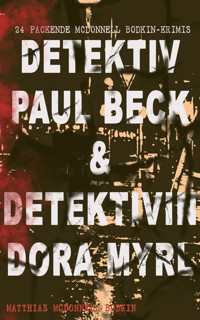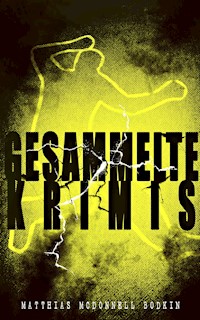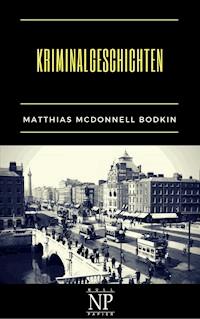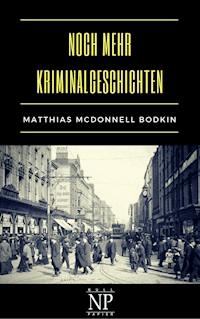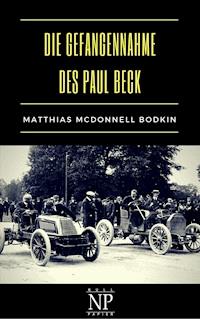Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Krimis bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Matthias McDonnell Bodkin (1850 - 1933) war ein irischer Nationalist, Politiker, Journalist und Schriftsteller. Neben seiner politischen Tätigkeit widmete er sich in nicht unbedeutendem Maße auch dem Schreiben von Kriminalgeschichten, Romanen, Dramen und politischen Kampfschriften. Bodkin zählt zu den populärsten Kriminalautoren des frühen zwanzigsten Jahrhunderts. Seine bekanntesten Geschichten kreisen um den privaten Ermittler Paul Beck. Diese Detektivfigur wird vielfach als der "irische Sherlock Holmes" bezeichnet. Bodkin ist es, der mit der hier vorgestellten Dora Myrl die erste weibliche Ermittlerin der Kriminalgeschichte präsentierte. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matthias McDonnell Bodkin
Eine Detektivin
Matthias McDonnell Bodkin
Eine Detektivin
(Dora Myrl, the Lady Detective)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Margarete Jacobi EV: Engelhorn, Stuttgart, 1913 2. Auflage, ISBN 978-3-954183-24-1
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Der falsche und der wahre Erbe
Die versteckte Violine
Der Krückstock
Die Sibylle
Wer gewinnt?
Ein Seidenknäuel
Auf der Lokomotive
Des Großonkels Vermächtnis
War es eine Fälschung?
Ein Versteckspiel
Gewogen und zu leicht erfunden
Künstliche Flügel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Krimis bei Null Papier
Der Frauenmörder
Eine Detektivin
Hemmungslos
Der Mann, der zu viel wusste
Noch mehr Detektivgeschichten
Sherlock Holmes – Sammlung
Eine Kriminalgeschichte & Das graue Haus in der Rue Richelieu
Der Doppelmord in der Rue Morgue
Indische Kriminalerzählungen
Kriminalgeschichten
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Das Buch
Matthias McDonnell Bodkin (1850 - 1933) war ein irischer Nationalist, Politiker, Journalist und Schriftsteller.
Neben seiner politischen Tätigkeit widmete er sich in nicht unbedeutendem Maße auch dem Schreiben von Kriminalgeschichten, Romanen, Dramen und politischen Kampfschriften.
Bodkin zählt zu den populärsten Kriminalautoren des frühen zwanzigsten Jahrhunderts. Seine bekanntesten Geschichten kreisen um den privaten Ermittler Paul Beck. Diese Detektivfigur wird vielfach als der »irische Sherlock Holmes« bezeichnet.
Bodkin ist es, der mit der hier vorgestellten Dora Myrl die erste weibliche Ermittlerin präsentierte.
Der falsche und der wahre Erbe
»Unmöglich!« dachte Roderich Aylmer, der Besitzer von Dunscombe, während er durch das Erkerfenster auf den breiten Kiesweg hinausblickte: »dieser kleine Backfisch soll ein glänzendes Universitätsexamen gemacht haben und Doktor der Medizin sein -- das ist ja rein lächerlich!«
Da kam mit raschem, flottem Schwung ein Fahrrad dahergesaust; ein zierliches, kleines Fräulein sprang ab und stieg leichtfüßig die steinernen Stufen herauf.
Sie trug auch wahrlich nicht den Stempel eines gelehrten Frauenzimmers, diese anmutige, bewegliche Gestalt, die jetzt auf der obersten Stufe im hellen Sonnenschein stand. Nach ihrer freundlichen und vergnügten Miene zu urteilen, hätte man sie viel eher für ein lustiges Schulmädchen halten können, das sich auf einem heißersehnten Ferienausflug ergötzt. Ein keckes Hütchen mit feuerrotem Federbusch saß auf den dicken glänzenden Flechten des krausen braunen Haares, und der kurze Rock ihres enganliegenden Kleides, den der leise Wind bewegte, ließ ihre zierlichen Füßchen sehen, die in hellbraunen Radfahrschuhen steckten.
Jetzt schritt sie unter den dorischen Säulen durch die Vorhalle und drückte auf die elektrische Klingel. »Kann ich Herrn Aylmer sprechen?« fragte sie den Diener, der die Türe weit öffnete, und reichte ihm ihre Visitenkarte. »Fräulein Dora Myrl« stand darauf.
Roderich Aylmer kam ihr selber entgegen. Er stieg die Treppe hinunter, durchschritt die kühle, mit schwarzen und weißen Marmorplatten belegte Halle und sagte, ihr die Hand reichend: »Seien Sie mir bestens willkommen!« Das Fräulein warf nur einen durchdringenden Blick auf sein ehrliches, hübsches Gesicht, dann legte sie ihr Händchen mit festem, herzlichem Druck in seine biedere Rechte.
»Wie ich Ihnen schon geschrieben habe, Fräulein Myrl«, begann er ohne weiteres, sobald sie zusammen im Wohnzimmer saßen, »ist meine Frau sehr krank und förmlich zum Schatten abgemagert: doch vermag kein Arzt ihr Übel zu erkennen. Als unser einziger Sohn vor zwölf Jahren geboren wurde, bekam sie ein schlimmes Fieber, von dem sie sich nie wieder ganz erholt hat. Sie ist immer geduldig, ja nur allzu sanft, wie mir dünkt: in Zorn gerät sie nie, aber es kommt auch kein Lächeln auf ihre Lippen. Obgleich sie unsern Sohn von ganzem Herzen liebt, scheint sie doch am traurigsten zu sein, wenn er bei ihr ist. Ihre Schwermut nimmt mit jedem Tage zu und wir führen ein trübseliges Leben. Deshalb schlage ich es Ihnen hoch an, daß Sie gekommen sind: ich würde Ihnen unendlich dankbar sein, wenn Sie meine arme Frau etwas herausreißen und erheitern könnten. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick; ich will ihr sagen, daß Sie hier sind, es wird ihr Freude machen.«
Als jedoch die hübsche Frau mit dem bleichen, abgezehrten Gesicht, auf den Arm ihres Gatten gestützt, langsam ins Zimmer trat, erkannte Dora Myrl auf den ersten Blick, daß die Herrin des Hauses über ihre Ankunft nicht erfreut war, sondern sich vor ihr fürchtete, wiewohl sie ihre geheime Angst unter einer liebenswürdigen Begrüßung zu verbergen suchte.
»Ich will ihr Vertrauen gewinnen und sehen, ob ich ihr nicht helfen kann«, dachte die scharfsinnige Dora in ihrem praktischen Sinn, während sie das tieftraurige Gesicht voll Mitleid betrachtete.
Die nächsten zwei Wochen vergingen in Dunscombe-Haus wie im Fluge. Aylmer fühlte sich neu belebt durch die Gesellschaft der munteren jungen Dame, die ihn ermutigte, sich im Tennis- und Croquetspiel auf dem glatten, grünen Rasen tüchtig anzustrengen und ihm Abends am Billard beim Schein der elektrischen Lampen manche Partie abgewann.
Auch der sanften Herrin des Hauses, die so traurige Augen hatte, war sie eine liebe Gefährtin. Selbst wenn sie ganz stumm bei einander saßen, hatte ihr teilnahmvolles Wesen etwas ungemein Trostreiches für dies schwergeprüfte Herz. Stets war sie fröhlich und hilfreich, aber obgleich ihre langen Gespräche mit Frau Aylmer oft in herzlicher Zärtlichkeit endeten und Dora mehr als einmal fühlte, daß sie dem verborgenen Kummer schon ganz nahe gekommen waren, so hatten sie ihn doch bis jetzt noch nicht berührt.
An einem warmen Nachmittag saßen sie beide in Alice Aylmers Boudoir, das auf den schattigen Garten hinausging, wo der kühle Springbrunnen plätscherte. Dora las und Frau Aylmer hielt eine Stickerei in der Hand, mit der sie sich stumm beschäftigte, aber trotzdem leisteten sie einander trauliche Gesellschaft. Während Dora mit den Blicken die Zeilen ihres Buches überflog und den Hauptinhalt der Geschichte auffaßte, waren ihre unruhigen Gedanken fortwährend mit dem Geheimnis beschäftigt, das sie in dem stillen Zimmer wie einen Druck zu spüren meinte.
Vertrauen erzeugt Vertrauen, überlegte sie, ich will damit anfangen, ihr etwas von mir zu erzählen. »Möchten Sie wohl wissen, Alice, wie es mir im Leben ergangen ist, ehe ich zu Ihnen kam?« fragte sie ohne besondere Einleitung.
»Nur wenn Sie gern davon sprechen, liebe Dora. Mir genügt es vollkommen, Sie als meine Freundin hier zu haben.«
»Aber Freundinnen sollten nichts voreinander verbergen«, sagte sie, und in ihren klaren grauen Augen leuchtete es hell auf. »Doch habe ich im Grunde wenig mitzuteilen, wenn ich’s recht bedenke. Mein Vater war ein ehrwürdiger Universitätsprofessor in Cambridge. Er heiratete spät und meine Mutter« -- hier bebte ihre Stimme und ihre Augen füllten sich mit Tränen -- »habe ich nie gekannt. Sie starb, als sie mir das Leben gab. Meinem Vater tat es zuerst leid, daß ich kein Knabe war, später indes söhnte er sich ganz damit aus und er setzte seinen größten Ehrgeiz darein, daß ich zugleich eine feingebildete Dame und eine Gelehrte werden sollte. Die Ärzte sagten, er habe dem Tode noch drei Monate länger widerstanden, als sie es für möglich gehalten hätten, um zu erleben, daß ich mein Examen in Cambridge mit Auszeichnung absolvierte. Dann starb er befriedigt und ließ mich im Alter von achtzehn Jahren mit zweihundert Pfund und meiner Würde als Bakkalaureus allein in der Welt zurück. Das mühselige Leben einer Schullehrerin reizte mich nicht; so verwandte ich denn mein geringes Vermögen darauf, mir den Doktortitel zu erwerben. Allein die Patienten blieben aus und auf sie warten konnte ich weder, noch mochte ich es. So bin ich denn im Laufe des letzten Jahres Telegraphistin, Telephonistin und Zeitungsschreiberin gewesen. Letzteres gefiel mir am besten, doch habe ich meinen eigentlichen Beruf noch nicht entdeckt. Ich bin ein kleiner unruhiger Geist, dessen rastlose Wißbegierde schwer zu befriedigen ist. Als ich in der Zeitung die Anzeige Ihres Gatten las, der eine lebhafte Gesellschafterin suchte, wurde meine Neugier wach, ich gab meine Stellung auf und kam hierher.«
»Hoffentlich haben Sie es nicht bereut!«
»Durchaus nicht, nur möchte ich --«
Ein lautes Klopfen an der Türe unterbrach ihre Worte.
»Frau Caruth ist unten«, meldete die eintretende Dienerin.
»Laß sie heraufkommen.«
Aber ehe das Mädchen noch die Botschaft ausrichten konnte, drängte sich Frau Caruth selbst mit Ungestüm an ihr vorüber ins Zimmer.
Sie war eine vierschrötige Gestalt mit blitzenden Augen unter scharf gezeichneten Brauen; Mund und Kinn verrieten Entschlossenheit, ihr Gesicht war ausdrucksvoll, selbst hübsch zu nennen, doch machte sie den Eindruck einer Frau, die mehr Furcht als Vertrauen einflößt. So kam es wenigstens der scharfsichtigen Dora Myrl vor, als sie von Frau Caruth zu Alice Aylmer hinblickte, die bei der zudringlichen neuen Erscheinung bald rot bald blaß wurde und zitterte wie Espenlaub.
Dora sah sie die Farbe wechseln, sie sah das Beben ihrer Glieder und gleich dem geübten Arzt, der den Patienten mit dem Stethoskop untersucht, bis er den geheimen Sitz der Krankheit erforscht hat, murmelte sie leise vor sich hin: »Hier steckt die Wurzel des Übels.«
Währenddem musterte Frau Caruth Dora mit unverschämten Blicken, in denen die deutliche Frage lag: »Was hast du hier zu suchen?«
Sicherlich hätte sich Dora dies freche Anstarren nicht gefallen lassen, aber aus Frau Aylmers Augen sprach ein so beredtes Flehen, daß sie ihr nicht widerstreben konnte.
»Wenn es Ihnen recht ist, Alice, möchte ich ein paar Briefe schreiben«, sagte sie und verließ eilends das Zimmer. Sie hörte, wie die Türe hinter ihr heftig zugeschlagen und der Schlüssel herumgedreht wurde.
Wohl eine Stunde saß Dora wartend im Nebenzimmer und vernahm von Zeit zu Zeit die herrischen Laute einer zornigen Stimme und unterdrücktes Weinen.
Endlich erschien Frau Caruth mit triumphierender Miene auf der Schwelle und entfernte sich, ohne Dora auch nur eines Blickes zu würdigen. Drinnen aber lag Frau Aylmer auf dein Sofa ausgestreckt! sie verbarg ihr Gesicht in den Samtkissen und schluchzte so leidenschaftlich, daß ihr ganzer Körper bebte.
Es lag in Dora Myrls Eigenart -- vielleicht war es ein Fehler ihrer Natur --, daß ihr trotz des warmen Mitgefühls, das ihr die leidende Freundin einflößte, doch der Gedanke durch den Kopf schoß: »Jetzt ist der günstige Augenblick gekommen, um das Geheimnis zu erfahren.«
Sie nahm neben dem Sofa Platz und umfaßte Alices matt herabhängende Rechte mit beiden Händen. »Nun sagen Sie mir alles, was Ihnen das Herz bedrückt«, bat sie.
Sie sprach freundlich wie zu einem Kinde, aber doch in so bestimmtem Ton, als könne von Widerspruch nicht die Rede sein, und Frau Aylmer, die durch Kummer und Furcht geschwächt war, fügte sich wie ein Kind ihrem Willen.
»Es war zur Zeit als mein Knabe geboren wurde«, begann sie.
»Ihr Sohn, der morgen in die Ferien nach Hause kommt?«
»Ja -- nein -- o mein Gott, Dora, haben Sie Geduld mit mir, ich will Ihnen alles bekennen. Aber unterbrechen Sie mich nicht, sonst verläßt mich die Kraft. -- Seit drei Jahren war ich mit Roderich verheiratet und unendlich glücklich, aber doch wußte ich nur zu gut, wie sehr mein Gatte sich einen Erben wünschte. Als der Knabe endlich zur Welt kam, war die Freude groß, aber leider nur von kurzer Dauer. Ich fühlte mich entsetzlich schwach und mein armer Säugling war sehr zart und hinfällig. Seine Händchen tasteten nach der Mutterbrust, aber vergebens öffnete er die Lippen, um Nahrung zu suchen. Ich hatte keine Milch für meinen Erstgeborenen -- o Dora -- Sie wissen nicht, wie schwer das ist! Frau Caruth war bei mir in Dienst gewesen und hatte dann den Grobschmied des Dorfes geheiratet -- einen Trunkenbold, wie ich später erfuhr. Am selben Tage, wie ich, hatte sie einen Knaben zur Welt gebracht und kam nun als Amme zu meinem Archibald. Es brach mir fast das Herz, als ich das winzige, blasse Geschöpfchen, das bei mir immer so kläglich wimmerte, in friedlichem Behagen an ihrer Brust liegen sah. Doch wurden wir täglich schwächer, der Knabe und ich; mir nahm wohl nur die Angst um das Kind alle Kraft. Eines Abends war ich fest eingeschlafen, und als ich erwachte, hörte ich in dem dunklen Zimmer meinen Mann und den Doktor im Flüsterton miteinander reden.
›Für sie fürchte ich keine Gefahr‹, sagte der Doktor mit solchem Nachdruck, daß es mich kalt überlief, denn ich erriet, was nun folgen würde.
›Und der Knabe?‹ erkundigte sich mein Mann leise. Wie oft hatte ich mich gesehnt die Frage zu stellen!
›Sind Sie stark genug, um die Wahrheit zu hören?‹
›Ja; alles ist leichter zu ertragen als diese beständige Furcht.‹
›Dann lassen Sie Furcht und Hoffnung fahren‹, antwortete der Doktor feierlich. ›Der Knabe kann nicht am Leben bleiben.‹
›Wie grausam ist dieser Ausspruch!‹
›Sie wollten die Wahrheit hören.‹
Ein leises verzweifeltes Stöhnen entrang sich der Brust meines armen Mannes. Mir blutete das Herz bei seinem Gram und ich hätte laut aufschreien mögen: da hörte ich, wie ihm der Doktor zuflüsterte: ›Nehmen Sie sich zusammen, damit Sie die Kranke nicht wecken.‹ Sie wußten wohl beide nicht, daß Frau Caruth im Zimmer war. Sobald sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, machte sie Licht, trat an mein Bett und sah mir ruhig ins Antlitz.
›Sie haben gehört, was der Doktor sagte, Madame; als Sie den Atem anhielten, wußte ich, daß Sie wach wären.‹
›O Martha, es wird meinen Mann umbringen‹, stieß ich verzweifelt heraus, ›er kann es nicht überleben!‹
›Möchten Sie ihm den Schmerz ersparen?‹
›Um jeden Preis. Selbst meine Seele gebe ich dafür hin -- doch es ist unmöglich.‹
›Ich weiß einen Ausweg. Wir müssen die Knaben vertauschen.‹
›Nun und nimmermehr!‹ rief ich.
›Erst hören Sie meinen Plan‹, sagte sie gebieterisch. ›Mein Sohn ist ein prächtiger Knabe und mehr wert als hundert solcher Jammerwesen wie Ihr Kind; Sie werden bei dem Tausch nur gewinnen. Ich kann Ihren Knaben nähren und vielleicht am Leben erhalten. In diesem Falle würden wir den Tausch wieder rückgängig machen. Stirbt er -- schaudern Sie nicht so -- Sie müssen darauf gefaßt sein -- stirbt er, so braucht es ihr Gatte nie zu erfahren und er behält immer noch einen schönen, kräftigen Erben.‹
Ich war so schwach und sie so stark; vielleicht dient mir das einigermaßen zur Entschuldigung. Meinem Gatten zuliebe willigte ich ein, mich von dem Knaben zu trennen: ich gab Frau Caruth Geld und Juwelen und ließ sie schwören, daß sie mein Kind gut behandeln würde.
›Ich will es lieben, als ob es mein eigenes wäre‹, versicherte sie mir unzählige Male.
Hierauf muß ich wohl in einen Fieberzustand verfallen sein; ich weinte und stöhnte den ganzen Tag, daß mein Sohn sterben würde. Bisher hatte mich eine freundliche Wärterin gepflegt; sie hieß Kitty Sullivan, war eine Irländerin und katholischer Religion. Sie versuchte auf jede Weise, mich zu trösten, und kniete zuletzt an der Wiege hin, um voll Inbrunst für mein Kind zu beten: ›Gegrüßet seist du, Maria! Heilige Jungfrau!‹ hörte ich sie wieder und wieder sagen, bis ich endlich in einen unruhigen Schlummer sank; doch selbst im Schlaf wurde ich von Furcht gepeinigt.
Die gute Kitty verließ mich an jenem Abend, und bis die neue Wärterin kam, sollte Frau Caruth meine Pflege übernehmen. Zur Nachtzeit betrat sie das düstere Krankenzimmer, zog ein Bündel unter ihrem Mantel hervor und machte sich an der Wiege zu schaffen. Ich schloß die Augen, um nicht zu sehen, wie sie die Kleider der beiden Kinder vertauschte. Wie ein finsterer Schatten glitt sie zur Türe hinaus und ich hörte ein Kind schreien. Das schnitt mir ins Herz gleich einem Messer: mein Knabe flehte mich an, ihn zu retten; aber alle Lebenskraft war von mir gewichen, ich fühlte mich sterbensmatt und fürchtete mich doch entsetzlich vor dem Tode.
Als ich wieder zu klarem Bewußtsein erwachte, schien der helle Tag ins Zimmer. Ich ahnte nicht, daß inzwischen ein Monat vergangen war. Der Arzt sprach mit meinem Manne, dessen Blick auf mir ruhte.
›Ihre Frau ist jetzt außer Gefahr‹, sagte er. ›An ihrer Erhaltung habe ich übrigens nie gezweifelt; aber, daß der Knabe lebt, ist ein wahres Wunder.‹ Man brachte ihn mir ans Bett, er war frisch und rosig und ich schwelgte in seinem Anblick.
Stellen Sie sich vor, Dora, daß ich Frau Caruth und ihren verruchten Plan gänzlich vergessen hatte und mir einbildete, es sei mein eigenes Kind. Welche Torheit, an den untrüglichen Instinkt der Mutter zu glauben! Ich liebte den Sohn jener abscheulichen Frau mit allen Fasern meines Herzens. Als mir die Erinnerung langsam zurückkehrte, brachte mich der Gedanke fast um den Verstand, aber an meiner Liebe änderte das nichts.
Man sagte mir, Frau Caruth sei spurlos verschwunden. Nach zwei Jahren kehrte sie jedoch ins Dorf zurück und brachte einen kleinen Knaben mit -- meinen und Roderichs Sohn, den wahren Erben von Dunscombe, den ich seiner Rechte beraubt hatte.
Seitdem fühle ich mich unaussprechlich elend in dem Bewußtsein, was ich für eine unnatürliche Mutter bin. Aber ich konnte und kann den Knaben, den ich liebe, nicht für meinen Sohn hingeben, der meinem Herzen fremd ist.
Frau Caruth war das wohl zufrieden. Ich gab ihr von Zeit zu Zeit Geld, und weiter verlangte sie nichts. Aber der Knabe, mein armer unglücklicher Sohn, ist auf böse Wege geraten. Heute kam sie, um mir zu sagen, man habe ihn auf einem Diebstahl ertappt und festgenommen. Ich müsse dafür sorgen, daß sein Vater ihn aus dem Gefängnis befreite, sonst würde sie alles verraten.
O, ich bin das elendeste Wesen unter der Sonne. Helfen Sie mir, Dora! Was fange ich nun an?«
»Sie müssen die Wahrheit gestehen.«
»Das kann ich nicht. Wie sollte ich es wagen! Es brächte Roderich um, wenn er erführe, daß sein Sohn ein Dieb ist. Ich weiß wohl, wie grausam und sündhaft es ist, daß ich mein eigenes Kind hasse und einem andern an seiner Statt meine Liebe zuwende. Doch es läßt sich nicht ändern. Wenn Sie morgen Archibald sehen, werden Sie meine Gefühle begreifen und mich bemitleiden.«
Am andern Tag kam vom Bahnhof ein Jagdwagen am Haus vorgefahren; ein munterer krausköpfiger Schulknabe hüpfte heraus, sprang wie ein Gummiball die Stufen hinauf und in Alice Aylmers ausgebreitete Arme. Bebend und errötend schloß sie ihn an ihr Herz.
»Denke dir nur, Mutter, fast hätte ich mein ›Glück‹ verloren«, rief er, während er noch an ihrem Halse hing. »Es fiel mir von der Uhrkette auf den Bahnsteig und wäre fast auf die Schienen gerollt. Bitte, verwahre es, bis man es wieder an der Kette festmachen kann.« Damit legte er eine kleine silberne Medaille auf das Schränkchen, neben dem er stand.
»Gut, ich will es an mich nehmen«, versetzte sie. »Geh jetzt nur auf dein Zimmer.«
Sobald der Knabe fort war, schwand alle Freude aus Frau Aylmers Zügen und sie warf Dora einen flehenden Blick zu, dem diese jedoch auswich.
»Sein Glück? Was wollte er damit sagen?«
Dora hatte die Medaille in die Hand genommen und betrachtete sie von allen Seiten. Sie war alt und abgenutzt, doch konnte man noch eine weibliche Gestalt darauf erkennen, die eine Krone trug und rings von Pünktchen umgeben war, die wie Sterne aussahen.
»Das gehört auch zu der Geschichte«, sagte Alice. »Die Schaumünze war an einem dünnen weißen Band fest um des Kindes Hals gebunden, das ich zerschneiden mußte, um sie abzunehmen. Als ich Frau Caruth danach fragte, geriet sie zuerst in Verlegenheit und leugnete, etwas davon zu wissen.
Nach einiger Zeit gestand sie mir aber, es sei ein Amulett, das ihr eine Zigeunerin gegeben habe. Natürlich glaube ich an solchen Zauber nicht, aber ich dachte, es könne nichts schaden, wenn der Knabe die Medaille an seiner Uhrkette trüge.«
»Haben Sie auch das Band aufbewahrt?« fragte Dora mit einer Erregung, die zu der unbedeutenden Tatsache in gar keinem Verhältnis stand.
»Jawohl«, versetzte Frau Aylmer verwundert. »Wollen Sie es sehen.«
Und sie schloß eine Schublade ihres Schreibtisches auf, wo unter andern Erinnerungszeichen aus Archibalds frühester Kindheit ein schmales weißes Band lag, das mit einem festen Knoten um des Kleinen Hals geknüpft gewesen und dicht am Knoten abgeschnitten war.
Dora Myrl nahm es der Mutter hastig aus der Hand, legte es neben des Knaben »Glück« auf den Tisch und betrachtete beides mit großer Aufmerksamkeit.
Dann wich plötzlich die Spannung aus ihren Mienen, und sie wandte sich mit strahlendem Lächeln zu Frau Aylmer hin.
»Es ist alles in Ordnung«, sagte sie.
»Aber was denn, liebe Dora?« fragte Alice erstaunt über die Zuversicht in Ton und Wesen der Freundin, die sie nicht zu deuten wagte.
»Sie sehen doch, daß das Band nur einmal zugeknüpft und nie wieder abgenommen worden ist?«
»Das ist ganz klar, aber --«
»Nur Geduld! Ich will Ihnen sagen, was das Amulett der Zigeunerin eigentlich ist: eine geweihte Denkmünze, auf deren Schutz die Katholiken fest vertrauen. Kein Wunder, daß Frau Caruth sich nicht erklären konnte --«
»O Dora, Sie erschrecken mich. Reden Sie weiter!«
»Sie werden mich gleich verstehen. Sagten Sie mir nicht, Ihre katholische Wärterin habe für den Knaben gebetet, noch ehe die Kinder vertauscht worden waren? Sie hat ihm die Medaille um den Hals gebunden, und sie ist niemals entfernt worden, bevor Sie das Band zerschnitten haben. Können Sie jetzt die frohe Botschaft erraten?«
»Es ist mein Kind, mein eigenes Kind!«
Die Worte kamen in gebrochenen Lauten über Frau Aylmers Lippen.
»Natürlich, Ihr eigenes Kind, liebe Alice«, versicherte Dora mit Bestimmtheit. »Ihre Mutterliebe hat sich nicht getäuscht. Frau Caruths Plan ist leicht zu durchschauen; sie hat weder die Kinder, noch deren Kleider jemals vertauscht, sonst hätte sie die Denkmünze bemerken müssen. Sie behielt ihr eigenes Kind, das sie gewiß auch auf ihre Art lieb hatte, und wußte Ihnen den Glauben beizubringen, daß es das Ihrige sei. Mochte Ihr Sohn nun leben, oder sterben, so hatte sie immer die Möglichkeit, aus dem Betrug Nutzen zu ziehen.«
Hoffnung und Freude malten sich in Frau Aylmers Blicken. Und als jetzt Archibald lustig ins Zimmer gestürmt kam, die Angelrute in der einen Hand und seine Ballkelle in der andern, war er nicht wenig erstaunt, als ihn die Mutter heftig an sich riß, so daß sein Spielzeug auf den Boden rollte, ihn mit Liebkosungen überhäufte und so fest ans Herz drückte, als wolle sie ihn nie wieder aus ihren Armen lassen. »Mein Sohn«, rief sie dabei, »jetzt endlich, endlich gehörst du mir ganz!«
Als Frau Caruth am nächsten Morgen Alice wieder zu sehen verlangte, wurde sie von Fräulein Dora Myrl empfangen. Bei dem Kreuzverhör, das die scharfsinnige junge Dame mit ihr anstellte, verlor die Betrügerin bald alle Fassung und gestand ihre Arglist ein. Mit Furcht und Zittern floh sie aus dem Dorfe und störte fortan Alice Aylmers Frieden niemals wieder.
»Sie sind unser guter Engel, Fräulein Myrl«, sagte Herr Aylmer an jenem Abend, als die drei beisammen saßen, und Alice lächelte dazu glückselig, wenn auch unter Tränen.
Sie hatte ihrem Gatten alles gestanden, und nun sie seiner Vergebung sicher war, kehrte wieder Ruhe in ihre Seele ein.
»Ja«, wiederholte Roderich Aylmer mit Nachdruck, »Sie sind unser guter Engel. Ihnen verdanken wir alles wiedergefundene Glück. Eine dunkle Wolke hing über unserm Hause und Sie waren die Sonne, die sie vertrieben hat. Nun müssen Sie uns aber auch gestatten, Ihnen unsre Dankbarkeit zu beweisen und --«
Da unterbrach ihn Dora mit munterem Lachen. »Reden Sie doch nicht in so poetischen Ausdrücken, Herr Aylmer«, sagte sie. »Ich bitte Sie nur, mich gelegentlich bei Ihren Freunden zu empfehlen, denn jetzt habe ich meinen Beruf entdeckt und will diese Karte sogleich nach der Druckerei schicken.«
Die junge Dame hatte, während sie sprach, etwas auf ein Stück Papier geschrieben, das sie jetzt vor Roderich Aylmer hinlegte.
In sauberer, klarer Schrift, fast so deutlich, als wäre sie gedruckt, waren darauf die Worte zu lesen:
Fräulein Dora Myrl, Geheimpolizistin.
Die versteckte Violine
»Ich käme gerne, Sylvia, aber ich kann nicht.«
»Du mußt, Dora!«
»Das ist leicht gesagt. Ich habe einen dringenden Fall zu bearbeiten, der bis morgen fertig sein muß. Wo soll ich die Zeit hernehmen?«
»Du wirst es schon einrichten.«
Die beiden Mädchen hatten am Nachmittag in Doras freundlichem, kleinem Wohnzimmer behaglich bei einer Tasse Tee gesessen. Jetzt sprang Sylvia so hastig auf, daß ihr seidenes Kleid raschelte; schelmische Grübchen zeigten sich in ihren Wangen und ihre Augen leuchteten. Sie mußte wohl eine angenehme Überraschung für die Freundin auf dem Herzen haben, die sie nur noch mit Mühe zurückhielt.
Dora folgte ihr mit den Blicken.
»Höre Sylvia, ich bin zwar Geheimpolizistin, aber dein Rätsel kann ich nicht raten. Wenn du es etwa in deinem neumodischen seidenen Ärmel verbirgst, dann nur heraus damit! --«
Sylvia stellte sich in freudiger Erregung vor sie hin.
»Signor Nicolo Amati wird bei uns spielen. So, nun weißt du’s.«
Dora Myrl dachte an keinen Widerstand mehr.
»Natürlich komme ich«, sagte sie lächelnd.
»Ob du Zeit hast oder nicht?«
»Unter allen Umständen!«
Eine solche Gelegenheit hätte sich auch niemand entgehen lassen, geschweige denn ein Mädchen wie Dora Myrl, der die Lebenslust in allen Fingerspitzen prickelte.
Ganz London -- das heißt, das ganze gebildete und kunstliebende Publikum Londons, war noch immer voll davon, daß der berühmte Mäcen und Musikkenner, Lord Mellecent, bei einer Reise, die er mit seiner Tochter Sylvia durch Norditalien machte, in einem unter Weinlaub verborgenen Dörfchen am Ufer des Po einen wunderbaren Violinisten mit einer himmlischen Geige entdeckt hatte.
Der Lord war sofort überzeugt gewesen, daß die Geige ein Meisterwerk von Antonio Stradivarius sein müsse, und der Geiger erwies sich als ein direkter Nachkomme von Nicolo Amati, dessen Namen er trug. Seit Jahrhunderten hatte sich das kostbare Instrument von Generation zu Generation in der hochbegabten Familie Amati vererbt und für die einfachen Dorfbewohner Musik gemacht. Bei Hochzeiten hatte es zum Tanz aufgespielt und an den Gräbern hatte es seine Klage erschallen lassen. Unter allen Geigern aber, die je mit dem Bogen seine Saiten gerührt hatten, galt der junge Nicolo für den ausgezeichnetsten. Er wußte seiner wunderbaren Violine Töne zu entlocken, die lieblicher waren als das Vogelgezwitscher zur Frühlingszeit und wehmütiger als das Stöhnen des Herbstwindes in den entlaubten Bäumen.
Lord Mellecent geriet außer sich vor Entzücken und konnte sich von dem sonnigen Dörfchen nicht losreißen, bis es ihm nach einem Monat gelang, den Geiger samt seiner Violine nach dem nebligen London zu entführen. Man munkelte sogar, die blauen Augen seiner goldhaarigen Tochter Sylvia seien bei dieser Eroberung nicht ganz unbeteiligt gewesen.
Nicolo Amati hatte seine Kunst nicht auf theoretischem Wege erlernt. Die zauberhaften Melodieen, die er zu spielen verstand, wurden ihm nur, wenn man so sagen darf, durch das Gehör als Erbteil übermittelt. Seine ganze Seele war voll Sang und Klang, und die Musik entströmte den Saiten seines Instruments mit solcher Leichtigkeit, wie der Nachtigall ihr Lied aus der Kehle quillt. Als er nun die Meisterwerke der großen Komponisten kennen lernte, sah er sich in eine neue Welt versetzt, die ihm ungeahnte Genüsse bot.
Im Frühling war er nach London gekommen, und als man die Ankündigung las, daß er im Anfang des Herbstes zum ersten Male öffentlich auftreten werde, wurden die Gemüter von fieberhafter Erwartung erfüllt.
So standen die Dinge, als Lord Mellecents Tochter ihrer Freundin Dora Myrl die aufregende Nachricht verkündigte, daß der Künstler, noch vor dem öffentlichen Konzert, bei einem Empfangsabend in ihrem elterlichen Hause spielen würde.
Beide Mädchen waren Schulgefährtinnen gewesen. Die um drei Jahre ältere Dora, die sowohl in der Klasse als auf dem Spielplatz immer die Erste war, hatte sich der schüchternen blondlockigen Kleinen bei ihrem Eintritt in die Schule liebevoll angenommen und ihr alle Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt. Daraus entstand allmählich eine innige Freundschaft, doch war und blieb Dora für Sylvia immer eine Respektsperson, und die Grafentochter schaute mit Ehrfurcht und Liebe zu der Geheimpolizistin auf. Seit einiger Zeit widmete sie aber auch zugleich dem wunderbaren Italiener ihre Huldigung und Signor Nicolo Amati wurde häufig in den Gesprächen der Freundinnen erwähnt. Dora brannte vor Begierde, ihn zu sehen und zu hören, und zwar nicht um Sylvias willen. Sie selber liebte die Musik leidenschaftlich und wünschte sich persönlich davon zu überzeugen, ob der neue Abgott am Kunsthimmel des Weihrauchs würdig sei, den man ihm streute.