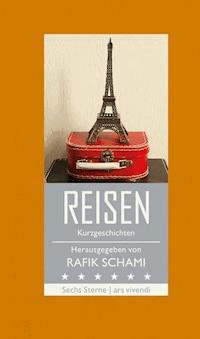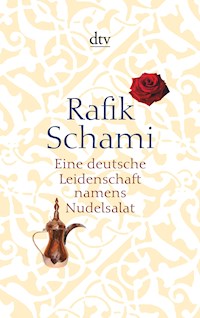
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein liebevoller Brückenschlag zwischen Orient und Okzident Seit beinahe vierzig Jahren lebt Rafik Schami nun schon in Deutschland, seinen staunenden und kritischen Blick auf den deutschen Alltag hat er dabei nicht verloren. Unnachahmlich charmant erzählt er in den teilweise erstmals veröffentlichten Erzählungen aus den Jahren 1990 bis 2010 von den Deutschen und ihren sprachlichen Eigenheiten, wundert sich über die unerschütterliche Konsequenz, mit der deutsche Gäste bei Einladungen selbst gemachten Nudelsalat mitbringen, muss erfahren, dass ein Kaufhaus kein Basar ist, verrät, warum er kein Amerikaner wurde, und schließt – beinahe – Freundschaft mit der sprechenden Stubenfliege Subabe. Neue, bislang unveröffentlichte und überarbeitete Erzählungen aus den Jahren 1990 bis 2010. Inhalt: - Warum wir keine Amerikaner wurden - Erinnerst du dich? - Eine deutsche Leidenschaft namens Nudelsalat - Der Leichenschmaus - Entspannung in Frankfurt - Von echten und unechten Deutschen - Vaters Besuch - Warum ist ein Kaufhaus kein Basar? - Eine Germanistin im Haus erspart den Psychiater - Schulz plant seine Entführung - Der geborene Straßenkehrer - Mein sauberer Mord - Eine Leiche zu viel - Der Libanese - Subabe - Eine harmlose Lesung - Der letzte Zettel - Gottes erster Kriminalfall - Einmal Kairo und zurück - Das Buch der Zukunft
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Rafik Schami
Eine deutsche Leidenschaft namens Nudelsalat
und andere seltsame Geschichten
Deutscher Taschenbuch Verlag
© 2011Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
eBook ISBN 978-3-423-40750-2 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-14003-4
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de/ebooks
Rückblende der Sehnsucht
Warum wir keine Amerikaner wurden
Erinnerst du dich?
Der andere Blick
Eine deutsche Leidenschaft namens Nudelsalat
Der Leichenschmaus
Entspannung in Frankfurt
Von echten und unechten Deutschen
Vaters Besuch
Warum ist ein Kaufhaus kein Basar?
Eine Germanistin im Haus erspart den Psychiater
Schulz plant seine Entführung
Der geborene Straßenkehrer
Mörderische Verwandlungen
Mein sauberer Mord
Eine Leiche zu viel
Der Libanese
Fantasie der Einsamkeit
Subabe
Eine harmlose Lesung
Der letzte Zettel
Gottes erster Kriminalfall
Einmal Kairo und zurück
Das Buch der Zukunft
[Informationen zum Buch]
[Informationen zum Autor]
Für Emil Fadel, für die kostbaren Jahre
Rückblende der Sehnsucht
Orte der Kindheit melden sich als Antwort auf Entfernung und Trennung oft in schillernden Farben zurück. Es sind Erinnerungen in Bildern, Stimmen und Geschichten. Wäre mein Gedächtnis eine Lagerhalle, so hätte die Abteilung »Kindheit« die meisten Mitarbeiter, und diese müssten mit Sicherheit oft zu Unzeiten Überstunden machen. Am frühen Morgen und spät in der Nacht.
Und seltsam ist, wie die Erinnerung schärfer und weicher malt, als das Erlebte zu seiner Zeit gewesen sein kann.
Warum wir keine Amerikaner wurden
Ein Onkel meines Vaters war nach Florida ausgewandert. Nach einem langen Arbeitsleben als Bäcker und Konditor war er ein reicher Mann geworden, aber kinderlos geblieben. Unter keinen Umständen wollte er sein Vermögen eines Tages einmal dem amerikanischen Staat vererben. Und da er als guter Araber auch nach vierzig Jahren noch eine starke Bindung zu seiner Sippe fühlte, schrieb er seinen drei Neffen, die ebenfalls alle Bäcker waren, sie sollten ihm Familienfotos schicken, da er Sehnsucht nach ihnen habe. In Wahrheit wollte er prüfen, wem gegenüber er möglicherweise Sympathie empfinden könnte.
Für uns in Damaskus bedeutete das einen überstürzten Fototermin. Wir bekamen neue Kleider und stellten uns im Innenhof unseres Hauses vor Blumen und Pflanzen in Pose. Der Fotograf war schlecht gelaunt, weil mein Vater dessen Kulissen aus Schwänen und Palmen rundweg abgelehnt hatte. »Schwäne bringen Unglück«, erklärte er dem Mann, meiner Mutter aber flüsterte er auf Aramäisch zu: »Das kostet sonst viel mehr.«
Mein Bruder Antonios hörte nicht auf, Faxen zu machen und vulgäre Dinge über den wirklich hässlichen Fotografen zu erzählen. Außerdem rief er dauernd dazwischen, er wolle als Hintergrund lieber ein Plakat vom Wilden Westen, und brachte meine Schwester Marie und mich immer wieder zum Lachen. Nur mein ältester Bruder stand unbeeindruckt und mit unbeweglicher Miene neben uns. Das war mehr, als der Fotograf ertragen konnte. »Wir sind doch hier nicht in einer Kaserne, mach dich locker«, schimpfte er. Dann hustete er und spuckte auf die glänzenden Fliesen des Innenhofs. Meine Mutter hasste nichts auf der Welt mehr als Männer, die spuckten. Aus diesem Grund hatte sie meinem Vater eine ganze Schublade voll feinster Taschentücher geschenkt. Sie verfluchte den Fotografen als Barbaren und als Sohn eines Barbaren und schaute angeekelt auf den mächtigen Batzen Spucke. Genau diese Miene war später auf dem Foto zu sehen.
Mein Bruder Antonios und ich bekamen die ersten Ohrfeigen. Marie blieb verschont, weil sie in ihrem weißen Kleid engelsgleich dastand und viel zu klein war für eine große Ohrfeige vom väterlichen Kaliber. Nach der zweiten Ohrfeige heulten wir. Der Fotograf verfluchte uns und mahnte meinen Vater barsch, seine Hand bei sich zu lassen. Diese Formulierung kam in meinem Leben nur einmal vor – die Hand bei sich lassen. Ich habe sie in bitterer Erinnerung und deshalb in meinen dreißig Büchern nicht ein einziges Mal gebraucht.
Als Antonios nicht aufhören wollte, Witze zu reißen, gab ihm mein ältester Bruder, stellvertretend für den Vater, einen kräftigen Tritt. Schlagartig verwandelte sich Antonios in einen Schauspieler, tat so, als wäre die Kamera des Fotografen, damals ein beachtlicher Kasten aus Holz, eine Filmkamera, und warf sich wie Robert Mitchum nach einem Faustschlag in einer Bar zu Boden. Der Fotograf bat ihn mit süßlicher, aber zugleich giftiger Stimme aufzustehen. Antonios richtete sich auf und wischte sich mit dem rechten Handrücken über seinen Mundwinkel. Es gab nichts zu wischen, aber diese Geste gehörte zur Filmszene. Ich bog mich vor Lachen und mein Vater drehte mir gegen alle Gesetze der Physik, Biologie und Pädagogik mein rechtes Ohr um 180Grad herum. Und staunte selbst, wie das Ohr in seine Ausgangsposition zurückschnellte. Dieses Staunen ließ sein Gesicht auf dem Foto nicht gerade intelligent erscheinen.
Ich mache es kurz. Das Foto wurde nach Amerika geschickt. Der Onkel in Florida hat nie geantwortet. Und so blieben wir Syrer.
© 2005
Erinnerst du dich?
Erinnerst du dich an unsere erste Begegnung? Ich weiß es noch wie heute. Es war Ostern, und Damaskus hatte es wie immer eilig und bot seinen Bewohnern einen sommerlich heißen Tag. Du hast ein dunkelblaues Kleid getragen und dieses merkwürdige klotzige vergoldete Herz an einer nicht dazu passenden dünnen Halskette. Ich ahnte sofort, dass du aus ärmlichen Verhältnissen kommst. Das ist das Geschenk, das reiche Eltern ihren Kindern mit auf den Weg geben: einen unbestechlichen Blick für die Armut, auch wenn sich diese mit Strass und Klunkern tarnt.
Aber als du mich angeschaut hast, war ich irritiert. Deinen Blick besaßen damals nicht einmal die Töchter der höchsten Kreise. Nur die Söhne der Feudalen hatten diesen herrischen Blick, der jedem sagte, hier bin ich der Herrscher, der dir gestattet, seine Anwesenheit zu genießen. Deine Antworten waren verwirrend frisch. Sie begaben sich nie ins Labyrinth der arabischen Höflichkeiten, sondern zielten ins Schwarze und trafen mein Herz.
Ich war zwanzig und befand mich bereits am Ende einer Sackgasse. »Hat jetzt eine weitere Tonne bitterer Galle dein Herz verlassen?«, hast du oft scherzhaft gefragt.
Übertrieben hast du nie. Jahr für Jahr hast du eine Region meines Herzens von Bitterkeit befreit, bis ich mich nach zehn Jahren an deiner Seite eines schönen Morgens so federleicht fühlte, dass ich, wenn ich etwas mutiger gewesen wäre, hätte fliegen können.
Du hast mir viel Zeit gegeben. »Warum warst du so bitter?«, hast du erst Jahre später gefragt; und ich wollte es dir immer erzählen, doch ich fand keine Gelegenheit oder hatte die Ruhe nicht. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.
Mein Vater, der große Georg Abiad, hatte mit seiner Schwester Amina, der steinreichen Witwe des ersten syrischen Bankiers, Joseph Hawi, ausgemacht, dass ich ihre Tochter Maissa heiraten sollte, um Ruhm und Reichtum zu vermählen. Ich mochte Maissa nicht. Sie war doppelt so groß wie ich und ihr Hintern roch ekelhaft nach altem Ziegenbock. Woher ich das wusste? Das ist eine kleine Geschichte.
Sie war drei Jahre älter als ich, und was ich von ihr aus vergangenen Kindertagen im Gedächtnis behalten hatte, war, dass sie mich immer schlug, mich zu Boden warf, sich auf meine Brust setzte und ihre Süßigkeiten aß. Sie nannte mich nur Kissen und Docht oder Zahnstocher. Mit den Jahren bekam ich immer Angst, wenn ich hörte, dass Tante Amina mit ihrer Tochter Maissa zu uns kommen wollte. Ich versteckte mich, und obwohl unser riesiges Haus Nischen und Winkel hatte, die nicht einmal ich kannte, und obwohl mich keiner der vielen Bediensteten meiner Eltern verriet, saß Maissa schon nach einer Viertelstunde auf mir und aß, bis irgendjemand Mitleid mit mir bekam und sie höflich bat, mich freizugeben. Sie sagte dann nur schlecht gelaunt: »Na, wenn es sein muss«, und stand auf. Und danach rochen mein Hemd und meine Hose so sehr nach altem Ziegenbock, dass ich mich sofort umziehen musste, wollte ich mich nicht erbrechen. Ich habe sie gehasst, doch wie so oft im Leben sollte gerade sie mir zu meinem Glück verhelfen, aber das kam ja erst viel später.
An dem Tag, als ich dich sah, war ich also sehr verbittert. Mein Vater hatte am Morgen mit dem Bischof gesprochen und festgelegt, dass die Hochzeit an Ostern stattfinden sollte. Wir, meine Cousine und ich, könnten uns in dem verbleibenden Jahr näher kommen.
»Docht«, sagte sie mir bei der nächsten Begegnung. Sie war dreiundzwanzig, und obwohl sie sich seit Jahren nicht mehr auf mich setzte, roch ich nach jeder Begegnung mit ihr sehr unangenehm und musste mich duschen. »Docht, ich will dich nicht«, sagte sie leise, »ich liebe einen anderen, einen Prachtkerl, der mich bei jeder Umarmung zerquetscht. Er ist verheiratet, aber er wartet, bis seine schwerkranke Frau stirbt, und ich will nur ihn. Zum Teufel mit deinem Vater und meiner Mutter.«
Ich liebte damals keine Frau. Ich wusste nicht einmal, was Liebe ist. Meine Eltern küssten sich nie. Ich erinnere mich noch daran, wie ich einmal in der Küche den Chauffeur meines Vaters dabei ertappte, wie er unsere hübsche Köchin küsste, und wie ich schrie: »Mama, Mama, der Chauffeur frisst unsere Köchin!«
Mein Vater ging, was ich erst viel später erfuhr, jede Woche zu seiner Hure, was meine Mutter damals mit der Geduld der arabischen Frauen ertrug. »Männer brauchen das«, sagte sie später verklärend und umhüllte ihre sklavische Haltung mit dem Mantel der Weisheit. »Sonst steigen ihnen die Samenwürmchen ins Hirn und fressen es auf.«
Ich fand Maissa zum ersten Mal in meinem Leben sympathisch und sehr mutig. Sie beging eine Todsünde und kümmerte sich nicht darum. Jeden Sonntag in der Kirche nahm sie die Kommunion und ging an mir vorbei zur Bank der Frauen. Sie ging mit verklärtem Blick, als wäre sie die heilige Therese persönlich. Als ich sie einmal unter vier Augen giftig darauf ansprach, lächelte sie. »Mein aufrechter Zahnstocher«, sagte sie, weil ich mir besondere Mühe gab, mit geschwellter Brust vor ihr zu stehen, »Liebe ist nie Sünde, lass dir das gesagt sein. Die Pfaffen haben keine Ahnung davon. Sie leben zu lange hinter hohen Mauern, und wenn sie das Kloster verlassen, tragen sie die Mauer im Herzen. Nein, mein Gewissen ist reiner als eine Lilie, und wenn Halim, mein Geliebter, mich drückt, rieche ich das Paradies und manchmal sehe ich sogar Engel auf einer Wolke vorbeischweben.«
Damals dachte ich, sie spinnt, aber hast du mir nicht später auch immer wieder dieselben Worte gesagt, als hätte Maissa sie dich gelehrt?
Ja, Maissa. Sie wartete Jahre auf ihren Halim, doch er starb vor seiner Frau. Und sie? Sie wurde verrückt vor Trauer.
Aber auch das war ja erst viel später. Damals, als ich dich sah, war die Welt ein einziger Schmerz. Mein Vater hatte von meiner Mutter erfahren, dass ich Maissa nicht wollte.
»Und warum?«, fragte er mich fast interessiert.
»Ich liebe sie nicht«, sagte ich mit dem Mut des Verzweifelten. Er hatte mich als Kind wegen Nichtigkeiten oft halb totgeschlagen.
»Maissa ist eine gute Frau und du wirst dich an sie gewöhnen, so wie ich mich an deine Mutter gewöhnt habe. Männer brauchen keine Liebe. Das ist Dichtung. Sie brauchen Rückendeckung und einen Stammhalter, und wie du siehst, habe ich keine schlechte Wahl mit deiner Mutter getroffen. Und wie lebt sie? Sie ist eine Königin. Sie braucht nur mit dem Finger zu schnippen, dann rennen alle im Haus, um ihr den Wunsch zu erfüllen.«
Mutter hatte mit vierzig Jahren zehn Kinder in die Welt gesetzt, drei davon waren schon unter der Erde. Sie war rund und rotbackig geworden und starb mit fünfzig an einem Hirnschlag. Und Vater hatte nicht gelogen. Sie war für die anderen Menschen eine Königin, aber eine Sklavin vor ihm. Er verehrte sie – vor allem vor Gästen. Sie war in der Tat eine Herrscherin über zehn Bedienstete, die im großen Garten, in der Küche, in den Wäscheräumen und den unzähligen Salons, Schlafzimmern, Bädern, Vorratsräumen, Kellern und Dachböden unablässig beschäftigt waren. Sie war eine einsame Herrscherin, todunglücklich, und hatte zu uns Kindern kein Verhältnis. Sie kam mir vor wie die Direktorin eines vornehmen Kinderheims.
Meine Eltern bewohnten damals das größte Haus in der Saitungasse. Es lag unmittelbar neben dem Sitz des katholischen Patriarchen. Ein Jahr nach unserer Flucht war das Haus dann in Brand geraten und Vater war dem Tode nur durch ein Wunder entkommen. Er wollte das Anwesen nie wieder betreten. Er verkaufte den Grund für viel Geld an die katholische Kirche und baute sich davon eine Villa in der neuen Stadt in Salihije. Dort leben heute noch meine drei jüngsten Schwestern mit ihren Ehemännern und zwanzig Kindern. Du weißt, sie können uns alle nicht in die Augen schauen, weil sie sich ihres Reichtums schämen, den sie durch meine Enterbung an sich gerissen haben. Aber das kam ja erst viel, viel später.
Damals, als ich dich sah, war ich dem Tode nahe.
Kennst du das? Man weiß, man will etwas nicht machen, aber alle anderen machen es. Michel wie Georg, die Söhne unserer wohlhabenden Nachbarn, heirateten Frauen, die von ihren Eltern bestimmt worden waren. Dabei hatten sie im Gegensatz zu mir bereits mit achtzehn ein abenteuerliches Leben mit jungen Frauen und Huren hinter sich, und ich dachte, wenn ich ihre Schilderungen hörte, ich komme aus einem Kuhdorf in den Bergen. Ich glaubte, sie würden es weit bringen und mindestens eine englische oder spanische Prinzessin heiraten, während ich als Ehemann unter Maissa liegen würde. Aber die zwei kamen in ihrem ganzen Leben nicht weiter als Bab Tuma, wo das Juweliergeschäft ihres Vaters war, und ihre Mutter bestimmte ihr Leben, denn ihre Frauen wurden bald zu Bediensteten im großen herrschaftlichen Haus. Und wenn ich sie fragte, wie es ihnen gehe, antworteten sie bitter: »C’est la vie« oder: »Das Leben ist kein Film.«
Alle, auch meine Geschwister, gehorchten dem Gesetz der Sippe. Die Sehnsucht nach Macht und Sicherheit war stärker als der Traum vom Herzkitzeln, das niemanden satt macht. Und sie alle zählten mir auf, welche Macht oder wie viel Geld der Mann oder die Frau, die für sie bestimmt war, hatte. Und als ich einmal fragte, wollt ihr leben oder den Staat mit Macht und Geld anführen, lachten sie mich aus. Und wenn dann etwas schiefging bei ihnen, nannten sie es Schicksal, auch das, was sie selbst verschuldet hatten.
Nur ich wollte mich nicht beugen und war einsam wie ein Verstoßener in der Wüste. Heute kann ich darüber lachen, aber damals konnte ich nicht schlafen.
Als ich dich traf, war ich am Tiefpunkt meines Lebens. Ich wollte auf gar keinen Fall mit Maissa leben und wusste keinen Ausweg, und dann sah ich dich. Mich faszinierte dein leichter Fuß. Im Tanz wie im Leben.
Erinnerst du dich, wie dünn du warst? Du hättest unter der Tür hindurchschlüpfen können. Ich dachte, die arme Frau hungert, wenn ich mit ihr lebe, werde ich sie zu einer Schönheit herausfüttern, aber als ich dann sah, was du an Mengen in dich hineingestopft hast und wie du trotzdem dünn geblieben bist, gab ich das Füttern auf. Ich weiß noch, du hast rote Schuhe getragen und ich liebte sie an deinen Füßen, und dann hast du mit den anderen im katholischen Gemeindehaus getanzt. Und ich war eifersüchtig auf alle und wusste nicht, warum.
Pfarrer Samuel hatte mich damals eingeladen. Er konnte nicht verstehen, dass mein Vater mich gegen meinen Willen verheiraten wollte. Ja, Pfarrer Samuel, das war ein Kerl. Er soll in seinem Leben die Erde einmal rundherum bereist haben, und einmal vertikal, durch Himmel und Hölle. Er war sechzig, doch sein Herz war jünger als unseres.
Er sagte mir, ich solle nicht so traurig dreinblicken, denn das passe nicht zu mir, und wenn ich Lust hätte, solle ich zu seinem Treff am Sonntagnachmittag kommen. Man singe und tanze zusammen und esse dann gemeinsam Abendbrot. Ich kam, ohne etwas zu erwarten, und ahnte nicht, dass mein Leben dort einen neuen Anfang nehmen würde und dass ich mit einer Liebe reich würde, die heute, mehr als fünfzig Jahre danach, noch heftiger in meinem Herzen pocht als zu ihrem Anfang. Hörst du, mein Herz?
Wenn mir das damals jemand gesagt hätte, so hätte ich gelacht und ihn gebeten etwas weniger zu übertreiben, aber wie du immer gesagt hast, das Leben ist der größte Märchenerzähler aller Zeiten.
Erinnerst du dich? Als ich dich fragte, ich saß zufällig neben dir beim Abendbrot, was du so machst, da hast du frech gesagt: »Ach, was soll eine wie ich schon den ganzen Tag tun? Vierzehn Stunden Daumendrehen und acht Stunden Schlaf.«
»Aber es bleiben zwei Stunden übrig«, wandte ich ein und schaute in die schönsten Augen der Welt, die vor Freude nur so sprühten.
»Ach ja, die übrigen zwei Stunden verbringe ich im Bad, um mich nach dem Daumendrehen zu erfrischen.«
Ich lachte.
Und im Laufe des Abends merkte ich, wie fremd auch du in dieser Versammlung warst. Erinnerst du dich? Du warst die einzige Frau, die nicht nur dann gesprochen hat, wenn man sie fragte, sondern auch dann, wenn sie das wollte.
Und du hast mir erzählt, dass du Dienstmädchen im Hause eines französischen Generals seist und dass die Herrin des Hauses sehr nett zu dir, aber nicht zu ihrem Mann sei. Und dass du schon seit zehn Jahren bei ihnen arbeitest, damit deine verarmte Familie überleben kann.
Ich erschrak, als ich erfuhr, dass du schon mit acht Jahren deine Familie ernähren musstest.
»Ich hatte noch Glück. Meine anderen Geschwister müssen noch härter arbeiten und liefern zu viert nicht so viel ab wie ich alleine. Die Franzosen sind großzügig.«
Ich hatte keine Ahnung von dieser Welt gehabt und bis dahin wie in parfümierter Watte gelebt, blind und taub für alles, was außerhalb meines Elternhauses passierte, und dann hast du mir erzählt, wie ihr als kleine Kinder vor Hunger nicht schlafen konntet. Und das im selben christlichen Viertel von Damaskus.
Ich durfte dich dann zu dem Haus in Bab Tuma begleiten, aber vor Sonnenuntergang. Das war die Bedingung der französischen Hausherrin.
Erinnerst du dich? Als du mich beim Abschied gefragt hast, ob ich am nächsten Sonntag wieder zu Pfarrer Samuel kommen würde, war es um mich geschehen. Dieser Blick, mit dem du mich gefragt und zugleich gebeten und mir befohlen hast, brachte mich um den Schlaf. In jener Nacht sah ich im Traum, wie die Mauer am Ende der Sackgasse zusammenfiel und an ihrer Stelle eine Kreuzung erschien. Ich stand da und hatte Angst und eine Stimme rief aus der Ferne nach mir.
Erinnerst du dich an unseren ersten Kuss? Es war an jenem zweiten Abend, und von da an war ich süchtig nach deiner Haut und deinem Geruch. Mein Vater merkte es als Erster, gleich beim Abendessen sagte er laut zu meiner Mutter: »Dein Sohn…« – vor Schimpftiraden pflegte er sich immer von dem Beschimpften zu distanzieren. Für meine Mutter war das der Alarm, sich zu ducken, damit sie sich nicht an der Lava verbrannte. Ich fürchtete ihn aber zum ersten Mal in meinem Leben nicht. Weder seine Worte noch seine Hand, ich hatte schon beschlossen, mit dir zu gehen –, »…dein Sohn liebt eine Hure und deshalb will er meine Nichte nicht. Nur wer Huren liebt, bekommt solche Teufelsaugen, an denen ein Messer zerbricht.«
Ich stand auf und ging.
Später sollte er dann erzählen, dass ich schon, als ich ihn verließ, und nicht erst, als ich dich geheiratet habe, enterbt gewesen sei.
Ich aber suchte dich und war so dumm, dass ich dachte, du würdest gleich mit mir abhauen und womöglich den Märtyrertod sterben.
»Salem«, hast du gesagt, »ich will nicht mit dir sterben, sondern leben.« Und deshalb sollte ich meinen und deinen Taufschein besorgen, die uns erlaubten, bei jedem anständigen Pfarrer zu heiraten.
Deine Vernunft hat mich erschreckt und sie sollte es in den nächsten Jahrzehnten noch öfter tun, lach nur. Ich dachte an den süßen Tod, du dagegen wolltest sichergehen.
Ich musste dir Recht geben, denn bereits um die Ecke lauerten zwei Männer auf mich. Sie sollten mich im Auftrag meines Vaters zusammenschlagen und nach Hause schleifen.
Ich entkam ihnen und versteckte mich bei Pfarrer Samuel, der mir erst nicht glauben wollte, dann aber auf seinen Wegen erfuhr, dass mein gekränkter Vater alles daransetzte, mich gefügig zu machen.
»Er will dich lieber umbringen, als dass du sein Wort brichst«, berichtete er mir besorgt.
Pfarrer Samuel verschaffte uns die Papiere. Gerade trat ich aus seiner Tür, da stieß mich Maissa fast um. Sie lachte breiter, als ihr Gesicht war. »Zahnstocher«, rief sie, »und ich habe gedacht, in diesem winzigen Brustkörbchen könne nur das Herz eines Regenwurms Platz finden. Alle Achtung! Meine Alte tobt und heult, seit mein Onkel ihr von deinem Nein berichtet hat.«
Und als sie von meinem Fluchtplan hörte, lief sie nach Hause und brachte mir zum vereinbarten Ort nahe der Omaijadenmoschee einen kleinen Samtbeutel mit fünfzig Goldlira. »Für das erste Jahr, bester Zahnstocher«, sagte sie und verschwand in der Menge.
Und dann war ich auf einmal mit dir allein, in diesem Zimmer im Beiruter Daura-Viertel, und du umgabst mich mit deiner Liebe, ganze Tage, Monate und Jahre.
Als mein Vater starb, wollte ich nicht zu seiner Beerdigung, doch du hast mich gedrängt, und ich fuhr ohne dich und ohne unsere zwei kleinen Töchter. Die Beerdigung mit Pomp und Gloria hätte ihm gefallen. Doch dann entdeckte ich meine in sich zusammengesunkene Mutter.
Ich hätte nicht auf sie hören sollen.
Sie weinte und bat mich, nach Damaskus zurückzukommen und in ihrer Nähe zu bleiben. Sie war auf einmal so klein und einsam.
Du warst arglos und deine Sehnsucht nach den Orten deiner Kindheit blendete dich. Wir wären besser in Beirut geblieben, denn vom ersten Tag an war unser Leben in Damaskus aus den Fugen geraten. Plötzlich musste ich dich nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit deinen unendlich vielen Verwandten teilen, die ich ja gar nicht kannte. Ich begann sie alle zu hassen. Ich wusste, dass die verlorenen Minuten nie wieder zurückzuholen waren, und deine Sippschaft, ja lach nur, so nannte ich deine Verwandten immer gehässig, also, deine Sippe weckte uns am frühen Morgen und ließ von uns erst, wenn wir vor Müdigkeit wie erschlagen waren.
Sie liebten dich, wie der Krake seine Beute liebt. Du warst die Oase in ihrer Einöde und ich suchte vergeblich deine Nähe. Manchmal konnte ich am Tag nicht einmal eine halbe Stunde mit dir sprechen, ohne dass sich eine fremde Nase zwischen uns schob. Ja, doch, doch, auch unsere Töchter Sahar und Samar gehörten dazu.
In dieser Zeit öffnete sich ein feiner Riss zwischen uns, erst unmerklich, und dann, als ich ihn endlich wahrnahm, war er schon ein beängstigend klaffender Spalt geworden.
Meine Mutter aber, der ich nun ein gelassenes Leben wünschte, konnte mit ihrem Leben ohne ihren Mann nichts anfangen. Sie fühlte sich leer und litt sehr. Sie bedrängte mich oft, sie zu besuchen. Das habe ich dir verheimlicht, ohne die geringsten Gewissensbisse zu haben. Du hattest ohnehin keine Zeit mehr für mich. Ich ahnte nicht, dass ich bei jeder Begegnung mit meiner Mutter einen Schritt weiter von dir wegging. Ich fühlte nur, dass meine Mutter mir so nahestand wie noch nie und dass sie mich brauchte. Bei dir hatte ich immer das Gefühl, du wärst sehr stark und bräuchtest niemanden. Eine unerschöpfliche Tankstelle.
Und dann begannen wir zu streiten. Weißt du noch, wann das erste Mal war?
Ich schon. Es war an Weihnachten, als meine Mutter einmal mit uns feiern wollte. Sie geriet mit deiner Mutter in Streit. Da fragte ich dich, ob deine Sippe uns nicht einen einzigen Tag in Ruhe lassen könnte. Ich schrie dich an. Und von da an hatte ich das Gefühl, dass du meine Mutter nicht magst, obwohl sie dich und unsere zwei Mädchen gern hatte. Wir stritten bei jedem Besuch.
Liebte mich meine Mutter so sehr, dass sie die Zerstörung meines Glücks nicht wahrnahm? Oder nahm sie mein Unglück in Kauf, um sich vor der Einsamkeit zu retten? Sah sie den Augenblick ihrer Rache gekommen? Weil ich mir mit meiner Entscheidung für dich etwas genommen hatte, was sie und mein Vater nie gewagt hätten?
In dieser Zeit begingen wir zwei Fehler, und es ist tröstlich zu wissen, dass wir uns gegenseitig die Schuld gaben. Wenn ich heute darüber nachdenke, empfinde ich meine Schuld als größer. Damals, kurz nach unserer Rückkehr nach Damaskus, beging Yakub, dein langjähriger Verehrer aus der Ferne, Selbstmord, als er seine Hoffnungen endgültig zerstört sah. Ich wusste von alldem nichts. Du hättest mir davon erzählen sollen, hast du später gesagt, als wir uns versöhnten. Aber ich hätte mich auch um dich kümmern müssen, statt den Richter zu spielen und dich in meinem Herzen zu verurteilen. Ich wusste nichts von dem Selbstmord und konnte mir nicht erklären, warum du mich nicht mehr umarmen wolltest, noch nicht einmal flüchtig. Du hast dich mit deinem schlechten Gewissen hinter mehreren unsichtbaren Türen versteckt und dir in dieser Rolle der Schuldigen, die sich selbst anklagt, gefallen. Du hast dich innerlich immer mehr von mir entfernt, wie du mir später erklärt hast. Sechs Monate vergingen so und meine Lust nach dir brannte immer mehr in mir, und genau in dieser Zeit lernte ich bei einem Besuch bei meiner Mutter meine Cousine Laila kennen. Ich war ihr zuvor nie begegnet. Sie war in Kanada aufgewachsen und nach ihrer Heirat nach Damaskus zurückgekehrt. Ihr Mann, nicht länger der weltoffene Emigrant, der er in Kanada gewesen war, machte sie todunglücklich. Geizig, herrisch, gehorsam gegenüber seiner Sippe und, wie ich später erfuhr, impotent. Sie dagegen verkörperte die reine Lust.
Meine Mutter ließ uns immer wieder einmal allein und irgendwann fielen wir auf eine Matratze. Laila befriedigte mich auf eine merkwürdige Art und war, wie sie selbst sagte, zum ersten Mal seit ihrer Jugend befriedigt. Ich liebte sie nicht, aber sie war meine sinnliche Oase. Sehr attraktiv und dumm, beschäftigte sie nur meinen Körper. Und ich konnte durch sie gelassener mit deiner abweisenden Haltung umgehen. Aber es war mir gleich, ob wir uns dreimal am Tag trafen oder einmal im Monat. Doch ihr war es das bald nicht mehr. Und dumm war nicht sie, sondern ich, denn sie hatte genaue Pläne für unsere gemeinsame Zukunft in Kanada geschmiedet.
Ich war schockiert.