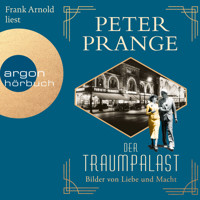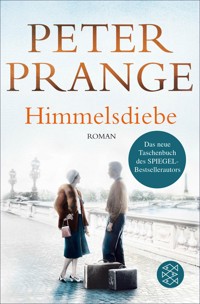9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Eine Familie in Deutschland
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die Fortsetzung der großen deutschen Familiengeschichte "Eine Familie in Deutschland" von Bestseller-Autor Peter Prange - historisch genau, wahrhaftig, bewegend. Groß war die Hoffnung im Wolfsburger Land, als auf Hitlers Befehl das Volkswagenwerk aus dem Boden gestampft wurde. War dies der Anfang einer neuen Zeit? Aufbruch in eine wunderbare Zukunft? Während die Welt der Familie Ising sich von Grund auf verwandelt, geht die Saat der falschen Verheißungen auf. Der Krieg bricht aus, und nun muss ein jeder sich zu erkennen geben, im Guten wie im Bösen ... Während Horst in der Partei Karriere macht, begleitet Edda mit dem Sonderfilmtrupp Riefenstahl den Polen-Feldzug der Wehrmacht. Georg bricht mit seinem VW zu einer Testfahrt auf, die ihn kreuz und quer durch das umkämpfte Europa bis nach Afghanistan führt. Zu Hause bangen die Eltern um ihr Sorgenkind, den kleinen Willy. Und Charly wartet auf Nachricht von Benny, der Liebe ihres Lebens. Doch er scheint in den Wirren von Krieg und Zerstörung verschollen. Was wird für sie alle in den Zeiten der Bewährung am Ende übrig bleiben - von ihren Träumen, von ihrer Hoffnung? Peter Prange bringt uns mit "Am Ende die Hoffnung", der Fortsetzung seines Bestsellers "Eine Familie in Deutschland. Zeit zu hoffen, Zeit zu leben", unsere Geschichte nah - in den Zeiten des Zweiten Weltkriegs 1939-1945.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1178
Ähnliche
Peter Prange
Eine Familie in Deutschland. Roman in 2 Büchern
Zweites Buch: Am Ende die Hoffnung 1939 – 1945
Über dieses Buch
Die Fortsetzung der großen deutschen Familiengeschichte "Eine Familie in Deutschland" von Bestseller-Autor Peter Prange - historisch genau, wahrhaftig, bewegend.
Groß war die Hoffnung im Wolfsburger Land, als auf Hitlers Befehl das Volkswagenwerk aus dem Boden gestampft wurde. War dies der Anfang einer neuen Zeit? Aufbruch in eine wunderbare Zukunft? Während die Welt der Familie Ising sich von Grund auf verwandelt, geht die Saat der falschen Verheißungen auf. Der Krieg bricht aus, und nun muss ein jeder sich zu erkennen geben, im Guten wie im Bösen ...
Während Horst in der Partei Karriere macht, begleitet Edda mit dem Sonderfilmtrupp Riefenstahl den Polen-Feldzug der Wehrmacht. Georg bricht mit seinem VW zu einer Testfahrt auf, die ihn kreuz und quer durch das umkämpfte Europa bis nach Afghanistan führt. Zu Hause bangen die Eltern um ihr Sorgenkind, den kleinen Willy. Und Charly wartet auf Nachricht von Benny, der Liebe ihres Lebens. Doch er scheint in den Wirren von Krieg und Zerstörung verschollen.
Was wird für sie alle in den Zeiten der Bewährung am Ende übrig bleiben - von ihren Träumen, von ihrer Hoffnung?
Peter Pranges zweibändiger Großroman “Eine Familie in Deutschland" setzt mit "Zeit zu hoffen, Zeit zu leben” am Tag der Machtergreifung 1933 ein. Mit "Am Ende die Hoffnung" führt er uns bis zum letzten Tag des Zweiten Weltkriegs 1945 und bringt uns so unsere Geschichte nah.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Peter Prange schreibt in seinem Bestseller ›Eine Familie in Deutschland‹ über ein Thema, das ihn sein ganzes Leben begleitet hat: die Verführbarkeit von Menschen in politisch prekären Zeiten. Nach dem erfolgreichen Auftakt ›Zeit zu hoffen, Zeit zu leben‹ folgt nun als Abschluss der zweite Band ›Am Ende die Hoffnung‹. Peter Prange ist als Autor international erfolgreich. Seine Werke haben eine Gesamtauflage von über zweieinhalb Millionen erreicht und wurden in 24 Sprachen übersetzt. Mehrere Bücher, etwa sein Bestseller ›Das Bernstein-Amulett‹, wurden verfilmt, sein Erfolgsroman ›Unsere wunderbaren Jahre‹ ist als großer TV-Dreiteiler in Produktion. Der Autor lebt mit seiner Frau in Tübingen.
Für uns Nachgeborene, die wir uns unserer selbst so sicher sind.
»Es kennzeichnet die Deutschen, dass bei ihnen die Frage ›Was ist deutsch?‹ niemals ausstirbt.«
Friedrich Nietzsche
Jenseits von Gut und Böse, 1886.
Achtes Hauptstück. Völker und Vaterländer
Vorbemerkung
Die nachfolgende Geschichte ist, obwohl angelehnt an historische Ereignisse, frei erfunden. Rückschlüsse auf die tatsächliche Lebenswirklichkeit der geschilderten Personen sollen in keiner Weise nahegelegt oder ermöglicht werden. Die Handlungsstränge der Geschichte sind ebenso wie die Lebenswege der Protagonisten Erfindungen des Autors. Dies gilt insbesondere für deren Verstrickungen in der Nazizeit und die Schilderung ihrer Privatsphäre. Alle intimen Szenen sowie die Dialoge und die Darstellung der Gefühlswelt des gesamten Romanpersonals sind reine Fiktion.
»Abraham schaute gegen Sodom und Gomorrha und auf das ganze Gebiet im Umkreis und sah: Qualm stieg von der Erde auf wie der Qualm aus einen Schmelzofen. Den einen Gerechten aber, den hatte Gott aus der Zerstörung fortgeleitet, während er die Städte, in denen er gelebt hatte, von Grund auf vernichtete.«
Genesis, Kapitel 19, Vers 28–29
Teil VierPotemkin’sche Dörfer
1939–1941
1
Ein Lied schickte sich an, die Welt zu erobern, ein Lied, das einem ganzen Volk aus der Seele sprach. Ein Dichter mit dem Allerweltsnamen Hoffmann hatte es im Jahre 1841 verfasst: August Heinrich Hoffmann aus Fallersleben, einem kleinen, unbedeutenden Städtchen im Wolfsburger Land, fernab der Welt und doch mitten in Deutschland gelegen. Damals war es nur eines von vielen patriotischen Liedern gewesen, entstanden in einer Zeit, in der es Deutschland noch gar nicht wirklich gab, Geburtsgesänge einer in die Wirklichkeit drängenden Nation, als der Deutsche Bund mit Deutschland in den Wehen lag.
Es sollte darum über ein halbes Jahrhundert vergehen, bis aus der Fallersleber Dichtung das »Lied der Deutschen« wurde, als nämlich in einer Schlacht des Ersten Weltkriegs Soldaten des 1871 gegründeten Kaiserreichs mit Hoffmanns Versen auf den Lippen eine feindliche Bastion erstürmten. Die Kunde davon beseelte die ganze Nation, und das Lied fand solche Verbreitung, dass es nach dem verlorenen Krieg, als das Kaiserreich schon wieder vergangen war, zur Nationalhymne der jungen Republik erhoben wurde, zu der Deutschland sich inzwischen gehäutet hatte.
Doch nie zuvor war das »Lied der Deutschen« inbrünstiger gesungen worden als 1933, dem Jahr, in dem die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei die Macht im Reich ergriff, und es schwoll zum ohrenbetäubenden, alles hinwegfegenden Orkan an, als es im Herbst 1939 aus den Kehlen Millionen im Gleichschritt marschierender Soldaten ertönte, die ihr Führer Adolf Hitler über die Grenzen Deutschlands geschickt hatte, auf dass sie, die Zeilen dieses Liedes brüllend, die ganze Welt erobern sollten.
Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt,
Wenn es stets zu Schutz und Trutze
Brüderlich zusammenhält,
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt –
Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt!
Und in Fallersleben? Dort ging das Leben beinahe weiter wie zu Friedenszeiten. Nachdem in Berlin beschlossen worden war, in der Weltabgeschiedenheit des Wolfsburger Lands die größte Automobilfabrik Europas zur Produktion eines »Volkswagens« mitsamt einer Wohn- und Schlafstadt für sechzigtausend Menschen aus dem Boden zu stampfen, hatte sich der einstige Grund und Boden der Grafen von der Schulenburg in eine einzige, von Horizont zu Horizont reichende Baustelle verwandelt. Während die »Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben«, wie die als Musterstadt des Führers geplante Ansiedlung offiziell hieß, vorerst nur aus einer Anhäufung notdürftig errichteter Baracken bestand, nahm das Volkswagenwerk allmählich den Betrieb auf, und immer mehr Arbeiter strömten in die Fabrikhallen, um zum Wohl von Führer, Volk und Vaterland die Fließbänder zu bestücken. Dabei schien der Krieg nur in den UFA-Wochenschauen stattzufinden, die in der fünftausend Menschen fassenden Veranstaltungshalle der Barackenstadt gezeigt wurden, gleichsam als Teil des Kultur- und Sportprogramms, mit dessen Hilfe man Kraft durch Freude zu schöpfen hoffte, um das große Werk so bald wie möglich zu vollenden. Zwar waren Nahrungs- und Verbrauchsmittel rationiert, auch wurden die wehrpflichtigen Männer des Landkreises, sofern nicht unabkömmlich, wie überall im Reich zum Kriegsdienst eingezogen. Doch die Anschaffung einer »starken Sirene«, wie sie bei Kriegsbeginn im Fallersleber Gemeinderat beantragt worden war, wurde ein ums andere Mal vertagt. Die Wehrmacht eilte ja von Sieg zu Sieg, da war die Dringlichkeit einer so kostspieligen Anschaffung nicht ersichtlich – zumal die Stadt jeden Monat einen Kriegsbeitrag von 3874,93 Reichsmark nach Berlin abzuführen hatte. Der einzige Grund, so glaubte man, warum das Wolfsburger Land je zum Ziel feindlicher Angriffe werden könnte, war das Volkswagenwerk, und für den höchst unwahrscheinlichen Fall, dass feindliche Jagdflieger die deutsche Flak überwinden und tatsächlich in den heimischen Luftraum vordringen könnten, trug man umfassende Vorsorge. Zum einen wurde auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerraffinerie der Bau eines Bunkers in Angriff genommen, der im Fall der Fälle sämtlichen Einwohnern von Fallersleben Platz bieten würde; zum anderen setzte man alle Arbeitskräfte und Materialien, die sich erübrigen ließen, dazu ein, eine Attrappe der Autofabrik nachzubilden, ein gigantisches Potemkin’sches Dorf aus Pappmaché, eine Scheinfabrik, die, auf freiem Feld und weithin sichtbar im Wolfsburger Land, den Feind bei einem möglichen Angriff ablenken würde, um alles Unheil auf sich zu ziehen, das je vom Himmel herabfallen mochte.
Dermaßen gerüstet, konnte der Alltag in Fallersleben weiterhin seinen mehr oder weniger gewohnten Gang gehen, und jedermann hoffte, dass es bis in alle Zukunft so bleiben würde. Schließlich hatte auch der erste große Krieg Stadt und Land so gut wie unberührt belassen.
Warum in aller Welt sollte es diesmal anders sein?
2
Dorothee konnte kaum mit ansehen, wie sehr ihr Mann litt. Die Hämorrhoiden setzten Hermann dermaßen zu, dass er an manchen Tagen nur noch mit Hilfe eines Schwimmreifens am Frühstückstisch sitzen konnte. Heute war so ein Tag. Selbst auf einem Daunenkissen hatte er es vor Schmerzen nicht ausgehalten, allein das Luftpolster, zu dessen Gebrauch Bruni geraten hatte, vermochte ein bisschen Linderung zu schaffen. Der Vater der im Ising’schen Haushalt ergrauten Dienstmagd hatte einst wohl dasselbe Leiden gehabt.
»Was meinst du, solltest du nicht allmählich eine Operation in Betracht ziehen?«, fragte Dorothee.
Statt zu antworten, goss Hermann ein wenig von seinem Kaffee auf die Untertasse und beugte sich pustend über die dampfende Flüssigkeit. »Das kann ich mir nicht leisten«, sagte er und nahm vorsichtig schlürfend einen Schluck. »Wenn die Ärzte einen erst mal in den Klauen haben, lassen sie einen nicht wieder los.«
»Ja und? Du hast doch Zeit genug.«
»Du meinst, weil ich nicht mehr in die Firma muss?«
Als sie sein Gesicht sah, bereute sie ihre Worte. Trotz seiner frisch gebügelten Uniform sah er aus wie ein geprügelter Hund. Gäbe es noch die Zuckerfabrik, säße er zu dieser späten Morgenstunde längst nicht mehr in der Küche. Im September begann die Rübenernte, und da hatte in früheren Zeiten stets Hochbetrieb in Haus und Hof geherrscht. Doch die Zuckerfabrik existierte nicht mehr. Obwohl es schon anderthalb Jahre her war, dass sie der Autostadt hatte weichen müssen, war Hermann noch immer nicht darüber hinweg.
»Aber so geht es doch nicht weiter! Die Gesundheit hat Vorrang!«
Hermann schüttelte den Kopf. »Und was wird aus der Ortsgruppe, wenn ich mich unters Messer lege? Die kann ich doch nicht sich selbst überlassen! Nicht jetzt, wo sowieso schon alle verrückt spielen!«
Er griff nach der »Aller-Zeitung«, um grummelnd dahinter zu verschwinden. Dorothee wusste, er hatte höllische Angst vor der Operation, doch eher würde er sich die Zunge abbeißen, als das einzugestehen. Also bedrängte sie ihn nicht weiter und räumte stattdessen den Tisch ab. Irgendwann würde er schon von allein zur Vernunft kommen.
»Das darf ja wohl nicht wahr sein!«, sagte er plötzlich.
»Was darf nicht wahr sein?«
»Sie wollen Zucker rationieren! Ausgerechnet hier, im Wolfsburger Land! Wo wir seit Jahrhunderten Zucker für ganz Deutschland produzieren.«
»Das ist sicher ein Irrtum! Da musst du was falsch verstanden haben.«
»Von wegen!« Er schlug mit dem Handrücken gegen die Zeitung. »Hier steht es – schwarz auf weiß! Eine offizielle Liste, welche Waren es ab sofort nur noch auf Bezugsschein gibt. Brot, Butter, Eier, Fleisch, Kaffee – und Zucker! Zur Begründung behaupten sie, Zucker sei ungesund. Wie zum Teufel kann man nur solchen Unsinn verbreiten?« Aus Protest schüttete er einen weiteren Löffel in seine Tasse. »Zucker schadet? Grundverkehrt! Zucker schmeckt, Zucker nährt! So heißt es im Wolfsburger Land, seit mein Großvater die Raffinerie gegründet hat.«
Während er den Kaffee umrührte, ging an der Haustür der Klopfer.
Dorothee horchte, ob Bruni aufmachte.
»Na los«, drängte Hermann, »worauf wartest du? Das wird der olle Kampmann sein. Vielleicht bringt er ja Post von unserem Goldschatz.«
3
Zur gleichen Zeit stand Horst ein Stockwerk höher in seiner Wohnung vor dem Garderobenspiegel und würgte an dem zu eng sitzenden Uniformkragen. Kreisleiter Sander erwartete ihn in Gifhorn, und vorher musste er noch Unterlagerführer Pagels den Marsch blasen.
»Das wird Ärger in der Familie geben!«
»Das ist in dieser Familie ja nichts Neues«, sagte Ilse, die mit einer Kleiderbürste in der Hand um ihn herumlief, um die Schuppen von seinen Schultern zu entfernen. »Worum geht es denn diesmal schon wieder?«
»Um die Bewirtschaftung von Grundnahrungsmitteln!«
»Und was hat das mit der Familie zu tun?«
»Wir müssen Zucker rationieren, Herrgott nochmal – Zucker! Und der Kreisleiter erwartet von mir Vorschläge, wie wir das den Volksgenossen schmackhaft machen können.«
»Und dafür hat er sich ausgerechnet dich ausgesucht?«
»Reine Schikane! Sander hat mich schon früher in der Schule getriezt, wie er nur konnte. Beim Turnen musste ich immer den Purzelbaum vormachen. Um den andern zu zeigen, wie es nicht geht! Dabei war ich im Völkerball mit Abstand der Beste!«
»Und – hast du schon eine Idee?«
»Was für eine Idee?«
»Wegen dem Zucker!«
»Meinst du, Ideen kann man so einfach kacken? Natürlich habe ich noch keine Idee! Außerdem heißt es nicht wegen dem, sondern wegen des Zuckers!«
Der kleine Adolf kam aus dem Kinderzimmer gerannt, schon mit dem Schultornister auf dem Rücken. »Zucker schadet? Grundverkehrt! Zucker schmeckt, Zucker nährt!«
In Erwartung eines Lobs blickte er zu seinem Vater auf. Doch Horst schnaubte nur unwillig durch die Nase. »Was plapperst du da?«
»Aber das sagt der Opa doch auch immer!«
»Bist du ein Papagei? Hör nicht auf deinen Opa, sondern auf deinen Vater!«
»Aber du hast doch früher auch …«
»Papperlapapp! Wir müssen jetzt mit Zucker sparsam sein, weil wir nämlich Krieg haben. Außerdem ist Zucker ungesund. Aber das verstehst du noch nicht, dafür bist du zu klein.« Horst sah die Enttäuschung seines Sohns und bekam ein schlechtes Gewissen. »Geh und hol deine Schwester«, sagte er. »Oder willst du, dass sie zu spät in den Kindergarten kommt?«
Während der kleine Adolf wieder verschwand, nahm Horst den Kamm von der Garderobenablage. »Warum muss eigentlich immer ich die Drecksarbeit machen?« Mit der Zungenspitze zwischen den Lippen zog er sich den Mittelscheitel nach.
»Selbst schuld«, erwiderte Ilse. »Nimm dir ein Beispiel an deinem Bruder. Der macht sich in Stuttgart ein schlaues Leben. Sitzt gemütlich in seinem Büro und wartet ab, bis der Krieg vorbei ist. Während andere sich für Deutschland aufopfern.«
Horst legte den Kamm beiseite und befeuchtete mit der Zunge seinen Zeigefinger. »Da wäre ich mir nicht so sicher.« Sorgfältig strich er ein paar Stoppeln glatt, die aus seinem blonden Hitler-Bärtchen hervorstanden. »Damit mein lieber Bruder sich drücken kann, müsste sein Büro als kriegswichtiger Betrieb eingestuft werden.«
Ilse horchte auf. »Ist es das denn nicht? Die haben doch diesen Kübelwagen erfunden.«
»Und wenn schon!« Horst zuckte die Achseln. »Der Kübelwagen ist inzwischen serienreif. Damit haben die Sesselfurzer in Stuttgart ihre Arbeit getan. Und dass sie jetzt Panzer oder Flugzeuge entwerfen, wäre mir neu.«
Ilse schaute ihn an, wie sie ihn schon lange nicht mehr angeschaut hatte. »Ich glaube, du kommst eines Tages noch mal ganz groß raus, mein Hotte …«
Horst musste schlucken. Ilse war zwar nicht die Hübscheste mit ihrer stumpfen Nase und den engstehenden Augen, und das Mutterkreuz würde sie dank des Andenkens, das er ihr aus dem Braunschweiger Puff mitgebracht hatte, wohl auch nicht mehr bekommen – aber weltanschaulich war sie eins a! Während sie ihn mit diesem besonderen Blick anschaute, mit dem sie ihn sonst nur in der Schlafkammer bedachte, und dabei auch noch verführerisch an ihren Ohrenschnecken nestelte, wurde ihm ganz anders.
»Meinst du wirklich, mein Ilsebillchen? Trotz dieser Familie?«
Ohne die Augen von ihm zu wenden, nickte sie ihm zu. »Da bin ich mir sogar ganz sicher, mein Hotte. Du wirst sehen, der Krieg ist deine große Chance. Da trennt sich die Spreu vom Weizen.«
Er konnte nicht länger an sich halten, er musste sie küssen. Doch bevor er sie zu fassen bekam, kam der kleine Adolf mit seiner Schwester Eva wieder aus dem Kinderzimmer.
»Ei, ei, ei, was seh ich da?«, riefen die zwei. »Ein verliebtes Ehepaar!«
Während Horst wie auf Kommando seine Frau losließ, drohte Ilse den beiden mit dem Finger.
»Macht ihr wohl, dass ihr fort kommt?«
»Aber ein bisschen dalli! Sonst gibt’s was hinter die Löffel!«
4
»Nun sag schon – ist was aus Görden dabei?«
Hermann hoffte, dass Dorothee ihm seine Anspannung nicht anmerkte, als sie mit der Post in der Hand in die Küche zurückkehrte. Jedes Mal, wenn der Briefträger kam, hoffte er auf eine Nachricht von dem kleinen Willy, und mit jedem Tag, der ohne Nachricht von ihrem Jüngsten verging, wuchs seine Nervosität.
Doch Dorothee schüttelte den Kopf. »Leider nein.«
»Aber sie hatten doch versprochen, uns so bald wie möglich zu schreiben.«
»Hab ein bisschen Geduld. Willy ist doch noch keine Woche im Heim.«
»Ich weiß. Aber mir kommt es vor wie eine Ewigkeit.« Bei der Erinnerung, wie sie Willy zum Bahnhof gebracht hatten und Lotti mit ihm in den Zug gestiegen war, um ihn in die Heil- und Pflegeanstalt zu bringen, kamen Hermann Tränen.
Dorothee trat zu ihm und strich ihm über den Kopf. »Es gibt trotzdem gute Nachrichten, mein Lieber. Aus Stuttgart.«
»Von Georg? Was schreibt er?«
Sie hob einen bereits geöffneten Brief in die Höhe. »Unser Ältester wird vorerst nicht eingezogen.«
»Na, Gott sei Dank! Das ist wirklich eine gute Nachricht! Wie lange haben sie ihn zurückgestellt?«
»Erst mal für ein halbes Jahr. Aber Professor Porsche ist wohl zuversichtlich, dass sein Konstruktionsbüro zum kriegswichtigen Betrieb erklärt wird.«
»Das wäre ein Segen. Dann würde Georg vielleicht sogar auf Dauer uk-gestellt.«
Dorothee nickte. »Er ist ja auch der unsoldatischste Mensch, den man sich nur vorstellen kann. Der hat nun wirklich nichts im Krieg verloren.«
»Das kannst du laut sagen«, pflichtete Hermann ihr bei. »Mit seinen Knickerbockern eignet er sich zum Soldaten wie der Igel zum Arschwisch! Kaum zu fassen, dass ausgerechnet er jetzt kriegswichtige Arbeit leistet.«
Dorothee streckte den Arm nach ihm aus. »Ich denke, wir haben allen Grund, dankbar zu sein.«
Er nahm ihre Hand und drückte sie. »Ja, meine Liebe, das haben wir. Mit ein bisschen Glück kommen unsere beiden Großen ungeschoren davon. Und welche Eltern von erwachsenen Söhnen können das schon behaupten?«
»Dann glaubst du also, dass auch für Horst keine Gefahr besteht?«
Hermann schüttelte den Kopf. »Eher trocknet die Aller aus, als dass sie einen Helden wie ihn an die Front schicken. Horst ist Ortsgruppenleiter und Hauptlagerführer. Damit ist er so unabkömmlich wie Adolf Hitler persönlich! Außerdem ist er kurzatmig und hat meine Plattfüße geerbt.«
»Ach ja«, seufzte Dorothee mit ihrem Lächeln, »für irgendwas ist schließlich alles gut. Dann wollen wir nur hoffen, dass Professor Porsche recht behält.«
5
Im Konstruktionsbüro »Prof. Dr. ing. Ferdinand Porsche« begann die Arbeit jeden Morgen um sieben Uhr dreißig, und obwohl Georg nie der Pünktlichste gewesen war, saß normalerweise auch er um halb acht am Schreibtisch. Doch heute war es schon zehn nach acht, als er endlich in der Kronenstraße eintraf. Der Grund für seine Verspätung hieß Felizitas, eine Buchhändlerin, die bei Wittwer am Charlottenplatz arbeitete. Ihr Name, so hatte er ihr am Abend zuvor erklärt, als er sie in einem Tanzcafé im Bohnenviertel kennengelernt hatte, bedeutete »Glückseligkeit«, und nachdem er sich beim Foxtrott mächtig ins Zeug gelegt hatte, hatte sie sich bei einer gefühlvollen Rumba bereit erklärt, diese mit ihm zu teilen. Sie hatte Wort gehalten – die ganze Nacht hindurch bis zum Morgengrauen, so dass er es vor der Arbeit noch nicht mal nach Hause geschafft hatte, um sich frisch zu machen. Jetzt konnte er nur hoffen, dass er nicht nach ihrem Parfüm roch.
Zwei Stufen auf einmal nehmend, eilte er das Treppenhaus hinauf. Obwohl sein Chef als gebürtiger Tscheche praktisch ein Balkanese war, war Professor Porsche, was Pünktlichkeit anging, preußischer als jeder Preuße, und seine Tobsuchtsanfälle waren legendär.
»Oh, ein neues Rasierwasser, Herr Ising?« Die Empfangsdame schnupperte demonstrativ in der Luft. »Ein bisschen süßlich, wenn Sie mich fragen. Doch statt darin zu baden, hätten Sie sich lieber rasieren sollen. Denn das haben Sie offenbar vergessen. Nun ja, Hauptsache, Sie sind da. Der Chef erwartet Sie – dringend!«
Das letzte Wort begleitete sie mit einem Blick, der Schlimmes befürchten ließ. Sich selber verfluchend, klopfte Georg an Porsches Tür. Wie konnte er nur so dämlich sein, für das Vergnügen einer Nacht seine uk-Stellung zu gefährden? Zwei seiner Ingenieurskollegen waren schon zum Kriegsdienst gezogen worden. Dass ihm dieses Schicksal bislang erspart geblieben war, hatte er allein Porsches Gunst zu verdanken. Doch die konnte jetzt gehörigen Schaden nehmen.
»Herein!«
Als er in das Büro seines Chefs trat, stutzte er. Statt ihn mit einem Tobsuchtsanfall zu empfangen, begrüßte Porsche ihn mit einem freudigen Strahlen.
»Gute Nachrichten aus Berlin! Wir haben den Prozess gewonnen!«
»Welchen Prozess?« Georg hatte keinen Schimmer, wovon die Rede war.
»Fragen Sie das im Ernst, Herr Ising? Gegen Josef Ganz natürlich!«
»Ach so, den Prozess meinen Sie. Meine Güte, den hatte ich ganz vergessen.«
»Ja, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sicher. Und das ist noch nicht alles! Auch in den anderen Fällen wurde zu unseren Gunsten entschieden.«
»In welchen anderen Fällen? Um ehrlich zu sein, ich verstehe nicht ganz.«
»Das können Sie auch nicht. War bis jetzt geheime Kommandosache! Obersturmbannführer Lafferentz hat seinen besten Mann darauf angesetzt, alle Konstruktionsteile des Schweizer Volkswagens daraufhin zu überprüfen, ob sie Patente anderer Hersteller tangieren, und überall, wo das der Fall war, wurde Anzeige erstattet.«
»Aber das treibt eine so kleine Firma ja in den Ruin!«
»Genau das war der Zweck der Übung! Und sie ist aufgegangen. Die braven Eidgenossen haben alle Prozesse mit Pauken und Trompeten verloren! Außerdem wurden sie zu zweihunderttausend Reichsmark Buße verdonnert!«
Georg wurde ganz flau im Magen. Er konnte sich denken, wer Lafferentz’ bester Mann war – Paul Ehrhardt, Georgs ehemaliger Kollege in Josefs Frankfurter Büro und dessen erbitterter Feind. Der hatte es bestimmt nicht an Gründlichkeit fehlen lassen, um sich an seinem alten Chef für die erlittene Kündigung zu rächen.
»Soll das heißen, Josef Ganz ist pleite?«
»Nicht persönlich, ihm gehört die Firma ja nicht. Aber er hat auf keines seiner früheren Patente mehr Anspruch! Nicht mal auf das Patent für die Pendelachse.«
»Aber die war doch seine eigene Erfindung!«
»Nicht in der Gestalt, wie wir sie weiterentwickelt haben.« Zufrieden strich Porsche sich über seinen Schnauzbart. »Ja, der Fortschritt geht weiter, lieber Kollege. Das mussten sogar die Herren Daimler und Benz erfahren. Sonst müssten wir ja heute noch ihre Erben um Erlaubnis bitten, wenn wir ein Auto konstruieren. – Aber was ist mit Ihnen?«, unterbrach er sich plötzlich. »Sie sind ja ganz blass um die Nase!«
Georg wusste nicht, was er antworten sollte. »Ich … ich habe letzte Nacht nicht besonders gut geschlafen.«
Sein Chef runzelte die Stirn. »Darf ich fragen, wie die Dame hieß?«
»Aber Herr Professor!«
Porsche winkte ab. »Nun, das geht mich nichts an. Solange die Arbeit nicht leidet!«
»Keine Sorge, Sie können sich auf mich verlassen.«
»Schön. Nur – warum ziehen Sie dann dieses Gesicht?«
Georg zögerte erneut. »Um ehrlich zu sein, ich … ich bin ein wenig überrascht.«
»Überrascht?«
»Wegen des Patentstreits mit den Schweizern. Ich dachte, die Sache hätte sich erübrigt. Ich meine, schließlich hat doch jetzt der Kübelwagen Priorität.«
»Von wegen! Bei der Grundsteinlegung in Fallersleben hat der Führer den KdF-Wagen zur nationalen Aufgabe erklärt. Daran hat sich nichts geändert. Im Gegenteil. Jetzt gilt es erst recht, die Ärmel hochzukrempeln! Als Zeichen für die ganze Welt, dass nicht mal der Krieg uns aufhalten kann.«
»Trotzdem …«
»Was trotzdem? Ich hatte angenommen, Sie wären glücklich über all die guten Neuigkeiten. Der Volkswagen liegt Ihnen doch genauso am Herzen wie mir! Und stellen Sie sich vor, der Jude Ganz hätte mit seiner Schweizer Klitsche das Rennen gemacht – wir wären erledigt gewesen! So aber haben wir beste Voraussetzungen, dass unser Büro als kriegswichtiger Betrieb eingestuft wird. Die Reichskanzlei sendet bereits entsprechende Signale. Dort hat man sich überaus befriedigt über den Ausgang der Sache geäußert. Und da das Gericht außerdem beschlossen hat, das in Deutschland verbliebene Vermögen des Juden Ganz zu beschlagnahmen …«
»Um Gottes willen! Das auch noch?«
Ein zweites Mal runzelte Porsche die Brauen. »Oh, plagt Sie auf einmal das Gewissen?« Er nickte. »Verstehe – wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Nur, so geht das leider nicht, Herr Ising. Oder haben Sie vergessen, dass Sie selbst es waren, der mich auf die Idee gebracht hat, Josef Ganz zu verklagen?«
6
Der Frühstückstisch war abgeräumt, und während Hermann seine Zeitung zusammenfaltete, schrieb Dorothee den Besorgungszettel für Bruni.
»Wenn ich nur wüsste, was mit unseren zwei Mädchen ist …«
»Was soll mit denen schon sein?«, erwiderte Hermann. »Die gehen ihrer Arbeit nach, wie alle anderen Leute auch.«
»Aber Edda ist in Polen, und da ist Krieg. Hast du keine Angst?«
»Warum sollte ich? Das Fräulein Riefenstahl hat doch nur den Auftrag, einen Film zu drehen.«
»Ja, aber nicht irgendeinen Film. Schon dieser martialische Name – Sonderfilmtrupp Riefenstahl. Das heißt, es geht an die Front!«
»Nie im Leben! Dann hätten sie doch Männer geschickt! Nein, das Fräulein Riefenstahl wird ein paar Aufnahmen von unseren Soldaten in der Etappe drehen, beim Essenfassen oder Marschieren, und Edda kümmert sich darum, dass alles wie am Schnürchen klappt. Die Front kriegen die beiden nicht mal durchs Fernglas zu sehen.«
»Glaubst du?«
»Und ob! Edda hat dir am Telefon doch selbst erzählt, wie sie losgefahren sind. In einer Mercedes-Limousine und begleitet von einem ganzen Vergnügungskonvoi – als ginge es in die Sommerfrische!« Er trank einen letzten Schluck Kaffee und stand auf. »Aber ich muss los. Um neun steht der Gemeinderat auf der Matte. Bürgermeister Wolgast will die Gründung einer Musikkapelle beantragen, auf Kosten der Stadt, offenbar hat er noch immer nicht verschmerzt, dass aus seinen Großstadtplänen nichts wurde, und ich muss jetzt dafür sorgen, dass ihm bei der Abstimmung der Gemeinderat den Zahn zieht. Für solche Sperenzchen fehlt im Moment das nötige Kleingeld.«
Während er sprach, machte Hermann ein so gequältes Gesicht, als würde ihm selbst ein Zahn gezogen. Dafür konnte es nur einen Grund geben.
»Willst du vielleicht den Schwimmreifen mitnehmen?«, fragte Dorothee.
»Soll ich mich zur Witzfigur machen?« Hermann gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Es ist ja sehr lieb, dass du so mit mir fühlst, aber nein – die Leute würden mich doch nicht mehr für voll nehmen.«
Er korrigierte den Sitz der Hakenkreuz-Armbinde, dann wandte er sich zur Tür. Doch bevor er die Küche verließ, drehte er sich noch einmal um.
»Was hat Lotti eigentlich gesagt? Du wolltest doch mit ihr telefonieren?«
Dorothee zögerte. Sie hatte gestern mehrere Male versucht, ihre Tochter anzurufen, um sich nach Benjamin zu erkundigen, seit Wochen war Charlotte nun schon ohne Nachricht von ihrem Mann, doch sie hatte sie nicht erreicht, weder in der Klinik noch zu Hause. Irgendwie hatte sie das Gefühl, dass das kein gutes Zeichen war. Trotzdem beschloss sie, ihre Sorge für sich zu behalten. Vielleicht gab es ja gar keinen Grund, sich zu beunruhigen, und sie wollte Hermann nicht unnötig belasten. Er machte sich vor lauter Sorge um Willy schon verrückt genug.
»Ich bin noch nicht dazu gekommen«, sagte sie also nur. »Aber ich probiere es heute mal um die Mittagszeit. Vielleicht erwische ich sie ja in der Pause.«
7
Dorothees Mutterinstinkt hatte nicht getrogen: Zwar befand Charly sich wie an jedem Arbeitstag auch an diesem Dienstagmorgen in der Göttinger Uniklinik, doch nicht als Ärztin auf der Kinderstation, sondern als Patientin der gynäkologischen Abteilung, wo Frau Dr. Reuter einen Eingriff an ihr vorgenommen hatte.
Während ihr Frühstück unangerührt auf dem Nachttisch stand, lag sie reglos auf ihrem Bett und starrte gegen die Decke, unfähig, irgendeinen Gedanken zu fassen oder etwas zu empfinden, nicht mal die Schmerzen in ihrem Unterleib, als würden diese nicht ihr, sondern einer fremden Person angehören. Am liebsten würde sie für immer so liegenbleiben, das war ihr einziger Wunsch, hier liegen und gegen die Decke starren, wo eine Fliege in sinnloser Emsigkeit hin und her schwirrte. Doch das war nicht möglich. Obwohl Frau Dr. Reuter ihr Diskretion versprochen hatte und es auch kein Namensschild an ihrer Zimmertür gab, durfte sie nicht länger als unbedingt nötig auf der Frauenstation bleiben, irgendwann würde sich sonst in der Klinik herumsprechen, dass sie hier lag, auch in der Kinderabteilung, und wenn Schwester Johanna von ihrem Eingriff erfuhr, würde sie eins und eins zusammenzählen und womöglich Horst in Kenntnis setzen.
Zum Glück hatte Frau Dr. Reuter sich bereit erklärt, sie schon heute zu entlassen. Also quälte sie sich aus dem Bett, obwohl sie in der Nacht kein Auge zugetan hatte.
Als sie sich in ihrem Nachthemd im Wandspiegel sah, strich sie sich über den Bauch, eine unwillkürliche Liebkosung ihres ungeborenes Kindes, die ihr zur zweiten Natur geworden war, seit Frau Dr. Reuter ihre Schwangerschaft festgestellt hatte. Stets hatte die kleine, zärtliche Geste sie mit einem tiefen, innigen Glücksgefühl erfüllt, und zugleich mit einer Ruhe, die ihr sonst fremd war. So lange sie ihr Kind im Bauch getragen hatte, war es gewesen, als stünde sie mit Benny in Kontakt, wie durch ein unsichtbares Band mit ihm verbunden, wo immer sie beide auch waren, selbst während seiner Irrfahrt auf der St. Louis nach Kuba, als Tausende von Kilometern sie voneinander getrennt hatten, hatte sie diese Gewissheit nie verlassen, und obwohl sie seit Bennys Ausschiffung in Antwerpen kein Lebenszeichen mehr von ihm bekommen hatte, hatte sie nicht einen Augenblick daran gezweifelt, dass er irgendwo auf der Welt für sie und ihr Baby da war und alles daran setzen würde, so bald wie irgend möglich wieder bei ihnen zu sein. Doch jetzt war ihr Bauch leer, das unsichtbare Band zerschnitten, und sie war so allein wie noch nie zuvor in ihrem Leben.
»Sind Sie sicher, dass Sie uns schon heute verlassen wollen?«, fragte Frau Dr. Reuter, als sie zur Abschlussvisite erschien.
Charly nickte. »Alles, was zu meiner Genesung nötig ist, ist ein bisschen Ruhe. Und im Bett liegen kann ich zu Hause ebenso gut wie hier.«
Die Ärztin schaute über den Rand ihrer Brille. »Nun gut, dann mache ich Ihre Papiere fertig. Aber nur unter der Bedingung, dass Sie sich ein Taxi nehmen und sich vor nächster Woche nicht bei der Arbeit blicken lassen. Bis dahin strikte Schonung! Keine körperliche Anstrengung! Und keinerlei Aufregung! Versprochen?«
»Natürlich.«
Charly wusste, sie hatte Frau Dr. Reuter dieses Versprechen schon einmal gegeben, zu Beginn ihrer Schwangerschaft, doch ohne es zu halten. Wie hätte sie das auch anstellen sollen? Die Blutung hatte eingesetzt, als Professor Wagenknecht diesen fürchterlichen Runderlass verlesen hatte. Der Fötus war schon so weit entwickelt gewesen, dass man mit bloßem Auge die Gliedmaßen hatte erkennen können, weshalb eine Ausschabung nötig gewesen war und ihr Unterleib immer noch schmerzte, trotz der Medikamente, die man ihr gegeben hatte. Aber diese Schmerzen konnte sie verwinden. Die anderen Schmerzen waren viel schlimmer. Und für die gab es keine Arznei.
»Einen Trost kann ich Ihnen immerhin mit auf den Weg geben, liebe Kollegin«, sagte Freu Dr. Reuter. »Sie können weiterhin Kinder bekommen. Gynäkologisch steht dem nichts im Wege.«
Charly schloss für eine Sekunde die Augen. »Gott sei Dank.«
Doch die Erleichterung dauerte nur eine Sekunde. Dann wurde sie überwuchert von der Angst, dass sie Benny vielleicht niemals wiedersehen würde.
8
Der »Sonderfilmtrupp Riefenstahl«, bestehend aus einem Dutzend Personen, zwei sechssitzigen Mercedes-Limousinen, einem Tonfilmwagen sowie zwei Motorrädern, war im Auftrag des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda nach Polen aufgebrochen, um dort den Feldzug der Wehrmacht zu dokumentieren, damit in den Lichtspielhäusern des Reichs alle Volksgenossen die Triumphe der deutschen Soldaten miterleben konnten, und es war noch keine Woche vergangen, da war Lenis Empörung, dass man sie wegen eines albernen Kriegs daran gehindert hatte, den »Penthesilea«-Film zu drehen, flammender Begeisterung gewichen. Seit sie die polnische Grenze überquert hatten, trug sie sogar Uniform, eine Phantasiekreation aus Krefelder Tuch, die man eigens für sie erfunden hatte, mit allen möglichen militärischen Accessoires, einschließlich Schulterriemen und Koppel.
»Der Führer hat ja recht«, sagte sie, während der Mercedes über eine von dunklen Wäldern gesäumte Landstraße in Richtung Końskie rauschte, einem Ort irgendwo am Rand des Heiligkreuzgebirges, wo die nächsten Aufnahmen stattfinden sollten. »In Zeiten wie diesen muss sich jeder nützlich machen, so gut er eben kann.«
Wie ein alter Frontsoldat spielte sie beim Reden in ihrer Hand mit der Gasmaske, die an einem Riemen vor ihrer Brust baumelte und ebenso zu ihrer Operettenuniform gehörte wie die Pistole in einem Seitenhalfter. Obwohl der Aufzug an Lächerlichkeit nicht zu überbieten war, sah sie darin einfach umwerfend aus. Auch bewegte sie sich in ihrer Verkleidung mit einer Selbstverständlichkeit, als hätte sie ihr Leben lang nichts anderes als Uniformen getragen. Die Mütze schräg auf dem Lockenkopf wie ein Husar am Roulettetisch, schlug sie in der geräumigen Limousine, die Edda und sie ganz für sich allein hatten, die gestiefelten Beine übereinander, trommelte mit den manikürten Fingern auf dem Koppelriemen und schwärmte von ihrem neuen Film.
»Kunst und Krieg – eine archaische Symbiose! Wie bei den alten Griechen! Ach, ich sehe alles schon vor mir … Die im Gleichschritt marschierenden Soldaten … Der Siegeswille in den Gesichtern … Die flammende Begeisterung in den Augen … Die unaufhaltsam rollenden Panzer, die jedes Hindernis mit der Kraft von Urgewalten niederwalzen … Die Jagdbomber, die wie stählerne Riesenvögel am Himmel ausschwärmen …«
Sie sprach, als hätten sie schon Dutzende von Schlachten erlebt, dabei hatten Edda und sie noch keine einzige Kampfhandlung gesehen. Auch der heutige Marschbefehl führte sie wieder in die Etappe. Von wegen Panzer und Jagdbomber! Auf Wunsch von General von Reichenau, der die 10. Armee kommandierte, sollten sie ein paar Landser beim Essenfassen ablichten – angeblich würde es Schweinebraten und Rotkohl geben, so dass mit lachenden Gesichtern zu rechnen sei. Aber das sei bei Homer auch nicht anders gewesen, behauptete Leni, der habe den Kampf um Troja bestimmt auch nur vom Hörensagen gekannt.
»Was ist denn da los?«, unterbrach sie plötzlich ihren Redeschwall, als sie den Stadtrand von Końskie erreichten.
Edda beugte sich vor. Durch das Wagenfenster erkannte sie in der Ferne eine Handvoll deutscher Soldaten, mit Gewehren im Anschlag eskortierten sie etwa zwei Dutzend Männer in Zivil, allem Anschein nach Einheimische.
»Schätze, das sind Partisanen«, sagte ihr Fahrer.
»Partisanen?«, rief Leni. »Sofort anhalten und die Kameras aufbauen! Wir drehen!«
9
Als Charly die Klinik verließ, empfing sie ein herrlicher Altweibersommer. Sonst genoss sie diese sonnendurchfluteten Septembertage mehr als alle anderen Tage im Jahr, ein Erbe ihres Vaters, dessen liebste Jahreszeit ja auch stets der Herbst gewesen war. Doch in der Verfassung, in der sie sich jetzt befand, wäre ihr ein grau verhangener Regenhimmel lieber gewesen als das goldene Sonnenlicht, dessen Zweck nur sein konnte, ihr die eigene Verfassung umso schmerzlicher zu Bewusstsein zu bringen.
Vor dem Portal winkte sie ein Taxi herbei, um zu ihrer Wohnung am Theaterplatz zu fahren, der eigentlich seit Jahren schon Adolf-Hitler-Platz hieß. Wann immer sie auf dem Weg dorthin aus dem Wagenfenster blickte, glaubte sie schwangere Frauen zu sehen, die mit verklärten Gesichtern ihre gewölbten Bäuche vor sich her trugen. Mit einem Seufzer wandte sie sich ab. So viele Kinder hatte sie in den Jahren, die sie als Ärztin praktizierte, zur Welt gebracht und behandelt – doch würde sie je selbst welche haben? Die Vorstellung, kommende Woche in die Kinderklinik zurückzukehren, machte ihr Angst. Die letzte Erinnerung, die sie an ihre Arbeit hatte, war der Moment, als das Blut an ihren Schenkeln heruntergeflossen war. Wieder stieg eine Frage in ihr auf, die ihr schon einmal gekommen war, unmittelbar vor ihrem Zusammenbruch, eine Frage, die diesen vielleicht sogar mit ausgelöst hatte und sie nun fast so sehr quälte wie der Verlust ihres Kindes.
Warum hatte Professor Wagenknecht sie von dem Runderlass, wonach missgebildete Kinder nach Berlin zu melden waren, so spät in Kenntnis gesetzt?
Korrekt, wie Professor Wagenknecht war, hatte er den Text einschließlich des Datums vorgelesen. Das Rundschreiben des Innenministers war schon über zwei Wochen alt gewesen. Eigentlich hatte es keinen Grund gegeben, dem eine Bedeutung beizumessen, auch bei Rundschreiben der Krankenkassen oder der Ärztekammer kam es vor, dass der Chef sie verspätet mitteilte. Doch in diesem Fall …? Der Verdacht, der sich in Charlys Kopf eingenistet hatte wie eine Zecke, war so unerträglich, dass sie ihn gewaltsam unterdrückte.
Keine Aufregung, hatte Frau Dr. Reuter gesagt.
Zum Glück dauerte die Fahrt nur wenige Minuten. Zu Hause wollte sie versuchen, ein paar Bissen zu essen, ohne Essen ging es ja nun mal nicht, und irgendwas würde sie in der Vorratskammer schon finden. Dann würde sie sich hinlegen und schlafen, am besten die ganze Woche lang, Tag und Nacht …
Unendlich müde stieg sie aus dem Taxi und überquerte die Straße. Im Hausflur öffnete sie den Briefkasten, aus reiner Gewohnheit, weil sie das immer tat, wenn sie nach Hause kam. Doch außer Reklamesendungen befand sich darin nur eine Ansichtskarte, von einem ihr unbekannten Ort.
Herzliche Grüße aus dem schönen Westerbork …
Der Absender war ein »Dr. Fritz Spanier«. Charly hatte den Namen noch nie gehört. Doch er war in einer Handschrift geschrieben, die sie unter tausenden wiedererkannt hätte.
Mit einem Mal war sie hellwach, und ihr Herz begann zu klopfen, als wolle es ihr aus der Brust springen.
Kein Zweifel – die Karte stammte von Benny!
10
Der Platz, auf dem der Sonderfilmtrupp Riefenstahl zum Stehen kam, wurde von einer Häuserzeile begrenzt, die, durchbrochen von einem Torbogen, die äußere Stadtgrenze von Końskie bildete. Wenn der Konvoi sonst irgendwo Station machte, strömten von allen Ecken Neugierige herbei, die die Mercedes-Limousinen und den Tonfilmwagen bestaunten und Leni wegen eines Autogramms belagerten. Doch diesmal war es anders. Als die Techniker ihr Gerät abluden, ließ sich keine Menschenseele blicken, nur ein paar Hunde und Katzen streunten über den staubigen Platz. Der Grund für die gespenstische Ruhe waren die deutschen Soldaten, die mit ihren Gewehren die Partisanen in Schach hielten. Während Leni den Aufbau der Kameras überwachte, überquerte Edda den Platz, um sich bei dem befehlshabenden Leutnant zu erkundigen, was es mit den Partisanen auf sich hatte.
»Partisanen?« Der Mann zog an seiner Zigarette. »Wie kommen Sie darauf? Die Männer sind hier aus dem Kaff, vollkommen harmlos.«
»Aber wozu dann die Gewehre?«
»Sicher ist sicher. Die Polacken sollen ein Grab ausheben, für unsere toten Kameraden.« Der Leutnant deutete mit dem Kopf einen Steinwurf weiter, wo Edda erst jetzt vier uniformierte Leichen am Boden sah. »Die hat der Feind erwischt.«
»Oh, das tut mir leid«, sagte sie. »Darf ich fragen, warum Sie Ihre Kameraden hier und nicht auf dem Friedhof beerdigen?«
Der Leutnant zuckte die Schultern. »Dieses Końskie ist ein Judennest, einen ordentlichen Friedhof gibt es hier gar nicht, nicht mal einen katholischen. Und wir wollen das Andenken unserer Kameraden nicht schänden, indem wir sie auf einem Judenfriedhof verscharren. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich habe zu tun.«
Er schnippte den Rest seiner Zigarette fort und schlenderte in Richtung seiner Soldaten, unter deren Aufsicht die Polen inzwischen mit der Arbeit begonnen hatten.
Edda kehrte zu Leni und den Technikern zurück.
»Ihr könnt wieder abbauen.«
»Wie bitte?«, fragte Leni, die bereits eine Kamera in Betrieb genommen hatte.
»Es gibt nichts zu filmen. Das sind keine Partisanen, nur irgendwelche Einwohner, die Gräber ausheben.«
Leni war sichtlich enttäuscht. »Ich hatte gehofft, wir bekämen hier was Interessanteres geboten als Essen fassen in der Etappe.«
»Glückliche Gesichter bei Schweinebraten und Rotkohl sind immer noch besser als Bilder von der Beerdigung getöteter Wehrmachtsoldaten«, erwiderte Edda. »Also sollten wir uns beeilen.«
Vom anderen Ende des Platzes ertönte plötzlich lautes Geschrei. Um besser gegen die Sonne sehen zu können, beschattete Edda die Augen mit ihrer Hand. Offenbar waren die Deutschen und Polen miteinander in Streit geraten. Während die Polen aufgeregt gestikulierend gegen irgendetwas protestierten, entsicherten die deutschen Soldaten ihre Gewehre.
»Um Himmels willen, wollen die etwa schießen?«
Noch während Edda sprach, knallte ein Schuss. Im selben Moment rannten die Polen auf und davon, die meisten auf den Torbogen zu, der in die Stadt führte.
Da gellte die Stimme des Leutnants über den Platz: »Feuer!«
Eine Gewehrsalve krachte. Während die Hälfte der Fliehenden zu Boden sank, versuchten die anderen, sich durch den Torbogen zu retten. Die meisten stürmten pfeilgerade voran, manche schlugen Haken, während in immer schnellerer Folge Schüsse abgefeuert wurden. Doch keiner der Männer erreichte sein Ziel. Wie Karnickel wurden sie abgeknallt, einer nach dem anderen.
»Feuer einstellen!«, rief der Leutnant, als der Letzte gefallen war.
Die Soldaten sicherten ihre Gewehre. Das Ganze hatte keine Minute gedauert. Doch der Platz, der eben noch friedlich im Sonnenschein gelegen hatte, war jetzt übersät von Leichen.
Während der Leutnant sich eine neue Zigarette anzündete, drehte Edda sich zu Leni herum.
»Hast du das gesehen?«
Doch Leni antwortete nicht. Bleich wie eine Wand, starrte sie ins Leere, den Mund weit aufgerissen, ohne dass ein Laut daraus hervordrang, als wäre ihr der Schrei im Halse steckengeblieben. Während ihre Kamera weiter surrte, um Bilder von dem Schreckensort aufzunehmen, sank sie ohnmächtig in den Staub.
11
Westerbork war ein Flüchtlingslager in der holländischen Provinz Drente, das eigens zur Aufnahme von aus Deutschland und Österreich geflohenen Juden eingerichtet worden war. Da die Regierung der Niederlande mit Rücksicht auf die Beziehungen zum Großdeutschen Reich im Dezember 1938 offiziell die Grenze für Flüchtlinge geschlossen hatte, galten diese als unerwünschte Ausländer, die mit der einheimischen Bevölkerung möglichst nicht in Kontakt treten sollten. Entsprechend hatte man den Standort des Lagers gewählt. Völlig isoliert gelegen, befand sich Kamp Westerbork zehn Kilometer nördlich einer Kleinstadt gleichen Namens, auf einer freien, Wind und Wetter ausgesetzten Tiefebene, inmitten eines gottverlassenen Torfmoorgebiets.
An diesen unwirtlichen Ort hatte es Benny nach seiner Landung in Antwerpen und der Quarantäne in Rotterdam verschlagen, zusammen mit rund hundert anderen Passagieren der St. Louis, die dem holländischen Flüchtlingskontingent zugeteilt worden waren und für die sich weder Freunde noch Angehörige hatten ermitteln lassen. Nein, auch für Benny hatten sich keine Bürgen gefunden, obwohl seine Mutter eine gebürtige Holländerin war. Laut eines Schreibens aus Den Haag hatten alle Personen, die er bei der Registrierung genannt hatte, das Land inzwischen verlassen. Vermutlich aus Angst vor den Deutschen.
Das Lager war auf eine so große Zahl zusätzlicher Flüchtlinge nur unzureichend vorbereitet. Privatsphäre gab es in Westerbork darum nicht, zu zwölft teilten die Insassen sich in den Baracken jeweils eine Stube, und statt auf Toiletten musste man die Notdurft auf stinkenden Latrinen verrichten. Noch schlimmer als die Unterbringung aber war die Langeweile. Von morgens bis abends verbrachte man die Stunden mit Warten, ohne zu wissen, worauf. Um beim Blick auf die Uhr nicht verrückt zu werden, hatte Benny sie abgelegt. Wenn er nur etwas zu tun gehabt hätte! Er hatte zwar ein Dach über dem Kopf, auch brauchte er nicht zu verhungern und konnte sich innerhalb und außerhalb des Lagers frei bewegen. Doch da er wie alle seine Leidensgenossen nur Asyl in Holland genoss, durfte er keiner Arbeit nachgehen.
Außer Kreuzworträtsellösen und Lesen waren Gespräche darum praktisch die einzige Möglichkeit, die sich endlos dehnende Zeit im Lager irgendwie totzuschlagen. Höhepunkt des Tages war die mittägliche Essensausgabe, dann kam ein bisschen Leben in die Alltagstristesse, man tauschte Informationen und diskutierte das Weltgeschehen. Seit die Wehrmacht in Polen einmarschiert war, beschäftigte die Gemüter vor allem eine Frage: Würde Deutschland die Neutralität der Niederlande respektieren? Die Meldungen vom unaufhaltsamen Vormarsch der Wehrmacht im Osten löste solche Ängste aus, dass manche der Lagerinsassen darüber nachdachten, Westerbork zu verlassen, obwohl sie nicht wussten, wo und wovon sie dann leben sollten. Benny nahm an diesen Diskussionen nicht teil – Flucht kam für ihn nicht in Frage. Solange er keine Nachricht von Charly hatte, musste er in Westerbork bleiben. Wie sollten sie sonst wieder zusammenfinden?
Eine Glocke rief zum Mittagessen. Als Benny sich auf den Weg machte, wehte ihm von der Küchenbaracke Fischgeruch entgegen. Die Verpflegung war außer der Unterbringung und der Langeweile das dritte große Übel im Lager. Alle naslang gab es Fisch, und gegen Fisch hatte Benny seit seiner Kindheit eine unüberwindliche Aversion. Heute stand Hering mit Salzkartoffeln auf dem Speiseplan. Das bedeutete, dass er sich einmal mehr mit der Beilage begnügen musste.
Als er in die Schlange der Wartenden trat, die sich von der Essensausgabe bis auf den Platz vor der Kommandantur zurückstaute, sah er, wie Dr. Spanier aus der Stadt zurückkehrte. Der Arzt hatte für den Briefwechsel mit seiner Frau und seinen Töchtern, die inzwischen von Kuba nach New York gelangt und dort bei Verwandten untergekommen waren, ein Postfach eingerichtet, und jeden Morgen lief er nach dem Frühstück zu Fuß den weiten Weg in die Stadt, um nach der Post zu schauen, stets in der Hoffnung auf das Visum, das seine Angehörigen für ihn in Amerika besorgen sollten. Bei seinem Anblick hellte Bennys Stimmung sich für eine Sekunde auf. Dr. Spanier hatte ihm das Fach zur Mitbenutzung zur Verfügung gestellt, damit er ohne Gefahr mit Charly korrespondieren konnte. Doch als er das Gesicht des Arztes sah, erlosch das kleine Flämmchen Hoffnung auch schon wieder.
»Wieder nichts dabei?«
»Leider nein.«
»Wenn ich nur wüsste, warum meine Frau nicht antwortet.«
»Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, Herr Jungblut. Ich bin sicher, Ihr Warten hat bald ein Ende. Wenn nicht heute, dann morgen. Morgen ist ein neuer Tag.«
Benny stieß einen Seufzer aus. »Ich hoffe nur, dass es an der Post liegt. Andere Gründe mag ich mir gar nicht vorstellen.«
Dr. Spanier legte ihm die Hand auf die Schulter. Benny wusste, der Arzt meinte es gut und wollte ihn trösten. Doch gerade darum ertrug er die Berührung nicht.
»Ich glaube, ich habe heute keinen Hunger! Sie wissen ja, ich mag keinen Fisch.«
»Aber Sie müssen doch etwas essen! Sie fallen sonst vom Fleische!«
Ohne eine Antwort ließ Benny den Arzt stehen.
»Dann wenigstens die Kartoffeln!«
»Sie können gern meine Portion haben.« Er wollte allein sein, wenigstens für ein paar Minuten, ohne all die fremden Menschen in seiner Nähe.
Durch das Haupttor verließ er das Lager, dann wandte er sich nach Westen, um die kleine Anhöhe hinaufzusteigen, die zu seinem Lieblingsplatz führte, von wo aus man nichts als die menschenleere Moorlandschaft sah, so weit das Auge reichte.
Hier war er ganz für sich.
Ein wenig außer Atem ließ er sich auf einen Baumstumpf nieder und wartete, bis sich sein Puls beruhigt hatte. Dann griff er in die Brusttasche seines Jacketts, wo er Charlys Foto bei sich trug.
Unbeirrt von allem, was in der Welt geschah, lächelte sie ihn an.
Obwohl er das Foto stets in seiner Brieftasche aufbewahrte, damit es keinen Schaden nahm, hatte es ein paar winzige Risse bekommen. Benny nahm sie gar nicht wahr, er sah nur das geliebte Gesicht, den vollen, ein wenig zu breiten Mund, den er so gern küsste, die hellen, klaren Augen, die zwei Grübchen auf den Wangen.
Ein kühler Wind wehte über die Ebene und ließ ihn in seinem dünnen Anzug frösteln. Während er den Kragen hochschlug, schaute er über die Torflandschaft. Obwohl nicht mal Mitte September war, war es schon so kalt, dass er sich nicht mehr lange hierher würde zurückziehen können – spätestens im Oktober würde er sich einen neuen Platz suchen müssen, wenn er mit Charly allein sein wollte.
Aber wer konnte schon wissen, was im Oktober sein würde?
12
Charly blickte auf die Ansichtskarte mit der falschen Unterschrift in ihrer Hand. Die Karte hatte sie aus ihrer schlimmsten Angst erlöst, war das erste, lang ersehnte Lebenszeichen von Benny, seit eine unbekannte Stimme ihr am Telefon gesagt hatte, dass er in Antwerpen gelandet sei. Doch zugleich war sie ein einziges Rätsel – ein Rätsel, das sie nicht verstand.
Was wollte Benny ihr damit sagen?
Wieder und wieder hatte sie die wenigen Worte gelesen, die er ihr geschrieben hatte, und die Karte, auf deren Vorderseite nur eine unscheinbare Dorfkirche zu sehen war, hin und her gewendet, in der Hoffnung, dass sie ihr Geheimnis preisgab. Dem Stempel nach hatte die Post über zwei Monate gebraucht – eine Ewigkeit, die Benny also schon in diesem Westerbork verbracht hatte, einem Ort südlich von Groningen und fünfzig Kilometer westlich der deutschen Grenze, wie sie mit Hilfe ihres alten Diercke-Atlasses herausgefunden hatte. Dass er ihr mit der Karte einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort geben wollte, daran hatte sie keinen Zweifel. Sie erinnerte sich an einen Artikel im »Stürmer«. Darin war Westerbork zynisch als »Luftkurort« bezeichnet worden, in dem die Regierung der »angeblich neutralen Niederlande« deutsche »Volksschädlinge« in »völkerrechtswidriger Weise« vor dem Zugriff des Reichs Schutz böte. Auch konnte sie sich denken, warum Benny einen falschen Namen verwendet hatte. Sie beide waren offiziell ja geschieden, eine Kontaktaufnahme unter richtigem Namen würde ihn also gefährden. Horst spekulierte schon offen darüber, wann die Wehrmacht in die Niederlande einmarschieren würde, um von dort aus Frankreich anzugreifen. Obwohl er nichts von Bennys Aufenthaltsort wusste, sondern weiterhin glaubte, sein Schwager lebe in Leipzig, lief es Charly bei der Vorstellung, dass Benny dann in Holland dem Zugriff der Gestapo ausgesetzt sein würde, kalt den Rücken hinunter.
Nur, warum dieser seltsame Name – Dr. Fritz Spanier? Warum hatte er sich nicht einfach Wilfried Meyer oder Günter Schulze genannt?
Sie beschloss, ein Bad zu nehmen – in der Wanne kamen ihr manchmal die besten Ideen. Also ging sie ins Badezimmer und drehte den Hahn auf. Während das Wasser dampfend aus dem Boiler sprudelte, öffnete sie den kleinen Toilettenschrank und nahm daraus das Stück Seife hervor, das Benny ihr beim Abschied in Hamburg geschenkt hatte, nach ihrer Liebesnacht im Vier Jahreszeiten, bevor er an Bord der St. Louis gegangen war. Obwohl sie mit der Seife äußerst sparsam umgegangen war, gab es nur noch einen winzigen Rest – kaum genug für ein Bad. Doch heute war der richtige Tag.
In Gedanken bei Benny, zog Charly sich aus. Dabei durchflutete sie die Erinnerung, wie schön es immer gewesen war, zusammen mit ihm nackt zu sein.
Wann würde sie dieses Glück je wieder genießen?
Mit der Hand prüfte sie die Wassertemperatur, dann drehte sie den Hahn zu und stieg in die Wanne.
Vorsichtig wickelte sie die Seife aus dem Papier, hielt das winzige Reststück mit beiden Händen vor ihr Gesicht und sog den Duft ein. Ja, Benny war bei ihr, ganz nah … Mit geschlossenen Augen ließ sie sich in das Wasser gleiten.
Irgendwann begann sie sich einzuseifen, ganz langsam und behutsam, erst den Hals, dann die Schultern und Arme, und stellte sich dabei vor, es wären Bennys Hände, die sie berührten.
Als sie ihre Brüste wusch, fiel ihr Blick auf die Karte, die sie auf einem Hocker neben der Wanne abgelegt hatte. Irritiert hielt sie inne. Sie hatte die Karte schon unzählige Male angeschaut, doch erst jetzt entdeckte sie – so winzig klein, dass man sie mit bloßem Auge kaum entziffern konnte – zwei Buchstaben unter dem Namenszug, beide jeweils mit einem Punkt versehen.
P.r.
Was hatten die zwei Buchstaben zu bedeuten?
13
Horst knurrte der Magen. Seit er mit Ilse verheiratet war, war er gewohnt, dass Punkt ein Uhr das Essen auf dem Tisch stand, sonst bekam er schlechte Laune. Jetzt war es schon halb zwei, und er hatte noch immer nichts gegessen. Schuld daran war Kreisleiter Sander. Für elf Uhr hatte der ihn nach Gifhorn bestellt, doch er selbst war erst um eins in seinem Büro aufgetaucht – angeblich wegen plötzlicher, unaufschiebbarer Termine. Jetzt hielt er Horst seit einer halben Stunde einen Vortrag über die Schädlichkeit von Zucker.
»Dann sind wir uns also einig?«, kam er endlich zum Schluss. »Sie lassen sich was einfallen, um den Leuten den Jieper auf Süßes auszutreiben?«
»Selbstverständlich«, erwiderte Horst, obwohl er nicht die leiseste Ahnung hatte, wie er das anstellen sollte. »Allerdings, um ganz offen zu sein, wäre es mir lieb, wenn ich mich in dieser Sache nicht öffentlich exponieren müsste.«
Sander sah ihn mit seinen stechenden Augen an. »Immer noch Schiss vor dem alten Herrn? Sollten Sie sich in Ihrem Alter mal langsam abgewöhnen.«
»Sicher, gewiss. Nur, andererseits – die Familie ist dem Nationalsozialismus heilig. Das betont der Führer immer wieder …«
»Der Führer betont vor allem, dass es unsere gottverdammte Pflicht ist, diesen Krieg zu gewinnen. Und um diese Pflicht zu erfüllen, müssen wir den Gürtel enger schnallen. Es ist deshalb mein unerschütterlicher Wille, dass im Landkreis Gifhorn ab sofort weniger Zucker gefressen wird! – Aber jetzt machen Sie sich mal nicht ins Hemd«, fuhr Sander mit seinem meckernden Lachen fort, als er Horsts Gesicht sah. »Sie werden das Kind schon schaukeln.«
»Jawoll, Kreisleiter! Sie können sich auf mich verlassen.«
»Das wollte ich hören.« Sander schien das Gespräch beenden zu wollen, doch dann fiel ihm noch etwas ein. »Apropos Kind. Gauleiter Telschow hat sich sehr erfreut gezeigt, wie Sie das Problem mit dem kleinen Kretin gelöst haben.«
Horst zuckte zusammen. »Kretin?«
»Ihr Bruder. Wie war noch mal sein Name? Willy?«
»Jawoll, so heißt er.«
»Wie auch immer. Ich soll Ihnen jedenfalls eine Belobigung aussprechen.«
»Ist mir eine Ehre, Kreisleiter.« Horst schlug die Hacken zusammen. »Habe versucht, mein Bestes zu geben. Zum Glück ließ sich meine Familie überzeugen. Sogar meine Schwester.«
»Tatsächlich?« Sander hob die Brauen. »Die von uns allen verehrte Frau Doktor Ising, zwischenzeitlich Jungblut?«
»Jawoll. Sie hat den Knaben persönlich in die Heil- und Pflegeanstalt überstellt und sich vor Ort einen Eindruck von der überragenden Qualität der Einrichtung gemacht.«
Sander steckte zufrieden die Daumen hinter seinen Koppelriemen. »Sieh mal einer an. Kommt da vielleicht jemand zu Verstand?« Doch dann runzelte er die Stirn, und seine Augen bekamen wieder diesen stechenden Blick, der Horst schon in seiner Kindheit Angst eingejagt hatte. »Ich gehe natürlich davon aus, dass Ihre Schwester keinen Kontakt zu dem Juden Jungblut hat. Oder irre ich mich?«
»Nein, Kreisleiter, nicht, dass ich wüsste.«
»›Nicht, dass ich wüsste‹ ist keine Antwort, Mann. Wenn Sie sich nicht sicher sind, verschaffen Sie sich Sicherheit!« Sander schüttelte den Kopf. »Wissen Sie, was das Problem mit Ihnen ist, Ortsgruppenleiter Ising? Dass man Ihnen immer alles haarklein vorbuchstabieren muss! Das war schon früher in der Schule so. Selbst für einen Purzelbaum brauchten Sie eine Zeichnung.«
Damit ließ er ihn stehen und setzte sich hinter seinen Schreibtisch. Horst wollte fragen, was genau von ihm erwartet wurde, doch das traute er sich nicht.
»Was stehen Sie da noch rum?« Ungeduldig blätterte Sander in irgendwelchen Unterlagen. »Wir haben alles besprochen. Oder ist noch irgendwas unklar?«
»Nein, Kreisleiter. Alles klar wie Kloßbrühe!« Zur Bekräftigung riss Horst seinen rechten Arm in die Höhe. »Heil Hitler!«
Ohne aufzuschauen, hob Sander die Hand. »Heil Hitler!«
14
Seit dem frühen Morgen saß Unterlagerführer Heinz-Ewald Pagels an seinem Schreibtisch, um die Listen der in der Stadt des KdF-Wagens tätigen Arbeitskräfte auf Vordermann zu bringen. Er war damit seit Tagen in Verzug, Horst hatte ihm deshalb vor seiner Abfahrt einen kräftigen Anschiss verpasst. Trotzdem schaffte Heinz-Ewald es nicht, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Mit leeren Augen starrte er auf die Namenslisten, die ihm so gleichgültig waren wie der liebe Gott.
War seine Glückssträhne gerissen?
Seit seiner Ankunft in Fallersleben hatte alles, was er angefasst hatte, wie am Schnürchen geklappt und sich wie von Zauberhand in Gold verwandelt. Statt sich krumm und blutig zu schuften, wie er am Anfang befürchtet hatte, hielt seine Arbeit sich in erfreulich überschaubaren Grenzen, und für den Schreibkram hatte er sogar ein eigenes Büro, von dem aus es ihm in kürzester Zeit gelungen war, einen schwunghaften Handel mit italienischer Damenunterwäsche zu entfalten, so dass sein Guthaben bei der Sparkasse Braunschweig ebenso gedieh wie sein leibliches und seelisches Wohl. Doch an diesem Morgen war ein Schreiben bei ihm eingetroffen, das alles zu zerstören drohte, was er sich hier aufgebaut hatte.
»Bist du mit deinen Listen immer noch nicht fertig?«
Heinz-Ewald schrak aus seinen Gedanken. Vor ihm stand sein Vorgesetzter, Hauptlagerführer Horst Ising.
»Tut mir leid. Aber mir ist heute nicht wohl.«
»Nicht wohl? Bei dir piept’s wohl!«
Statt einer Antwort reichte Heinz-Ewald ihm das fatale Schreiben. Mit gerunzelter Stirn las Horst die wenigen Zeilen.
»Dann hat es dich also erwischt?«, sagte er. »Sie wollen dich tatsächlich ziehen?«
Heinz-Ewald nickte. »Ich bin natürlich der Letzte, der sich vor dem Kriegsdienst drücken würde. Aber – ich hatte gedacht, dass ich mich an der Heimatfront nützlicher machen könnte als in einem Schützengraben, wo ich ja doch nur zum Kanonenfutter tauge.«
Horst gab ihm den Einberufungsbescheid zurück. »Darüber ist das letzte Wort noch nicht gefallen.«
Unsicher blickte Heinz-Ewald zu ihm auf. »Meinst du?«
»Natürlich! Du bist mein wichtigster Mann, ich kann unmöglich auf dich verzichten.« Horst zögerte, dann fügte er hinzu: »Aber vielleicht kannst du mir ja auch einen kleinen Gefallen tun?«
Heinz-Ewald sprang von seinem Stuhl auf. »Stets und mit Freuden zu Diensten!«
Horst kratzte sich am Kragen. »Die Sache ist die – es gibt Querulanten, die gegen die Lebensmittelrationierung meutern. Das betrifft vor allem die Beschränkungen von Zucker, der, wie du weißt, hier bei uns im Wolfsburger Land ja eine ganz herausragende Bedeutung hat …«
Ebenso umständlich wie ausführlich erklärte er sein Anliegen. Normalerweise stellte Heinz-Ewald bei solchen Gelegenheiten auf Durchzug. Doch diesmal waren die Phrasen seines Vorgesetzten Musik in seinen Ohren. War das vielleicht seine Chance, das Unheil doch noch abzuwenden?
Horst kaute an seinem Daumennagel. »Was meinst du? Fällt dir dazu was ein? Möglichst kurz und knackig, so in der Art unseres alten Reklamespruchs – Zucker schadet? Grundverkehrt! Zucker schmeckt, Zucker nährt!«
»Verstehe«, erwiderte Heinz-Ewald. »Ich werde mir Mühe geben.«
»Schön, ich verlasse mich auf dich.« Wieder machte Horst eine Pause, dann sagte er: »Ach, übrigens, bevor ich’s vergesse, da wäre noch etwas.«
15
Und Gilla? Arme Gilla!
Bis zu ihrer Abschlussprüfung in Herward Senftlebens Modeinstitut waren es nur noch wenige Wochen, als der Direktor sie nach dem Unterricht im Flur abfing.
»Ich will nicht um den heißen Brei herumreden. Auch wenn es mir noch so schwerfällt, Fräulein Bernstein, Sie müssen uns verlassen.«
Seit Wochen hatte Gilla sich vor diesem Moment gefürchtet. Sie war nicht nur die einzige Jüdin in ihrer Klasse, sondern inzwischen in der ganzen Schule. Doch mit jedem Tag, der ohne Hiobsbotschaft vergangen war, hatte sie ein bisschen mehr Hoffnung geschöpft, dass Herr Senftleben sie bis zum Examen behalten würde. Sie war doch eine der besten Schülerinnen, die er je gehabt hatte, das hatte er ihr selbst gesagt!
Umso heftiger traf sie jetzt seine Eröffnung. »Aber … die Schule ist doch meine einzige Chance …«
»Ich weiß. Und darum habe ich wirklich alles versucht, um Ihre Entlassung zu vermeiden! Alles! Das müssen Sie mir glauben!« Herr Senftleben zog ein so gequältes Gesicht, als würde er genauso leiden wie sie. »Aber ich kann nichts mehr für Sie tun. Weil – ich bin bei den Herrschaften selbst in die Schusslinie geraten.«
»In welche Schusslinie?«
»Sie wissen doch, Männer wie ich …« Statt den Satz zu Ende zu sprechen, klimperte er nur mit den Wimpern und richtete sich mit seinen manikürten Fingern das Haar. »Uns geht es doch auch an den Kragen.«
»Aber warum denn? Sie haben doch nie jemandem was zuleide getan.«
»Glauben Sie, darauf käme es an?« Er bedachte sie mit einem so zärtlichen Blick, wie kein anderer Mann es je getan hatte. »Ach Gilla, mein schönes, unschuldiges Kind …«
Mehr sagte er nicht.
Und mehr musste er auch nicht sagen.
»Adieu, Gisela Bernstein. Ich wünsche Ihnen alles Gute, von ganzem Herzen. Lassen Sie sich nicht unterkriegen.«
Er nickte ihr noch einmal zu, dann wandte er sich ab und verschwand in seinem Büro. Wie betäubt stand Gilla da und schaute ihm nach. Niemand außer ihr war noch in dem großen, leeren Gebäude, weder Schülerinnen noch Lehrer. Eine lange Weile wartete sie, dass irgendwas geschah, den Blick auf die geschlossene Bürotür gerichtet, wartete in der verzweifelten Hoffnung, dass Herr Senftleben noch einmal zurückkehren würde, um alles ungeschehen zu machen. Aber das tat er nicht.
Warum hieß das Leben »Leben«? Natürlich, um was zu erleben …
Welche Hoffnungen hatte sie an ihre Ausbildung hier geknüpft. Trotz allem, was man ihr und ihren Eltern angetan hatte, hatte sie nie daran gezweifelt, dass es ihr mit einem Abschlusszeugnis von Herrn Senftlebens Institut irgendwie gelingen würde, als Modezeichnerin unterzukommen und wenigstens ein kleines bisschen glücklich zu sein. Doch wieder war sie gescheitert, und wieder aus demselben Grund.
Es war, wie ihre Mutter gesagt hatte: Sie war Jüdin, und weil sie das war, konnte es für sie in diesem Leben kein Glück geben.
Kaum schaffte sie es, sich loszureißen und das Gebäude zu verlassen. Draußen schien die Sonne. Mit schweren Schritten schleppte Gilla sich die Bleibtreustraße entlang Richtung Ku’damm. Aus dem Fenster einer Villa drang Gläserklingen und Stimmengewirr. Heini Grätjens, der Conférencier des »Kakadu«, hatte behauptet, in der Villa würde ein »Etablissement« betrieben, in dem sich Parteibonzen, Generäle und Fabrikanten träfen, um rauschende Feste zu feiern. Dort, so hatte er mit einem Augenzwinkern hinzugefügt, würde niemand fragen, ob jemand arisch sei oder nicht, dort würde es nur nach Schönheit gehen, zumindest bei den Frauen …
Gilla blieb stehen und schaute zu dem Fenster hinauf, aus dem die fröhlichen Klänge drangen, die nicht zu der Tageszeit passten.
Ob sie da vielleicht klingeln sollte?
16
»Dann würden Sie also ausschließen, dass Frau Dr. Ising mit dem Juden Jungblut weiter in Kontakt steht?«
Oberschwester Johanna rückte die Haube ihrer Tracht zurecht. »Ausschließen kann man ja nichts. Immerhin hat sich der Itzig früher ziemlich oft hier blicken lassen, einfach so ist der hier reingeschneit, als würde er dazugehören, einmal ist er sogar in eine Weihnachtsfeier geplatzt, um die Frau Doktor zu sprechen, und angerufen hat er regelmäßig, obwohl der Professor Privatgespräche gar nicht gerne sieht. Der Jude als solcher ist ja von Natur aus unverschämt. Aber seit gut einem halben Jahr ist er wie vom Erdboden verschwunden. Als hätte er sich in Luft aufgelöst.«
Heinz-Ewald machte sich eine Notiz, damit war sein Auftrag im Grunde erledigt. Die Aussage der Schwester, die ihn auf lebhafte Weise an eine Wärterin der Strafanstalt Werl erinnerte, deckte sich mit dem, was er bei seinen Nachforschungen am Adolf-Hitler-Platz herausgefunden hatte: Nichts deutete darauf hin, dass Frau Dr. Ising die Ehe mit dem Juden Jungblut heimlich weiterführte. Und das war alles, was Horst wissen wollte …
Trotzdem lag Heinz-Ewald noch eine Frage auf der Zunge. Allerdings war die eher privater Natur. »Bekommt die Frau Doktor vielleicht irgendwelche Anrufe, die Ihnen verdächtig erscheinen?«
»Was für Anrufe meinen Sie?«
»Anrufe von Leuten, die nicht ganz koscher sind. Zum Beispiel von neuen Verehrern?«