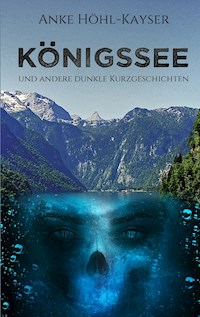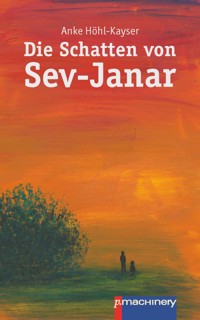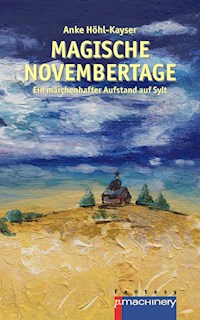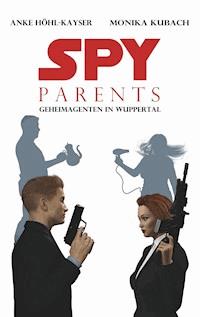5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Merret hat Eulenaugen", spotten Silas und Olli, weil Merret eine Brille trägt. Merret möchte ihnen am liebsten eine reinhauen. Aber sie hat sich noch nie wehren können. Als auch noch ihr Hund Freddie krank wird, kann es für Merret nicht mehr schlimmer werden. Da taucht ein Mann im lila Umhang in ihrem Zimmer auf und stellt sich als ihre Fee vor – und Merrets Leben verändert sich wie im Märchen. Gemeinsam mit ihrem Fee-er erlebt Merret verzauberte Abenteuer in der Wuppertaler Schwebebahn, im Weltraum und im Meer. Auf Sylt wartet Merrets größte Herausforderung: Die Okeaniden, ein geheimnisvolles Meeresvolk, bitten sie um Hilfe. Sie sind von der Vernichtung bedroht. Kann die schwache Merret mit den Eulenaugen die Okeaniden retten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Anke Höhl-Kayser
Eine Fee namens Johnny
Fantasy 30
Anke Höhl-Kayser
EINE FEE NAMENS JOHNNY
Fantasy 30
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: November 2017
p.machinery Michael Haitel
Titelbild & Illustrationen: Alexandra Fröb
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda, Xlendi
Lektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda, Xlendi
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Ammergauer Str. 11, 82418 Murnau am Staffelsee
www.pmachinery.de
ISBN der Printversion: 978 3 95765 114 3
Für Frauke
1. Ein Tag wie jeder andere?
Merret stellte ihren Schulrucksack eine Spur zu heftig auf den Tisch. Sie biss die Zähne zusammen. Sie musste jetzt unbedingt ein cooles Gesicht machen! Aber die Tränen bahnten sich einen Weg von tief unten, und sie konnte sie nicht mehr zurückhalten. Sie legte ihre Arme um den Rucksack, steckte ihr Gesicht in die Öffnung und schluchzte so leise wie möglich drauflos.
Niemand sollte sehen, dass es dem blöden Silas wieder gelungen war, sie zum Heulen zu bringen!
Der dicke Silas und sein Freund Olli ärgerten Merret dauernd. Die Gründe fürs Ärgern waren dermaßen dämlich, und Merret ärgerte sich über sich selbst, dass sie sich immer wieder darüber aufregte.
Silas und Olli sagten Sachen wie:
»Du hast Eulenaugen!«
»Du kannst dich überhaupt nicht wehren!«
»Du bist so blöd in Mathe!«
»Du siehst aus wie ein Zwerg!«
»Merret ist ein doofer Name, der klingt wie ein Jungenname!«
Manches davon stimmte halt. Merret war tatsächlich klein für jemand, der elf Jahre alt war und in die vierte Grundschulklasse ging. Sie hatte keine Ahnung vom Raufen oder Hauen, weil zu Hause nur mit Worten gestritten wurde. Merret konnte auch nicht so laut brüllen wie die anderen Kinder. Deshalb hörte niemand auf sie.
Merret konnte sehr schlecht sehen. Seit sie drei war, trug sie eine Brille, und das linke Auge wurde mit schicken Pflastern abgeklebt. Das war nichts Schlimmes, es lag nur daran, dass Merret stark auf dem rechten Auge schielte. Das gesunde Auge bekam die Pflaster drauf, damit das andere »sehen lernte«. Dazu ging Merret einmal im Monat in eine Sehschule. Dort wurde nicht, wie sie anfangs gedacht hatte, ihr schwaches Auge von Lehrern unterrichtet, sondern es wurde geprüft, ob Merret beim Sehen Fortschritte gemacht hatte. Inzwischen konnte Merret dank ihrer Brille beinahe so gut sehen wie alle anderen auch, und das Pflasterkleben sollte zum Wechsel auf die weiterführende Schule auch enden. Aber sie brauchte für manche Dinge länger Zeit als andere Kinder in ihrem Alter.
Der Rucksack war fertig gepackt. Die meisten anderen Kinder hatten den Klassenraum schon verlassen. Merrets Tränen versiegten, und sie wischte sich schnell mit einem Taschentuch das Gesicht ab. Niemand hatte etwas bemerkt.
Frau Heyder, die noch ihre Unterlagen ordnete, winkte Merret fröhlich zu.
»Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag«, sagte sie.
Von draußen hörte Merret Olli hämisch lachen. Sie ballte unwillkürlich die Hände zu Fäusten.
In diesem Moment wehte hinter ihr der blaue Vorhang ganz hoch auf. Frau Heyder und Merret zuckten beide zusammen.
»Du meine Güte«, sagte Frau Heyder. »Das muss aber sehr windig sein da draußen. Das Fenster ist doch nur einen Spaltbreit offen!«
Merret ging durch das Treppenhaus nach unten. Die meisten Schüler waren schon weg. Auf dem Schulhof machten die Kinder des Ganztags ihre Pause.
Unten vor der Tür wartete Mama. Sie schien hellsehen zu können.
»Hattest du einen schlechten Tag, Merret?«
Merret war fest entschlossen, den Ärger nicht zuzugeben.
»Ach nein«, sagte sie achselzuckend. »Die haben mich nur ein bisschen geärgert.«
An den hochgezogenen Augenbrauen sah Merret, dass sie ihre Mutter nicht täuschen konnte.
»Wieder wegen Mathe?«, wollte Mama wissen.
Merret guckte auf den Boden. Mathe war ihre Schwachstelle.
Sie bekam Nachhilfe bei einer sehr netten Lehrerin, aber die Zahlen machten ihr einen Riesenschrecken. Sie wurden immer größer, je länger man zur Schule ging. In der ersten Klasse war es ja noch überschaubar gewesen, aber dann! Inzwischen gab es nicht nur Zahlen mit unendlich vielen Nullen, sondern auch Zahlen hinter einem Komma. Gehörten Kommas nicht eigentlich in den Deutschunterricht? Und wer konnte sagen, was in Mathe noch auf sie wartete!
»Denk einfach dran, wie gut du in Deutsch bist«, sagte Mama. »Du kannst am besten lesen von allen Kindern in deiner Klasse.«
Ja, wenn das Silas und Olli nur mal interessieren würde!
Merret sah über den Schulhof und entdeckte Ollis türkisblaues T-Shirt beim Klettergerüst. Die beiden schauten zu ihr und Mama rüber, sie hatten ihre Tornister geöffnet und alles um sich herum verstreut.
»Chaoten«, brummte Merret vor sich hin. Kein Wunder, dass Silas und Olli in Mathe nicht besser waren als sie und in Deutsch viel schlechter.
»Merret ist ein Jungenname«, blökte Silas und schaukelte am Seil im Klettergerüst hin und her. Dass Merrets Mama dabei war, störte ihn gar nicht. Er streckte ihnen beiden die Zunge raus.
»Jetzt reicht es aber«, murmelte Mama und ging geradewegs auf die beiden zu.
Merret ergriff panisch ihre Hand.
»Nicht, Mama, das hat keinen Zweck, komm, lass uns gehen«, flehte sie.
Aber Mama hörte nicht.
Silas und Olli sahen ihr herausfordernd entgegen. Sie hatten nicht die geringste Angst. Merret dafür umso mehr. Mamas Eingreifen machte alles nur noch schlimmer.
»Könnt ihr mir mal sagen, was für ein Problem ihr eigentlich mit Merret habt?«, fragte Mama die beiden Jungs ruhig.
Silas grinste spöttisch.
»Gar keins«, antwortete er. »Merret hat nur ein Problem mit uns.«
»Merrets Name kommt aus dem Friesischen«, erklärte Mama ruhig. »Es ist die alte norddeutsche Form von Marie. So ungewöhnlich ist der Name also gar nicht. Ihr habt Kinder in der Klasse, die viel ungewöhnlichere und fremdartiger klingende Namen haben, und die ärgert ihr ja auch nicht. Es wäre schön, wenn ihr nun auch Merret in Ruhe lassen würdet.«
Silas und Olli nickten eifrig und grinsten beide von einem Ohr zum anderen.
»Na klar«, antwortete Olli, »machen wir doch. Wir haben das nur nicht gewusst, das mit dem Frieschissen.«
Er tat so, als habe er sich versprochen, und entschuldigte sich, aber Merret wusste es besser.
Als Mama und Merret ihnen den Rücken zuwandten, lachten die beiden ihnen hinterher.
»Na, das hat ja nicht gerade viel geholfen«, bemerkte Mama. »Ich muss unbedingt noch mal mit Frau Heyder sprechen.«
Sie sah ganz traurig aus. »Süße, als Papa und ich uns entschieden haben, dir und Sönke eure friesischen Namen zu geben, war das für uns eine Erinnerung an die Zeit, als wir uns auf Sylt ineinander verliebt haben. Ich hätte niemals gedacht, dass du irgendwann einmal darunter leiden musst. Vielleicht war es keine gute Idee, schließlich leben wir nicht an der Nordseeküste, wo sicher mehr Kinder solche Namen kennen. Es tut mir so leid.«
»Muss es nicht, Mama«, antwortete Merret mit Nachdruck. »Ich mag meinen Namen. Gerade, weil niemand sonst so heißt. Ich fühle mich ja auch anders als andere.«
Mama strich ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
»Du bist etwas ganz Besonderes. So selten und einzigartig wie eine Sternschnuppe am Nachthimmel. Wenn man sie sieht, darf man sich etwas wünschen, und es geht in Erfüllung.«
Auf einmal waren Merret Silas und Olli egal. In diesem Jahr würde es besser werden. Merret wechselte von der Grundschule auf eine Gesamtschule. Sie freute sich sehr darauf. Dann war sie die beiden Quälgeister los.
»Je älter du wirst, desto leichter wird es dir fallen, Ellbogen zu entwickeln und dich nicht mehr in die Ecke drücken zu lassen«, hatte Frau Heyder gesagt.
Je näher Merret ihrem Zuhause kam, desto besser konnte sie sich das vorstellen. Der Schulkummer blieb hinter ihr zurück. Merret freute sich auf den Nachmittag.
»Ich hab Hunger. Was gibt es zu essen?«
»Ich habe Pizza gemacht. Es musste schnell gehen, denn heute Nachmittag haben wir einen Termin mit Freddie beim Tierarzt.«
Familienhund Freddie bellte schon, als sie die Haustür aufschlossen. Er hüpfte wie wild um sie herum und wollte gestreichelt werden. Er war ein bildhübscher weißbrauner Beagle, den die Eltern aus dem Tierheim geholt hatten, als Merret fünf Jahre alt gewesen war. Sie konnte sich an ein Leben ohne ihn gar nicht erinnern.
Als sie noch klein war, hatte Merret viel Blödsinn mit Freddie gemacht. Zum Beispiel hatte sie ihm ein Diadem ins Haar gesteckt. Und Mama erzählte gern die Geschichte mit dem Lippenstift: »Ich wollte meinen Lipgloss benutzen, aber er war voller Hundehaare. Da habe ich Merret gefragt, woher das wohl käme. Merret sagte: Mama, Freddie wollte auch mal schöne Lippen haben.«
Freddie liebte es, wenn Merret ihn zu sich holte. Merret durfte ihn sogar als Kopfkissen benutzen. Freddie sprang auf ihr Bett, und Merret lehnte sich mit ihrem Kopf an seinen Rücken, las ein Buch und genoss den Rhythmus seines Atems und seine Wärme.
Seit einiger Zeit aber stimmte irgendetwas mit Freddie nicht. Er wirkte unbeholfen, und manchmal stieß er mit dem Kopf gegen den Tisch oder den Türrahmen.
Wenn Merret Freddie so wie jetzt herumhüpfen sah, war sie eigentlich ganz beruhigt. Es konnte doch nichts Schlimmes sein.
»Muss er wirklich zum Tierarzt, Mama? Er sieht doch ganz munter aus!«
»Ja, aber wir wollen lieber nachschauen lassen, warum er manchmal so schlecht sieht«, antwortete Merrets Mutter.
»Na gut, dann gehe ich mit, wenn du nachher zum Tierarzt musst«, sagte Merret.
Mama nickte.
»Gut, mach das. Gleich nach dem Mittagessen machen wir uns auf den Weg.«
Als Merret schon am Tisch saß und sich die selbst gemachte Pizza in den Mund stopfte, kam Sönke nach Hause.
Sönke war zwei Jahre älter als Merret und ging schon aufs Gymnasium. Sönke ärgerte Merret auch oft, aber das war anders als mit Silas und Olli. Bei Sönke fühlte sie sich nicht unterlegen, sondern konnte mit ihm streiten, dass die Fetzen flogen. Mama und Papa fanden das nicht immer schön, aber Merret genoss es.
Der Stress mit Silas und Olli kam Merret wieder in den Sinn. Um den abzubauen, war ein Streit mit ihrem Bruder gerade richtig: »Heute möchte ich an deinem Computer spielen. Er ist der einzige Computer, auf dem mein Spiel läuft.«
Sönke knallte seinen Schulrucksack in die Ecke.
»Geht’s noch? Sonst hast du keine Wünsche?«
Sein Gesicht verfärbte sich dunkel, und seine fast schwarzen Augen wurden riesengroß. Fast standen ihm die Haare zu Berge.
»Ich bin gerade aus der Schule gekommen«, fuhr er sie wütend an. »Das ist mein Computer. Ich habe gleich noch jede Menge Hausaufgaben!«
»Na, das ist doch super – wenn du Hausaufgaben hast, kannst du eh nicht Computer spielen!«
»Denkst du! Ich lass dich nicht an meinen Computer!«
»Lässt du doch! Lässt du doch!«
Merret wusste: Wenn sie kreischte, fiel ihrem Bruder keine ruhige Erwiderung mehr ein. Beide standen einander gegenüber und brüllten sich an.
»He, ihr zwei! Schluss jetzt«, rief Mama dazwischen. »Denkt ihr bei eurem Geschrei auch mal an Freddie? Gleich haben wir eh einen Tierarzttermin. Du wolltest doch mitgehen, Merret. Zum Computerspielen bleibt heute Abend noch Zeit. Jetzt wird erst mal gegessen!«
Merret atmete tief durch. Sie fühlte sich nach dem Gekreisch gleich viel besser. Sönke setzte sich und aß seine Pizza, und sie unterhielten sich, als wäre gar nichts gewesen.
Nach dem Essen machten sie sich alle zusammen auf den Weg.
Bis zur Tierarztpraxis waren es nur zehn Minuten zu Fuß. Freddie wusste schon auf halbem Weg genau, wohin es ging, und sträubte sich gegen die Leine. Merret, Sönke und Mama hatten alle Mühe, ihn zu beruhigen, bis sie schließlich an dem alten Fachwerkhaus angekommen waren.
Mama meldete Freddie an der Rezeption an. Sönke und Merret setzten sich schon mal ins Wartezimmer. Sönke hielt Freddie auf dem Schoß und streichelte ihn. Dabei warf er Merret tröstende Blicke zu. Eigentlich ist Sönke ein toller Bruder, dachte Merret.
Das Wartezimmer war voll, sie mussten eine Dreiviertelstunde warten. Dann wurden sie ins Sprechzimmer gerufen.
Die Tierärztin, Frau Doktor Fischer, kannte Freddie, seitdem er als Welpe aus dem Tierheim zu den Giessners gekommen war. Er war bisher nicht oft krank gewesen, hatte nur geimpft und entwurmt werden müssen. Er ließ die Untersuchung brav über sich ergehen, obwohl er sich sichtlich fürchtete.
Frau Doktor Fischer untersuchte Freddie eingehend. Sie maß seine Temperatur, hörte Herz und Lunge ab, nahm eine Blutprobe, schaute ihm in den Rachen und leuchtete ihm mit einer speziellen Lampe in die Augen.
Sie machte ein nachdenkliches Gesicht.
»Es sieht so aus, als ob sich auf beiden Augen ein Grauer Star bilden würde«, sagte sie. »Ich fürchte, Freddie wird blind. Er muss operiert werden. Und auch die OP ist keine Garantie für die Erhaltung seines Augenlichts.«
Oh nein, dachte Merret entsetzt. Wie schrecklich! Das ist nicht nur wie bei mir, mit meinem Pflaster und dem einen Auge, auf dem ich gucken kann. Das bedeutet, dass er gar nichts mehr sehen wird.
»Gibt es nichts, was man sonst tun kann?«, fragte Mama. Sie klang genauso entsetzt, wie Merret sich fühlte.
»Warten wir erst mal die OP ab und schauen dann weiter«, beruhigte Frau Doktor Fischer.
Derweil stand Freddie da wie ein Lamm und machte dieses Gesicht, das besagte, ob sie nicht endlich wieder nach Hause gehen konnten.
Vor dem Schlafengehen nahm Merret Freddie ganz fest in die Arme.
»Bitte, werde nicht blind«, flüsterte sie in sein weiches Fell.
Freddie hob den Kopf und schnupperte an ihrem Ohr, dann pustete er schnaufend hinein. Es kitzelte, und Merret musste lachen. Es war so, als ob Freddie sie trösten wollte.
In der Nacht konnte Merret lange nicht einschlafen. Der Beagle ging ihr nicht aus dem Kopf. Sie war gleichzeitig traurig und zornig, weil sie überhaupt nichts tun konnte.
Auf einmal wehte die Gardine vor dem Fenster ganz wild in die Höhe, so wie Merret es in der Schule auch schon beobachtet hatte.
Seltsam – dabei war es doch gar nicht windig?
Sie stand auf, um das Fenster zu schließen. Aber es war überhaupt nicht geöffnet.
Sie sprang zitternd ins Bett, machte ganz fest die Augen zu und schlief vor lauter Angst sofort ein.
2. Der Mann im lila Umhang
Eine Woche später war Freddies Operation. Am Abend vorher durfte er schon nichts mehr fressen. Das war schlimm. Immer wieder lief er zum Napf und schaute hinein, und dann kam er zu einem Familienmitglied nach dem anderen, um kundzutun, dass sein Magen leer war. Er verstand nicht, warum seine Schüssel nicht wie sonst aufgefüllt wurde, wenn die Familie mit dem Abendbrot fertig war. Er setzte sich vor Merret hin und sah sie kummervoll an. Schließlich hatte er eine Idee: Er hielt ihr sein Pfötchen hin.
»Wenn du mir jetzt nichts gibst, weiß ich es auch nicht!«, sagte sein Blick. Aber Merret konnte nichts anderes tun, als ihm den Kopf zu streicheln.
»Streicheln macht den Hundemagen nicht voll, nicht wahr, Freddie?«, fragte Merrets Papa. Freddie schien ihm recht zu geben und rollte sich schließlich resigniert auf seiner Decke zusammen.
Als Papa an diesem Abend mit Merret die Mathehausaufgaben machte, merkte sie, dass er auch besorgt um Freddie war.
Daran erkannte Merret erst recht, wie bedrohlich Freddies Zustand war.
In der Schule konnte sie sich kaum konzentrieren. Mama und Papa waren mit Freddie nach Duisburg in eine Tierklinik gefahren, wo die Operation gemacht werden sollte.
Merret wurde von Thérèse, der Mutter ihrer Freundin Anne, von der Schule abgeholt. Mama und Papa waren gerade nach Hause gekommen. Nur Freddie war noch in Duisburg.
»Er muss sich noch von der Narkose erholen und kann erst am nächsten Tag wieder nach Hause kommen«, erklärte ihr Mama. »Die OP war schwierig, und es ist nicht sicher, ob Freddie geheilt werden konnte.«
Es war Schlafenszeit. Merret durfte noch etwas lesen. Sie war schon im Schlafanzug und lag im Bett. Sie versuchte, sich auf ihr Buch zu konzentrieren. Aber ihre Gedanken wanderten. Zu Freddie. Und von da aus geradewegs zu der Sache mit dem fliegenden Vorhang. Die Geschichte fiel ihr dummerweise immer abends wieder ein, mit Vorliebe, wenn sie schlafen wollte.
Sie hatte Mama und Papa davon erzählt, und beide waren überzeugt, sie habe nur geträumt.
Aber heute Abend war ihr ganz gruselig zumute. Sie ging ins Elternschlafzimmer und bat Mama um Hilfe.
»Kannst du noch mal schauen, ob das Fenster auch geschlossen ist?«
Mama nickte und schob den Vorhang beiseite. Draußen war es schon ganz dunkel, Wolken zogen vor dem Mond und den Sternen.
»Es ist wieder windig«, murmelte Merret unbehaglich.
Mama öffnete das Fenster und schloss es wieder.
»Es ist jetzt ganz fest zu, Liebes«, sagte sie. »Du musst dir keine Sorgen machen. Bestimmt hat an diesem einen Tag nur der Wind darauf gestanden. Und er hat durch die Ritzen geblasen.«
Merret war ziemlich sicher, dass das nicht so gewesen war. Und das machte die Sache nicht besser.
Mama nahm sie in den Arm und drückte sie.
»Irgendetwas ganz Normales hat den Vorhang bewegt«, erklärte sie mit Nachdruck. »Alles ist gut. Du wirst ganz tief und fest schlafen. Gute Nacht, meine Maus.«
Merret nickte, obwohl ihr Herz stark klopfte.
»Gute Nacht, Mama.«
Sie legte das Buch weg und machte das Licht aus. An Schlaf war nicht zu denken. Sie schaute immer wieder zum Fenster. Durch den Vorhang schimmerte das Mondlicht hindurch. Merrets Herz klopfte jetzt ganz laut, und ihre Hände waren feucht vor Angst.
Aber nicht das Geringste geschah. Der Vorhang hing ganz still herunter. Irgendwann schlief Merret ein.
Als Merret am anderen Tag aus der Schule kam, war Freddie wieder da.
Aber diesmal bellte er nicht, als sie die Treppe hinauf stürmte. Er lag ganz still im Esszimmer vor dem Fenster auf seiner Decke und hob noch nicht einmal den Kopf, als Merret hereinkam. Sein rechtes Auge war unter einem dicken Verband verborgen.
Merret griff in die Leckerchentüte und hielt ihm einen seiner Lieblingscracker hin. Er schnupperte lustlos daran und ließ den Kopf wieder sinken, ohne ihn zu fressen.
Merret kämpfte mit den Tränen.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte Mama tröstend, die hereingekommen war. »Das sind die Nachwirkungen der Narkose. Bald wird es ihm wieder besser gehen, und dann wird er auch wieder fressen.«
»Und was ist jetzt mit seinem Auge?«, wollte Merret wissen. Ihre Stimme zitterte, und sie wischte sich verstohlen die Tränen aus den Augen.
»Das wissen wir noch nicht genau«, antwortete Mama.
Beim Abendessen waren beide Eltern sehr ernst. Merret verkniff es sich deshalb, mit Sönke zu streiten. Sie wusste, dass die Eltern etwas Wichtiges mitzuteilen hatten.
Schließlich sagte Papa: »Kinder, Freddies Auge ist zwar operiert, aber es ist nicht sicher, ob Freddie damit wieder wird sehen können. Normalerweise würde man nun das andere Auge operieren. Leider hat sich herausgestellt, dass Freddie ein Herzproblem hat, und deswegen hat er die Narkose so schlecht vertragen. Und das bedeutet, dass man ihm keine weitere OP zumuten kann. Auf dem linken Auge ist er tatsächlich ganz blind.«
Merret mochte nichts mehr essen. Sie schob den Teller weg. Sönke ließ den Kopf hängen.
»Und was machen wir jetzt?«, wollte er wissen.
»Man kann nichts machen«, antwortete Mama sanft. »Bei Hunden ist Blindheit nicht so schlimm, da sie sich hauptsächlich mit der Nase orientieren. Wir müssen gut auf ihn aufpassen, damit er sich nicht stößt, dann wird es schon gehen.«
Merret stand so heftig auf, dass der Stuhl nach hinten umkippte. Sie lief wortlos in ihr Zimmer und knallte die Tür zu.
Sie warf sich aufs Bett und trommelte mit den Fäusten aufs Kopfkissen.
»Gemein!«, schrie sie in die Matratze. »Das ist gemein! So gemein! Wer lässt es zu, dass meinem Hund so etwas passiert?«
Die Tränen kullerten nur so über ihre Wangen. Sie warf ihre Kuscheltiere quer durch das Zimmer und stampfte mit den Füßen so fest gegen das Fußende des Bettes, dass ihr die Zehen wehtaten.
Eine Bewegung ließ sie aufsehen.
Der Vorhang am Fenster bauschte sich heftig. Eine Art Welle rollte immer wieder von oben nach unten durch. Und das Fenster dahinter war eindeutig geschlossen.
Merret schlug die Hände vors Gesicht. Vor Schreck brachte sie keinen Ton heraus. Sie hätte sich gern die Decke über das Gesicht gezogen, aber sie traute sich nicht.
Es war ganz still.
Endlich wagte sie es, die Hände fortzunehmen.
Der Vorhang hing wieder herunter, aber er war so seltsam ausgebeult. So, als ob dahinter jemand stünde.
»Wer ist da?«, rief Merret entsetzt.
Der Vorhang bewegte sich ein wenig.
Merret wurde wieder wütend. Ganz egal, wer das war: Niemand hatte ein Recht, in ihr Zimmer einzudringen, sich hinter dem Vorhang zu verstecken und sie zu beobachten, während sie weinte!
Sie sprang wutschnaubend auf und riss den Vorhang zur Seite.
Dahinter stand ein junger Mann.
Er war dünn, noch dünner als Merret, mit genauso dünnen Armen, und sehr groß. Er hatte ein freundliches Gesicht, ein bisschen mausartig mit einer spitzen Nase und dunklen Kulleraugen. Das sah lustig aus. Nicht die Bohne zum Fürchten.
Obwohl er jung aussah – vielleicht so um die zwanzig –, waren die Haare des Mannes schneeweiß. Sie leuchteten regelrecht. Das war nicht das einzig Seltsame an ihm: Seine Konturen waren von demselben weißen Leuchten umflossen wie seine Haare.
Er trug ziemlich komische Kleidung. Schwarze hohe Lederstiefel und eine schmal geschnittene schwarze Samthose, dazu ein sonnengelbes Leinenhemd und darüber einen dunkel lilafarbenen Umhang, der am Hals mit einer silbernen Schnalle zusammengehalten wurde.
Merret hatte überhaupt keine Angst vor ihm. Zum einen, weil er so freundlich und mausig aussah. Zum anderen, weil die ganze Situation so unwirklich war.
Jetzt muss ich irgendwas sagen, dachte Merret. Aber ihr fiel nichts ein.
Schließlich plapperte sie einfach drauflos.
»Was machst du hier?«
Der Mann sah sie mit seinen dunklen Kulleraugen an. Er schaute so niedlich mäusespitzig dabei aus.
»Tolle Frage«, sagte der Mann. Er hatte auch eine nette Stimme, so ein bisschen piepsig, als ob er im Stimmbruch wäre.
»Das war jetzt ironisch, oder?«, erkundigte sich Merret. »Tut mir leid. Mir ist nichts Besseres eingefallen – so auf die Schnelle.«
»Du hättest zum Beispiel fragen können, wer ich bin«, sagte der Mann beleidigt. Seine Nase wurde ein bisschen spitzer.