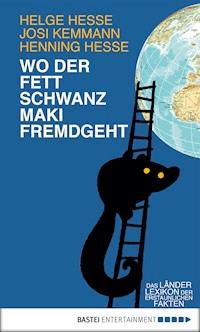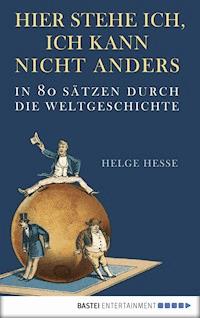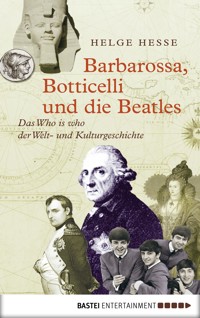Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In unserem Alltag spielen wirtschaftliche Zusammenhänge eine sehr große Rolle - doch wieviel verstehen wir davon? Wo fängt die Geschichte Ökonomischen Denkens eigentlich an und was gehört alles dazu? Wer sind die wichtigsten Denker und welche fast vergessenen geben neue Anregungen? Welche Theorien beeinflussen uns heute? Das Buch gibt einen Überblick über einflussreiche Ökonomen und ihre Ideen. Von der Antike bis zur Gegenwart beleuchtet es die Geschichte einzelner Denkschulen und berichtet von Kontroversen. Dabei wirft es Schlaglichter nicht nur auf die wichtigsten Ideen, Wendepunkte und Denker, sondern geht auch auf Außenseiter ein und zeigt damit die Vielfalt und Tiefe der Wissenschaft vom wirtschaftlichen Handeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtImpressumVorwortDer AutorEinleitung 1 Der Mensch ist Mensch, weil er wirtschaftet und kooperiert – vom Ursprung des Denkens und der Kultur2 Das Geld der Griechen und die Güter der Römer – das eigentliche ökonomische Denken beginnt in der Antike3 Was hat Gott mit dem Geld gewollt? – ökonomische Positionen der Scholastik4 Das kleine und das große Ganze – das Handwerk des Kaufmanns und die Geburt von Utopien in der Neuzeit5 Der Staat als Unternehmer – Merkantilismus und Kameralismus6 Kreise und Bienen – die Physiokratie und andere Ideen am Übergang zum Denken im System7 Das Wirtschaften als System – Adam Smith und der Beginn der Klassischen Schule8 Zwischen Skepsis und Optimismus – die Debatten der Klassischen Schule9 Vom Inhalt und den Methoden – die Ökonomik findet ihre Wege10 Arbeit und Gesellschaft – Marx und die Varianten des Sozialismus11 Außergewöhnliche Blickwinkel – von Bodenreformern und Anarchisten12 Vom Einfluss der Gesellschaft und der Geschichte – die Historische Schule13 Der Nutzengedanke bestimmt den Markt – die Grenznutzenschule14 Ob und wie Sozialismus funktioniert – Debatten über Theorie und Umsetzung15 Das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage – die neoklassische Schule16 Wenn der Markt in der Krise ist – der Keynesianismus17 Von der Freiheit des Marktes und des Menschen – der Neoliberalismus und seine Facetten18 Das Unternehmen, die Arbeit und das Wachstum – von Schumpeter, Samuelson, Antworten auf Keynes und dem Nobelpreis19 Über Wechselwirkungen von Wirtschaft und Gesellschaft – Wirtschaftsgeschichte, Soziologie und Entwicklungstheorien20 Das Wesen und die Bedeutung der Institutionen – alte und Neue Institutionenökonomik21 Verhalten und Strategien – Finanzmarkttheorie, Spieltheorie, experimentelle Ökonomik, Glücks- und Verhaltensökonomik22 Globalisierung und Digitalisierung – Ansätze und Anregungen für das 21. JahrhundertSchlusswort und AusblickLiteratur und weiterführende LiteraturStichwortverzeichnisHinweis zum Urheberrecht
Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH, Stuttgart
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2018 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht [email protected]
Umschlagentwurf: Goldener Westen, Berlin Umschlaggestaltung: Kienle gestaltet, Stuttgart (Bildnachweis: © DrAfter123, iStock)Lektorat: Bernd Marquard, StuttgartSatz: Claudia Wild, Konstanz
September 2018
Schäffer-Poeschel Verlag StuttgartEin Unternehmen der Haufe Group
Vorwort
Von John Maynard Keynes stammt die berühmte Aussage: „Die Ideen der Ökonomen und Philosophen, seien sie richtig oder falsch, sind mächtiger, als man im Allgemeinen glaubt. Um die Wahrheit zu sagen, es gibt nichts anderes, das die Welt beherrscht.“
Nehmen wir an, Keynes hatte auch nur ansatzweise recht, dann ist es für unser Bild von der Welt sicher nicht schlecht, ein wenig über diese Ideen und ihre Denker zu wissen, auch einen Überblick darüber zu gewinnen, wann und wie ihre Ideen entstanden und wie sie auf Wissenschaft und Gesellschaft wirkten und noch immer wirken.[2]
Während wir uns immer wieder zur Philosophie hingezogen fühlen, sind dagegen Fragen zu Geld, Arbeit und Wirtschaft für wenige ein verlockendes Thema. Sie haben mit solch lästigen Dingen zu tun wie abhängiger Arbeit, Zwängen, Konkurrenz, Steuererklärung, Altersvorsorge, Versicherungen. Daher befassen sich auch viele Gebildete und Intellektuelle, die sich in Philosophie, Kunst, Musik und Geschichte hervorragend auskennen, nur selten vertiefend mit ökonomischen Fragen. Ihr Wissen auf diesem Feld ist daher vergleichsweise häufig erschütternd gering.
Hinzu kommt: Zu oft widersprechen sich Ökonomen, die in der breiten Öffentlichkeit zu Wort kommen, weshalb manche in der Wissenschaft von der Wirtschaft im Grunde keine richtige Wissenschaft sehen, sondern eher eine Ansammlung von Techniken und Ordnungssystemen, die letztlich im Dienste böser Kapitalisten stehen. Nicht wenige nicken da rasch und gerne beifällig. Allein diese Verdikte verkennen die Komplexität dieser Wissenschaft und auch die Intentionen derer, die sich tiefgreifend damit auseinandersetzen.
Doch wirtschaftliches Denken bestimmt nicht nur unseren Alltag, sondern – ob wir wollen oder nicht – unser gesamtes Leben. Gerade zu Beginn des 21. Jahrhunderts, einer Epoche gewaltiger politischer und technologischer Umbrüche, stehen ökonomische Fragen im Mittelpunkt vieler Diskurse. Nicht nur Wirtschaftsordnungen werden hinterfragt, sondern die Wirtschaftswissenschaft selbst. Was ist ihre Aufgabe? Was leistet sie? Was kann sie leisten?[3]
So zentral die vielfältigen Forschungsgebiete der Wirtschaftswissenschaft in der heutigen gesellschaftlichen Diskussion sind, so wenig weiß man im Allgemeinen außerhalb des Fachs über die Vielfalt des ökonomischen Denkens, erst recht nicht über seine Entwicklung und darüber, wie vielfältig und reich an Ideen es ist. Selbst vielen ökonomisch Ausgebildeten fehlt oft ein Überblick, der auch das Hinausgreifen in andere Wissenschaften einschließt. Denn wirtschaftliches Denken greift auch hinein in Soziologie, Mathematik, Philosophie und viele andere Disziplinen.
Es gibt zahlreiche Bücher über die Geschichte des ökonomischen Denkens. Dieses bewusst sehr knapp gehaltene Buch versucht, Studenten, Wissenschaftlern jeglicher Fächer, die mit Ökonomik zu tun haben, letztlich aber allen Interessierten einen seriösen Überblick zu geben. Es will Ideen, Denker, Schulen und Kontroversen der ökonomischen Wissenschaft ins Bild setzen und nicht zuletzt helfen, Ansätze für weiteres Lesen und weitere Beschäftigung mit dem Thema zu geben.
Ich hoffe zu zeigen, dass Ökonomie als Wissenschaft letztlich nicht die trockene Lehre vom Produzieren, Handeln, Güterverteilen und Geldverdienen ist und dass sie zahlreiche Felder des menschlichen Handelns und Denkens erfasst und durchdringt. Denn Ökonomen und in zunehmendem Maße Ökonominnen sind nicht nur Experten, die wirtschaftliche Entwicklungen voraussagen, die dann nicht eintreffen. Sie sind vielmehr kluge Köpfe, deren Denken und Forschen sehr viel mit Philosophie und vielen anderen Wissenschaften gemein hat, vor allem aber sind sie, wie Keynes es ansprach, Menschen, die Ideen entwickeln, die unser Leben prägen.[4]
Mein Dank für ihre Hilfe bei diesem Buch gilt Michael Tochtermann, Frank Katzenmayer, Bernd Marquard, Dr. Nils Hesse und meiner Frau Josi Hesse. Alle Fehler im Buch sind selbstverständlich meine.
Düsseldorf, im Juli 2018
Helge Hesse
Der Autor
Helge Hesse studierte Betriebswirtschaft und Philosophie und arbeitete im Verlagsmanagement und als strategischer Marketingberater. Seit einigen Jahren veröffentlicht er Bücher zu kulturellen, ökonomischen, historischen und philosophischen Themen. Viele davon, wie der Bestseller „Hier stehe ich, ich kann nicht anders – In 85 Sätzen durch die Weltgeschichte“, wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Mit Wirtschaftsthemen befasste sich Helge Hesse unter anderem in seinem „Personenlexikon der Wirtschaftsgeschichte“ und in mehreren Artikelserien im Handelsblatt. Auch verfasste er mehrere Texte zu bedeutenden Werken der Wirtschaftstheorie, so auch in Kindlers Literaturlexikon.
Einleitung
Die Wirtschaftswissenschaft beziehungsweise Ökonomik ist erst spät als Nachzügler unter den Wissenschaften entstanden. Von der ersten Stunde war unzweifelhaft, dass in diesem neuen Wissenschaftsgebiet der Mensch im Mittelpunkt steht, denn ohne Mensch keine Wirtschaft: Wirtschaften und Handeln entspringen der menschlichen Natur. Oder wie Adam Smith hervorhob: Die Neigung zum Tausch finde sich bei allen Lebewesen der Natur so eindeutig ausgeprägt nur beim Menschen.[5]
Was ihr Selbstverständnis betrifft, bewegt sich die Wirtschaftswissenschaft seit jeher zwischen zwei Polen. Da ist zum einen der Anspruch, allgemeingültige Marktmechanismen zu erfassen, festzuhalten und instrumentell für die Akteure der Wirtschaft nutzbar zu machen. Hier wird die Wirtschaftswissenschaft tendenziell mathematisch und hier folgt sie auch Francis Bacons zu Beginn der Neuzeit formuliertem Credo, dass die Wissenschaft dem Menschen vor allem Nutzen bringen sollte. Mathematische Modelle haben nichtsdestoweniger zu außerordentlichen Erkenntnissen über so verschiedene ökonomische Mechanismen wie die von Märkten, Preisen oder des Geldes geführt. Auch das Modell des vielzitierten und umstrittenen, rational ökonomisch handelnden Homo oeconomicus als Prämisse, um reine Mechanismen wirtschaftlichen Agierens zu erforschen, hat viel zum Wissen über wirtschaftliches Handeln beigetragen.
Auf der anderen Seite steht die eher soziologisch orientierte Methode. Sie versucht Geschichte, Philosophie und Psychologie zu nutzen, um wirtschaftliches Handeln zu erklären und anhand von Erkenntnissen zu Handlungsmodellen zu kommen. Einige Vertreter dieses Ansatzes gehen so weit zu behaupten, es gebe keine allgemeingültigen wirtschaftlichen Mechanismen. Diese Sichtweisen sind eng verbunden mit dem Wunsch, das Wesen des Wirtschaftens zu durchdringen, um Abläufe in der Gesellschaft zu ergründen und ökonomische und gesellschaftliche Aufgaben daraus abzuleiten. Diese eher philosophisch-soziologischen Ansätze sind sehr rasch mit normativen Ansätzen verbunden. Sie führen zu der Frage, was wir beim Wirtschaften anstreben sollen und welche Gesellschaft eine gute Gesellschaft ist.[6]
Im Grunde ist die Wirtschaftswissenschaft auch der Prototyp einer Wissenschaft der Moderne. Es ist daher nur schlüssig, dass sie als eigentliche Wissenschaft erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, zur Blütezeit der Aufklärung entstand. Und vielleicht ist es gerade die Wirtschaftswissenschaft, in der sich beispielhaft die schwindelerregenden Umbrüche zu Beginn des 21. Jahrhunderts spiegeln.
Zweifellos steht keine Wissenschaft nur für sich. Jede, auch die vermeintlich objektivste wie die Physik oder die Mathematik, stößt an Grenzen des Verstehens durch den Menschen. Und spätestens dann wird sie zum Gegenstand der Philosophie.
Die Ökonomik ist eine Wissenschaft der Dynamik des Wandels der Gesellschaft, des Fortschritts, der Veränderungen durch neue Technologien, der Unberechenbarkeit der Zeitläufte. Und daher verändert sich ihre Expertise zuweilen drastisch, ein Umstand, der Ökonomen allzu oft angekreidet wird. Tatsächlich sind sich Ökonomen so gut wie nie einig. Keine Theorie eines ökonomischen Denkers ist ohne Widerspruch geblieben. Der Philosophie, der es ebenso geht, verzeiht man es, der Ökonomik nicht, vielleicht oder auch gerade, weil sie allzu oft den Anspruch erhebt, zukünftige Entwicklungen vorhersehen zu können. Bei einem Philosophen sagt man: „Das war eben sein Blick auf die Welt“, beim Ökonomen sagt man „Er hat sich verrechnet“, oder wie Winston Churchill gerne zitiert wird: „Wenn ich drei Ökonomen frage, dann bekomme ich vier Meinungen. Zwei davon von Professor Keynes.“ Aber so ist das in einer Wissenschaft, die anhand der Zeitläufte Paradigmenwechseln unterliegt.[7]
Gerade Umbruchzeiten führen zu Neubewertungen, zu neuen Sichtweisen. In der Ökonomik gilt es, die Sicht freier zu machen, es gilt auch, sich von alten, ideologisch verengten Bewertungen zu lösen und neu auf Ideen großer Denker zu blicken und zu fragen, welche ihrer Anregungen zu Lösungsansätzen der Zukunft führen könnten. Friedrich Engels ließ einst schon wissen, Karl Marx habe einmal gesagt „Alles, was ich weiß ist, dass ich kein Marxist bin.“ Oder ein Gedankenspiel: Wäre Adam Smith, würde er heute leben, ein Anhänger des ungezügelten Kapitalismus? Wohl nicht. Hätte Marx den Leninismus oder Maoismus gutgeheißen? Wohl kaum.
1 Der Mensch ist Mensch, weil er wirtschaftet und kooperiert – vom Ursprung des Denkens und der Kultur
„Jeder lebt davon, dass er etwas verkauft.“
Robert Louis Stevenson
„Aller Anfang ist schwer, am schwersten der Anfang der Wirtschaft.“[8]
Johann Wolfgang von Goethe
Vermutlich entwickelten schon die ersten modernen Menschen, die Homo sapiens, Überlegungen zu dem, was wir tun und damit auch, was das Wirtschaften betrifft. Bereits vor etwa 160.000 Jahren – so alt sind die ältesten Funde – streiften kleine Gruppen von Männern, Frauen, Alten und Kindern umher und versuchten zuallererst, ihr eigenes Überleben und das ihrer Sippe zu sichern und zu gestalten. Die Gruppen mussten sich organisieren. Sie teilten ihre Kräfte ein, sie mussten ihre Versorgung planen. Sie wirtschafteten.
Wie schwer das Leben auch war, zuweilen gelang es den Menschen, sich auch aufgrund guten Wirtschaftens Freiräume im Kampf um das Überleben zu schaffen. Dann konnten sie schöpferisch sein, dachten nach, probierten aus, meist aus dem reinen Bedürfnis, Lösungen für die Anforderungen des Lebens und Überlebens zu finden und aus dem Antrieb, ihr Leben zu verbessern. So begannen sie, Symbole zu erschaffen. Wollten sie Spuren hinterlassen? Wollten sie anderen Menschen Hinweise geben? Sie ritzten Zeichen in Felsen. Sicherlich wurde auf diese Weise zum ersten Mal gezählt, Mengen festgehalten. Bis zur Schrift aber war es noch weit. Doch Kunst entstand. Die ältesten gefundenen Zeugnisse, wie die kleine Frauenskulptur der Venus vom Hohlefels, sind bis zu 40.000 Jahre alt und stammen damit aus der Zeit, in der sich beim Menschen nach und nach auch die Sprache ausgebildet hat.
Was der Anfang der Sprache war, das vermuten wir nur. Sie entstand vielleicht aus Rufen, um sich abzustimmen, aus immer feiner werdenden Lautzeichen, verbunden aber auch womöglich mit den Zusammenhalt der Gruppe fördernden musikalischen Artikulationen. Bei Anbruch der Nacht saß die Sippe um das Lagerfeuer, besprach, was als nächstes und vielleicht als übernächstes zu tun sei, und man erzählte sich Geschichten von der Jagd und berichtete von Ereignissen beim Sammeln von Holz und Beeren im Wald. Gerade in den erlebten Abenteuern suchten die Menschen nach Antworten auf ihr Dasein. Vorstellungen, gewisse Theorien über alle möglichen Dinge des Lebens hatten sie sicher auch schon, nannten diese aber wohl nicht so.[9]
Das Denken richtete sich vornehmlich auf das Praktische des Alltags. Gingen Überlegungen darüber hinaus, stießen die Menschen auch auf Fragen zu Zusammenhängen und Hintergründen des Seins. Diese erklärten sie sich, sobald sie an die Grenzen ihres Wissens und Verstehens stießen, häufig mit dem Handeln von Geistern und Göttern.
Als die Menschen ab etwa 12.000 Jahren vor unserer Zeit nach und nach lernten, Pflanzen anzubauen und Tiere zu ihrem Nutzen an sich zu binden, hörten sie nach und nach auf, herumzuziehen und wurden sesshaft. Dieser Prozess, der in seinem Zeitablauf eher ein evolutionärer, in seiner Bedeutung im Vergleich zu der Weite der Zeit und für das Dasein des Menschen aber ein revolutionärer war und daher im Allgemeinen die neolithische Revolution genannt wird, brachte auch eine völlig neue Organisation des Alltagslebens mit sich. Die Menschen mussten für Aussaat und Ernte das Jahr nach den Jahreszeiten planen, begannen Kalender anzufertigen, sie lernten Vorräte anzulegen, sie fingen an, Haushalte zu führen.[10]
Siedlungen entstanden und wuchsen, einhergehend mit sich ausdehnendem Handel, über Generationen zu Städten. Überhaupt war der Handel eine eng mit dem Homo sapiens verbundene Tätigkeit. Schon sehr früh ist der Transport von Muschelschalen und Feuerstein über große Entfernungen nachweisbar. Jedoch bei dem lange (etwa 130.000 Jahre) neben dem Homo sapiens lebenden Neandertaler, der sich zum Teil auch mit diesem mischte und vor etwa 30.000 Jahren ausstarb, war eine solche Tätigkeit bisher nicht nachzuweisen.
Die Neigung, Geschäfte zu machen, befand aber Adam Smith, sei „allen Menschen gemeinsam, und man findet sie nirgends in der Tierwelt ... Niemand hat je erlebt, dass ein Hund mit einem anderen einen Knochen redlich und mit Bedacht gegen einen anderen Knochen ausgetauscht hätte …“. So ging die Ausdehnung des Handels einher mit den Veränderungen vom Nomadendasein zur Sesshaftigkeit und der Ausbildung komplexerer gesellschaftlicher Strukturen. Während man immer weniger Menschen brauchte, um die reine Ernährung sicherzustellen, brauchte man immer mehr Menschen, um den sich ausweitenden Handel und die immer komplizierteren Verwaltungsaufgaben zu bewältigen. Immer mehr Wissen wurde für einzelne Aufgabenbereiche benötigt. Berufe entstanden. Dies alles geschah in noch stark hierarchischen Gesellschaften, in denen aufgrund der wachsenden Komplexität über die Jahrtausende aus Sippenführern Häuptlinge und schließlich Könige wurden, aus Schamanen und Weisen wurden Priester. Über die Zeit entwickelten sich erste Hochkulturen, in denen Macht stets mit dem Glauben zusammenspielte. Dieser manifestierte sich in den allmählich entstehenden komplexen Religionen, die frühere Kulte und Mystizismus in sich vereinten, wie zunächst dem Buddhismus und dem Judentum.[11]
Das Wissen um die Abhängigkeit von der Natur, vor allem aber um die Endlichkeit des Daseins, hatte die Menschen schon immer über die Frage grübeln lassen, welche Mächte außerhalb ihrer Erkenntnisfähigkeit walteten. War es die Macht der Sterne, der Sonne? Waren es Götter? Sie versuchten, in Kontakt mit diesen Mächten zu treten und sie sich gewogen zu machen. Hatten sie zunächst Bilder auf Höhlenwände gemalt, bauten sie nun Tempel. Priester hatten nach wie vor die Aufgabe, mit Ritualen die Zwiesprache mit den Mächten aufrechtzuerhalten, von denen die Menschen glaubten, dass sie ihre Lebenswelt bestimmten. Soweit es den Menschen gelang, versuchten sie aber auch immer selbst, Antworten auf ihre Fragen zu finden. Zunächst aber schienen die Gesetze des Lebens und der Natur nicht schlüssig und logisch zu durchdringen zu sein, vieles schien sogar auf ewig Geheimnis der Götter zu bleiben. Aber das Leben selbst, den Alltag wussten die Menschen von Generation zu Generation zu verbessern.
In den ersten Hochkulturen, beginnend um das 4. Jahrtausend v. Chr. in Mesopotamien und im Pharaonenreich in Ägypten, entstanden erste große Städte und damit wuchsen auch die Anforderungen an die Organisation und die Verwaltung des immer komplexer werdenden Lebens von vielen Menschen auf engem Raum. Es entstanden Wirtschaftskreisläufe um Märkte, um Tempel und um Herrscherpaläste. Bei der Vorratshaltung und im Handel wurden Zeichen auf Gefäße und Tafeln zum Nachhalten von Mengen geritzt oder gemalt. Daraus entstand eine erste Art von Buchführung und schließlich auch die Schrift, wie etwa die Keilschrift in Mesopotamien.[12]
Wesentliche Faktoren der Wirtschaft waren die Landwirtschaft, das Handwerk und der Handel. Das Bedürfnis, in diesen wichtigen Funktionen für die Gesellschaft Sicherheit zu verankern, führte zu Regeln und Gesetzen wie dem berühmten Codex Hammurabi von etwa 1750 v. Chr., unter dessen Bestimmungen erste Handelsgesetze zu erkennen sind. Den Zins kannte die Menschheit schon vor dem Geld, so im 3. Jahrtausend v. Chr. bereits die Sumerer. Sie kannten auch den Zinseszins. Der Codex Hammurabi erlaubte den Zins. Wer ihn nicht zahlte, dem drohte Schuldknechtschaft.
Schon seit Jahrtausenden hatten Menschen bestimmte Güter als Vorformen des Geldes genutzt. Silber, Gold, Muscheln, Getreide und Salz hatten sich als sogenannte Zwischentauschmittel oder „Warengeld“ bewährt. Sie waren begehrt und konnten immer vergleichsweise leicht weiter getauscht werden. Gerade Silber und Gold nutzte man gerne. Sie wurden nach Gewicht gehandelt. Mit Gold und Silber konnte man, anders als in der Tauschwirtschaft, in der jeder der Beteiligten genau das Gut haben musste, das der Tauschpartner begehrte, jedes Gut erwerben, das angeboten wurde. Einen neuen und entscheidenden Schritt der Entwicklung des Wirtschaftens machte die Menschheit dann mit der Erfindung des Geldes.[13]
2 Das Geld der Griechen und die Güter der Römer – das eigentliche ökonomische Denken beginnt in der Antike
„Das Geld macht also wie ein Maß die Dinge messbar und stellt eine Gleichheit her. Denn ohne Tausch wäre keine Gemeinschaft möglich, und kein Tausch ohne Gleichheit und keine Gleichheit ohne Kommensurabilität.“
Aristoteles
„Von allen den Erwerbszweigen aber, aus denen irgendein Gewinn gezogen wird, ist nichts besser als Ackerbau, nichts einträglicher, nichts angenehmer, nichts eines Menschen, nichts eines Freien würdiger.“
Marcus Tullius Cicero
Den Lydern sprechen wir im Allgemeinen das Verdienst zu, die Münze und damit das eigentliche Geld erfunden zu haben. Lydien war ein Königreich in Kleinasien auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Dort gab es Vorkommen von Elektron, einer natürlichen Legierung aus Gold und Silber. Zunächst nahmen die Lyder abgewogene kleine Klumpen und nutzten sie als Zahlungsmittel. Dann, zwischen 650 und 600 v. Chr., prägten sie Löwen- oder Bullenköpfe ein, um damit ein Garantiezeichen ihrer Herkunft und Güte zu geben. Das erste „Geld“ konnte genutzt werden, um nun Waren weit freier zu tauschen als bisher.[14]
Die Griechen prägten etwa ein Jahrhundert später eine Münze namens Stater (dt. derjenige, der wiegt). Mit dem sprichwörtlich gewordenen Obolus kam eine Untereinheit hinzu. 6 Oboloi waren 1 Drachme, 2 Drachmen 1 Stater. Die Tetradrachme aus 14 bis 17 Gramm Silber wurde schließlich zur dominierenden Münze. Die Prägung von Herrscherporträts setzte sich erst mit Alexander dem Großen und den Diadochenherrschern um 300 v. Chr. durch.
Was das ökonomische Denken betrifft, so sind uns aus dieser Zeit nur Dokumente bekannt, mit denen lückenhaft das eine oder andere Thema behandelt wird, aber keine umfassende Sicht auf den umfangreichen Gegenstand zu erkennen ist. Der Dichter Aristophanes beschrieb in seiner vermutlich 405 v. Chr. uraufgeführten Komödie Die Frösche ein Phänomen, das später als Greshamsches Gesetz in die Geschichte des Wirtschaftsdenkens eingehen sollte: das Verdrängen guten Geldes durch schlechtes. Athen hatte seinerzeit minderwertiges Notgeld aus Kupfer ausgegeben und Aristophanes ließ in seinem Stück den Chorführer berichten, das Kupfergeld verdränge die Silbermünzen, die nun gehortet würden.
Der Handel und die Wirtschaft in der griechischen Hemisphäre der Antike waren lediglich in Athen komplexer entwickelt, was heißt, dass sich hier ein Fernhandel entwickelte, der über die griechischen Küsten hinausging und spezialisierte Kaufleute und Geldverleiher, die aber längst noch nicht Bankiers genannt werden konnten, Schiffsunternehmungen finanzierten. Auch in Athen wie im übrigen antiken Griechenland war es vor allem der Landbau vor der Stadt, der die produzierende Wirtschaft im Wesentlichen bestimmte. Meist lebten Familien und Sippen auf ihren Höfen von dem, was sie selbst produzierten, doch es gab auch Großbesitzer, die auf Feldern mehrere Dutzend Sklaven für sich arbeiten ließen. Überhaupt fußte der wesentliche Anteil an der Wirtschaftsleistung auf Sklavenarbeit. So schufteten beispielsweise in den Minen von Laureion zeitweise 20.000 Sklaven.[15]
Da Wirtschaft bei den Griechen der Antike mehr oder minder etwas war, das von Sklaven erledigt wurde, Menschen also, über deren Rolle man glaubte, sich wenig Gedanken machen zu müssen, waren ökonomische Überlegungen auch eher dem Haushalt, dem Hof gewidmet und der Organisation und dem Auskommen des Gemeinwesens der freien Bürger, der Polis. So ist es kein Wunder, dass der Begriff Ökonomie (sinngemäß „Gesetz vom Umgang mit Haus und Besitz“) zusammengesetzt ist aus den griechischen Wörtern „Oikos“ für „Haus“, „Besitz“, und „Nomos“ für „Gesetz“.
Die Schrift Oikonomikos, um 390 bis 355 verfasst von Xenophon (ca. 430 bis ca. 345 v. Chr.), der wie Platon ein Schüler von Sokrates war, befasste sich in der damals üblichen Darstellungsform des Dialogs mit dieser Hauswirtschaft. Das Werk enthält Empfehlungen für das Hauswesen („Oikos“), gibt Ratschläge zur Bewirtschaftung der Felder, der Viehhaltung und -zucht, aber auch für den Handel und Grundstückskauf und -verkauf. Schon Xenophon empfahl Arbeitsteilung als Mittel zur Steigerung der Produktivität.[16]
Einer der ältesten Texte mit ökonomischen Gedanken aber stammt von dem Dichter Hesiod (um 700 v. Chr.), der seinen Lebensunterhalt als Ackerbauer und Viehhalter verdiente. In seinem um 700 v. Chr. verfassten Lehrgedicht „Werke und Tage“ berichtete er von der Arbeit des Bauern und des Fischers und schilderte eine Wirtschaft und Gesellschaft, die auf Wettbewerb aufgebaut war und in der es vor allem auf das tägliche Überleben auf dem Land ankam. Das Leben der Polis und die Belange der Gesellschaft hatten für ihn daher nachrangige Bedeutung.
Für die Polis, den antiken griechischen Stadtstaat, bestehend aus Stadt im Mittelpunkt und seiner Umgebung, bildete die Agora, der Marktplatz, einen wichtigen Ort nicht nur des Handels, sondern der öffentlichen Meinungsbildung. Hier verstrickte Sokrates im 5. Jahrhundert v. Chr. seine Mitbürger in philosophische Gespräche, hier hielten Bürger politische Reden. Sokrates lebte zur Blütezeit der Polis und der Agora. Seine Zeitgenossen und Mitbürger in Athen waren der Dichter Aischylos, der die Tragödie schuf, der Politiker Perikles, der das demokratische Staatswesen ausbaute, der Bildhauer und Architekt Phidias, der den Parthenon errichtete, der Gelehrte Herodot, der die Geschichtsschreibung begründete. Es war eine wahrhaft große Zeit und die Leistungen dieser Männer schlugen Pfade, aus denen Wege in die heutige Zeit entstanden. Was das ökonomische Denken betrifft, war es Sokrates’ Schüler Platon[17] (428/427 v. Chr. bis 348/347 v. Chr.), der auch auf diesem Gebiet Prägendes beitrug, und dies aus einem völlig anderen Blickwinkel als dem der Hauswirtschaft.
Platon stammte aus einer vornehmen und wohlhabenden Familie Athens. Als er Sokrates kennenlernte, war er sofort so stark von ihm beeindruckt, dass er sich der Philosophie zuwandte und dessen Schüler wurde. In der Jugend Platons begann der Niedergang seiner Heimatstadt. Ihre Kräfte hatten sich im Kampf gegen Sparta im Peloponnesischen Krieg (431 bis 404 v. Chr.) erschöpft. In Athen wechselten die Staatsformen zwischen Tyrannis, Oligarchie und Demokratie. Es herrschte fürchterliche Unsicherheit und oft kam es zu Terror und Anarchie. Sokrates wurde während einer Phase der Demokratie durch Abstimmung zum Tode verurteilt, was Platon tief erschütterte. Er verließ Athen, bereiste den Mittelmeerraum und gründete 387 v. Chr. nach seiner Rückkehr im Hain des Akademos seine Schule, die Keimzelle aller Akademien und Universitäten.
In einer Zeit der Verwerfungen und vielfältigen Weltdeutungen wurde Platon zum Philosoph der Ideen, zum Denker des Absoluten und Umfassenden. Er stand damit auch in Opposition zu der Denkschule der Sophisten, die im Hier und Jetzt nach Antworten suchten und im rhetorischen Diskurs gleich frühen Debattierklubs die Fragen der Welt erörterten. Ihr bedeutendster Kopf Protagoras gab sogar Rhetorikunterricht und umriss mit seinem programmatischen Satz „Der Mensch ist das Maß aller Dinge“ auch die Relativität menschlicher Erkenntnis. Platon hingegen suchte das Ideal, das Absolute, das, was hinter und über den Dingen zu finden ist. Wenn er über Wirtschaft redete, redete er über das Zusammenleben von Menschen in der Gesellschaft, wobei er den Staatsmann wie den Herrn eines Hauses aus einer philosophisch-aristokratischen Haltung heraus weiterhin als Hirten verstand.[18]
Seine Idee einer gerechten Ordnung legte Platon in seiner Schrift Politeia nieder, einem umfangreichen Text aus mehreren Dialogen. Platon schwebte ein Ständestaat in einer überschaubar bleibenden Polis vor. Jeder sollte darin in einem frühen Konzept der Arbeitsteilung nach seinen Fähigkeiten zum Wohl der Gemeinschaft eingesetzt werden. Platon unterteilte in drei Stände: 1. die Philosophen, 2. die Wächter beziehungsweise Wehrmänner und 3. die Handwerker, Händler und Bauern. Der Stand der Philosophen sollte die unumschränkte Macht erhalten und weise zum Wohl der Polis regieren. Für den Stand der Wächter sah Platon keinerlei Besitz vor, sondern betrachtete ihn als eine Gemeinschaft, in der alle Frauen, alle Kinder und aller Besitz „gemeinsam“ sind. Die beiden anderen Stände dürften hingegen sehr wohl Eigentum haben, doch nur in Maßen. Überhaupt war das Maßhalten beim Wirtschaften für Platon und seine griechischen Zeitgenossen von großer Bedeutung. Reichtum, davon war er überzeugt, entstehe im Allgemeinen nicht durch redliches Tun, sondern durch Verschlagenheit.
Der Handel, der Austausch von Gütern, sollte auf Märkten stattfinden, die aber streng zu kontrollieren seien und nur einmal im Monat abgehalten werden sollten, wie er in seinem späteren Werk Nomoi [19](Die Gesetze)darlegte. Darinwandelte er die Idee des idealen Staates in den Entwurf eines „zweitbesten“ Staates ab. Nun betonte er die Bedeutung von Gesetzen. Geld als Zahlungsmittel sollte den Tausch erleichtern. In seinem ästhetisch-harmonischen Verständnis einer Gemeinschaft sah Platon Vorschriften zur Verteilung von Eigentum vor, um sowohl drückende Armut als auch großen Reichtum zu bekämpfen. Was die Preisbildung betraf, müsse ein Gut entsprechend seinem Wert verkauft werden, und ein Verkäufer dürfe nicht zwei verschiedene Preise verlangen. Land solle im Besitz der Polis bleiben; was Zinsen betraf, so seien sie nicht zu zahlen.
Platons autoritäre Staats- und Wirtschaftsauffassung, die nur wenigen erwählten sogenannten Philosophen die politische Macht zuwies und ein selbstbestimmtes Leben des Menschen außerhalb der vorgegebenen harmonisch definierten Gesellschaft nicht vorsah, diente in der Folge als Rechtfertigung totalitärer Herrschaftsideen und -formen. Zu erklären ist Platons Ansatz vor dem Hintergrund der politischen Unsicherheit seiner Zeit und seiner aristokratischen Auffassung, die dem normalen einzelnen Bürger wenig vertraut und noch fern davon ist, Menschen als gleich zu betrachten. In Athen zur Zeit Platons hielt im Prinzip jeder Bürger einen Sklaven. Platon hatte fünf Sklaven, reiche Bürger hielten oft 50. Freie Bürger versahen keine Arbeit, zumindest keine körperliche. Entsprechend dem Selbstverständnis der freien Bürger waren Handel und Handwerk von Zugereisten und deren Sklaven zu verrichten. Der freie Bürger hingegen habe zu denken und etwas entstehen zu lassen, statt Handel zu treiben und körperlich zu arbeiten. Platon und später sein Schüler Aristoteles erkannten die Problematik der Sklaverei zwar, waren aber noch nicht so weit, ihre Überwindung ins Auge zu fassen.[20]
Aristoteles (384 bis 322 v. Chr.) war neben seinem Lehrer Platon der bedeutendste Denker der Antike. Mit seinem umfassenden Werk, das wie kein anderes die Gebiete menschlichen Wissens und Suchens umfasste und ordnete, ist er der Begründer der systematischen Wissenschaft und ihrer Disziplinen, wie wir sie heute kennen.
Für Aristoteles war der Mensch ein Zoon politikon, ein soziales, zur Gemeinschaft hingezogenes Wesen. Die Polis, der griechische Stadtstaat, sah er als ein natürliches Gebilde. Sie habe als vollkommen zu gelten und solle sich wirtschaftlich selbst genügen. Die Polis stand in ihrer Existenz noch vor der Hausgemeinschaft (Oikos), dem Ort des Wirtschaftens, und vor den Menschen im Oikos, die sich in Herrschende (den Hausherrn) und sich Unterordnende, wie Frauen, Kinder, Sklaven, unterteilten.
Bedeutsam für die Wirtschaftswissenschaft ist Aristoteles’ Schrift Politika (dt. Die politischen Dinge). Auch Aristoteles betrieb Ökonomik nicht im heutigen Sinne, dass Mechanismen wertfrei untersucht werden, sondern er lieferte eine Ethik und definierte ein moralisches Soll. Reichtum sei gerechtfertigt, aber in Maßen. Gleichheit sei anzustreben, allerdings nur unter Ebenbürtigen.[21]
Wie für Platon war auch für Aristoteles Geld eine Tauscherleichterung und dennoch etwas, was mit Skepsis zu betrachten sei. Den Zins bezeichnete Aristoteles als etwas „Hassenswertes“, da er Geld aus Geld und nicht aus Arbeit schaffe. In einer frühen Form von Werttheorie differenzierte Aristoteles zwischen dem Tauschwert und dem Gebrauchswert, den jedes Gut habe. Der Tauschwert werde vom Bedürfnis bestimmt. Ein Gut soll vor allem für den Gebrauch hergestellt werden, nicht für den Verkauf. Mit dem letzteren Gedanken, der aus heutiger Sicht seltsam wirkt, zeigte Aristoteles eine sehr besondere Vorstellung von den Beweggründen der Arbeit, etwa des Handwerkers. Es ist eine Auffassung, die sich von der oft heute betriebenen Chrematistik abgrenzt, des Erwerbs um des Reichtums willen.
Es ist überhaupt praktisches Denken mit einem Hang zur Muße, was bei Aristoteles anzutreffen ist, und bildet die Wirtschaftspraxis seiner Zeit und Welt ab: Der Hof genügt sich in der Selbstverwaltung des Benötigten, Autarkie ist wichtiger als Wachstum. Das, was die Gemeinschaft, die Polis braucht, wird bezahlt durch Steuern und Tribute. Exportiert werden durfte in Athen zuweilen nur, wenn dies mit einem entsprechenden Importgeschäft verrechnet werden konnte.
Mit allem bisher Gesagten bewegte Aristoteles sich auf einer ähnlichen Linie wie sein Lehrer Platon. Doch er widersprach auch in manchen Dingen. So wies er Platons Forderung nach einer Gütergemeinschaft und die Ablehnung von Eigentum an Grund und Boden zurück. Für Aristoteles war Grundeigentum weit vorteilhafter als Gemeinschaftseigentum. Denn Privateigentum führe dazu, dass sich Menschen kümmerten, und erziele daher effizientere Ergebnisse. Insofern finden sich also schon bei Platon und Aristoteles zwei wesentliche Argumentationslinien der nächsten Jahrhunderte: Auf der einen Seite die Überzeugung vom Vorteil des geplant verwalteten Gemeinschaftseigentums (Platon), auf der anderen Seite die Überzeugung vom Vorteil der Eigenverantwortung und Initiative, die aus dem Eigentum entsteht (Aristoteles).[22]
Ein Rätsel stellt in der Rezeption nach wie vor der sogenannte Pseudo-Aristoteles dar. Es sind drei Bücher über Hauswirtschaft, deren Urheberschaft im Dunkeln liegt und die vermutlich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte nach dem Tod von Aristoteles niedergeschrieben wurden. Waren es Niederschriften von Aristoteles’ Schülern, die Gedanken des Meisters wiedergaben? Man weiß es nicht. Die Schriften enthalten Beschreibungen der Pflichten des Hausherrn, der Ehefrau, der Verwaltung, der Behandlung der Sklaven.
An ökonomischem Denken aus dem antiken Griechenland zu erwähnen ist noch Iambulos oder Jambulus, der im 3. Jahrhundert v. Chr. lebte. Seine Utopie Politeia tou Heliou (Der Sonnenstaat) verfasste er um 240 v. Chr., in der sich kynische und stoische Ideen wiederfinden. Iambulos entwarf als Ideal einen Staat mit einfachsten Lebensverhältnissen. Jeder Bewohner ist zur Arbeit verpflichtet, wechselt aber immer wieder die Tätigkeit. Geld gibt es nicht. Iambulos’ Ideen fanden später Nachklang in Tommaso Campanellas Utopie von einem Sonnenstaat und in den Vorschlägen John Ruskins, dass jeder sowohl körperliche als auch geistige Arbeit leisten solle.[23]
Den Überlegungen der Griechen fügten später die praktischen Römer vor allem betriebswirtschaftliche Gedanken hinzu; obwohl sich das Wirtschaftsleben im römischen Weltreich bereits weit komplexer gestaltete als einst in den griechischen Stadtstaaten – die Versorgung der Millionenstadt Rom war ebenso ein zentrales und dauerhaftes Thema wie der Unterhalt der römischen Legionen und die Versorgung von Veteranen. Verwerfungen des Staatshaushalts und des Finanzsystems blieben nicht aus. Dennoch entstanden keinerlei Schriften zu derlei Themen. Bemerkenswert am Rand ist die praktische Bedeutung, die der kurz nach Nero 69 n. Chr. zum Kaiser erhobene Vespasian dem Geld zuwies. Als er, um den Staatshaushalt zu sanieren, eine Steuer auf den Urin der Latrinen erhob, der zur Ledergerbung verwandt wurde, und sein Sohn Titus entsetzt darüber war, antwortete er mit den berühmt gewordenen Worten „Geld stinkt nicht“.
Die Schriften aus der römischen Antike mit ökonomisch zu bezeichnendem Einschlag sind meist Anleitungen zur Bewirtschaftung eines Landguts, ergänzt um einige Fragen des allgemeinen Wirtschaftens. Auch Ratschläge, die man heute Management-Slogans nennen würde, finden sich. So mahnte Cato der Ältere[24] (234 bis 149 v. Chr.) in seinem Werk De agri cultura (Über den Landbau): „Ein Hausvater muss verkauflustig, nicht kauflustig sein.“
Im 1. Jahrhundert nach Christus verfasste Lucius Iunius Moderatus Columella, der um 70 n. Chr. starb, De re rustica libri duodecim (dt. Zwölf Bücher über die Landwirtschaft). Bedeutender ist das im Jahrhundert zuvor, um 37 v. Chr. verfasste und mit De re rustica fast gleich betitelte landwirtschaftliche Lehrbuch des Marcus Terentius Varro (116 bis 27 v. Chr.). Varro, der wohl der größte Universalgelehrte seiner Zeit, wollte mit der Schrift seiner Frau einen Leitfaden zum Bewirtschaften der eigenen Güter nach seinem Tod zur Verfügung stellen. In ihr beschrieb er unter anderem die Erstellung eines Arbeitskalenders für den Ackerbau und lieferte somit eine Art früher Produktionsplanung. Beim Arbeitskräfteeinsatz riet er, Sklaven zu belohnen, da dies ihre Leistung steigere. Zudem führe man sie erfolgreicher, wenn man sie erklärend und beispielgebend anweisen würde, statt ihnen Strafen anzudrohen. Da Varro Sklaven als Teil des Vermögens sah, riet er, sie schonend einzusetzen und sie vor Krankheiten zu schützen. So sei in Sümpfen, zu jener Zeit gefürchtete Krankheitsherde, lieber auf freie Arbeiter zurückzugreifen.
Varro verwies auch auf die Bedeutung der Standortwahl. So sei die Profitabilität eines Gutes abhängig von seiner Nähe zu einem städtischen Markt. Als womöglich erster erörterte er das Problem der von der Produktionsmenge unabhängigen „fixen“ Kosten. Am Beispiel eines Olivenhains legte er dar, dass man bei Verdoppelung der Fläche zwar mehr Arbeiter einsetzen müsse, aber keinen zweiten Aufseher einzustellen brauche.[25]
Wie bei den Griechen waren auch bei den Römern die Gedanken zum Wirtschaften einerseits sehr stark auf den praktischen Haushalt oder das Gut konzentriert, andererseits auf ethische, staatsphilosophische Gedanken. Gesamtwirtschaftliche Abläufe aber waren kein Thema. Was das Staatsphilosophische betrifft, ist von den römischen Schriften für das ökonomische Denken im Sinne der Ausstrahlung ethischer Normen auf das Handeln vor allem das Werk Marcus Tullius Ciceros (106 bis 43 v. Chr.) von Einfluss, einem der bedeutendsten Politiker und Redner der Römischen Republik und Gegenspieler Julius Caesars. Zu erwähnen sind vor allem das in Dialogform verfasste De re republica (Über den Staat bzw. Vom Gemeinwesen), das zwischen 54 und 51 v. Chr. entstand, und das 44 v. Chr., kurz vor Ciceros Tod verfasste De Officiis (Über die Pflichten oder Vom pflichtgemäßen Handeln). Gerade letztgenanntes Buch wirkte auf die Geistesgeschichte, insbesondere durch seine Darlegung der vier Kardinaltugenden Einsicht beziehungsweise Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maßhalten.
Aus unserer eurozentrischen Sicht übersehen wir oft Entwicklungen und Überlegungen außerhalb unserer Hemisphäre. Daher sei hier abschließend aus jener Epoche auf den chinesischen Denker Huan Kuan[26] verwiesen, über dessen Leben so gut wie nichts bekannt ist. Huan Kuan schilderte in seinem Werk Yantie Lun (Die Debatte über Salz und Eisen) die im Jahr 81 v. Chr. geführte Debatte zwischen Konfuzianern und Schriftgelehrten sowie den höchsten Beamtenvertretern des Staates um Reformen, die Aufgaben der Regierung, die Bedeutung von Handel und Handwerk, um Profitdenken, Geldwirtschaft und Staatsmonopole bei Salz- und Eisenproduktion. Auch geht es um die Gerechtigkeit von Steuern, vor denen sich die Reichen drücken könnten, die die Bauern aber sicher zahlen müssten. Ein Phänomen, das manch kritischer Geist noch heute als gegeben sieht.
Aufeinander trafen in der „Debatte um Salz und Eisen“ staatlicher Machtanspruch auf der einen Seite und konfuzianische Sicht der Welt und der Gesellschaft auf der anderen Seite. Die Debatte spiegelt in ihrem bemerkenswerten Kern auch den Widerstreit von Denk- und Lebenstradition und staatlichem und ökonomischem Effizienzdenken. Die Gelehrten bevorzugten die Landwirtschaft, die Vertreter des Kaisers traten für die Förderung von Handel und Handwerk ein, auch für den Außenhandel.
3 Was hat Gott mit dem Geld gewollt? – ökonomische Positionen der Scholastik
„Es ist unmöglich, dass ein Mensch gut sei, außer er stehe im rechten Bezug zum gemeinen Wohl.“
Thomas von Aquin
„Pro tali numismate tales merces – Für diese Münze diese Waren (Du bekommst das, was du bezahlst).“
Gabriel Biel
Der weltgeschichtliche Bruch, der mit dem Ende des Römischen Reiches einherging, war radikal. In die machtpolitische und religiöse Leere drängten nicht nur weltliche Mächte wie germanische Stämme, die aufgrund des Einfalls der Hunnen in Osteuropa die Völkerwanderung auslösten, sondern auch eine neue Religion. Spätestens als Kaiser Konstantin der Große zur Wende zum 4. Jahrhundert das Christentum zur Sicherung seiner Macht nutzte, gewann dieses entscheidend an Einfluss. Hatten Griechen und Römer noch viele Götter angebetet, lieferte der Glaube an nur einen Gott nun auch ein Argument, dass es auch auf Erden nur einen Herrscher geben dürfe. Das Christentum hielt zudem einen strafferen Denkrahmen bereit, dies flankiert von der als heilig benannten Schrift, der Bibel, die im Grunde zu einer Art Gesetzeswerk zur Gestaltung allen Lebens ernannt wurde.[27]
Die Strukturen der ihre Macht konsequent ausbauenden Kirche halfen Konstantin, seine eigene Macht zu stützen, und auf die Kirche ging nach und nach die Deutungshoheit der Welt, des Lebens, des Staates, auch des Denkens über Wirtschaft über. Letzteres blieb jedoch weiterhin ein stiefmütterlich behandelter Randbereich, und alle Gedanken auf diesem Feld beschäftigten sich noch immer nicht mit dem, was ist, also nicht mit den Mechanismen des Produzierens, des Geldflusses, des Handels. Die Kirche nahm nun eine andere Perspektive ein als die griechische Antike, in der Wirtschaften als eine Domäne des Hausvaters begriffen wurde, und stellte die Frage, wie wirtschaftliche Handlungen mit christlicher Moral zu vereinen seien. Unähnlich sind sich die Betrachtungen allerdings letztlich nicht. Im Laufe der Jahrhunderte, über Früh-, Hoch- und Spätmittelalter bis in die nach der Entdeckung Amerikas beginnende Neuzeit, standen weiter Fragen nach dem gerechten Preis, die Missbilligung des Wuchers und das Gebot des Wirtschaftens nicht um jeden Gewinn im Mittelpunkt. Der moralische Wert des Wirtschaftens bestand dabei weiterhin im Streben nach einem guten Auskommen, nicht in dem Erreichen von Wachstum und Fortschritt. Diese Ziele entstanden erst später in der beginnenden Moderne mit Industrialisierung und Aufklärung.[28]
Wirkmächtig an der Schwelle des Übergangs vom antiken zum christlichen Denken des Mittelalters stand der Kirchenvater Augustinus von Hippo (354 bis 430), der im heutigen Algerien als Sohn eines heidnischen Bauern und einer frommen christlichen Mutter geboren wurde und nach ausschweifendem Leben als 30-Jähriger zum christlichen Glauben fand. In der Stadt Hippo Regius, dem heutigen algerischen Annaba, wurde er Bischof und verfasste dort während seines über 30-jährigen Wirkens ein umfangreiches Werk. Besonders zu erwähnen ist sein Hauptwerk De civitate Dei (Vom Gottesstaat). Darin legte er dar, dass die Geschichte letzten Endes auf ein Gottesgericht zulaufe und nicht, wie die Antike es sah, aus einer Wiederholung von Abläufen bestehe. Wegweisend für das Verhältnis und das Verständnis von Kirche und Staat war Augustinus mit seiner Forderung der Unterwerfung der Menschen unter ein irdisches Gottesreich, denn in seinem Weltbild besaß der Mensch keinen freien Willen, war in Erbsünde verhaftet und abhängig von einem strengen Gott, der richtet und erwählt.[29]
Was das Ökonomische an sich betraf, rechtfertigte Augustinus körperliche Arbeit, woraus aber auch die Billigung von Frondienst und der Arbeit im Dienst von Feudalherren abgeleitet wurde. Dem Handel wies Augustinus die Funktion zu, Mangel auszugleichen. Zins und Wucher lehnte er entschieden ab und unterteilte, wie auch schon Aristoteles, nach Tausch- und Gebrauchswert der Waren.
Die ein Jahrhundert nach Augustinus endgültige Ablösung des Denkens der Antike markieren manche Historiker gerne 529 n. Chr. In jenem Jahr schloss die berühmte platonische Akademie in Athen, während in Italien Benedikt von Nursia (480 bis 547) den Benediktinerorden gründete. Die Arbeitsethik Benedikts, verdichtet in dem Satz „Ora et labora!“, der sich auf die Klosterregeln der Benediktiner bezieht, lieferte noch einmal eine Rechtfertigung irdischer körperlicher Arbeit.
Aus den ab dem 6. Jahrhundert entstandenen Kloster- und Domschulen entwickelten sich mit zunehmender Vertiefung wissenschaftlichen Arbeitens Ende des 11. Jahrhunderts die ersten Universitäten. Als erste Universitätsgründung in Europa gilt die der Hochschule im italienischen Bologna im Jahr 1088. Zu Beginn war diese Universität vor allem eine Hochschule der Rechtswissenschaften, erst im 14. Jahrhundert kamen die sieben freien Künste hinzu sowie die Philosophie und die Medizin. An Ökonomie als Lehrfach war noch lange nicht zu denken.[30]
In der wissenschaftlichen Methode bildete sich etwa zeitgleich mit dem Ausbau der Kloster- und Domschulen und dem Entstehen der ersten Universitäten im 11. Jahrhundert die Methode der Scholastik heraus. Erste Ansätze lieferte Anselm von Canterbury mit seiner Maxime „Ich glaube, um zu erkennen“, mit der er Wissenschaft und Logik zu Instrumenten machte, mit denen die religiöse Lehre des Christentums zu beweisen war.
Die Scholastik entwickelte sich weiter aus einem Wechsel der einst von Augustinus vertretenen platonischen Ansichten hin zu einem Ansatz, der auf Aristoteles und dessen Schriften aufbaute. Nachdem er durch Verwerfungen der Völkerwanderung und der Vernachlässigung des antiken Erbes durch das aufkommende Christentum fast in Vergessenheit geraten war, fand Aristoteles vor allem durch Neuübersetzungen und die wirkmächtige Rezeption durch arabische Gelehrte wieder Eingang in das Denken vor allem der nun beginnenden Hochscholastik. Besondere Verdienste gebühren Avicenna und vor allem Ibn Ruschd, besser bekannt unter seinem latinisierten Namen Averroes (1126 bis 1198), der mit seinen Kommentaren vielen scholastischen Denkern den Zugang zu Aristoteles eröffnete und bald mit der bewundernd raunenden Bezeichnung „Der Kommentator“ in den Stuben der Klosterschulen berühmt war.
Äußerten sich Scholastiker zu ökonomischen Themen, waren es wieder vor allem Fragen zum gerechten Preis, zum Wucher, zum Zins. Sie blieben auch zentral in den ökonomischen Beiträgen des wohl bedeutendsten Denkers der Scholastik, des Hochscholastikers Thomas von Aquin[31] (um 1225 bis 1274). Er lebte in einer Epoche wachsenden Wohlstands in Europa, guter Ernten, verbesserter Wege und damit aufblühenden Handels. Italienische Stadtstaaten wie Genua und Venedig entwickelten sich zu Thomas’ Lebenszeit zu bedeutenden Handelsmächten. 1271, zwei Jahre vor Thomas’ Tod, reiste Marco Polo nach China.
Thomas stammte aus einem italienischen Adelsgeschlecht und wurde schon mit sechs Jahren in Monte Cassino, dem Gründungskloster der Benediktiner, erzogen. Gegen den Willen seiner Eltern trat er dem Dominikanerorden bei und studierte bei Albertus Magnus in Paris, später bei ihm in Köln. Wie dieser baute Thomas von Aquin sein Denken auf den Schriften des Aristoteles auf. Thomas versuchte, den von der Scholastik errichteten Widerspruch zwischen Logik und Glauben aufzulösen, indem er konstatierte, dass der Glaube nicht zu beweisen, Vernunft aber dessen Vorstufe sei. In seinem Hauptwerk Summa theologiae (Summe der Theologie), an dem er in seinem letzten Lebensjahrzehnt arbeitete und das bis zu seinem Tod unvollendet blieb, legte er auch seine Gedanken zum besten Staats- und Gesellschaftswesen dar. Der Mensch sei ein soziales Wesen. Die beste Herrschaftsform sei die Monarchie, da auch in der Natur alles ein Höchstes habe. Der König sei Vertreter Gottes im Staat, dessen Macht aber beschränkt werden müsse, um das Entstehen einer Tyrannei zu unterbinden. Dem König beziehungsweise dem Staat aber noch übergeordnet sei die Kirche, deren moralische Vorgaben beide erfüllen müssen.[32]
Was das Ökonomische betraf, trieb Thomas vor allem die Frage nach der Berechtigung der Zinserhebung um. Geld dürfe nicht mit Zins verliehen werden. Denn Zins sei Wucher, da Zins der Preis für die Zeit sei, in der der Verleihende auf das Geld verzichtet. Die Zeit gehöre aber Gott. Nur für säumige Schuldner sei ein Aufpreis zu rechtfertigen. Erklärlich ist Thomas’ Zinsauffassung, da Geld im Allgemeinen nicht geliehen wurde, um zu investieren und in Zukunft höhere Einnahmen zu erzielen. Derlei Geschäftspraktiken gab es damals kaum, sondern eher wurde Geld geliehen zur Überbrückung von Notzeiten oder zum Bau eines Hauses.
Gerechtigkeit blieb auch für Thomas ein zentraler Punkt, und aus einem Handel sollten beide Seiten den gleichen Nutzen ziehen. Der „gerechte Preis“ käme zustande, wenn es kein Monopol, keinen Betrug oder keine Zurückhaltung von Wissen gäbe. Jeder Marktteilnehmer müsse also versuchen, vollkommene Transparenz und Konkurrenz herzustellen. Der „gerechte Preis“ werde aber auch durch die gesellschaftliche Stellung des Anbieters mitbestimmt, etwa durch die Arbeit, die in die Leistung eingeflossen sei. Der Verkäufer müsse, um einen Aufschlag auf ein zuvor woanders erworbenes Gut verlangen zu dürfen, etwas geleistet haben, wie etwa den Transport der Ware.
Auch der schottische Philosoph John Duns Scotus[33] (1265 bis 1308) fragte nach dem gerechten Preis. Für ihn mussten darin die Kosten der Herstellung und der Lagerung eines Gutes ebenso berücksichtigt sein wie das Risiko des Kaufmanns. Er kam jedoch zum Schluss, es gebe keine Möglichkeit, den gerechten Preis objektiv zu bestimmen.
Für den Spätscholastiker Jean Buridan (1300 bis 1358) und seinen Schüler Nicolaus Oresmius (um 1320 bis 1382) rückten hingegen die Fragen nach dem Wesen und dem Wert des Geldes in den Mittelpunkt. So war für Buridan Münzverschlechterung (also die Minderung des Edelmetallgehalts bei der Prägung) ein Angriff auf das Wesen des Geldes. Im Gedächtnis der ökonomischen Wissenschaft bleibt Buridan aber durch das Gedankenmodell von „Buridans Esel“. Darin geht es um einen Esel, der zwischen zwei identischen Heuhaufen verhungert, weil er sich für keinen der beiden entscheiden kann. Dieses Modell, das in der Entscheidungstheorie Anwendung findet, stammt aber vermutlich nicht von Buridan, sondern von einem seiner Kritiker, der damit Buridans Behauptung angreifen wollte, dass der Wille nicht ohne hinreichend rationalen Grund aktiv werden kann.
Buridans Schüler Oresmius verhalf den Wissenschaften an sich zu neuen Perspektiven, indem er Thesen aufstellte, die zum Teil auch der Lehre der Kirche widersprachen, was die Widerlegbarkeit der christlichen Lehren denkbar machte. In der ökonomischen Wissenschaft gebührt ihm das Verdienst, 1357 mit seinem Tractatus de origine, natura, iure mutationibus monetarum[34] (Traktat über Ursprung, Wesen, Recht und Abwertung der Münzen) eines der ersten Werke über Geld und Geldentwertung vorgelegt zu haben. Oresmius versuchte, in dieser Schrift vor allem dem mangelnden Bewusstsein für die Bedeutung eines stabilen Geldwertes entgegenzuarbeiten. Dabei knüpfte auch er an Aristoteles an. Geld sah er als Eigentum der Gesellschaft, das seinen Wert erhalte, weil die Menschen dafür arbeiten. Ein Fürst als jener, der das Geld prägt, habe nicht das Recht, das Geld zu verschlechtern. Tue er dies, treibe er das gute Geld aus dem Land. Damit war auch Oresmius ein Vordenker des später nach dem Gründer der Londoner Börse Thomas Gresham (1519 bis 1579) benannten Gesetzes – der es ebenfalls formuliert haben soll –, wonach schlechtes Geld mit beispielsweise minderem Silbergehalt gutes aus dem Markt drängt, da die Marktteilnehmer eher gutes Geld horten.
Als Denker in der Tradition Thomas von Aquins ordnete nach Oresmius schließlich Bernhardin von Siena (1380 bis 1444) die ökonomischen Gedanken der Scholastik. Er lieferte zudem eine Rechtfertigung des Unternehmers als von Gott mit bestimmten Fähigkeiten ausgestatteter Mensch, der durch seine für die Wirtschaft und für die Gesellschaft nutzbringende Arbeit einen Profit verdiene, insbesondere auch aufgrund seiner Bereitschaft, Wagnisse einzugehen.
Auch der deutsche Spätscholastiker Gabriel Biel (1420 bis 1495) betonte die Bedeutung des Unternehmertums, aber auch die der Vertragsfreiheit, und er ging sogar so weit, die Praktikabilität des Konzepts des „gerechten Preises“ infrage zu stellen. Denn Handel käme nicht zustande, wenn alle Handelspartner daraus nicht Vorteile zögen. Biel rechtfertigte die Umgehung des kirchlichen Zinsverbotes durch feste vertragliche Einigungen und sprach sich gegen das Verbot des Tauschgeschäfts mit Münzen aus, da Geld erst im freien Tausch seine volle Wirksamkeit entfalten könne.[35]
Viel von dem Wissen der Scholastik und damit der Weiterentwicklung des Denkens des Abendlandes ist – wie bereits erwähnt – der Arbeit von Denkern des arabischen Raums zu verdanken. Nach Avicenna und Averroes war es Ibn Khaldun (1332 bis 1406), der bemerkenswerte Beiträge lieferte. Sein 1401 oder 1402 erschienenes Buch al-Muqaddima gilt als ein klassisches Werk der arabisch-islamischen Literatur. Hochinteressant ist Ibn Khalduns Versuch, den Lauf der Geschichte anhand der Ordnungen, Gesetze und Regeln der jeweiligen Gesellschaften zu erklären. Er zog lange vor Adam Smith Grenzen zwischen den Aufgaben des Staates und der Freiheit des Wirtschaftens und hegte so die Reichweite des Staates ein. Der Staat habe für Sicherheit zu sorgen, das Münzwesen zu überwachen und die Einhaltung der Gesetze sicherzustellen, aber keinerlei Aufgaben zu übernehmen, die nicht ebenso gut von der privaten Wirtschaft ausgeführt werden können, denn das würde auch die Eigeninitiative der Menschen hemmen. Außerdem dürfe der Staat nicht in Konkurrenz zur Privatwirtschaft treten, weil zu starke Staatstätigkeit sogar die Privatwirtschaft zerstören würde. Ibn Khalduns Denken und Leistung ist noch immer, auch aufgrund eurozentrischer Sicht, zu wenig gewürdigt.[36]
Nachdem durch die osmanische Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453 die Wege der Seidenstraße versperrt waren, begann die Suche nach einem Seeweg nach Indien. Die Ergebnisse sind bekannt. Er wurde nicht nur durch Vasco da Gama gefunden, sondern Christoph Kolumbus entdeckte für die Europäer einen völlig neuen Kontinent mit seinen Schätzen. Das Gold und das Silber, das die Spanier in Südamerika zusammenrafften, überschwemmte Europa. Die Erde war rund, die Neuzeit begann. Was das ökonomische Denken betraf, wurde nun aufgrund der Einfuhr gewaltiger Mengen Goldes und Silber aus Südamerika die Betrachtung des Wuchers und des gerechten Preises um Probleme der Inflation durch Steigen der Geldmenge ergänzt.
Bemerkenswert aus dieser Zeit der Wende zur Neuzeit ist, was das Denken über Geld und Geldwert betrifft, der sächsische Münzstreit von 1526, der zwischen den katholischen Albertinern und den katholischen Ernestinern ausgetragen wurde. Dabei sprachen sich die Albertiner gegen eine Verschlechterung der geprägten Münzen durch Beimischungen zum Silber aus, die Ernestiner waren dafür.
Vor allem aber wurde nun das Nachdenken über die ökonomische Bedeutung von Edelmetall, Geld- und Münzwesen zu einem zentralen Thema im Land jener Weltmacht, die am meisten von der Entdeckung Amerikas durch die Europäer profitierte: Spanien. Dort entstand die berühmte spätscholastische Schule von Salamanca. Als ihr Begründer gilt Francisco de Vitoria[37] (zw. 1483/1493 bis 1546). Er stammte von zwangsgetauften Juden ab und gehörte dem Dominikanerorden an.
Die Schule von Salamanca steht für einen kritischen Realismus, der auf der Auseinandersetzung mit der Summa theologiae von Thomas von Aquin fußt, wobei vor allem Vitoria versuchte, die Ideen Thomas’ mit den geistigen und wirtschaftlichen Umwälzungen nach der Entdeckung Amerikas zu vereinen.
Vitoria veröffentlichte zu Lebzeiten nichts, doch seine Studenten hinterließen der Nachwelt Niederschriften seiner Vorlesungen. Er hatte eine Ethik für die Kolonialisierung erarbeitet und versucht, darin die Rechte der Menschen und der Völker zu klären sowie Regeln für das ökonomische Handeln aufzustellen. Vor allem seine Auffassung des Völkerrechts als Recht zwischen den Völkern („ius inter gentes“), das er dem bisherigen Recht der Völker („ius gentum“) entgegenstellte, machte ihn zum Wegbereiter des Völkerrechts der Moderne.
Vitorias Schüler Domingo de Soto (1495 bis 1560) ging dann vor allem, was soziale Fragen betraf, weiter und tiefer. So sprach er den Armen das Recht auf Selbstbestimmung zu und schloss sich der Forderung des Dominikaners Bartolomé de las Casas an, die Menschenrechte der Ureinwohner Amerikas zu achten. In seiner 1545 erschienenen Schrift Deliberación en la causa de los pobres lehnte de Soto aber ab, das Bettelwesen zu bekämpfen, denn die Existenz von Armut sei durch die Bibel legitimiert, sie eröffne den Reichen sogar die Möglichkeit, mildtätig zu sein. De Sotos Gedanke der Schicksalsergebenheit in einem Gottesreich trug dazu bei, dass in Spanien soziale und ökonomische Reformen ausblieben.[38]
Andere Antworten zur Frage der Armut und Bettelei lieferten Vitorias und de Sotos Zeitgenossen und Landsmänner Juan de Robles und Juan Luis Vives (1492 bis 1540). Letzterer stammte wie Vitoria von zwangsgetauften Juden ab. Er wurde am Hof des englischen Königs Heinrich VIII. Lehrer von dessen Tochter Maria, der späteren Königin Maria I., und plädierte in seinen Schriften für Fortschritt in den Wissenschaften und in der Methodik. Die Scholastik lehnte er ab. Sein 1526 erschienenes Werk De subventione pauperum (Tratado del soccoro de los pobres)