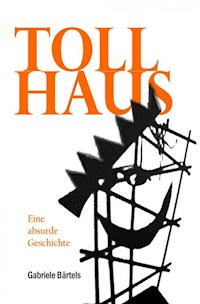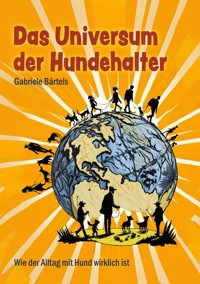Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
50 Jahre alt und vor dem Zusammenbruch ihrer Existenz: Für diese Frau ist die Begegnung mit einem charmanten, erfolgreichen und vermögenden Mann die Rettung in letzter Minute. Obwohl er noch verheiratet ist, wollen sie gemeinsam ein neues Leben beginnen. Das Paar baut ein Haus, schafft einen Hund an. Doch hinter dem Glück schwelen Konflikte. Der Mann entpuppt sich als Rechthaber und Geizkragen. Er verletzt den Stolz der Ich-Erzählerin und geht sogar noch weiter, um ihre Seele zu zerstören. Ein Psychodrama bahnt sich an. Leserin: "Man hat Gänsehaut ob der Nähe, die man spürt zur Erzählerin, und wegen der durchgehend authentischen und bis ins kleinste Detail glaubwürdigen Schilderung. Diese Echtheit berührt mich zutiefst."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriele Bärtels
Eine Minute
Gabriele Bärtels
Eine Minute
Roman
Berlin, 2021, Gabriele Bärtels
Umschlaggestaltung Gabriele Bärtels
gabriele-baertels.de
Alle Rechte vorbehalten
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Nachwort
Eins
Heute Morgen war ich wieder mit dem Hund beim Tierarzt. Wir müssen jetzt alle zwei Tage hin, um den Verband wechseln zu lassen, und um zu prüfen, ob sich an ihrem rechten Hinterlauf Druckstellen gebildet haben. Dieser Hinterlauf ist geschient, weil sie sich vor zehn Tagen im Gebüsch eine Glasscherbe eingetreten hat. Von dem Moment an, in dem ich diese breite, blutende Wunde entdeckte, war dieser Sonntag traumatisch verlaufen, aber Du wusstest nichts davon, denn Du warst wie jedes Wochenende nicht hier.
Es war der Tag, an dem ich ausziehen wollte. Schon am Abend zuvor hatte ich zusammen mit einem Freund mein Bett in die neue Wohnung geschafft, die ich morgens erst gemietet hatte, ein absoluter Glücksfall. Ich wollte weg sein, wenn Du wie gewöhnlich am Sonntagmittag heimkehren würdest.
Wochenlang hatte ich nach einer Unterkunft gesucht, es ist nicht einfach für eine Frau knapp unter sechzig, die eine lächerliche Einkommenssteuererklärung vorzuweisen hat, dazu einen großen Hund, den sie ungern aus einem Haus mit Garten in eine winzige Etagenwohnung verpflanzen möchte.
Ich klapperte wie ein Haufen Kleiderbügel, seit ich entschieden hatte, mich lieber um meine ganze Existenz zu bringen, als auch nur eine Nacht länger als nötig mit Dir unter einem Dach zu hausen. Und Du glaubtest immer noch, ich würde es nicht wagen, weil ich es die ganzen Jahre nicht gewagt habe. Gleichzeitig wolltest Du verzweifelt, dass ich endlich abhaue.
Der Unfall des Hundes machte meine Absichten zunichte.
Für die Verbandswechsel erscheine ich gewöhnlich eine Viertelstunde vor Praxisöffnung, da ist der Parkplatz noch leer, und ich kann darauf hoffen, die erste zu sein. Doch dann entdecke ich ein altes Fahrrad, das am Geländer lehnt, welches zur Treppe ins Souterrain hinunterführt. Unten auf dem Treppenabsatz wartet offenbar schon jemand darauf, dass in der Praxis die Lichter angehen.
Gewöhnlich springt mein Hund ja aus dem Auto, aber seit zehn Tagen muss ich das Tier hinein- und hinausheben und alle Stufen hinuntertragen, denn sie darf keinerlei unkontrollierte Bewegungen machen. Ich schleppe sie also zum Treppenabsatz, schaue hinab und entdecke die ältere Frau in Shorts, die auf der zweituntersten Stufe sitzt. Sie hält einen Katzenkorb auf dem Schoß und hat stämmige, blaugeäderte, weiße, behaarte Beine. Sie blickt zu mir hoch, und in ihren Augen lodert der gleiche Schmerz, der auch mich immer noch im Griff hält, obwohl ich in den vergangenen Tagen viel Ruhe gehabt habe.
Nachdem ich meinen Hund vorsichtig auf sein Bett abgelegt und mich selbst auf die oberste Treppenstufe in den Staub gesetzt habe, halte ich sie am Halsband fest. Sie darf nicht aufspringen und schon gar nicht nach der Katze geifern, die sich wenige Stufen weiter unten in ihrer Box vollkommen still verhält.
Ihre Besitzerin mag Mitte sechzig sein, ihr herausgewachsener Haarschnitt und ihre schwitzende, kurzärmelige Erscheinung wirken ärmlich und farblos und teilen jedem Betrachter mit, dass sie nichts mehr auf ihr Äußeres gibt.
Aber die Katze. „Sie ist fünfzehn“, flüstert sie, erstickt fast dabei. Ihr zitterndes Kinn kämpft wild darum, nicht loszulassen.
„Sie wiegt nur noch zwei Kilo. Früher waren es fünf. Sie erbricht sich dauernd. Der Tierarzt sagt, man sollte sie nicht länger am Leben halten. Vielleicht kann er ihr doch noch eine Spritze geben, dass es wenigstens vier Wochen weitergeht…“
Jetzt klappert sie doch am ganzen, fülligen Körper. Tränen pressen sich gegen ihren Willen aus den geröteten Augen.
Ich bin überzeugt, sie hat niemanden mehr, außer dieser todkranken, alten Katze, die wahrscheinlich schon zu lange lebt.
Sie hält ihren Riesenschmerz nur schwer zurück. „Ich könnte mit ihr noch in die Uniklinik, aber ich hab doch kein Geld“, stößt sie stockend hervor.
Wir sind ganz allein hier im Staub dieser Treppe zum Souterrain. Es ist wie ein Beichtstuhl aus Betonwänden. Die Katze kann ich nicht sehen, aber mein Hund zappelte auf ihrem Bett und will unbedingt zu ihr hinunter. Ich halte sie eisern fest.
Die Frau erkundigt sich höflich nach ihrem geschienten Bein, doch weder sie noch ich können ein sachliches Gespräch führen.
„Es gibt keinen Trost“, sage ich statt einer Antwort, weil das die Wahrheit und in diesem Augenblick die einzige Realität dieser Frau ist. „Es ist schrecklich, was Sie jetzt entscheiden müssen.“
Sie krampft die Hände um die Katzenbox aus Plastik und erkennt in meinen Augen, dass ich genauso beschissen dran bin wie sie, auch wenn ich geschminkt und geschmackvoll angezogen bin.
Wenige Minuten später wird die Praxis von innen aufgeschlossen. Im Wartezimmer setze ich mich auf den Boden neben meinen Hund und schaue auf die Tür zum Behandlungszimmer, hinter der die Frau mit ihrem Katzenkorb verschwunden ist.
Man kann den Tierarzt leise murmeln hören, und nur, wer weiß, was in diesem Zimmer vor sich geht, mag vereinzelt das verkrampfte Schluchzen einer Frau vernehmen. Hinter mir treten zwei Leute ins Wartezimmer, sie stellen einen Käfig mit einem Kaninchen auf den Empfangstresen und scherzen mit der Tierarzthelferin. Dann geht die Tür zum Behandlungszimmer auf, die Frau tritt heraus, und der Transportkorb, den sie trägt, ist zu leicht, als dass die Katze sich noch darin befinden kann.
Die Frau stellt sich dann hinter den beiden Leuten an, denn sie muss das Einschläfern ja noch bezahlen. Ich wechsele einen offenen Blick mit ihr. Sie schüttelt den Kopf und senkt dann die Lider. Ihre Schultern beben, sie würgt Laute herunter. Die Tierarzthelferin flüstert, dass es ihr Leid tut. Nachdem die Frau die PIN-Nummer ihrer EC-Karte eingegeben hat, verabschiedet sie sich höflich und geht schnell an mir vorbei hinaus, die Treppe hoch. Zuletzt sehe ich noch ihre weißgelblichen Füße in den Wandersandalen.
Über den Tresen schaut man in weitere Praxisräume. Der Hinterkopf des Tierarztes taucht auf, eine Kühlschranktür klappt auf- und zu. Die Frau radelt jetzt sicher schon mit dem Katzenkorb auf dem Gepäckträger durch die Seitenstraßen, blind für die blühenden Bäume und das sprießende Grün dieser warmen Maitage.
Dann werde ich aufgerufen und muss mit meiner Patientin zum Verbandswechsel.
Jetzt liegt mein Hund in ihrer Sofa-Ecke und schaut mich an, ohne sich zu rühren. Sie kann mir nicht sagen, welche Schmerzen sie hat. Brennend wünsche ich mir mein Viech von gestern zurück: rauflustig, rennlustig, jagdlustig und verfressen. Wenn ich mit ihr auf die Straße ging, wedelte ihr ganzer Körper erfreut jeden Nachbarn an, den wir trafen. Jetzt weiß ich kaum, wie ich sie anfassen soll, damit nur nicht die genähte Sehne riss oder das genähte Fleisch. Ich setze mich neben sie und massiere ihre Ohren. Sie seufzt vor Wohlbehagen. Ihre Augen sind rotgerändert. Endlich lässt sie den Kopf sinken, schnauft kräftig aus und schließt die Lider.
Seit Du weg bist, fahre ich alle zwei Tage zum Tierarzt, manchmal jeden Tag. Vorher zittern meine Knie vor Aufregung. Selbst auf der kurzen Fahrtstrecke könnte es geschehen, dass ich scharf bremsen muss, und der Hund mit der zusammengenähten Sehne darf doch nicht durchgeschaukelt werden. Haben wir es wieder heil nach Hause geschafft, so breite ich ihr das Bett im Schatten aus, lege sie dort ab und lasse sie ihr Futter im Liegen fressen.
Fast den ganzen Tag sitze ich neben ihr auf der Terrasse des Hauses, das Du und ich zusammen gebaut haben, und schaue auf den breiten Fluss, an dessen Ufer wir dieses Glücksgrundstück zufällig entdeckt hatten. Der Hund rührt sich kaum. Mein weiter Blick auf Himmel, Wasser und Wald wird nur von Ligusterhecken, Kastanienbäumen und Staudenbeeten begrenzt. Ich höre kein Auto, aber den Kuckuck, der im Kirschbaum des Nachbarn sitzt. Ich sehe keine fassadenhohen Werbeplakate, keine schnell vorbeiwischenden Farben und Konturen, sondern verfolge einen einzelnen Fischreiher, wie er vorbeisegelt. Ein Paradies, das sagt jeder, der die paar Kilometer aus dem Stadtzentrum zu uns hinausfährt.
Mein Auszug ist um vier bis fünf Wochen aufgeschoben. Solange werde ich hier allein leben, mit meinem kranken Hund und ohne Dich. Ob Du in ein Hotel gezogen bist, bei Deiner Freundin nächtigst oder bei Deiner Ehefrau, interessiert mich nicht mehr.
Die Kisten, die ich für meinen Auszug schon gefüllt hatte, habe ich teilweise wieder ausgepackt, der Rest stapelt sich in meinem Schlafzimmer. Es lohnt sich nicht, die Sachen zurück in den Schrank zu räumen. Nur das Bett ist in der neuen Wohnung geblieben, aber das macht nichts, weil ich ohnehin weiter meine Matratze ins Wohnzimmer schleppe, um neben meinem Hund zu schlafen.
Außer meiner Lieblingssendung schaue ich abends nicht mal mehr fern, sondern hülle mich in meine Wolldecke und setze mich zur Abwechslung auf die Gartenbank, lausche den klaren, lauten Gesängen von Nachtigallen und Amseln, die von keinerlei Stadtgeräusch übertönt werden.
Nicht nur mein Hund ist krank – ich bin es auch. Ich bin so dünn geworden, dass jeder erschrickt, der mich lange nicht gesehen hat. Hin und wieder muss ich weinen, weil ich gescheitert bin.
Der Frühling ist in diesem Jahr viel zu trocken, die Temperaturen fast sommerlich. Schon jetzt im Mai muss der Garten jeden Abend gewässert werden. Das werde ich beibehalten, bis ich ausgezogen bin, denn ich möchte die Blumen, von denen viele gerade erst Knospen bilden, nicht vor meinen Augen verdorren sehen.
Die kaukasischen Vergissmeinnicht unter den Hortensien pflanzte ich erst letztes Jahr – sie haben riesige, schön gezeichnete Blätter, über denen die winzigen, hellblauen Blüten schweben. Im Gestrüpp unter der Zierkiefer gehen zum ersten Mal die Maiglöckchen auf, und ich bücke mich oft, um daran zu schnuppern. Ein dunkelglitzernder Star hüpft über den Rasen und piekt seinen Schnabel ins Gras. Eine Flotte Kindersegelboote schwappt vorbei, sie sehen aus wie ein Schwarm weißer Schmetterlinge. Das Motorboot des Trainers folgt ihnen.
Der Postbote taucht hinter der Hecke auf, blinzelt mir zu und reicht die Briefe über das Tor. Wir kennen uns lange genug, um manchmal gar nichts mehr zu sagen, dann winken wir einander nur zu. Von Dir weiß er nur den Namen, der auf den Briefumschlägen steht.
Mein Hund muss furchtbare Schmerzen haben. Manchmal nehme ich mir ein Kissen und lege mich hinter sie auf ihr Bett, so dass wir beide in gleicher Augenhöhe über Rasen, Uferkante und das Wasser schauen, sie meinen Herzschlag spürt und ich ihren warmen, glatten Rücken. „Kontaktliegen“, heißt das in der Tierpsychologiefachsprache.
Dass Dein Raum da oben leer ist, macht nichts, im Gegenteil. Ich gieße Deine beiden Orchideen, mein Blick streift im Vorbeigehen über geschäftliche Schreiben, die Du nie wegsortierst. Auf dem Dielenboden bilden sich Staubmäuse, aber ich sehe nicht, weshalb ich für Dich noch den Staubsauger hochschleppen soll. Der Haushalt fährt auf Sparflamme, nur die Hecken habe ich geschnitten, die werden sonst zu hoch.
Wer soll das machen, wenn ich nicht mehr hier bin? Wer wird Unkraut jäten, im Frühjahr den Hortensien die vertrockneten Blütenköpfe abschneiden? Wer wird den Efeu im Zaum halten, den Giersch zurückdrängen, wer düngen, gießen, verstaubte Spinnweben unter dem Dach wegfegen, die Regenabflussrohre reinigen? Du eher nicht, denn Du zertrittst blicklos frisch gepflanzte Stauden und gräbst ohne Rückfrage einen teuren Zwergahorn aus, um ihn dann mit nacktem Wurzelballen bei dreißig Grad in der Sonne vertrocknen zu lassen.
Ich gebe zu, dass es mir eine gewisse Genugtuung bereitet, mir vorzustellen, wie Du Dich von Fast Food ernähren wirst und um Dich herum das Chaos immer größer werden wird. Es wird ein paar Wochen dauern, bis Du es bemerken wirst. Dann wird kein Kaffee mehr da sein, kein Waschmittel. Dann wirst Du Dein Fertigpesto nicht mehr finden und schon gar nicht das amerikanische Müsli, das ich Dir regelmäßig gebacken habe. Dann werden die Kalkflecken im Bad gelb und die Fensterscheiben trübe. Ameisen werden bis in die Küchenoberschränke vorgedrungen sein. Aber diese Genugtuung wiegt nur wenige Gramm gegenüber der Tatsache, dass ich geglaubt habe, dass dieses Haus meine Heimat für immer sein würde.
Seit Du weg bist, mache ich tatsächlich nichts, sitze nur da, behüte meinen Hund, schaue hinaus und rieche die Blütenluft. Wenn Wind aufkommt, segeln tausend rosa Blättchen von dem Zierapfelbaum zwei Grundstücke weiter. Der weite Blick nach vorn ist immer gleich, aber vor meinem inneren Auge zieht unsere Geschichte vorbei. Wie aus einer späten Liebe so ein heilloses Desaster werden konnte, zeichnet sich darin ab. Ich mag mich nicht mehr gern daran erinnern, weil alles von heute aus gesehen einen bitteren Beigeschmack hat.
Zwei
Wir begegneten uns vor zehn Jahren am Rande einer Pressekonferenz, mit der ich weiter nichts zu tun hatte. Ich begleitete lediglich eine Freundin, die als Fotografin gebucht worden war. Fünf Minuten vor Beginn nahm ich eine Tasse Kaffee vom Buffet und balancierte sie samt Untertasse durch eine schwere Glastür hinaus, um draußen noch schnell eine Zigarette anzuzünden.
Dich sah ich nicht kommen, hörte nur plötzlich ganz nah bei mir jemanden rufen: „Das ist ja nett, dass es hier Kaffee gibt!“
Dann nahm mir dieser Mann die Tasse aus der Hand und hob sie an seine Lippen. Über dem Tassenrand schauten mich helle, kluge, schalkhaft glitzernde Augen an.
Ich war dermaßen aus dem Konzept gebracht, dass ich nur stottern konnte: „Ist aber kein Zucker drin!“
Das machte Dir nichts. Erst jetzt nahm ich wahr, dass Du groß warst und gut aussehend. Du trugst ein helles Jackett, und eine Lesebrille steckte in der Hemdtasche darunter. Unter Deinem Arm klemmte eine rote Aktenmappe.
„Solange Sie meinen Kaffee halten, kann ich mir ja endlich eine Zigarette anzünden!“, antwortete ich mit leichter Verzögerung und kramte grinsend in meiner Tasche nach der Schachtel und dem Feuerzeug.
„Gern würde ich auch die mit Ihnen teilen, aber ich muss jetzt leider rein.“ Mit diesen Worten reichtest Du mir die Tasse zurück.
Du hast dermaßen warm gelächelt, dass ich mich von einer Extrasonne bestrahlt fühlte. Zuletzt nahm ich noch wahr, dass Du in Begleitung warst. Vier Herren in Anzügen baten Dich mit unterdrückter Dringlichkeit höflich hinein. Du schautest Dich nach mir um, und ich lächelte zurück.
Dass Du der Hauptgrund für die Pressekonferenz warst, begriff ich, als ich mich nach einigen Minuten hinein schlich und Dich vorn am Pult in der Mitte sitzen sah, flankiert von zwei Damen, die von den Journalisten wenig gefragt wurden. Während Du seriöse Antworten gabst und das kleine Publikum zum Lachen brachtest, begegneten sich unsere Blicke immer wieder, bis ich das Gefühl nicht mehr loswurde, dass wirklich etwas passiert war.
Nach der Pressekonferenz wartete ich draußen, bis meine Freundin ihre Sachen zusammengepackt hatte. Ich sah auch Dich heraustreten und beobachtete, wie sich sofort eine Menschentraube um Dich bildete. Aber dann hast Du Dich entschuldigt, sie alle stehengelassen, kamst quer über den Vorplatz auf mich zu.
„Freut mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben!“, sagtest Du, und Dein ganzes, schönes, schmales Gesicht war mir zugetan.
„Das kann ich nur zurückgeben“, antwortete ich ebenso überförmlich.
Dann lachten wir beide.
Zu meiner Überraschung hatte ich plötzlich Deine Visitenkarte in der Hand. Verlegen suchte ich in meinem Portemonnaie nach meiner eigenen. Als ich sie Dir reichte, drücktest Du kurz meine Hand. Dann kam ein Mann auf Dich zu, wies auf eine geparkte, dunkle Limousine, eilte vor und öffnete Dir die Wagentür. Bevor diese zuschlug, sah ich noch Deinen winkenden Arm.
Im Auto meiner Freundin seufzte ich: „Ich glaub, ich habe mich in diesen Mann verschossen.“
„Vergiss es. Er ist dreißig Jahre verheiratet. Kannst Du bei Wikipedia nachlesen.“
Heute ist es so schwül, dass möglicherweise endlich Regen fällt. Von unserer Terrasse aus kann ich kilometerweit in den blassblauen Himmel gucken. Schon am Vormittag zieht er sich zu, Wolken stapeln sich übereinander und scheinen heiße Luft nach unten zu drücken.
Mein Viech liegt neben mir auf ihrem Bett im Schatten und hechelt, aber ich darf sie wegen der Schiene um den Hinterlauf nicht schwimmen schicken, der Verband soll ja nicht nass werden. Ich habe etwas Buttermilch mit einem Teelöffel Leberwurst verquirlt, es in Schälchen gefüllt und eingefroren. Das Eis kriegt mein Hund, um sich abzukühlen, und auch, damit sie im Liegen eine Weile beschäftigt ist.
Ein ferner Donner grollt, die blassen Wolken schieben sich zusammen und verdunkeln. Eine scharfe Windböe wirbelt durch die Kastanienblätter. Während es anfängt zu sausen und Staub auffliegt, sammele ich draußen schnell alle Sitzkissen ein. Statt ins Haus zu flüchten, lege ich das Bett meines Hundes hinter die Schwelle der Terrassentür, drapiere alle Sitzkissen drumherum und mache es uns dort hinter der offenen Terrassentür gemütlich. Mein Viech kommt bereitwillig angehumpelt und lässt sich mit einem Seufzer nieder. Über uns beide klappe ich den großen, blauen Regenschirm auf, so dass er als eine Art Markise fungiert, und setze mich eng an meinen Hund.
Dann schauen wir uns das Inferno aus Heulen, Pfeifen, Donnern, Blitzen und Rauschen an, und ich beobachte, wie die Nasenlöcher meines Hundes sich ständig fein bewegen. Sie saugt laufend den feuchten Wind und seine Gerüche ein.
Wieder hat ein Segelboot es nicht rechtzeitig ans Ufer geschafft und kentert in dem jetzt schäumenden, schwarzen Wasser. Ein orangerotes Rettungsboot nähert sich mit Blaulicht und Höchstgeschwindigkeit.
Auf der Terrasse bildet sich eine Pfütze, wir kriegen ein paar Regenspritzer von unten ab. Und kaum, dass die aus dem Himmel stürzenden Fluten etwas nachlassen, hüpfen schon die ersten Amseln auf den Rasen, um nach Regenwürmern zu picken.
Der Hund und ich gucken, horchen und riechen nur und sagen kein Wort.
Die Luft ist jetzt herrlich kühl und feucht. Vorsichtig schüttele ich den Regenschirm ab und klappe ihn zusammen. Anstatt wie sonst nach solchen Gewittern nach den Regenrohren rund ums Haus zu schauen, die Bioabfall aus den Dachrinnen schwemmen und schnell verstopfen, rühre ich mich nicht, schaue nur zu, wie der Wald am Ufer gegenüber dampft.
Mit zehn Jahren Verspätung fällt mir auf, dass man es auch als übergriffig bezeichnen könnte, als Du mir, einer Fremden, ohne Vorwarnung die Tasse aus der Hand nahmst.
Es gab damals weitere Gründe, die Begegnung mit Dir zu vergessen und Deine Visitenkarte in kleine Stücke zu zerreißen: Wir spielten nicht in derselben Liga. Während Du eine landesweit anerkannte Führungskraft warst, war ich nur ein lächerlicher Freiberufler, der mit Klauen und Zähnen an seiner Freiheit hing. Der Preis dafür war, dass ich zwar einige wenige Erfolge vorzuweisen hatte, aber auch ein mit zweitausend Euro dauerüberzogenes Konto, das ich niemals mehr würde auf Null bringen können, denn der große Durchbruch war nicht eingetreten.
Ich war neunundvierzig, die Wechseljahre hatten noch nicht begonnen, aber ich hatte mich schon damit abgefunden, dass ich meinen Existenzkampf nicht mehr gewinnen und mein Lebensweg über kurz oder lang zum Sozialamt führen würde. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich allein altern würde, lag bei nahezu hundert Prozent.
Selbst wenn ich ganz hübsch war und nicht blöde, galt ich auf dem Markt der suchenden Herzen als Ladenhüter. Jeder nur halbwegs vernünftige Mann würde sich angesichts meiner in einer Online-Partnerbörse aufgeführten Daten sogleich fragen: „Wieso sitzt diese Dame mit fast fünfzig noch auf keinem grünen Zweig?“ Es meldeten sich einige sehr alte Männer, die mir eine Versorgungsheirat anboten, wenn ich sie dafür bis in den Tod pflegte.
Ihnen schrieb ich freundliche Absagen und lebte weiter von Monat zu Monat, wohl wissend, dass es klüger gewesen wäre, für die Zukunft vorzusorgen, das konnte man ständig in der Zeitung lesen. Leider musste ich den Zusatzrentenvertrag, den ich abschloss, ein Jahr später wieder auflösen, weil ich die Raten nicht mehr zahlen konnte. Bis jetzt hatte es immer gerade eben gereicht, doch je facettenreicher das Internet wurde, desto schneller ging es mit meiner Branche bergab. Manchmal konnte ich tagelang an nichts anderes denken als an Geld. Mehrfach rettete mich der Sachbearbeiter meiner Bank vor dem Hungertod, in dem er eine Baranweisung über fünfzig Euro unterschrieb, die durch keinerlei Einnahmen abgefangen werden würden. Heute, fünfzehn Jahre später, würde der Algorithmus meiner Online-Bank solche Gnadenakte strikt verweigern.
Die Vermieter meiner hübschen Wohnung waren alt, würden bald senil werden. Spätestens dann würde eine Verwaltung das Haus übernehmen. Die sehr günstige Miete würde von der Firma augenblicklich erhöht werden, denn sie lebte ja vom prozentualen Anteil dessen, was Mietshäuser abwarfen. Ich hauste also auf Treibsand wie viele in der Großstadt. Jederzeit konnte mir mein Nest abhandenkommen. Mit meinem Einkommensbescheid würde mir niemand eine hübsche Wohnung geben, schon gar nicht gegen eine kleine Miete.
Aber diese Sorgen trug ich nicht zur Schau. In meinem Mietshaus und im Viertel kannte ich viele Leute und grüßte in alle Richtungen. Ich will mich nicht selbst loben, oder vielleicht doch: Jedenfalls denke ich, dass die meisten Menschen, die mich kannten, sich freuten, wenn sie mir im Aufzug oder im Zeitschriftenladen um die Ecke begegneten. Für ein Schwätzchen war ich immer zu haben, außerdem hatte ich mir geschworen, nicht zu verbittern, wollte nicht eines Tages mit scharfen Falten, niedergeschlagenem Blick und abweisender Haltung herumlaufen wie manche ältere Herrschaften, die meinten, das Schicksal sei ihnen etwas schuldig geblieben.
Das schlechteste Beispiel, dem ich einmal begegnet bin, war ein Blinder, erst dreißig Jahre alt. Er war der Freund eines Freundes und hatte im Alter von zwanzig bei einem Unfall sein Augenlicht verloren. Noch nie zuvor hatte ich mit einem Blinden direkten Kontakt gehabt und wollte möglichst alles richtig machen. Zu dritt saßen wir um einen Kaffeetisch, und ich achtete darauf, mein Wasserglas nicht innerhalb seiner Reichweite abzustellen. Doch man konnte ihm nichts Gutes tun – sein Grundton war gereizt. Er hetzte über Pflegekräfte und Behördenstreitigkeiten, redete den Weltuntergang herbei. Langsam bekam ich ein schlechtes Gewissen, weil ich über meine volle Sehkraft verfügte und er nicht. Als er versehentlich mit dem Finger an seine eigene Kaffeetasse stieß, fluchte er wie eine Furie. Seine Lider waren ständig gesenkt, ich fürchtete mich regelrecht, in seine toten Augen zu schauen. In seiner Nähe verbrannte jegliche Heiterkeit und Leichtigkeit, krumpelte sich zusammen wie glühendes Papier, zurück blieb Asche und ein bisschen Rauch.
Da fällt es nicht schwer, eine Überleitung zurück zu Dir zu finden. Die Zeiten, da wir uns vor Lachen gebogen haben, liegen weit zurück.
Nach unserer ersten Begegnung hatte ich Dich zwar nicht vergessen, aber schnell mit Dir abgeschlossen, denn das Gefälle zwischen uns war einfach zu groß. Vielleicht hatte ich noch ein paar Tage unterirdisch gehofft, es werde sich ein Zauber ereignen, aber jeder Morgen begann wie üblich: Ich schlug die Augen auf und sah zuerst Geldsorgen. Dann raffte ich mich trotzdem auf, und versuchte, aus nichts etwas zu machen. Und wenn ich soweit war, alle fünf Minuten online mein Konto zu überprüfen, in der absonderlichen Hoffnung, jemand könne versehentlich eine Million Euro darauf überwiesen haben, zog ich mir flache Schuhe an und wanderte zwei Kilometer bis zum nächsten Park. Mir war kaum bewusst, dass ich nie in die Mitte der Stadt strebte, immer nur in die grünen Oasen.
Meinen geheimsten und größten Wunsch hatte ich noch nie jemandem offenbart, denn er erschien lächerlich angesichts der Karrieren, die man heutzutage machen konnte, und die ich nicht gemacht habe, obwohl man mir Bestreben nicht absprechen kann. Doch jetzt ging es mir längst nicht mehr um den großen Durchbruch. Für den hoffentlich noch langen Rest meines Lebens wäre ich glücklich gewesen mit einem Mann, einem Haus und einem Hund.
Ein einziges Mal gab ich Deinen Namen in eine Suchmaschine ein, doch es kam mir vor wie eine niedrige Form von Stalking. Ich schloss das Browserfenster und widmete mich meinem Tagwerk. Als ich einige Wochen später Deine Mail entdeckte, die nichts weiter als ein kurzer Gruß war, konnte ich vor Schreck nicht vor dem PC sitzenbleiben. Mein Herz wurde zum Schlägel eines Gongs. Nur mit äußerster Selbstbeherrschung gelang es mir, nicht augenblicklich zu antworten.
Ich trat dann eine besonders lange Stadtwanderung an. Doppelstöckige Busse zischten an mir vorbei. An Kreuzungen rannten die Passanten bei Grün über die Straße und ich rannte mit, bog in Seitenstraßen ein, lächelte einem alten Herrn zu, der nur in Trippelschrittchen vorwärtskam, und fiel in einen flotten Geh-Rhythmus, der mir auch heute noch am leichtesten fällt, wenn ich mit meinem Hund auf den Feldern unterwegs bin.
Nebenbei formulierte ich im Kopf verschiedenste Antworten und spürte, dass sich bestimmte Sätze immer wieder aufdrängten. Ich schob alle weg und beschloss, Dich mindestens einen Tag lang warten zu lassen. Doch wahrscheinlich hast Du gar nicht gewartet, inzwischen weiß ich, wie dicht Deine Termine getaktet sind, wie viele Reden und Vorträge Du vorbereiten musst.
Jedenfalls setzte ich mich am nächsten Morgen aufrecht hin und schickte Dir eine glasklare, unmissverständliche Mail, die sich jegliches Drumherum sparte. Keine Ahnung, ob Dich meine Worte amüsiert haben. Jedenfalls schrieb ich Dir, dass Du meinem Lächeln nicht ansehen konntest, welche ausgesprochen eigenwillige, stolze Frau dahinter steckte, und dass ich ein Mikropartikel des sogenannten Großstadt-Prekariats darstellte, um genau zu sein: Nahezu ständig zahlungsunfähig war. Dann dankte ich Dir noch für die sehr nette Begegnung und wünschte Dir eine schöne Zukunft.
Es kostete mich keinerlei Überwindung, diese Mail abzuschicken, sie war sorgfältig durchdacht. Ich gab Dir damit die Chance, Dich nie wieder zu melden und wäre darüber nicht einmal sonderlich enttäuscht gewesen, denn Du warst ja obendrein verheiratet. Zudem wollte ich mich vor einer viel größeren Enttäuschung schützen, die unweigerlich auf mich zugekommen wäre, wenn Du erst nach und nach begriffen hättest, wie blank ein Mensch sein konnte, der auf den ersten Blick gut angezogen und gepflegt erscheint. Da, wo Du unterwegs warst, hatten die Frauen überwiegend ihr eigenes Geld, waren Ehefrau oder Professorin.
Es kam, wie ich vorausgesehen hatte: keine Antwort-Mail von Dir. Damit war das Kapitel für mich abgeschlossen. Manchmal dachte ich noch an diese erfreuliche Minute unseres Augenkontaktes. Die Bilder verblassten so langsam, dass ich es kaum merkte.
Im Herbst zogen die Stadtbewohner wieder ihre dunklen Sachen an. Die Nacht brach früher herein, und ich begann mich auf mein Winterleben einzurichten: Viel am Schreibtisch, lange Spaziergänge durch graue Kälte, abends Jogginghose und Fernsehprogramm, ausgedehnte Telefonate mit Freundinnen, die bei Minustemperaturen auch keine Lust hatten, im Dunkeln allein an der U-Bahn zu stehen, um zu irgendeiner Veranstaltung zu fahren, damit sie unter Menschen kamen. Und immer diese unbestimmte Unruhe, was eigentlich werden sollte, wohin ich trieb, und das Wissen, wie verletzlich und ausgeliefert ich ohne Geld war und im nicht mehr so fernen Alter weiter werden würde.