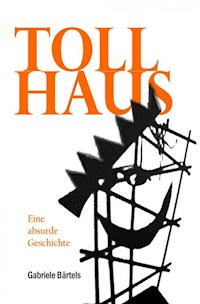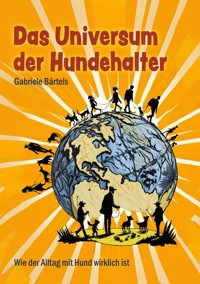Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Großstadt sind so viele einsam, aber man sieht sie nicht. Die Protagonisten dieser achtzehn surrealen, tragikkomischen bis magischen Geschichten kämpfen mit diesem Gefühl, richten sich darin ein, schaffen sich ihre eigenen Welten. Ob es der Verbrecher ist, der sich von einer alten Dame austricksen lässt, oder der Mann, der auf eine Schauspielerin lauert, der Modelleisenbahner oder die Königin der Nebelkrähen: Unbemerkt strudeln diese Großstadtbewohner durch ihr Leben, kurz vor dem Untergang. Alle Geschichten, so unterschiedlich sie sind, haben einen düsteren Unterton und eine überraschende Wendung. Dicht und spannend erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verschüttet
von Gabriele Bärtels
Verschüttet
Geschichten über Einsamkeit
Gabriele Bärtels
Berlin, 2021 © 2021 Gabriele Bärtels
Umschlaggestaltung: Gabriele Bärtels
gabriele-baertels.de
Alle Rechte vorbehalten.
Der Verbrecher
Amoklauf
Vögelchen
Verschüttet
Alles wie immer
Der erste Fremde
Der Ohrring
Dessous
Hotel Seehof
Schilder
Venezianischer Karneval
Kronzeugen
Das Schiff
Hass
Insekten
Maßstabsgetreu
Nebelkrähen
Sonnengott
Über die Autorin
Der Verbrecher
An einem kalten Wintertag um sieben Uhr früh trat der Verbrecher ins halbdunkle Treppenhaus und musterte die Briefkästen. Einige waren leer, aus anderen wucherten Werbezettel. Auf der Erde lagen ausgetretene Kippen und der Fußabtreter vor der ersten Stufe bestand nur noch aus einem Gerippe von Seilen. Der Verbrecher stieg die Treppe hoch. Vorbei an einer Tür, aus der Posaunenklänge drangen, vorbei an Namensschildchen aus Emaille und Ton, vorbei an Gummistiefeln und leeren Flaschen. Er atmete etwas schneller, als er im fünften Stock angekommen war.
Vor der rechten Tür blieb er stehen. Auf der Glasscheibe befand sich ein Aufkleber. Hier wache ich, stand unter der Zeichnung eines schwarzen Hundekopfes. Der Verbrecher zog eine Sprühdose aus seiner Jackentasche. Bevor er klingeln konnte, schlug der Hund an.
Aus einem entlegenen Zimmer der Wohnung rief eine alte Frauenstimme: "„Bajazzo!“ Der Hund bellte weiter. „Ich komme,“ rief die Frau.
Der Verbrecher trat einen Schritt zurück und wartete. Das wütende Kläffen füllte das stille Treppenhaus mit kurzen, keuchenden, hallenden Lauten.
Endlich drehte sich ein Schlüssel im Schloss und die Tür ging einen Spalt auf. Dazwischen drängelte sich der bärtige Kopf eines lackschwarzen Riesenschnauzers. Aus dem dunklen Rosé seiner Maulhöhle leuchteten weiße Zähne. Er knurrte.
Der Verbrecher richtete die Sprühdose auf den geifernden, hochspringenden Hund. Ein dichter, feiner Nebel entwich und legte sich dem Hund um den Kopf, so dass dieser augenblicklich zu jaulen anfing, eine Pfote hob und versuchte, sich die Augen auszuwischen. Als ihm das nicht gelang, warf er sich auf den Teppich, wälzte sich hin und her und rieb seinen Kopf an der Wolle. Der Verbrecher stellte einen Fuß in die Tür. Sie schwang langsam auf.
Er schaute auf das Tier hinab. Neben seinem sich windenden Körper standen die zwei nackten, krummen Füße einer alten Frau. Die Nägel ihrer großen Zehen waren braun und krümmten sich wie Echsenrücken.
„Sie sollten zur Fußpflege gehen,“ sagte der Verbrecher und trat ein. Er schob die Frau zur Seite und warf die Tür hinter sich ins Schloss.
Die Frau fiel neben dem Hund auf die Knie: „Bajazzo, Bajazzo!“, stotterte sie.
Der Hund hörte sie nicht. Er hechelte und schüttelte den Kopf, als habe er einen Fliegenschwarm im Ohr. Der Blick der Frau glitt von den Hosenbeinen des Verbrechers hoch in sein Gesicht.
Sie fragte mit einer anderen, tiefen Stimme: „Was wollen Sie?“
Er lehnte sich gegen die Tür, zog eine Zigarette aus der Tasche, fummelte das Feuerzeug heraus, zündete sie an und zog ihren Rauch tief in seine Lungen. Das tat er zweimal, sein Gesicht beruhigte sich, er lächelte fast, als er die Asche auf den Teppich fallen ließ.
„Ich will Geld.“
Noch immer schaute er auf ihre Füße. Die alte Frau erhob sich mühsam. Sie zeigte mit einem krummen Finger auf ihn.
„Sie sind ein Verbrecher“, sagte sie zur fallenden Asche und machte einen Schritt vor. Mit der rechten Fußsohle zerrieb sie das graue Röllchen in den Teppich. Eine schwarze Spur blieb übrig. Der Verbrecher ließ die Zigarette danebenfallen und trat sie aus.
Die alte Frau trug einen Morgenmantel, dessen Kragen sie nun hochschlug. Sie musste über siebzig sein, aber ihr Rücken war ungebeugt.
Warmes Licht leuchtete den quadratischen Flur aus, von dem vier Türen in Küche, Bad und zwei Zimmer führten. Sie standen alle offen, in der Küche keuchte eine Kaffeemaschine, im Wohnzimmer dudelte leise ein Radiosender, das Doppelbett im Schlafzimmer war zerwühlt und auf der unbenutzten Seite lag eine rotkarierte Hundedecke. Im Badezimmer hing ein feuchtes Handtuch über der Heizung. Es roch nach Duschbad, Kaffee und nach einer Nacht voller tiefer Atemzüge.
Der Hund hatte sich winselnd unter dem Bett verkrochen. Die Frau drehte dem Verbrecher den Rücken zu und ließ ihn stehen. Im Bad griff sie nach dem Handtuch, ließ Wasser darüber laufen und ging quer über den Flur ins Schlafzimmer, als wäre das Brandloch nicht im Teppich, als lehne der Verbrecher nicht an der Wand, als hätte es nie geklingelt. Sie brachte den Hund mit einer Mischung aus rauen Befehlen und zärtlichen Lockungen unter dem Bett hervor, hielt seinen Hals im Klammergriff und wischte ihm mit dem Handtuch die Augen aus.
Der Verbrecher stand noch immer im Flur und musterte die Wände. Neben ihm hing ein Bild mit einer Dünenlandschaft, über der die Sonne auf- oder unterging. Er hob das Bild mit dem Finger zwei Zentimeter an, und als der Haken sich von der Wand gelöst hatte, zog er seinen Finger weg. Das Bild fiel krachend herunter und der Rahmen zerbrach. Die Frau hob kaum den Kopf.
Der Verbrecher trat auf die noch heile Glasscheibe, es splitterte. Das Bild darunter wurde zerrissen und zerknickt.
„Sie sollten Schuhe anziehen,“ sagte er zu der Frau, die dem Hund noch einmal beruhigend auf den Hals geklopft hatte. Sie erhob sich vom Bettrand.
„Möchten Sie Kaffee?“, fragte sie. „Ich mache jeden Morgen zu viel.“
Der Verbrecher antwortete lange nicht. Schließlich sagte er: „Ich trinke nur Tee.“
„Ich kann auch Tee kochen.“ Sie hob ein paar Kleidungsstücke von einem Stuhl. „Sie werden nichts dagegen haben, dass ich mir etwas anziehe,“ stellte sie fest, machte einen Bogen um die Scherben am Boden und schloss die Tür des Badezimmers hinter sich.
Der Verbrecher zog seine Jacke aus und hängte sie auf einen Haken an der Garderobe.
„So bunt!“, sagte er und strich über rote, grüne, blaue und gelbe Jackenärmel.
Der Hund schaute unter dem Bettrand hervor. Mit wenigen Schritten war der Verbrecher im Schlafzimmer und trat nach der bärtigen, schwarzen Schnauze.
„Verpiss Dich, Töle,“ sagte er laut.
Er ließ sich auf das Bett fallen und legte sich mit über dem Kopf verschränkten Armen nach hinten. Etwas juckte ihn am Kinn, er fuhr darüber und fand ein weißes Haar zwischen den Fingern. Er schüttelte es schnell ab und verzog das Gesicht.
Die Wände des Schlafzimmers waren vertäfelt. Dazwischen standen Schränke aus dem gleichen, dunklen Holz. Der Verbrecher zog eine Schublade auf und kippte ihren Inhalt auf den Boden. Taschentücher, Postkarten, Wäscheknöpfe und ein Buch fielen auf die Erde. Aus einer zweiten Schublade kullerten weiße Socken wie Wollknäuel.
Der Verbrecher griff nach einem und zog es auseinander.
„Die passen mir,“ sagte er und streifte seine Schuhe ab.
Die Strümpfe, die darunter zum Vorschein kamen, waren an Ballen und Fersen so dünn, dass die Hornhaut durchschimmerte.
„Und feucht sind sie auch noch,“ sagte der Verbrecher, zog sie aus und warf sie hinter sich.
Nachdem er die frischen Socken angezogen hatte, schob er die Schuhe nebeneinander unter den Rand des Bettes und stand auf. Er öffnete alle Schränke, riss alles heraus, warf alles auf den Boden.
Er bemerkte nicht, dass die alte Frau schon eine Weile im Türrahmen stand und ihn beobachtete. Der Haufen ihres Eigentums wurde immer höher, und die einzelnen Teile waren immer schwerer auseinanderzuhalten. Da krümmten sich Drahtbügel um Hosenbeine und Rüschenkragen. Spitzenträger ringelten sich um Kabel von Bügeleisen, Frotteeberge türmten sich, von Laken durchzogen, Gürtel schlängelten sich zwischen Knopfdosen und klickten mit ihren Verschlüssen aneinander. Glasketten blitzten zwischen rotem Stickgarn, und Bücher blätterten sich auf wie Seerosen am Morgen.
„Der Tee ist gleich fertig,“ sagte sie und der Verbrecher sah hoch.
Zum ersten Mal schaute er in ihre Augen, blaue, klare, blitzende Augen über einem breiten, roten Brillengestell, das ein schmales Gesicht umklammerte. Er glitt von ihrem ruhigen Blick ab, als hätte er den Halt verloren. Die alte Frau trug nun weiße Hosen, mit einem gestreiften T-Shirt darüber, sie hatte die Haare zu einem Zopf geflochten, ein schweres, grobes, weißgoldenes Kettenarmband rutschte ihr fast vom dürren Handgelenk. Der Blick des Verbrechers blieb daran hängen.
„Das will ich haben,“ sagte er und streckte seine Hand aus.
Die Frau drehte sich um und ging in die Küche. Der Verbrecher folgte ihr. Er stieß gegen die Lampe, die über dem Tisch hing, und der Lichtschein schaukelte hin und her.
„Ich habe nur Teebeutel,“ sagte die Frau zu dem kochenden Wasser und übergoss diese damit.
Der Verbrecher sagte: „Das Armband.“
Die alte Frau öffnete den Verschluss und die schwere Kette glitt von ihrem Handgelenk auf die Anrichte, wo es zusammengeringelt liegenblieb.
Der Verbrecher griff nicht danach, sondern legte seine großen Hände neben ein Messer auf dem Tisch. Sie schoben einen Teller beiseite. Die Rechte und die Linke nahmen einander in die Hand, streichelten sich, lösten sich wieder. Ein Zeige- und ein Ringfinger trommelten auf der weißen Tischplatte, blieben liegen, zuckten einmal hoch. Die Hände falteten sich zusammen und die Fingerknöchel wurden weiß. Die Linke griff nach dem Messer und ritzte einen langen Strich in die Platte, dann noch einen, quer dazu. Die alte Frau stellte die Teekanne daneben, der Verbrecher berührte mit dem Handrücken das heiße Porzellan und zuckte zurück. Das Messer fiel mit einem Klirren auf die Kacheln. Aus dem Schlafzimmer bellte der Hund.
Er bückte sich und hob das Messer auf.
Die alte Frau streckte ihre Hand aus und sagte: „Geben Sie her. Der Boden ist voller Hundehaare. Ich hole Ihnen ein neues.“
Der Verbrecher sah auf die fleckige, braune Hand. Dann legte er langsam das Messer hinein. Seine Finger berührten die alte Haut nicht.
Die Frau griff nach einem Block aus Holz, in dessen Schlitze Messer aller Größen bis zum Heft steckten und zog das längste heraus. Die Schneide war gezackt und blitzte.
„Hier,“ sagte sie und legte es neben ihn auf die andere Seite des Tellers. Sie lächelte. „Du bist doch Linkshänder.“
Der Verbrecher wurde rot. „Duzen Sie mich gefälligst nicht!“, sagte er, sprang so heftig auf, dass der Stuhl nach hinten umkippte und griff nach dem Armband auf der Anrichte. Er ließ es in die Tasche gleiten und sagte: „Das habe ich schon mal.“
Die Frau goss Tee ein. Sie wies mit der Handfläche auf den umgekippten Stuhl und sah den Verbrecher einladend an. Der bückte sich, hob den Stuhl auf und setzte sich. Ihm gegenüber nahm die Frau Platz. Ihre Blicke trafen sich auf gleicher Höhe.
Die Frau goss Kaffee ein. Sie schüttete einen Löffel Zucker nach dem anderen in ihre Tasse, rührte klingelnd um, nahm den Löffel zwischen ihre faltigen Lippen und leckte ihn ab.
„Fünf Löffel Zucker?“, fragte der Verbrecher, hinter jedes Wort ein Ausrufezeichen setzend.
Die alte Frau zuckte mit den eckigen Schultern und griff nach dem Brot. Die Hände des Verbrechers legten sich um die Teetasse, als sei sie ein rohes Ei. Er trank schlürfend, schaute die Frau an und grinste. „Sie glauben doch nicht, dass ich Mitleid mit Ihnen habe.“
Die alte Frau schluckte das Brot hinunter und sagte: „Nein.“
„Wo sind Ihre Sparbücher?“
„Im Wohnzimmer. Zweite Schranktür rechts oben, in einem Spielekasten.“
Der Verbrecher kicherte: „Was haben Sie sonst noch, was sich lohnt?“
Die alte Frau krauste die Stirn.
„Das kommt darauf an, ob Sie mit dem Wagen da sind oder mit dem Bus. Die Stereoanlage, der Fernseher. Ein Gemälde aus dem 18. Jahrhundert. Der Maler wird Ihnen kaum etwas sagen.“
„Was ist mit Schmuck, Bargeld, Schecks?“
„Alles in dem Spielekasten.“
Der Verbrecher stand auf. Das Messer nahm er mit. „Nur zur Sicherheit,“ sagte er.
Die alte Frau räumte den Tisch ab. Schranktüren klappten auf und zu, dann erschien der Verbrecher mit dem bunten Spielekasten wieder in der Küche. Auf dem Pappdeckel klebte das Foto einer Familie, sie ließen lächelnd Würfel rollen. Oben auf lag das Messer. Er stellte den Karton auf den Tisch und öffnete ihn. Er räumte Mensch-Ärger-Dich-Nicht- und Schachspiel-Bretter beiseite, ließ sie einfach fallen, schaufelte mit beiden Händen rote, grüne und blaue Halmafiguren heraus, schwarze und weiße Schachfiguren, einen Würfelbecher, Dame-Steine. Darunter lagen lange Goldketten, ein Ehering, eine Brosche, Reiseschecks und drei blaue Postsparbücher. Der Verbrecher blätterte sie auf, suchte nach der letzten Eintragung, klappte sie wieder zu und sagte: „Yep!“
Die alte Frau reichte ihm eine leere Plastiktüte. Er füllte alles hinein und drückte seine Beute an sich. Die alte Frau stellte die benutzten Tassen in die Spüle. Der Verbrecher räusperte sich.
„Ich gehe,“ sagte er.
Sie nickte und wischte sich die Hände an einem Handtuch ab. Der Verbrecher betrat das Schlafzimmer, setzte sich auf das Bett und zog seine Schuhe darunter hervor. Er stellte seine Füße hinein und beugte sich nach dem unsichtbaren Hund.
„Tschüs, Köter,“ zischte er.
Vor der Garderobe rief er: „Danke für den Tee.“
Er ließ die Tüte auf den Boden sinken, griff nach seiner Jacke und zog sie an.
Als er sich nach der Tüte bückte, traten die nackten Füße der alten Frau leise in sein Blickfeld. Eine Messerklinge blitzte auf.
„Sie könnten mir mal eben helfen,“ sagte die alte Frau auf ihn herunter. „Zu Mittag will ich den Hund braten. Würden Sie ihm das Fell abziehen?“ Ihre Augen schauten ruhig über den Rand der Brille.
Der Verbrecher schlug ihr das Messer aus der Hand und riss die Wohnungstür auf.
Er keuchte, als er die Treppe herunterflog, stolperte, fing sich, brach sich dabei den kleinen Finger, merkte es nicht. Der Hund spitzte die Ohren und lauschte ihm nach. Die alte Frau drückte die Tür zu und hob die Tüte mit ihren Wertsachen auf.
Amoklauf
Ich bin ein durchschnittlicher Großstadtmensch. Einer, den Sie morgens in tausendfacher Ausführung in der S-Bahn, U-Bahn, in den Bussen sitzen sehen können. Morgens riecht die S-Bahn gut. Wir Fahrgäste sind frisch gewaschen, geschminkt, rasiert, fahren im Halbschlaf oder Zeitung lesend in die Nähe unserer Arbeitsplätze und legen den Rest zu Fuß zurück, eine Brötchentüte unter dem Arm. Mit einem Ruck stoßen wir die schweren Glastüren zu unseren Bürogebäuden auf, es sei denn, sie sausen von selbst auseinander. Wir residieren im ersten, zweiten oder dritten Stock und könnten die Etagen nicht auseinanderhalten, wären sie nicht nummeriert. Alles genau wie gestern: Weiße Wände mit Schrammen in Kniehöhe, das verquollene Gesicht des Kollegen, der sich in der Teeküche seinen ersten Magentee braut. Der kaputte Kopierer, der Staubschutz auf der Tastatur, die fünf Handgriffe: Computer einschalten, Fenster auf, Pflanze gießen, Schreibtischlampe ausrichten, Passwort eingeben. Es macht „Kling“. Da bin ich, und ich hasse es. Zumal ich mit einer Kollegin das Zimmer teile, die andere Vorstellungen von frischer Luft hat als ich.
Heute tat ich dann Folgendes: Ich schlug ihr den dämlichen Schädel ein, als sie mich darum bat, das Fenster wieder zu schließen. Dann schloss ich das Fenster, nahm meine Pflanze unter den Arm und verließ meinen Arbeitsplatz für immer. Wie dramatisch mein Abgang war, bemerkte niemand. Die Mitarbeiter in den anderen Büros drehten sich nicht um. Sie dachten wohl, ich hätte einen frühen Außentermin.
Erstaunlich, wie radikal man durch so einen Schritt aus seinen Verhältnissen katapultiert wird. Eben war es noch selbstverständlich, ein Bürger mit einer Zeitkarte für den öffentlichen Nahverkehr zu sein, der das Recht hat, sich an jedem Kiosk der Stadt eine Illustrierte für die Mittagspause zu kaufen. Nun ist nicht mehr sicher, ob der Polizist gegenüber vor dem Zeitschriftenladen steht, weil er alarmiert wurde. Aber den kann man ja abschütteln.
Er kann nicht ernstlich wissen, wer da im grauen Kostüm an ihm vorbeistöckelt. Die langjährigen Kollegen haben es ja nie geahnt. Noch jetzt, da sie ihren zweiten Kaffee trinken, werden sie von mir nur Gutes denken, so hilfsbereit wie ich bin, so zurückhaltend. Die letzte Weihnachtsfeier der Abteilung habe ich organisiert, und alle waren begeistert. Wer weiß, wie lange es dauert, bis jemand die Kollegin im Papierkorb findet.
Heute hatte ich Lust, Amok zu laufen. In meiner Handtasche trage ich eine Pistole, aber ich wollte sie nicht gleich im Büro benutzen. Ich habe Lust, die Stadt leer zu schießen. Die Munition dafür sammele ich schon lange. Meine Handtasche ist ziemlich schwer.
Der Polizist schaut sich PC-Hefte an, oder tut er nur so und observiert mich in der reflektierenden Scheibe? Er muss die Frage nicht beantworten, denn ich klemme die Pflanze unter den Ellenbogen, krame in meiner Handtasche, räume alle Zweifel aus, schieße ihm ins Genick. Er sackt weg, als hätte er einen Stromausfall. Hätte ich nicht gedacht.
Jetzt kreischen schon die ersten drüben an der Bushaltestelle und lassen ihre Supermarkt-Tüten fallen. Es scheint eine Familie zu sein. Ich habe etwas gegen Familien. Paff. Nun gibt es eine weniger. Ihr Blut mischt sich auf dem Asphalt sehr schön. In den Scheiben des Kioskes kann ich genau erkennen, wie fein ich lächele und wie seriös ich auf die Passanten wirke, die nun erstarren, während der Autoverkehr weiterrollt. Nur wenige sind so schlau, nicht mit offenem Mund stehenzubleiben. Die Zähne der anderen fliegen nur so durch die Gegend.
Ich steige eine S-Bahn-Treppe hinauf und verliere mich im Gewühl derer, die hinuntersteigen. Der Bahnsteig steht voller schlagender Herzen. Weit hinten kann man die Reichstagskuppel sehen, aber dann braust der Zug in mein Blickfeld, und ich zögere noch, ob ich mitfahren soll. Der Waggon ist voll und ich werde Mühe haben, alle Fahrgäste niederzumachen, bevor wir die Friedrichstraße erreichen. Ich steige trotzdem ein und als der Zug anruckt, fange ich sofort an. Zuerst die in meiner Nähe, sie kippen um, und so erwische ich auch die ganz hinten. Kann sein, dass jemand gewimmert hat, es ist mir entgangen. Jedenfalls rührt sich zwei Minuten später nichts mehr. Die Pistole, die ich besitze, ist keine Kleinigkeit. Blut läuft an den zerkratzten Scheiben herunter und bildet seltsame Muster. Schade, dass ich keinen Fotoapparat dabeihabe. Friedrichstraße steige ich aus. Auf meinem rechten Pump ist ein roter Spritzer, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich will ein bisschen an der Spree spazieren.
Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und nichts geschafft. Hin und wieder setzte ich sogar meine Büropflanze ab und schoss mit beiden Händen. Von der Kanalbrücke herunter auf das Sightseeing-Schiff und auf dem Gendarmenmarkt einfach im Kreis. Verschiedene Hunde liefen herrenlos herum, manche schleiften ihre Leinen hinter sich her. Einen Augenblick meinte ich, sie würden sich zu einem Rudel formen, mir folgen, aber dann wollte nur ein Pinscher an mir hochspringen. Er flog im hohen Bogen über die Leichen, von denen wahrscheinlich mehr als die Hälfte Touristen waren, wie auch im Hiltonhotel. Ich zog durch Seitenstraßen und kam rechtzeitig zum Schulschluss an einem Gymnasium vorbei, ich glaube, es war ein französisches, jedenfalls hörte ich mehrfach: „Mon Dieu“. Nun machen sie nie wieder Lärm.
Als ich nach Hause kam, brannten hinter allen Fenstern Lichter, und das bedeutete, dass ich erst einen Bruchteil der Einwohner erwischt hatte. Auf meinem Anrufbeantworter blinkte es hektisch. Sechzehn Nachrichten. Ich hörte sie nicht ab. Nach zwei Stunden Schlaf zog ich wieder los, mit frisch geföhnten Haaren. Den Spritzer auf dem Pump habe ich entfernt, die Pflanze gegossen und auf das Küchenfensterbrett gestellt. Im letzten Augenblick nahm ich sie dann doch mit, denn ich werde nicht wieder zurückkehren können. Über kurz oder lang wird man bei mir klingeln. Seit gestern stehen genug andere Wohnungen leer und einige davon haben bestimmt einen gefüllten Kühlschrank und ein frisch bezogenes Bett, weil die Putzfrau gerade da war.
Die Höflichkeit ist von mir abgefallen, nicht aber meine gerade Haltung. Ich sehe es in den Spiegeln eines Friseurgeschäftes in der Goltzstraße, das ich zu diesem Zweck betreten habe. Die Damen wenden sich alle nach mir um, wohl weil ich sehr laut grüße. Als ich sie der Reihe nach von ihren Frisuren erlöse, beobachte ich gleichzeitig, wie ich dabei aussehe. Nicht schlecht. Ich nehme ein Haarfärbemittel aus dem Regal.
Die Straße wirkt schon merklich leerer.
Der Zufall will, dass heute eine Demonstration stattfindet, an Schicksal glaube ich nicht. Es geht um Arbeitslosigkeit und verschiedenfarbige Parteien. Fünfhunderttausend Leute schieben sich auf der Straße des 17. Juni vorwärts. Man kann sich bequem hinsetzen und einen nach dem anderen ins Visier nehmen. Ich habe die Pistole gegen ein Präzisionsgewehr eingetauscht, auf das ich lange gespart habe. Es wartete im Besenschrank, ist geradezu damenhaft schlank und passt unter meinen Mantel. Ich mähte alle nieder.
Es wurde unglaublich friedlich danach. Endlich hörte man mal wieder die Vögel singen. Sogar ein Wildschwein trat hinter der Siegessäule hervor, und sein Schwänzchen wedelte.
Zum Feierabend bin ich dann mit dem Bus in den Grunewald gefahren, nur der Busfahrer und ich lebten noch. Ich wies ihn an, alle Haltestellen anzusteuern, und jedem, der einstieg, raubte ich den Atem, sobald er nach hinten durchgegangen war. Dort stapelten sich Körper, und der Fahrer hatte Mühe, das überladene Fahrzeug zu steuern. Ich wartete höflich, bis wir an der Endhaltestelle waren, aber als er den Motor abgestellt hatte, musste er dran glauben. Es macht Lust, den Türöffnungsmechanismus von Bussen selbst zu bedienen.
Hier standen alte Villen wie überdimensionale Grabsteine in ihren Gärten. Ich suchte mir die schönste aus und klingelte. Es wohnte nur ein Single dort. Die Schlüssel habe ich mir von ihm noch geben lassen. Es hat einen Swimmingpool und wollte wohl gerade in seine Kellersauna. Ich wusch den Dreck des Tages ab und entspannte mich auf den heißen Holzbänken. Das durchlöcherte Single brauchte das nicht mehr.
Morgens hole ich seine abonnierte Tageszeitung herein. Heute ist es ein dünnes Blatt, auf der Rückseite lauter Todesanzeigen von Redakteuren. Auf dem Titel ist nur von mir die Rede, man kennt inzwischen meinen Namen und ein Foto ist auch abgedruckt. Es zeigt mich auf der Weihnachtsfeier, wie der Chef mir gerade Sekt eingießt. Die Leute sollen in ihren Häusern bleiben, schreibt man, rot unterstrichen. Ich betrachte meine Pflanze. Sie steht wieder auf dem Küchen-Fensterbrett und es sieht aus, als würde sie bald blühen. Drei kleine, rosa Knospen haben sich gebildet.