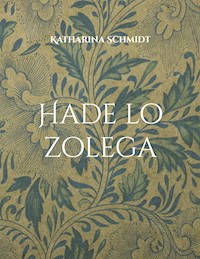Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brandstätter Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Einst war er fixer Bestandteil des menschlichen Daseins und des gesellschaftlichen Alltags: Heute wird der Tod verdrängt, jeder Gedanke an das unweigerliche Ende so lange wie möglich hinausgeschoben. Während Sterbende der High Tech-Medizin überlassen werden und Trauern keinen Platz findet, diskutiert man auf politischer Ebene über die Suizidbeihilfe. Dazwischen stehen Fragen, die uns alle betreffen: Wie wollen wir uns dem Thema Tod wieder annähern? Wie können wir Alte und Sterbende besser versorgen? Und: Wie wollen wir selbst sterben? In ausführlichen Gesprächen mit Ärzten, Pflegenden und Angehörigen sucht die Autorin nach Antworten und kommt zu dem Schluss: Die Beschäftigung mit der eigenen Endlichkeit schärft den Blick auf das Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katharina Schmidt — EINE SONDERBARE STILLE
Katharina Schmidt
EINE SONDERBARE STILLE
Warum der Tod ins Leben gehört
INHALT
WARUM DIESES BUCH
I.„ALS OB NIEMAND STÜRBE“ – DIE MODERNE GESELLSCHAFT UND DER TOD
Die Verdrängung des Todes
„Sie werden sterben“ – der Tod als Angstgegner der Medizin
Die Dinge beim Namen nennen: Kinder und der Tod
Hospizkultur – ein neuer Zugang
Halten statt Heilen – der Weg der Palliative Care nach Österreich
II.DIE STERBLICHKEIT SCHLEICHT SICH AN
Alte Menschen als Last?
„Was nachher ist, das weiß man nicht“ – Familie Haas
„Es gibt vieles, was ich noch machen möchte“ – Katharina F.
„Es hört nicht auf, Chaos zu sein“ – Familie Menzel
III.LEBEN LERNEN AUF DER ZIELGERADEN
Ein würdevoller Tod?
Ein Ort des Übergangs
Reden über das Sterben
„Ich hoffe noch immer, dass ich davonkomme“
Abschiedlich leben durch die Arbeit im Hospiz
Die Expansion als Tod der Hospizbewegung?
IV.UNSANFT ENTSCHLAFEN
Was am Ende wichtig ist
Das Sterben verlängern?
„Eine sonderbare Stille“ – Familie Weise
„Trauer hat viele Gesichter“ – wenn Kinder sterben
V.ÜBER DEN TOD SELBST BESTIMMEN?
Autonomie am Lebensende
Sterbehilfe zulassen?
Was wirklich zählt
WEITERFÜHRENDE LINKS
DANK
ANMERKUNGEN
ÜBER DIE AUTORIN
WARUM DIESES BUCH
Alles sieht genauso aus wie in den vier Wochen zuvor. Die Pappeln am Straßenrand; darunter die grüne Bank, auf der wir noch vor wenigen Tagen in der Sonne gesessen sind und überlegt haben, ob man nun das Konto leerräumen muss; das kleine Eisentor, das angeblich – so warnt jedenfalls das halbverwitterte Schild am Zaun – nur bis 16 Uhr Einlass in das Gelände bietet und doch immer offensteht. Auch der kurze Asphaltweg zwischen Tor und dem halbverfallenen Pavillon, in dem die 4. Medizinische Abteilung des Krankenhauses untergebracht ist, ist wie immer gesäumt von Roten Nacktschnecken. Lebendigen und von eiligen Füßen zertretenen. Ich habe es eilig. Trotzdem sind meine Sinne auf das Höchste geschärft und ich schaffe es auch jetzt, mitten in der Nacht, den schleimigen Tierchen auszuweichen.
Wie an jedem anderen Tag in den vier Wochen zuvor frage ich mich, wann einmal ein Fassadenteil auf einem Besucher oder einem Patienten landen wird. Aber immerhin, der Aufzug funktioniert. Fast schon aus liebgewonnener Gewohnheit drücke ich den Knopf für den zweiten Stock. Ich atme kurz durch.
Es hat sich abgezeichnet, lange schon. Immer wieder hat mein Vater in den vergangenen Jahren Tage oder Wochen im Krankenhaus verbringen müssen, meist war es das Herz, manchmal auch die Lunge, nie waren es Lappalien. Als am 21. August 2010 um 4.12 Uhr das Handy läutet – „Twisted Nerve“ von Bernard Herrmann, das gepfiffene Lied aus Quentin Tarantinos „Kill Bill“ –, bin ich nicht einmal überrascht. Nur verwundert, dass ich genau jetzt zum ersten Mal von ihm geträumt habe. Die Couch meiner Kindheit im Haus meiner Kindheit, in dem meine Mutter bis heute wohnt. Ein braunes Cord-Ungetüm, das irgendwann in den 1970er Jahren einmal der letzte Schrei gewesen sein muss. Darauf mein Vater, 68 Jahre alt, dösend. Er sieht aus wie immer, nur sehr erschöpft. Rundherum stehen wir – meine Mutter, meine Geschwister – und beratschlagen, wie wir ihm jetzt erklären sollen, dass er sterben wird. Ihm, der sich immer vor dem Tod so gefürchtet hat.
Gut, dass er im Koma liegt, denke ich mir, als ich aufspringe, um nach meinem Telefon zu greifen. Meine Mutter sagt irgendetwas, das mich dazu bringt, meinen Freund zu wecken. Ich laufe ins Badezimmer im Keller des kleinen Gartenhäuschens, in dem wir diesen Sommer verbringen, und wühle in meiner Unterwäsche. Wenn der Tod kommt, muss man schöne Unterwäsche tragen. Keine Löcher, nicht zu provokant. Merkwürdig, welche Streiche einem das Gehirn spielt, um in Ausnahmesituationen reibungslos funktionieren zu können. Innerhalb von fünf Minuten sitzen wir im Auto. Mein Freund fährt, er hat Angst, ich würde rasen. Würde ich auch, wenn ich könnte. So beschränke ich mich darauf, ihn von Zeit zu Zeit anzutreiben und das Lied von „Subway to Sally“ in meinem Kopf mitzusummen: „Ich hab heut’ Nacht vom Tod geträumt, er stand auf allen Wegen. Er winkte und er rief nach mir so laut.“
Als wir das Spital erreichen, ist die Sonne noch nicht aufgegangen. Mein Vater liegt seit vier Wochen auf der Herzintensivstation im künstlichen Tiefschlaf. Mehr und mehr wird er mit Medikamenten vollgepumpt, um eine nicht auffindbare Infektion zu bekämpfen, die langsam ein Organ nach dem anderen zerstört. Das Krankenhaus sieht aus wie immer, als wäre es sich der Größe dieses Augenblicks nicht bewusst. No offense, ich bin es auch nicht. Als ich an der Tür der Intensivstation läute, will ich wie immer meine Hände in Desinfektionsmittel baden. Ich lasse es diesmal sein. Im Zimmer hat sich seit meinem letzten Besuch nicht viel verändert. Auf den ersten Blick deutet nichts auf das baldige Ende hin. Erst auf den zweiten erkenne ich die schwarze elektrische Kerze, die die Schwestern zwischen all den Schläuchen und Infusionen aufgestellt haben. Und das Dialysegerät, das in den letzten Tagen auf Hochtouren gelaufen ist, steht nutzlos in einer Ecke. „Nieren-Anstartversuch“ haben sie das gestern genannt, ohne viel Hoffnung. Im Bett die Hülle meines Vaters, bewegungslos, die Augen mit Hilfe einer dicken Salbe verschlossen, ohne irgendein Zeichen, dass da noch ein Rest Leben ist. Erst vor ein oder zwei Wochen habe ich mir eingebildet, er hätte mit einem Auge gezuckt, als ich ihm ein paar seiner Lieblingsstücke und das WM-Lied „Waka Waka“ von Shakira vorgespielt habe. Links und rechts neben seinem Bett stehen meine Mutter und meine Schwester. Beide weinen. Meine Schwester macht Platz, damit ich auch noch ein Stück meines sterbenden Vaters berühren kann. Sein eingebundener Arm riecht ein wenig streng, wahrscheinlich hat man ihm die Mühe des Verbandswechsels nicht mehr angetan. Die Anzeige auf dem Hightech-Intensivbett mahnt ein, dass ein Teil der Matratze zu entlüften wäre, um ein Wundliegen zu verhindern. Auch das wird nun wohl nicht mehr geschehen. Und so warten wir auf das Erwartete und Unvermeidliche. Keiner traut sich, auf die Toilette zu gehen oder etwas zu Trinken zu holen. Keiner setzt sich hin. Nur ich gehe ab und zu auf den Gang und versuche meinen Bruder in München zu erreichen. Er wird es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Wir starren auf den Monitor, der uns anzeigt, wie viel physisches Leben noch in meinem Vater ist. Dass der Wert immer weiter sinkt, ist ebenso logisch wie unbegreiflich. Jetzt und hier geht langsam ein Leben zu Ende. Wir sind nur Beobachter, die hoffen, dass der geliebte Mensch in unserer Mitte in dieser starren, furchteinflößenden Krankenhausatmosphäre unsere Anwesenheit auch spürt.
Sterben gehört hier zum Alltag. Um sieben Uhr kommt die Putzfrau. Sie rumort herum, dreht das Wasser im Waschbecken neben meinem Vater auf und verschwindet, ohne es wieder abzudrehen. Das macht dann meine Schwester, die Würde ist leidlich wieder hergestellt. Wir schauen weiter den Linien und Zahlen auf dem Monitor zu, und wie sie – für uns Laien nichtssagend, aber trotzdem verständlich – immer flacher und niedriger werden.
Um 7.24 Uhr hebt es irgendwas in meinem Herzen aus. Wie auf einer Achterbahn den Magen. Dann piepst der Monitor nur mehr einen langen Ton. Den Herzschrittmacher müssen sie extra ausschalten, der weiß nicht von alleine, dass sein Job jetzt getan ist. Die Krankenschwester macht das Fenster auf, damit die Seele meines Vaters in den Sommermorgen entschwinden kann. Es ist einer der letzten heißen Tage im Jahr 2010. Im Krankenhaus geht der Alltag weiter.
Die Tage und Wochen nach dem Tod meines Vaters vergingen wie im Nebel. Wir funktionierten, gingen ins Büro, organisierten das Begräbnis, die Papiere, die Verlassenschaft. Das hielt uns aufrecht. Die Familie rückte näher zusammen, wir blätterten in Fotoalben und redeten viel. Wie wahrscheinlich jede andere Familie hatten auch wir uns immer fürchterlich vor dem Tod gefürchtet und jeden Gedanken daran weggeschoben. Vor allem mein Vater. Zu Weihnachten durften jahrelang keine Foto- und Filmaufnahmen gemacht werden, weil in einer Zeit lange vor meiner Geburt immer dann, wenn zu Weihnachten fotografiert wurde, kurz darauf ein Familienmitglied starb. Von seinem 64. Geburtstag an wiederholte mein Vater jedes Jahr, dass er jetzt schon älter sei als jeder seiner männlichen Vorfahren. Doch war diese Angst gerechtfertigt? Natürlich ist mein Vater viel zu früh verstorben, wir hätten ihm so sehr noch zahlreiche gesunde Jahre, seine Pension und seine Enkelkinder genießend, gewünscht. Und natürlich haben wir getrauert und trauern heute noch – sein Tod hat ein Loch in unsere Familie gerissen, das nicht mehr zu füllen ist. Aber ich traue mich auch zu behaupten: Die Angst vor dem Tod war unbegründet. Denn mein Vater ist exakt so gestorben, wie es für ihn gepasst hat – er musste sich nicht fürchten und hatte nach menschlichem Ermessen keine Schmerzen. Alleine dieses Wissen ist uns ein wichtiger Trost geworden. Vielleicht aber hätten wir uns alle – allen voran mein Vater selbst – weniger vor dem Tod und dem Sterben gefürchtet, hätten wir uns vorher damit beschäftigt.
Darum dieses Buch. Denn die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit und mit dem Tod als Teil des Lebens nimmt uns ein wenig die Angst davor. Selbstverständlich können wir uns nicht darauf vorbereiten, denn das Sterben – das eigene oder das eines Angehörigen – wird immer einen anderen Verlauf nehmen, als wir es erwarten und wird uns auch manchmal kalt und jäh erwischen. Aber wir können uns die essentiellen Fragen des Lebens und des Sterbens schon früh – rechtzeitig, wenn man so will – stellen. Wir können mit unseren Angehörigen darüber reden, damit sie unsere Vorstellungen kennen und im Ernstfall für die Wahrung unserer Würde eintreten können. Und umgekehrt. Wir können die Gegenwart unserer An- und Zugehörigen intensiver genießen, wenn wir nicht in der Illusion leben, sie wären für immer da. Und wir können unser eigenes Leben intensiver genießen, wenn uns seine Endlichkeit bewusst wird. In diesem Zusammenhang kann es tröstlich sein, die Geschichten von Menschen zu hören, die mit Schicksalsschlägen konfrontiert sind oder selbst am Ende ihres Lebens stehen und darüber Bilanz ziehen – und von ihnen zu lernen. So beschreiben viele das Leben im Angesicht des Todes als schöner und friedlicher als zuvor, weil sie es nun endlich schaffen, ihre kleinen Probleme und Sorgen abzustreifen. Vielleicht lässt sich das am besten damit vergleichen, dass der Sonnenuntergang am letzten Abend des Urlaubs nie so schön ist wie an den Abenden zuvor, dass der Blick aufs Meer einen nie so berührt wie an dem Tag, an dem man es das letzte Mal für lange Zeit sieht. Es wäre falsch, aus dieser Beobachtung eine Todessehnsucht oder gar Glorifizierung des Todes abzuleiten. Vielmehr sollten wir es uns zur Aufgabe machen, jeden Tag den Sonnenuntergang zu genießen und in der Mitte des Urlaubs von denen zu lernen, die bald nach Hause fahren müssen. Einige dieser Menschen kommen in diesem Buch zu Wort, es lohnt sich, ihnen zuzuhören.
Der Tod trifft uns in unserem Innersten, er beleidigt uns in unserem Kontrollbedürfnis und unserem modernen Anspruch, unendlich konsumieren und genießen zu können. Auf der anderen Seite lehrt uns die Akzeptanz der Sterblichkeit Achtsamkeit, Demut vor dem Leben und Respekt vor den Menschen, die wir lieben und die uns nahe sind. So ist es mit allen Fragen rund um das Thema Tod und Sterben, weil es den Kern des Daseins berührt: Es gibt immer ein „andererseits“, keine der Fragen ist letztgültig und für alle zu beantworten. Darum versteht sich dieses Buch auch nicht als Antwort, sondern als Annäherung – und als Anregung, sich auch gegen die eigenen Widerstände zu den essentiellen Fragestellungen des Lebens durchzugraben.
I.„ALS OB NIEMAND STÜRBE“ – DIE MODERNE GESELLSCHAFT UND DER TOD
„War der Tote ein Erwachsener, so schlugen die Leute mit den Totenknochen eines Greises in die Trommel, war es ein Kind, so mit einem Kindertotenknochen. Die Trommeln waren an den Rändern mit schwarzem Flor verhüllt, und an den beiden Schlagseiten stand in schwarzer Farbe PAX. Drei Tage lang wurde im Sterbehaus nicht gekocht. Die Nachbarn schickten den Hinterbliebenen warme Schokolade und kalten Fisch. Die Leichen der armen Leute wurden splitternackt im Kanal versenkt, von wo aus sie ins Meer trieben.“1
Es gibt wohl kaum einen Autor der europäischen Gegenwartsliteratur, der sich so eindringlich, schonungslos und nachhaltig mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigt wie der Kärntner Josef Winkler. In diesem Fall schildert er ein Totenritual in Süditalien, unvergessen sind auch seine beklemmenden Abrechnungen mit seinem Kärntner Elternhaus oder die Schilderung der indischen Bestattungskultur am Ganges. Als reflektierter, moderner Mensch fühlt man sich von dem Beschriebenen schlicht nicht betroffen. Denn der Tod als Teil des Lebens ist heute – zumindest in der westlichen Welt – von eben diesem abgekapselt und weggesperrt. Um ein Beispiel aus der Arbeitswelt zu nennen: Bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Bundesbedienstete oder auch Journalisten bei Tages- und Wochenzeitungen haben Anspruch auf Sonderurlaub, wenn ein naher Angehöriger stirbt. Das ist ein Vorteil gegenüber anderen Berufsgruppen, allerdings wird hier eine zeitliche Abstufung vorgenommen, die geradezu grotesk anmutet: Wenn Ehegatten oder Kinder, die im gemeinsamen Haushalt leben, sterben, darf man drei Tage zu Hause bleiben, bei Eltern zwei Tage, sind die Kinder schon erwachsen und leben nicht im gemeinsamen Haushalt, so muss man nach einem Tag wieder im Büro erscheinen – nach Möglichkeit voll funktionsfähig. Natürlich ist dieses Beispiel keinesfalls repräsentativ für den Umgang der Gesellschaft oder auch nur der Dienstgeber mit dem Tod, aber es zeigt ungewollt doch deutlich, wie meilenweit wir heute von einer Kultur des Abschiednehmens entfernt sind. Wie sollen die tote Oma oder der Schwiegervater drei Tage zu Hause aufgebahrt2 werden, wenn ich laut Kollektivvertrag nur einen Tag zu Hause bleiben darf? Tagsüber müssen wir funktionieren, doch was ist, wenn es um uns herum still wird?
Die Verdrängung des Todes
Es ist eine paradoxe Angelegenheit: Auf der einen Seite nimmt die Zahl der Toten, deren Bilder ganz selbstverständlich jeden Tag über die Fernsehbildschirme flimmern, kontinuierlich zu. Rasend schnell verbreiten sich über soziale Medien wie Twitter und Facebook Fotos von Toten wie zum Beispiel jenes des im September 2015 an der türkischen Küste angespülten Flüchtlingskindes Aylan Kurdi. Früher wie heute wurde in den Redaktionen der Zeitungen und Fernsehstationen intensiv darüber diskutiert, ob und wenn ja man in welchem Zusammenhang solche Bilder abdrucken oder ausstrahlen darf. Muss den Lesern und Zuschauern der Tod so drastisch nahegebracht werden? Ist es notwendig, dass Bilder wie dieses, das sich bald als Symbolbild für das Versagen Europas in der Flüchtlingskrise durchgesetzt hat, von den Medien gezeigt und erklärt werden, um Politik und Bevölkerung aufzurütteln? Überlegungen wie diese waren vielleicht vor Jahren sinnvoll, als die Medien eine Art Filterfunktion der Nachrichtenflut wahrnahmen. Doch durch die sozialen Medien hat eine Demokratisierung der Nachrichtenströme stattgefunden: Jeder entscheidet selbst, was er konsumiert, weiterleitet und mit seinen Freunden teilt. Wenn also eine Redaktion beschließt, keine Fotos von Kriegsopfern und auf der Flucht Verstorbenen zu zeigen, dann dient das heute vor allem der Verdeutlichung der Linie des jeweiligen Mediums, kann aber nicht mehr darüber bestimmen, ob diese Bilder tatsächlich an die Öffentlichkeit gelangen. Wenn wir also nicht gerade – neue und alte – Medien verweigern, so sind wir einer kontinuierlichen Flut von Bildern ausgesetzt, die Tod, Gewalt und Trauer zeigen. Der Tod ist fixer Bestandteil unseres medialen Wahrnehmungsalltags.
Trotzdem sind wir nicht dazu in der Lage, ihn als fixen Bestandteil unseres Lebensalltags zu akzeptieren und zu integrieren: Während wir uns einerseits inzwischen an die Massen von Leichen in unseren Wohnzimmern gewöhnt haben, erscheint uns gleichzeitig unsere eigene Sterblichkeit und die unserer nahen Verwandten so fremd und surreal wie wohl noch nie in der Menschheitsgeschichte. Ein ungeschriebenes Gesetz des gesellschaftlichen Miteinanders verbietet es uns, den Tod zu erwähnen – am besten denken wir noch nicht einmal daran, sonst werden wir ob unserer vermeintlich düsteren Gedanken kritisch von unseren Mitmenschen beäugt. In der Literatur finden sich ganz unterschiedliche Erklärungsansätze für diese Tabuisierung, die in den vergangenen Jahren nur durch die in unterschiedlichen Intensitäten wiederkehrende Debatte über Sterbehilfe oder allenfalls noch durch die kollektive Trauer am Tag eines Staatsbegräbnisses unterbrochen worden ist. So sieht der niederösterreichische Gemeindearzt und Autor Günther Loewit die generelle „Lebenssucht“ der Gesellschaft als Ursache für deren Weigerung, den Tod als gegeben anzunehmen. „In der Spaß- und Lustgesellschaft unserer Tage werden negative Emotionen in der Öffentlichkeit weder gerne gesehen noch gehört“3, schreibt Loewit – und dadurch sterbe es sich eben auch schwerer. In einer Welt, in der negative Emotionen keinen Platz haben, ist es kaum verwunderlich, dass die Trauer – sozusagen als die Mutter der negativen Gefühle – kaum eine Rolle spielt.
Zu einem ähnlichen Ergebnis wie Loewit kommt der Theologe Hans Küng, der schon vor mehr als 20 Jahren vor der „Erlebnisgesellschaft“ warnte, die Sterben und Tod als Störfaktoren eben dieser Erlebnisse verdrängen würde. Erst wenn das Sterben selbst zum Erlebnis würde, könne man es auch wahrnehmen, meint Küng4 – und schielt ironisch auf die damals wie heute populären Schilderungen von Nahtoderlebnissen, mit denen es immerhin gelegentlich gelingt, eine schaurig-schöne Todesfaszination auszulösen. Diese geht dann freilich nicht über ein kurzes Strohfeuer hinaus.
Weniger kulturpessimistisch spricht der US-amerikanische Meditationslehrer Stephen Levine davon, dass wir uns vorstellen, der Tod sei eine Katastrophe oder etwas Widerwärtiges. Er sieht also eine Art Ekel vor dem Tod und meint gleichzeitig, dass wir uns schuldig fühlen, weil wir sterben müssen, und daher nur hinter vorgehaltener Hand über das Thema sprechen.5 Aber sprechen wir denn überhaupt hinter vorgehaltener Hand darüber? Wäre das nicht schon ein Fortschritt gegenüber der aktuellen Situation? Denn über den Tod zu sprechen hieße ja, sich darauf einzulassen und damit auseinandersetzen zu müssen, und das gelingt oft nicht einmal den Menschen, die täglich damit konfrontiert sind. So sind Ärzte im Angesicht des Todes oft genauso sprachlos wie die Angehörigen oder die Patienten selbst. Denn auch oder gerade die Menschen, die selbst das Ende kommen sehen, haben oft Schwierigkeiten, sich anderen zu öffnen.
Dass das nicht immer so war, zeigt der 1984 verstorbene französische Historiker Philippe Ariès in seinem Standardwerk zur Geschichte des Todes.6 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts „[…] veränderte im gesamten Abendland […] der Tod eines einzelnen Menschen auf feierliche Weise den Raum und die Zeit einer sozialen Gruppe, die eine ganze Gemeinde umfassen konnte […]“.7 Wie man es aus alten Filmen kennt, rief der Mensch, der sein Ende nahen spürte, Freunde, Verwandte, Nachbarn zu sich. Letzte Aufgaben wurden verteilt, letzte Streitigkeiten beigelegt, vielleicht auch letzte Freundlichkeiten und Liebesbekundungen ausgetauscht. Dann starb der Moribunde, versehen mit dem Sakrament der Letzten Ölung, einen Tod, den man heute würdevoll nennen würde – und das trotz sicherlich schlechterer medizinischer Versorgung. Der Tod eines Einzelnen führte dazu, dass die gesamte (Dorf-)Gemeinschaft innehielt, es gab einen Trauerzug und Kondolenzbesuche, auch nach der intensiven Trauerzeit war es ganz normal und gesellschaftlich akzeptiert, dass zum Beispiel Witwen Trauer trugen. „[D]er Tod ist stets etwas Soziales und Öffentliches gewesen […]“, schreibt Ariès – doch im Laufe des 20. Jahrhunderts habe die Gesellschaft den Tod „ausgebürgert“: Man lege „keine Pause mehr ein […]. Das Leben in der Großstadt wirkt so, als ob niemand mehr stürbe.“8 Einzig das Totenmahl – der Leichenschmaus – nach der Beerdigung ist von den alten Traditionen übrig geblieben.
Aber wie kam es dazu und warum? Am Anfang war die Lüge, meint Ariès. Bereits seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts habe sich die Einstellung zur Aufklärung des Sterbenden über seine Situation radikal geändert – die Angehörigen hinderten die Ärzte daran, sogar der Priester wurde oft erst nach dem Tod gerufen, um den Sterbenden nicht zu ängstigen. Um dieser Unart entgegenzuwirken, hat die Kirche reagiert und die Letzte Ölung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in Krankensalbung umbenannt.9 Neben der Lüge – beziehungsweise dem meist unzulänglichen Versuch, dem Erkrankten sein nahes Ende zu verheimlichen – sieht Ariès noch zwei weitere Entwicklungen, die seiner Ansicht nach zur Verdrängung des Todes beigetragen haben: Die Tatsache, dass der Tod plötzlich schmutzig und ungehörig wird.10 Er zeichnet diese Entwicklung anhand eines literarischen Werks nach, das wie kaum ein anderes die Verdrängung des Sterbens im 20. Jahrhundert verdeutlicht: Leo Tolstois „Der Tod des Iwan Iljitsch“. Nachdem Iljitsch sein Zustand – freilich ohne den gewünschten Erfolg – verheimlicht worden war, schrie er drei Tage lang. Wurde der Tod noch im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit als Erlösung von den irdischen Unbilden wahrgenommen und war daher auch durchaus positiv besetzt, steht nun das Negative, das Abstoßende im Vordergrund. Ebenfalls schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts sieht Ariès den Trend zur Auslagerung der Kranken und Sterbenden aus dem häuslichen Umfeld in eine eigene Einrichtung angelegt: eine der wohl einschneidensten Veränderungen der Sterbekultur des Abendlandes. Mit der Individualisierung der Gesellschaft und dem damit einhergehenden Fokus auf Aspekte wie die persönliche Hygiene und den Komfort seien die Menschen empfindlicher geworden, meint der Historiker. Dies, gepaart mit einem zunehmenden Desinteresse des sozialen Umfelds, habe dazu geführt, dass die „[…] physiologischen Begleiterscheinungen des menschlichen Lebens […] aus der Alltagswirklichkeit ausgebürgert […]“11 wurden – nämlich ins Spital, wo der arme Todgeweihte dann möglichst still und leise und, wie wir noch sehen werden, in vielen Fällen auch unter Vermeidung ärztlichen Zuspruchs verstirbt. Ebenso wie der Tod selbst in der medikalisierten Welt als Krankheit wahrgenommen wird, gilt auch die Trauer als Krankheit oder als Charakterschwäche. Weil aber die traditionellen Trauerbräuche verfallen und der Einzelne in seiner Trauer alleine gelassen wird, „[…] wird der Hinterbliebene zwischen dem Gewicht seines Schmerzes und dem des gesellschaftlichen Tabus zermalmt“12, erläutert Ariès.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts – in bäuerlichen Gegenden auch noch zur Jahrhundertmitte, wie man bei Josef Winkler nachlesen kann – wuchs ein Kind also noch ganz selbstverständlich mit der Sterblichkeit seiner näheren Umgebung auf. Damit war auch der Umgang mit Trauernden Teil der überlieferten Kultur. Heute besteht hier ein Defizit, das jeder schon einmal am eigenen Leib gespürt hat: Es gibt kaum eine unangenehmere Aufgabe im sozialen Zusammenspiel, als jemandem zum Tod eines nahen Angehörigen oder Freundes zu kondolieren und dabei weder mitleidig noch unernst zu wirken und bestenfalls noch echtes Mitgefühl zu vermitteln. Diesem modernen Problem begegnet das größte Bestattungsunternehmen der österreichischen Hauptstadt, die Bestattung Wien, mit einer geradezu grotesk wirkenden Maßnahme: Gemeinsam mit dem bekannten Benimmspezialisten Thomas Schäfer-Elmayer hat man eine Broschüre über „Das richtige Verhalten bei einem Trauerfall“13 herausgegeben. Darin finden sich unter anderem Tipps zur richtigen Kleiderwahl für ein Begräbnis, Vorlagen für Kondolenzbriefe und Informationen über das richtige Verhalten auf Friedhöfen. Immerhin: In Österreich ist es noch erwünscht, zu kondolieren, aber sogar das ist laut Ariès in vielen Ländern nicht mehr der Normalfall.14
„Sie werden sterben“ – der Tod als Angstgegner der Medizin
Nur weil wir den Tod verdrängen, bedeutet das freilich nicht, dass wir ihm nicht alle irgendwann ins Auge sehen müssen. Seit Beginn des Jahrtausends sterben in Österreich jedes Jahr zwischen etwa 74.000 und 79.000 Menschen, etwas mehr als die Hälfte von ihnen im Krankenhaus,15 also unter ärztlicher Überwachung. Man sollte folglich meinen, dass die Ärzte an den Sterbeprozess und den Tod gewöhnt sind. Weit gefehlt: Die Mediziner nehmen sich selbst in erster Linie in ihrer Rolle als Heiler wahr. Dass sie irgendwann aufgeben und akzeptieren müssen, dass sie nichts mehr für einen Patienten tun können, fällt ihnen schwer. Karl Bitschnau16, Vizepräsident des Dachverbands Hospiz Österreich, schildert etwa eine Begegnung mit einer Hausärztin, die sich nicht getraut hat, ihren Patienten eine Hospiz-Broschüre in die Hand zu drücken, weil das für sie einem Todesurteil gleichkam. „Ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass das nichts damit zu tun hat, was in diesem Folder steht, sondern mit der Einstellung derer, die den Folder übergeben“, sagt Bitschnau.
Die von Ariès erwähnte zunehmende Medikalisierung macht scheinbar immer mehr möglich – fast sieht es so aus, als könne man mit Medikamenten, Infusionen, Operationen und Transplantationen den Tod aufhalten. Mittlerweile lassen sich ja bereits Organe komfortabel im 3-D-Drucker nachbauen. Die Kulturhistorikerin Anna Bergmann spricht in diesem Zusammenhang davon, dass „[…] die moderne Medizin zunehmend auf eine fundamentale Modifikation der Gesetze des Lebens abzielt […]“17. Dass die Gesetze des Lebens aber eben nicht komplett zu modifizieren sind – sprich, dass jeder einmal sterben muss und dass auch noch so große Fortschritte in der Forschung auf absehbare Zeit daran nichts ändern werden – trifft die Mediziner in ihrem Innersten. Schließlich geht es hier um das identitätsstiftende Selbstverständnis einer ganzen Berufsgruppe.
Der Palliativmediziner Gian Domenico Borasio, der derzeit im Schweizerischen Lausanne lehrt, hat den Begriff vom Tod als „narzisstische Kränkung“ des Arztes, als dessen ultimatives Versagen geprägt.18 Wohlgemerkt: Es geht hier rein um die Wahrnehmung der Ärzte selbst und nicht um die Fremdwahrnehmung durch Patienten oder Angehörige. Ein Grund für diese Selbstwahrnehmung ist ein Mangel in der Ausbildung. Zwar gibt es mittlerweile im Medizinstudium Kommunikationsseminare und Kurse zum Umgang mit Sterbenden. Gemessen an seiner Bedeutung spielt das Sterben in der Ausbildung der Mediziner aber nur eine untergeordnete Rolle. Auch existiert in Österreich immer noch keine Facharztausbildung in Palliativmedizin. Natürlich kommt es nicht selten vor, dass die Angehörigen die Ärzte noch um eine weitere Therapie bitten (weniger häufig kommt dieser Wunsch von den Patienten), manchmal wird auch der Arzt sogar für den Tod eines Moribunden verantwortlich gemacht. Dennoch sind die größten Feinde des Todes ihrer Patienten die Ärzte selbst.
Wie sehr diese Abwehrhaltung das vielzitierte Sterben in Würde behindern kann, hat schon 1969 die in der Schweiz geborene US-amerikanische Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross eindrucksvoll beschrieben. Sie gilt als die Begründerin der Sterbeforschung und ihre Arbeiten haben die Vermeidungstaktik der Medizin erstmals aufgebrochen. Für ihre wichtigste Forschungsarbeit, die ursprünglich im Rahmen eines Universitätsseminars stattfand und die sie später in dem Buch „Interviews mit Sterbenden“19 veröffentlicht hat, führte Kübler-Ross unzählige Gespräche mit Schwerstkranken in einem Krankenhaus in den USA. Hinter einem Einwegspiegel konnten Medizin-, Psychologie- und Theologiestudenten zusehen, später wurde das Gesehene und Gehörte gemeinsam diskutiert und ausgewertet. Die unterschiedlichen Reaktionen der Beteiligten auf das Forschungsprojekt, das immerhin in den 1960er Jahren stattgefunden hat, sind bis in die heutige Zeit symptomatisch für den Umgang mit dem Thema. Nur eine der von Kübler-Ross angesprochenen 200 Patientinnen und Patienten verweigerte ein Interview generell aus Angst vor dem Tod, alle anderen „[…] waren froh, sich mit einem interessierten Menschen unterhalten zu können […]“20. Bei den Ärzten war das Bild ein völlig anderes, dort stießen die Forscherin und ihr Team auf eine Mauer der Ablehnung: „Etwa neun von zehn Ärzten reagierten mit Unbehagen, Verärgerung, offener und versteckter Feindseligkeit […], manche […] leugneten […] rundheraus, dass sich unter ihren Patienten überhaupt Kranke im Endstadium befanden.“21