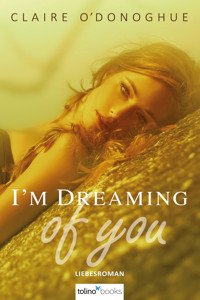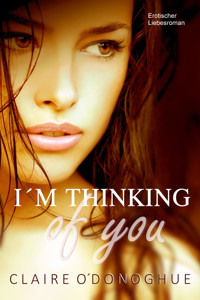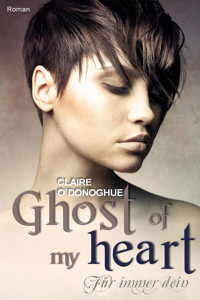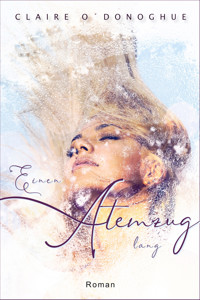
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dank einer Herztransplantation hat Emilia Nowak die Chance auf ein neues Leben. Wieder genesen, nimmt sich das gefragte Model eine kleine Auszeit, um den letzten Wunsch der verstorbenen Großmutter zu erfüllen. Spontan schließt sich die junge Frau deshalb einer Wandergruppe an. Nichts ahnend, dass sich ihr lang ersehnter Traum in Bruchteilen einer Sekunde zu einem unfassbaren Albtraum entwickeln wird. An der Schwelle zwischen Leben und Tod trifft Emmi dann ausgerechnet auch noch auf den Mann, den sie in ihrem ganzen Leben nie wiedersehen wollte. Aber so groß Emmis Abneigung gegen Silas Lange auch sein mag, bleibt ihr kaum eine andere Wahl, als diesem arroganten Kerl zu vertrauen. Auch Silas ist alles andere als begeistert. Als hätte der Teufel persönlich seine Hand im Spiel, muss er jetzt auch noch in diesem denkbar ungünstigsten Moment auf Emmi treffen. Dabei ahnt Silas jedoch noch nicht, dass sie beide weitaus mehr als der Kampf ums Überleben verbindet. Eine mitreißende Geschichte über Mut und Hoffnung und die Unvorhersehbarkeit der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
CLAIRE O´DONOGHUE
Roman
Februar 2022
Copyright © by Claire O´Donoghue
All rights reserved.
Alle Rechte vorbehalten!
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin. Personen und Handlungen dieser Geschichte sind frei erfunden, jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist zufällig und unbeabsichtigt.
© by Claire O´Donoghue
E-Mail: [email protected]
Facebook: www.facebook.com/Claire.O.Donoghue77
Instagram: https://picgra.com/user/claire_odonoghue_autorin/9214218546
Cover-Picture: Designs EE
Cover-Design: Claire O´Donoghue
Kapitelübersicht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Emmis Brief
Danksagung
Über die Autorin
Weitere Romane der Autorin
Leseprobe Traumland
Impressum
Kapitel 1
Emmi
Ein dumpfes, beunruhigendes Grollen war aus der Ferne zu hören. Wind und Schnee zerrten an mir. Die Kälte schnitt mir wie Messerklingen durchs Gesicht. Doch das spielte jetzt keine Rolle mehr. Es gab kein Entkommen.
Ich wusste, ich würde sterben.
Hier und jetzt. Meter tief unter den weißen Schneemassen begraben. Und die Welt, sie würde sich weiter drehen.
Ohne mich.
In dem einen Moment stand ich noch unter dem Gipfel im Schnee, der an einigen Stellen hart, an anderen pulvrig war und fühlte mich frei wie ein Falke, der seine Kreise über die Bergspitze zog. Und im nächsten Augenblick musste ich hilflos dabei zusehen, wie der Steilhang in voller Breite in sich zusammenbrach und eine riesige, weiße Masse den Berg hinunter direkt auf uns zurauschte.
Mein Blick hing an der Lawine.
Berauscht von dem kalten Weiß und dem Geräusch meines unnatürlich lauten Atems, fühlte ich mich einen kurzen Moment lang wie gelähmt, unfähig mich auch nur einen einzigen Millimeter von der Stelle zu bewegen. Meine Lippen bebten und begannen vor Angst zu zittern. Ich wünschte mir verzweifelt, es sei ein Traum. Ein Albtraum, aus dem ich gleich hochschrecken und wieder aufwachen würde. Aber dem war nicht so. Ich wusste, was gleich passieren würde, doch ich konnte es nicht stoppen.
Seit jeher waren Naturgewalten unberechenbar. Sie schlugen mit extremer Kraft zu. Und so war ich den Elementen jetzt schutzlos ausgeliefert. Schnee und Wind peitschten mir unaufhörlich ins Gesicht. Die Luft wurde knapp. Die Brust eng. Und mein Herz raste.
Das Atmen fiel mir von Sekunde zu Sekunde schwerer. Mit wachsender Panik stellte ich fest, wie sich der Boden unter meinen Füßen in Bewegung setzte. Ich verlor den Halt und versuchte mich noch irgendwie aus den Schneemassen herauszuwinden. Noch in letzter Sekunde gelang es mir, meine Hände aus den Schlaufen der Wanderstöcke zu befreien. Die Schneeschicht um mich herum nahm rapide zu. Und ich wusste, nur noch einen Atemzug lang und ich wäre tot, begraben unter tausenden Tonnen aufgewühltem, erdrückendem Schnee.
Beinahe hätte ich in meiner aufsteigenden Panik gelacht. Wie konnte ich auch nur denken, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen? Ich hatte meine Krankheit besiegt. Und ja, ich hatte ein neues Leben geschenkt bekommen. Tatsache aber war: Ein anderer musste dafür sterben, damit ich weiterleben konnte. Ich hatte den Tod vor mehr als einem Jahr ausgetrickst und jetzt nahm er sich, was ihm gehörte.
Mich.
Auf einmal ging alles rasend schnell. Es blieb mir nicht viel Zeit, über mein Leben nachzudenken oder über meine Wünsche und Träume, die ich mir noch gerne vor meinem Ableben erfüllt hätte. Im ersten Moment begann ich noch, mich gegen die Schneemassen aufzulehnen, wand mich wie ein Tier, das in die Fänge einer tödlichen Falle geraten war. Doch es nutzte nichts. Alles, was ich versuchte, war vergebens.
Und mir wurde bewusst: Nicht mehr lange. Und es wäre vorbei. Ich hörte die Schreie der anderen, voller Angst und Panik. Innerhalb weniger Sekunden war auch ich bis zu den Schultern im Schnee versunken. Wie erstarrt hielt ich inne, während eine Welle des Grauens über meine Seele hinwegschwappte. Mein ganzer Körper bebte und meine Hände, die eben noch die Wanderstöcke fest umklammert hatten, zitterten wie Espenlaub. Ich öffnete ein letztes Mal den Mund, als ein erstickter Schrei aus meiner Kehle schlüpfte.
Und dann … war alles weiß.
Mit der Gewalt eines Tsunamis wurde ich von der Lawine erfasst und mitgerissen. Die Welt um mich herum begann sich zu drehen. Mir wurde schwindelig. Mein Herzschlag beschleunigte sich. Der Pulsschlag dröhnte mit der Wucht eines Presslufthammers in meinen Ohren.
Luft.
Ich brauchte Luft.
Der Drang zu atmen wurde jetzt beinahe übermächtig. Gleichzeitig breitete sich eine eisige Gewissheit in mir aus. Ich erinnerte mich zurück an die Zeit, als ich täglich Gespräche mit dem Tod geführt und mit ihm verhandelt hatte. Als ich ihn voller Verzweiflung angefleht hatte, mir noch ein paar weitere Tage zu schenken. Und bei allem, was ich getan hatte, war ich mir bewusst gewesen, dass es vielleicht das letzte Mal sein könnte. Nachdem meine Kraft von Tag zu Tag weniger wurde, hatte ich schon längst mit Gott meinen Frieden geschlossen. Ich hatte keine Angst mehr vorm Sterben, weil die Ärzte mir gesagt hatten, dass es nicht schmerzhaft sein würde. Mein Herz. Es würde einfach aufhören zu schlagen.
Aber jetzt? Jetzt würde es anders sein. Jetzt würde ich Qualen erleiden und elendig ersticken. Der Schnee drückte sich bereits erbarmungslos in meinen Mund. Panisch spuckte ich ihn wieder aus. In meinem Kopf begann sich alles zu drehen. Kurz bevor ich jedoch drohte, ganz das Bewusstsein zu verlieren, kam ich wie durch ein Wunder wieder frei. Voller Angst riss ich den Mund auf, schnappte nach Luft, in dem verzweifelten Versuch meine Lungen mit genügend Sauerstoff zu füllen. Instinktiv streckte ich meine Arme nach oben, schwamm wie auf einer Welle, um nicht wieder unterzugehen.
Nach etlichen Metern, die ich von der Lawine mitgerissen und wie eine Stoffpuppe umhergewirbelte wurde, verlangsamten sich nun um mich herum die Bewegungen. Schließlich kam die Schneemasse irgendwann zum Erliegen. Reflexartig schlug ich meine Arme vor den Kopf, während ich mit Entsetzen feststellte, wie der Schnee von hinten weiterhin erbarmungslos auf mich drückte.
Dort steckte ich nun zitternd und schluchzend fest. Jede einzelne Faser meines Körpers tat weh, aber es war nicht der Schmerz, der mich fast zum Weinen brachte. Sondern die schrecklichen Erinnerungen und die dazugehörenden Empfindungen an den Tag der Transplantation. An den Tag, an dem mein eigenes Herz aufhören musste zu schlagen, damit ich weiterleben konnte.
Inzwischen war der Druck auf meinen Körper so groß, dass ich glaubte, jeden Moment von den Massen zerquetscht zu werden. Doch glücklicherweise wehrte das Gefühl nur kurz, dann gab es einen Ruck und das Gewicht war weg und ich wurde einfach von dem nachstürzenden Schnee bedeckt.
Totenstille.
Jegliche Geräusche um mich herum verstummten. Mein Herz klopfte mir bis zum Hals. Die Finsternis war undurchdringbar. Ich wusste nicht, dass der menschliche Verstand so überfordert sein konnte, dass mir noch tausende Dinge durch den Kopf schwirrten, bevor ich sterben würde.
Hastig blinzelte ich die Bilder und Erinnerungsfetzen hinfort. Ich brauchte einen Moment, um mich wieder zu beruhigen und zu registrieren, dass ich den Lawinenabgang tatsächlich überlebt hatte. Vorerst. Die Freude darüber war jedoch sehr verhalten.
Ja, vielleicht mochte ich noch am Leben sein, doch was war mit den anderen? Wie hoch würde wohl die Wahrscheinlichkeit sein, dass einer von ihnen das Unglück überlebt hatte?
Verschwindend gering.
Ich dachte an die beiden Frauen Anfang Vierzig – Zwillinge, nach ihrem Aussehen und ihren Erzählungen nach zu urteilen – sie waren binnen von Sekunden vor meinen Augen vom Schnee verschluckt worden. Ich blinzelte hektisch, als ich an die kleine Gruppe von jungen Männern dachte, die gutgelaunt ein paar gemeinsame Tage verbringen und den Junggesellenabschied von dem schüchternen Mann mit der lustigen, blauen Bommelmütze feiern wollten. Statt vor dem Traualtar würde seine Verlobte nun an seinem Grab stehen und um ihn weinen.
Ich konnte nur hoffen, dass sich wenigstens der Bergführer in Sicherheit bringen konnte. Ihm galt meine letzte Hoffnung, denn sonst gab es niemanden mehr, der mich hätte retten können.
Nein. Das stimmte so nicht.
Da war noch jemand gewesen. Erst jetzt erinnerte ich mich. Wie hatte ich ihn bloß vergessen können? Vielleicht, weil er erst heute Morgen zu unserer Gruppe hinzugestoßen war?
Ein stiller Mann. Ein stummer Zeitgenosse. Unnahbar. Wenn überhaupt hatte er sich mit dem Bergführer unterhalten. Ich hatte ihn lediglich von Weitem gesehen, mit Skimütze und Sonnenbrille, sodass ich sein Gesicht kaum erkennen und sein Alter nicht richtig einschätzen konnte. Keine Ahnung, was mit ihm passiert war und ob er ebenso von der Lawine erfasst worden war, wie ich.
Ich presste die Augen fest zu und biss die Zähne zusammen. Eine erschreckende Vorstellung: Allesamt Menschen, die eben noch voller Träume und Lebensfreude gewesen und jetzt vermutlich tot waren. Und ich – ich würde es auch bald sein.
Eine Woge der Hoffnungslosigkeit überflutete mich. Und Angst.
Angst ohnmächtig zu werden.
Angst nicht rechtzeitig gefunden zu werden.
Angst zu sterben.
Es blieb nur zu hoffen, dass es nicht allzu schmerzhaft sein würde.
Der Schnee rings um mich herum war bereits gefroren, sodass ich einen Teil meines Körpers nicht mehr bewegen konnte. Wie lange würde es wohl dauern, bis die Bergwacht am Unglücksort eintraf? Ein Lawinenortungsgerät trug ich nicht bei mir. Vermutlich wäre ich bald ohnehin erfroren oder noch schlimmer erstickt. Die Erkenntnis, auf solch schreckliche Weise den Tod zu finden, brach wie eine Welle über mich herein und schnürte mir die Kehle zu. Plötzlich konnte ich nicht mehr atmen. Ich konnte das Dröhnen in meinem Kopf nicht abschalten. Ich konnte mein Hirn nicht abschalten.
Nein, Emmi, hör auf! Reiß dich gefälligst zusammen! Du wirst nicht sterben! Zumindest nicht hier und nicht jetzt. Erst als sich mein Herzschlag allmählich wieder zu beruhigen begann, bemerkte ich, dass mein Körper nicht ganz von den Schneemassen eingeschlossen war. Meine beiden Arme, die ich zum Schutz vor meinen Kopf gestreckt hatte, sowie mein rechtes Bein waren frei.
Schlagartig war ich hellwach.
Meine Hände waren inzwischen steif vor Kälte, aber das hinderte mich nicht daran, verbissen den Schnee zur Seite zu schaufeln und den dabei aufkommenden Schmerz zu ignorieren. Mein ganzer Körper begann von der Anstrengung bereits zu zittern. Doch ich dachte gar nicht daran, aufzugeben. Ich grub weiter und biss die Zähne zusammen. Ich hatte nicht wochenlang im Krankenhaus gegen den Tod gekämpft, um jetzt einfach so zu sterben.
Nach allem, was ich an Opfern auf mich genommen hatte, nach allem, was ich durchlitten hatte, würde das Schicksal doch bestimmt nicht so fies sein, mir ausgerechnet jetzt zu zeigen, dass meine Zeit auf dieser Erde abgelaufen war. Oder?
Nein. Das konnte nicht sein. Also grub ich weiter. Meine Arme brannten jetzt wie Feuer und meine Kräfte schwanden von Minute zu Minute mehr. Fast hätte ich die Hoffnung schon aufgegeben. Aber nur fast. Denn als ich nur wenige Sekunden später diesen winzigen Lichtschimmer durch die feste Kruste über mir entdeckte, hätte ich vor Glück weinen können. Unterdessen war ich vollkommen erschöpft, mit letzter Kraft schob ich den Schnee zur Seite. Und dann endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, hatte ich es geschafft.
Ich blinzelte gegen das Licht. Tränen standen in meinen Augen.
Ich war frei.
Oh mein Gott.
Ich war frei und ich lebte. Noch.
Ich schluckte trocken, während ich auf allen Vieren aus meinem Schneegrab kletterte und mich langsam aufzurichten begann. Ein heftiger Windstoß fegte über mich hinweg, der mich erschaudern ließ und auch noch das letzte Quäntchen Lebenskraft mit sich davontrug. Ich war müde und erschöpft. Am liebsten würde ich mich einfach nur noch hinlegen und schlafen.
Nein, Emmi! Du bist stark. Kämpfe!
Meine Beine wollten jedoch nicht so wie ich und gaben zuerst nach. Sie waren so weich wie Wackelpudding. Ich fiel der Länge nach hin, aber irgendwie gelang es mir nach einer Weile dann doch, mich wieder aufzurichten und mich mit letzter Kraft zurück auf die Beine zu kämpfen. Unter größter Anstrengung richtete ich mich auf und ließ meinen Blick umherschweifen.
Mir stockte der Atem bei dem, was ich da sah.
Unfassbar, wie ein paar winzig schöne Kristalle, die in einer Schneeschicht brachen, ein solches Inferno aus Schnee und Zerstörung auslösen konnten. Am auslaufenden Gletscherboden türmten sich die Schneemassen. Jetzt erst wurde mir das wirkliche Ausmaß der Katastrophe bewusst. Und erst jetzt realisierte ich, welches Glück ich gehabt hatte. Allerdings war ich mir bei dem Anblick, der sich mir gerade bot, nicht ganz sicher, ob ich mich über mein Überleben freuen und lieber in Panik ausbrechen sollte.
Ein eisiger Schauer rann über meinen Rücken. Das nächste Bergdorf lag mehrere Tagesmärsche von hier entfernt. Außerdem hatte sich der Bergführer aufgrund der sich immer schneller verschlechternden Wetterlage dazu entschieden, eine andere Route einzuschlagen. Der letzte Hoffnungsschimmer hier lebend herauszukommen, sickerte soeben mit dem Rest Adrenalin, der durch das Lawinenunglück freigesetzt wurde, durch meine Beine direkt in den Schnee.
Bei Gott, ich konnte nicht mehr. Der Schneefall hatte in den letzten Stunden so stark zugenommen, dass es mir in meinem derzeitigen Zustand fast unmöglich vorkam, überhaupt einen einzigen Schritt nach vorne zu machen, geschweige denn mich zu bewegen.
Egal. Ich musste es wenigstens versuchen. Ein paar Mal drehte ich mich völlig orientierungslos im Kreis. Nur der Himmel allein wusste, wo sich diese Berghütte befand, von der der alte Mann gesprochen hatte. Meine Gedanken rasten. Was sollte ich jetzt tun? Sollte ich versuchen die Hütte zu finden, um dort Schutz zu suchen oder vielleicht doch besser hier am Unglücksort bleiben und auf Rettung warten? Ich wusste es nicht.
Doch was war mit den anderen? Übelkeit überfiel mich, wenn ich bloß daran dachte, dass vielleicht noch jemand lebte und gerade an dem Schnee, der sich in den Mund und Nase hineingedrückt hatte, erstickte.
Ich konnte jedoch nicht nur hier herumstehen und nichts tun. Ich musste etwas tun. Irgendwas. Allerdings konnte ich mich noch immer nicht bewegen. Vielleicht stand ich unter Schock oder vielleicht lag es auch einfach nur daran, dass ich im Begriff war, durchzudrehen. Wer wusste das schon?
Komm schon, Emmi! Tu endlich was! Setz deinen verdammten Hintern in Bewegung!
Doch je mehr ich mich unter Druck setzte, diesen armen Menschen helfen zu müssen, umso mehr schnürte sich meine Kehle zu und Panik stieg in mir auf.
Ich schloss die Augen. Und für einen winzigen Moment hörte ich auf zu atmen, hörte ich auf zu fühlen. Ich wollte nicht mehr sein, wünschte mich ganz weit weg, an einen anderen, schöneren Ort, aber als ich die Augen wieder öffnete, war ich immer noch hier.
Hier inmitten der Hölle.
Und die Hölle … sie war weiß.
Ich schluckte erneut, drängte die Angst zurück, die kurz davor war, mich erneut zu lähmen. Bilder meiner besten Freundin, Mica, die kurz nach der Transplantation an meinem Krankenbett gesessen und meine Hand gehalten hatte, blitzen vor meinem inneren Auge auf.
»Emmi, die Ärzte haben alles getan, was in ihrer Macht stand. Nun liegt es ganz allein an dir. Wenn du leben willst, musst du endlich damit anfangen, zu kämpfen. Kämpfe!«
Ja. Wenn ich überhaupt eine Chance hatte, einigermaßen unbeschadet aus dieser Sache herauszukommen, sollte ich endlich meinen Hintern hochkriegen und kämpfen. Und zwar jetzt. Und so riss ich mich zusammen und setzte mich in Bewegung, setzte einen Fuß vor den anderen.
Schritt für Schritt.
Wenn auch nur mühselig, aber ich kam voran. Immer wieder versank ich mit meinem Körper tief im Schnee, kämpfte mich weiter durch die Schneewüste in Richtung nirgendwo. Ich schwankte und taumelte, als hätte ich die ganze Nacht durchgemacht. Um einen Augenblick zu verschnaufen, blieb ich kurz stehen. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie so gefroren. Der Schnee kroch überall hin. Eisregen biss sich in mein Gesicht. Doch ich musste weiter. Ich tat den nächsten Schritt und blieb mit meinem Schuh an etwas Hartem hängen.
»Was zur Hölle?«, stieß ich noch hervor. Im nächsten Moment hatte ich bereits das Gleichgewicht verloren und landete kopfüber im Schnee. Ich hob meinen Kopf und blickte zurück, während ich versuchte, gegen den Sprühnebel, der sich auf mein Gesicht legte, anzublinzeln.
Und da entdeckte ich, was meine unsanfte Landung verursacht hatte. Nur wenige Zentimeter von mir entfernt, ragte eine Männerhand aus dem Schnee empor. Ich hielt den Atem an. Ob er noch lebte? Vielleicht war es ja nur eine Täuschung oder nicht viel mehr als ein verzweifeltes Wunschdenken – aber bei Gott, ich hätte schwören können, diese Hand, sie hatte sich bewegt.
Da. Jetzt schon wieder.
»Oh, bitte«, wisperte ich, während ich voller Verzweiflung auf Händen und Knien zu ihm robbte und in der nächsten Sekunde damit begann, den gefrorenen Schnee zur Seite zu scharren.
Das Glück hatte es gut mit mir gemeint, denn der Rest seines Körpers war nur wenige Zentimeter unter der glitzernden Oberfläche begraben, sodass ich nicht allzu lange brauchte, um ihn ganz von den Massen zu befreien.
Ich packte seine Schultern und drehte ihn um. Es handelte sich um den stillen Mann aus unserer Gruppe. Ich erkannte ihn sofort. Wie könnte ich auch nicht. Auch wenn er den ganzen Tag allein geblieben war und sich im Hintergrund gehalten hatte, besaß er dennoch eine Präsenz, der man sich nur schwerlich entziehen konnte. Sein Gesicht war regungslos. Seine Lippen blau und seine Augen geschlossen. Ein eigenartiges Gefühl beschlich mich, so als ob ich diesen Mann von irgendwoher kannte, doch es blieb mir keine Zeit, weiter darüber nachzudenken. Ich musste handeln und zwar schnell. Meine Hände zitterten wie Espenlaub, während ich nachschaute, ob der Schnee seine Atemwege verstopft hatte. Doch seine Nase und sein Mund schienen frei.
Atmete er noch?
Hastig drückte ich mein Ohr auf seine Brust. Aber seine Jacke war so dick und der Wind pfiff so laut, dass es unmöglich war, seinen Herzschlag zu hören. Und so presste ich mich noch näher an ihn heran. Ein stöhnender Laut kam über seine Lippen und dann atmete er ein paar Mal gequält ein und wieder aus.
»Danke. Lieber Gott. Danke«, stieß ich ein Stoßgebet gen Himmel und hatte jetzt wirklich Mühe, meine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Rasch streckte ich meine Hand aus, legte sie an seine Wange und begann sie leicht zu tätscheln.
»Hallo? Hallo? Hören Sie mich?« Er blieb weiterhin stumm.
Verdammt. Die Freude darüber, nicht die Einzige zu sein, die das Unglück überlebt hatte, wehrte nur kurz. Stattdessen machte sich wieder Sorge in mir breit. Ratlos starrte ich auf den Mann, der noch immer bewegungslos vor mir lag und hatte keine Ahnung, was ich jetzt tun sollte.
Die Witterungsverhältnisse wurden immer schlechter, sodass man schon bald die Hände vor den Augen nicht mehr sehen konnte. Die Hoffnung, dass ein Rettungshubschrauber kommen und nach uns suchen würde, schwand von Sekunde zu Sekunde mehr.
Hilfesuchend schaute ich mich um und überlegte, was ich jetzt tun sollte, als mein Blick an einem hervorstehenden Felsen hängenblieb. Mein Herz machte einen kleinen Sprung. Irrte ich mich oder war da etwa eine kleine, schwarze Öffnung am Fuß des Felsens?
Eine Höhle. Konnte das wirklich sein? Ich blinzelte gegen den Wind, um besser sehen zu können. Und tatsächlich. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Gleichzeitig hatte ich Angst, dass mir meine Augen womöglich nur einen bösen Streich spielen könnten. Doch es war weder eine Halluzination noch war es ein Traum. Die Rettung befand sich nur wenige Meter weit von uns entfernt, am Fuße einer senkrechten Felsenwand, die von Weitem nicht viel größer als ein Mauseloch aussah.
Mein Blick glitt erneut zu dem Mann, der noch immer vor meinen Füßen lag. Er war mindestens ein Meter neunzig groß und musste fast das Doppelte von mir wiegen. Egal. Voller Entschlossenheit zog ich mir meine Mütze tiefer in die Augen und schlug die Hände zusammen. Einen Moment lang verzog ich gequält das Gesicht, als die Handflächen aufeinandertrafen. Meine Rippe tat weh. Ich schenkte ihr jedoch keinerlei Beachtung, dafür hatte ich jetzt keine Zeit. Es dauerte noch einige Sekunden, bis ich wieder genug Kräfte gesammelt hatte und der Schmerz verebbt war. Dann bückte ich mich, zog und zerrte an dem bewusstlosen Mann, ohne dass er sich merklich bewegte. Mist. Sofort spürte ich jedes Gramm. Und schon wenige Minuten später musste ich mir eingestehen, dass es ein hoffnungsloses Unterfangen war. Tränen der Verzweiflung sammelten sich in meinen Augen, doch ich blinzelte sie zurück.
Reiß´dich gefälligst zusammen! Du wirst ihn nicht zurücklassen! Auf gar keinen Fall. Das kommt überhaupt nicht in Frage.
Und so biss ich die Zähne aufeinander, packte ihn unter seinen Armen und schleifte ihn Millimeter für Millimeter durch den Schnee in Richtung Felsen. Ich brauchte eine gefühlte Ewigkeit für eine Entfernung, für die ich unter normalen Umständen zwei Minuten gebraucht hätte.
Schnell wurde ich müde. Meine Arme und mein Rücken schmerzten. Und meine Beine zitterten inzwischen wie verrückt. Immer wieder gaben sie unter seinem Gewicht nach, sodass ich kurze Pausen einlegen musste, ehe ich mich erneut in der Lage dazu fühlte, einen weiteren Schritt zu machen.
Ich keuchte. Mein Atem formte dabei kleine Wölkchen. Der kalte Wind schlug mir unaufhörlich ins Gesicht, was sich wie Peitschenhiebe anfühlte. Trotz der eisigen Temperaturen rann mir vor Anstrengung der Schweiß über den Rücken. Der Gedanke, dass wir es nicht bis zur Höhle schaffen könnten, bevor wir beide erfroren wären, quälte mich von Minute zu Minute mehr.
Du wirst nicht aufgeben! Weiter. Verdammt. Weiter!, feuerte ich mich selbst im Geiste an. Denn eines wusste ich ganz sicher: Aufgeben war keine Option. Das war es nie. Abgesehen davon lag es ohnehin nicht in meiner Natur, kampflos aufzugeben, selbst wenn die Lage im ersten Augenblick noch so hoffnungslos erschien. Und deshalb biss ich weiter die Zähne zusammen, so lange, bis wir endlich den Eingang der Höhle erreicht hatten. Mit meinen letzten Kraftreserven zerrte ich den Mann über die rutschigen Steine in den Schutz der Dunkelheit.
Erschöpft ließ ich mich nun neben den Fremden auf den Boden sinken. Das Adrenalin hatte mich die ganze Zeit über aufrechtgehalten. Doch jetzt spürte ich deutlich: Meine Kraft war zu Ende. Müde legte ich meinen Kopf auf seine Brust und schlang meine Arme um seinen Körper, weil es mir am sinnvollsten erschien, sich erst einmal gegenseitig zu wärmen.
Nur eine Minute ausruhen. Nur ganz kurz. Ich schloss die Augen. Der kräftige, regelmäßige Herzschlag in der Brust dieses Mannes hatte auf unerklärliche Weise eine beruhigende Wirkung auf mich.
Irgendwann musste ich wohl eingenickt sein. Denn das Nächste, an das ich mich erinnern konnte, war, dass ich grob an den Schultern gepackt und auf den Rücken gerollt wurde. Flatternd öffnete ich meine Lider. Wenige Zentimeter entfernt schwebte über mir das Gesicht des Fremden. Seine Augen waren dunkel und sein Blick strahlte eine arktische Kälte aus, die mir augenblicklich das Blut in den Adern gefrieren ließ. Selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich nicht aufhören können, ihn anzustarren. Die Erkenntnis fiel mir wie Schuppen von den Augen, während mein Herz wie wild gegen meinen Brustkorb hämmerte, sodass ich glaubte, er könnte gleich zerspringen.
Silas?!
Nein. Das durfte nicht wahr sein. Da wollte sich Gott wohl einen schlechten Scherz mit mir erlauben?! Ich blinzelte und hoffte gleichzeitig, dass ich mich irrte. Aber er war es. Ganz sicher. Seit unserer letzten Begegnung mussten mindestens zehn oder elf Jahre vergangen sein und obwohl er reifer und männlicher geworden war, sah er attraktiver aus denn je.
Seine Augen waren noch immer dieselben. Augen, die ich überall wiedererkennen würde und die so dunkel waren wie seine Seele.
»Die Lawine hat uns erwischt?!« Es war weniger eine Frage als eine Feststellung, daher nickte ich nur stumm, während ich ihm dabei zusah, wie er langsam seinen Kopf hob und seinen Blick umherschweifen ließ.
»Wir sind in einer Höhle?« Unglaube schwang nun in seiner Stimme mit. Er rieb sich mit der Hand über sein Gesicht. Teile seines Körpers lagen noch immer auf mir, sodass ich an seinen Muskeln spürte, wie angespannt er war.
Warum musste er bloß so verdammt gut aussehen? Viel zu gut.
Konnte er denn nicht, wie so viele andere Männer auch, mit den Jahren einen Wohlstandsbauch bekommen? Es fiel mir schwer, ihm länger in die Augen zu schauen und so sah ich an ihm vorbei, ohne ihm zu antworten und schwieg. Was sollte ich auch sagen? Schließlich war es offensichtlich, dass wir uns in einem Hohlraum in einer Felsenwand befanden.
Er hielt sich immer noch den Kopf. »Na, kommen Sie schon. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Ich kann mich nicht erinnern. Wie sind wir noch gleich in die Höhle gekommen?«
Sie?
Ich stockte. Er siezte mich? Mit dieser Reaktion hatte ich nicht gerechnet. Im Gegensatz zu mir hatte er mich also nicht erkannt. Nicht, dass es mir etwas ausmachen würde.
Wieso sollte es auch?
Um ehrlich zu sein, überraschte es mich nicht wirklich. Früher hatte er mir bereits keinerlei Beachtung geschenkt. Nein, das stimmte so nicht ganz. Ich hatte in Silas Welt nie existiert, bis auf diesen einen Abend, den ich nur allzu gerne aus meinem Gedächtnis streichen würde.
Kurz spielte ich mit dem Gedanken, ihm zu sagen, wen er da vor sich hatte, wem er sein Leben zu verdanken hatte. Ich tat jedoch nichts dergleichen. Mein törichter Stolz verbot es mir. Sollte er doch weiterhin im Dunkeln tappen. Mir doch egal.
»Na ja, ich habe Sie aus dem Schnee befreit und hierher in Sicherheit gebracht?!«, entgegnete ich daher so gleichgültig ich konnte.
Sein Kopf ruckte herum. »Sie? Sie ganz allein?« Er ließ seinen Blick ungläubig an meinen Körper entlanggleiten und sah mich dabei mit zusammengekniffenen Augen an, geradeso, als ob ich ihm erzählt hätte, Medusa zu sein, der Schlangenhaare aus dem Kopf wuchsen und deren Blick ihn zu Stein erstarren lassen könnte.
Ich wusste selbst, dass ich mit meinen knapp ein Meter siebzig und fünfundfünfzig Kilo nicht gerade so aussah, als ob ich einen erwachsenen Mann seiner Statur durch den Schnee schleppen könnte.
Konnte ich ja auch nicht. Über den Boden schleifen und zerren traf da wohl viel eher zu. Ich konnte mich kaum daran erinnern, wie ich es geschafft hatte, ihn in diese Höhle zu bringen. Aber egal. Fakt war doch: Ich hatte es getan.
Der Wille versetzte ja bekanntlich Berge.
Und mein Wille war stark.
So stark wie der einer Löwin.
Und an dieser Tatsache war er nicht ganz unschuldig. Obwohl mich in der Vergangenheit alle belächelt hatten, weil ich so gar nicht in ihre scheinbar so heile Schickimicki-Welt hineinpassen wollte. Und mir auch später in meinem Job immer und immer wieder gesagt wurde, dass ich nicht gut genug, nicht schön genug und nicht groß genug für eine Laufstegkarriere sei, hatte ich es all meinen Kritikern gezeigt. Ich hatte ihnen gezeigt, dass es im Leben nicht immer auf die Größe, sondern viel mehr auf Ausstrahlung, Persönlichkeit und Charakter ankam.
In dieser Welt der Oberflächlichkeit war es an der Zeit, die Schönheit endlich mal als etwas Tieferreichendes zu begreifen, als nur als eine Reihe von Makel, die verborgen werden mussten. Makel, die jeder Mensch hatte und die wie so oft durch Make-up und eine gekonnte Kameraeinstellung unsichtbar gemacht wurden. Es war an der Zeit, uns Frauen so zu akzeptieren wie wir waren – selbst wenn man, so wie ich, modeluntypisch war und mit meiner großen Narbe keinesfalls dem gängigen Schönheitsideal entsprach. Inzwischen trug ich sie mit stolz, denn Narben waren in meinen Augen nichts anderes als verheilte Haut, die uns daran erinnerten, wie stark wir einmal waren.
Man konnte sagen: Ich war schon immer anders gewesen. Diesmal hatte ich mein Anderssein jedoch zu meinem Vorteil nutzen können.
»Ja, ich. Ich ganz allein«, entgegnete ich jetzt schon fast trotzig. »Die anderen, ich denke, sie sind alle tot«, fügte ich nun sanfter hinzu.
»Nun, jetzt schon«, brummte er. Mit einer Hand auf ein Knie gestützt versuchte er aufzustehen und schwankte.
Was? Das hatte er jetzt nicht wirklich gesagt? Eine Ladung Blut schoss in meine Wangen. Ich starrte ihn an. Dieser unverschämte Kerl! Er wollte damit doch wohl nicht andeuten, dass es meine Schuld war?
»Was genau hätte ich denn Ihrer Meinung nach tun sollen?«, stieß ich nun aufgebracht hervor. Ich setzte mich auf und meine Augen funkelten ihm wild entgegen. »Nur mal so zur Erinnerung: Auch ich wurde von der Lawine mitgerissen. Und nur Gott allein weiß warum, aber ich hatte großes Glück, mich selbst aus dem Schnee befreien zu können.« Ich atmete tief durch. »Ich habe niemanden gesehen. Überall war nur Schnee. Es war reiner Zufall, dass ich über Sie gestolpert bin.«
»Na, was für ein Glück«, bemerkte er trocken und obwohl seine Worte hart klangen und vor Sarkasmus geradezu trieften, hörte ich noch etwas anderes in seiner Stimme mitschwingen – Schmerz?
»Wie bitte?« Entgeistert starrte ich ihn an, direkt in diese dunklen, schokoladenfarbigen Augen. Ein Fehler wie sich sogleich herausstellte. Von jetzt auf gleich verlor ich mich in ihnen. Und obwohl ich Silas für schroff und mehr als undankbar hielt, machte mein beklopptes Herz gerade einen Sprung. Ich hasste ihn dafür, aber vor allem mich selbst, dass er nach all der Zeit noch immer eine solche Wirkung auf mich ausüben konnte.
»Nichts. Vergessen Sie es einfach«, sagte er knapp.
Vergessen? Hatte er sie noch alle? Ich schüttelte innerlich den Kopf und bemühte mich, ruhig zu bleiben. Was lief bei diesem Kerl bloß verkehrt?
»Anstatt hier irgendjemandem die Schuld in die Schuhe zu schieben, für etwas, wofür keiner von uns etwas kann, sollten wir doch wohl eher überlegen, was wir jetzt tun sollen«, sagte ich, so ruhig ich konnte, denn die ganze Situation belastete mich. Ich war erschöpft und fuhr körperlich und seelisch am Limit. Und er vermutlich auch, sonst würde er nicht so bescheuert reagieren.
»Das ist der erste vernünftige Satz, den ich heute von Ihnen höre.« Er starrte mich herausfordernd an, als warte er nur darauf, dass ich ihm etwas entgegensetzte.
Doch ich würde den Teufel tun. Ich dachte gar nicht daran, auf seine Provokationen weiter anzuspringen. Auch wenn es mir nicht gefiel, war ich dennoch auf seine Hilfe angewiesen. Alleine würde ich in der eisigen Kälte noch keine Nacht überleben. Also straffte ich lediglich meine Schultern und zwang mich, seinem prüfenden Blick standzuhalten.
Und starrte zurück.
Wahrscheinlich glaubte er, er schüchterte mich mit seinem Machogehabe ein. Aber in Wahrheit weckte er dadurch nur noch mehr meinen Kampfgeist.
Ich war nicht dieses schwache Wesen, das ich früher einmal war. Er wäre gut damit beraten, sich vor mir zu hüten und sich nicht von meiner lieblichen Erscheinung blenden zu lassen. Denn mein Kopf war inzwischen dicker als jede Wand.
Die Emmi, die er hier vor sich sah, war schon lange nicht mehr das rotblonde, kleine Mädchen, über das sich alle lustig gemacht hatten.
Nein. Inzwischen war ich erfolgreich und auf den großen Laufstegen der Welt zu Hause. Den Erfolg, all das Geld, hatte ich mir hart erarbeitet und erkämpft.
Jeder Stein, der mir in den Weg gelegt wurde, jede Scherbe, auf die ich treten musste, um ganz nach oben zu kommen, hatten mich stärker gemacht. Selbst dem Tod war ich jetzt zweimal von der Schippe gesprungen. Dieser Kerl mit dem selbstgefälligen Grinsen sollte sich also besser in Acht vor mir nehmen. Vor allem aber sollte er mich nicht unterschätzen.
Mit zusammengekniffenen Augen sah ich ihm dabei zu, wie er sich mit der Hand an der Höhlenwand festhielt und langsam Richtung Ausgang schwankte.
»Was ist los mit Ihnen? Wo liegt eigentlich Ihr verdammtes Problem?«, fragte ich mit leiser und kontrollierter Stimme. Ich war todmüde und erschöpft. Ich hatte jetzt wirklich keinen Nerv dafür, mich mit diesem Typen anzulegen.
»Sie fragen mich ernsthaft, wo mein Problem liegt?« Er schwang so abrupt herum, dass ich erschrocken vor ihm zurückwich. »Also gut, ich sage es Ihnen. Sie …« Er zeigte mit dem ausgestreckten Finger auf mich. »Sie sind das verdammte Problem!«
»Ich?« Fassungslos schnappte ich nach Luft.
Dieser … dieser unverschämte Neandertaler. Was bildete er sich eigentlich ein?
»Ja, Sie! Schauen Sie sich doch mal an. Schauen Sie doch nur, wie Sie dasitzen mit Ihrem schicken Designerfummel. Oh, ich kenne solche Frauen wie Sie zur Genüge. Vermutlich sind Sie Daddy´s kleiner Liebling, dem er jeden Wunsch von den Augen abliest und die permanent Zucker in ihren süßen, kleinen Arsch hineingeblasen bekommt. Und wenn es dann mal nicht so läuft, wie sich das Töchterchen das so vorgestellt hat, dann drückt sie auf die Tränendrüse und bekommt dann doch ihren Willen. Habe ich Recht?«
Ich versuchte, den Kloß herunterzuschlucken, der in meinem Hals saß. Er hatte ja keine Ahnung, wie falsch er damit lag. »Sie wissen doch gar nichts über mich«, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
Er musterte mich so scharf, dass es mir schwerfiel, meine Gefühle weiterhin in Schach zu halten.
»Wie dem auch sei«, sagte er knapp und legte arrogant den Kopf schief. »Fangen Sie lieber an zu beten, dass die Witterungsverhältnisse sich bald wieder bessern und sie nach uns suchen werden. Ansonsten sehe ich nämlich schwarz.« Seine dunklen Augen fixierten mich. »Und bis dahin, bemühen Sie sich, mir einfach nicht auf die Nerven zu gehen, sonst kann ich für nichts garantieren.«
Meine Miene blieb ungerührt, obwohl sich eine Gänsehaut auf meiner Haut ausbreitete und ein kleiner Schauer meinen Rücken hinablief. Ich biss die Zähne zusammen und meine Hände ballten sich zu Fäusten. Mit Mühe gelang es mir, mich selbst davon abzuhalten, mich nicht doch noch auf ihn zu stürzen und ihm an die Gurgel zu springen. Aus dem Augenwinkel heraus sah ich ihm nun dabei zu, wie er mir den Rücken zukehrte und an der Wand entlang, auf den in etwa ein Meter breiten und drei Meter hohen Spalt zwischen den Höhlenwänden, zuhielt.
Der Druck in meiner Brust wurde stärker. Was sollte ich jetzt tun? Ihm folgen? Kurz wägte ich ab, ob ich nicht alleine besser dran wäre.
Mist.
»Warten Sie! Wo wollen Sie denn hin?«, rief ich schließlich und schluckte meinen Ärger über ihn hinunter. Hastig sprang ich auf, was ich im nächsten Moment sogleich wieder bereute. Meine Beine gaben nach und mir wurde ganz schwindlig. Haltsuchend streckte ich meine Hand aus, um mich an der kühlen Steinwand abzustützen und atmete ein paar Mal tief ein und langsam wieder aus, bis die grellen Punkte vor meinen Augen endlich wieder damit aufhörten, zu tanzen. Natürlich bekam er von alledem nichts mit. Er sah nicht ein einziges Mal zu mir zurück.
War ja klar.
Ich schüttelte den Kopf und starrte auf seinen breiten Rücken. So sehr ich den Gedanken auch hasste: Ich brauchte ihn. Ich brauchte diesen arroganten, selbstgefälligen Mistkerl. Ohne ihn würde ich entweder verdursten oder erfrieren. Somit blieb mir also keine andere Wahl, als ihm zu folgen, wohin auch immer das gerade sein mochte.
Sobald ich ebenfalls den Ausgang erreichte, spürte ich auch schon den eisigen Wind auf meinem Gesicht. Ich blinzelte gegen das helle Licht und blieb in gebührendem Abstand hinter ihm stehen. Er stand nach wie vor mit dem Rücken zu mir und schaute starr auf den Schnee.
»Verdammte Scheiße«, murmelte er. Seine Schultern sackten nach vorne und es fühlte sich an, als würde die Zeit stillstehen.
Mein Herz zog sich zusammen, weil ich bereits wusste, was er sah. Trotzdem folgte ich seinem Blick.
»Ja«, stimmte ich ihm heiser zu, denn was hätte ich auch sonst sagen sollen?
Ich machte ein paar Schritte auf ihn zu. »Und nun?«, fragte ich in der Hoffnung, dass ihm eine Lösung für unsere missliche Lage einfallen würde.
Aber er antwortete nicht und schwieg.
Kapitel 2
Silas
Das hier war nicht real.
Es konnte einfach nicht real sein.
Ich ballte meine Hände zu Fäusten, damit ich nicht versucht war, aus Wut auf irgendwas einzuschlagen. Ich hätte sterben können, verdammt nochmal.
Mein Herz setzte einen Schlag aus.
Ich könnte jetzt tot sein. Doch ich war es nicht. Ich lebte. Dank ihr lebte ich.