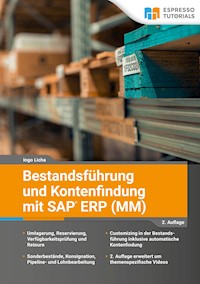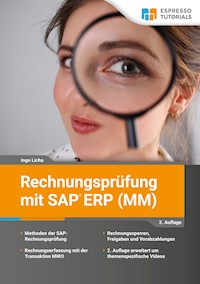14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Espresso Tutorials
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Lernen Sie die Grundlagen des Einkaufsprozesses in SAP ERP kennen. Das in diesem Buch mit vielen SAP-Screenshots illustrierte durchgängige Beispiel führt Sie durch alle wichtigen Teilschritte des Hauptprozesses im Material Management (MM): Sie starten mit den grundlegenden Einstellungen in den Kreditorenstammdaten und betrachten die Bestellanforderung bis hin zur Bestellung. Auf diesen Grundlagen aufbauend verfolgen Sie den dazu passenden Wareneingang und alle notwendigen Maßnahmen in der sich anschließenden Rechnungsprüfung. Die Autorin möchte Sie vor allem als Ratgeberin für das Zusammenspiel dieser einzelnen Prozessschritte begleiten. Die 2. Auflage wurde besonders im Hinblick auf den Freigabeprozess und das Gutschriftsverfahren erweitert. Sie finden weiterhin umfangreiche Tipps und Tricks, die den Arbeitsalltag erleichtern sowie eine ausführliche Beschreibung des Einkaufsinfosatzes und einen ersten Einstieg in den Materialstamm.
- Kompaktes Handbuch für den Einkaufsprozess mit SAP
- Stammdaten, Bestellanforderung, Wareneingang und Rechnungsprüfung
- Erleichterungen und Prozessoptimierungen für den Arbeitsalltag
- 2., erweiterte Auflage inklusive Freigabeprozess und Gutschriftsverfahren
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 102
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ingo Licha
Einkaufsorientierte Bedarfsplanung mit SAP®
Alle Rechte vorbehalten
1. Aufl. 2015, Gleichen
© Espresso Tutorials GmbH
URL:www.espresso-tutorials.com
Das vorliegende Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Übersetzung, des Vortrags, der Reproduktion und der Vervielfältigung. Espresso Tutorials GmbH, Zum Gelenberg 11, 37130 Gleichen, Deutschland.
Ungeachtet der Sorgfalt, die auf die Erstellung von Text und Abbildungen verwendet wurde, können weder der Verlag noch Autoren oder Herausgeber für mögliche Fehler und deren Folgen eine juristische Verantwortung oder Haftung übernehmen.
Feedback: Wir freuen uns über Fragen und Anmerkungen jeglicher Art. Bitte senden Sie diese an: [email protected].
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Unter Disposition versteht man die Tätigkeit, Ware oder Leistungen dem Verbraucher termingerecht, in ausreichender Menge und am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen. Zugleich sollen die kapitalbindenden Lagerbestände möglichst niedrig gehalten werden. Berücksichtigt man diese beiden Aspekte, befindet man sich in einem Zielkonflikt zwischen der Verfügbarkeit und einem möglichst geringen Lagerbestand. Ein zu geringer Lagerbestand kann zur Folge haben, dass das Material (aufgrund von Produktionsschwankungen) in Momenten erhöhter Nachfrage nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht. Das verursacht einen Produktions- oder Versorgungsstopp und entsprechende Umsatzeinbußen, die schlussendlich die Lagerungskosten übersteigen können. Eine zu hohe Lagerhaltung dagegen verursacht ebenso Kosten. Da jedes Material unterschiedlichen Beschaffungszeiten unterliegt sowie spezifische Lagereigenschaften besitzt, ist es notwendig, individuell reagieren zu können. Dieses Buch soll Sie dabei unterstützen, mithilfe der Materialwirtschaft im SAP-Standardsystem die Vorgaben einer geringen Lagerhaltung mit der Sicherheit der Warenverfügbarkeit so einzustellen, dass beide Prämissen möglichst weitgehend erfüllt werden.
Sie finden hier die unterschiedlichen Methoden der Disposition mit den jeweils notwendigen Einstellungen in SAP beschrieben, und zwar sowohl aus Anwendersicht in den Stammdaten als auch aus Sicht des Customizing-Verantwortlichen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Auswertung der Planung und Weiterbearbeitung der erzeugten Daten. Alle Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf Verfahren der verbrauchsgesteuerten Disposition. Für die plangesteuerte Disposition empfehle ich die Lektüre »Bedarfsplanung in der Produktion mit SAP® PP« von Björn Weber, erschienen 2013 bei Espresso Tutorials.
Dieses Buch ist meinen Schulungsteilnehmern gewidmet, als Dank für viele Fragen, durch die ich mich auch heute noch in die Sicht eines SAP-Einsteigers versetzen kann.
Mein Dank gilt ebenso Anja Achilles, die bei der Erstellung des Buches mitgeholfen hat.
Einen Dank auch an den SAP-Bildungspartner alfatraining. Basierend auf meinen langjährigen Erfahrungen, die ich als Trainer bei Schulungen sowie in der Ausbildung von SAP-Anwendern und -Beratern in dessen Bildungszentrum gemacht habe, kann ich in diesem Buch gezielt auf die wichtigsten Anwendungen und Fragen eingehen.
Ingo Licha
Juni 2015
Im Text verwenden wir Kästen, um wichtige Informationen besonders hervorzuheben. Jeder Kasten ist zusätzlich mit einem Piktogramm versehen, das diesen genauer klassifiziert:
Hinweis
Hinweise bieten praktische Tipps zum Umgang mit dem jeweiligen Thema.
Beispiel
Beispiele dienen dazu, ein Thema besser zu illustrieren.
Achtung
Warnungen weisen auf mögliche Fehlerquellen oder Stolpersteine im Zusammenhang mit einem Thema hin.
Zum Abschluss des Vorworts noch ein Hinweis zum Copyright: Sämtliche in diesem Buch abgedruckten Screenshots unterliegen dem Copyright der SAP SE. Alle Rechte an den Screenshots liegen bei der SAP SE. Der Einfachheit halber haben wir im Rest des Buches darauf verzichtet, darauf unter jedem Screenshot gesondert hinzuweisen.
1 Grundlagen zur Disposition
Zum Einstieg möchte ich Ihnen die Grundlagen der Disposition erläutern. Das Kapitel soll Ihnen das maßgebliche Ziel der Disposition erläutern und einen Überblick über die unterschiedlichen Dispositionsverfahren sowie die dazu erforderlichen Voraussetzungen im SAP-System geben.
1.1 Aufgabe der Disposition
Die Disposition zielt darauf ab, die Warenverfügbarkeit sicherzustellen, indem eine Beschaffung für die im Unternehmen benötigten Materialien ausgelöst wird. Ob das Material für den Eigenbedarf, die Produktion oder für den Wiederverkauf benötigt wird, ist nicht relevant. Hierbei ist darauf zu achten, dass die ausreichende Menge zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung steht. Im SAP-System endet die Aufgabe der Disposition mit der Erstellung eines Beschaffungsvorschlages in Form einer Bestellanforderung (Banf), eines Planauftrags, einer Reservierung oder einer Lieferplaneinteilung. Die Umsetzung dieser Beschaffungselemente erfolgt anschließend im Einkauf (Bestellanforderung ( Bestellung) oder in der Produktion (Planauftrag ( Fertigungsauftrag). Da eine Banf nur für die externe Beschaffung vorgesehen ist, kann sie in Einkaufsbelege wie Bestellungen oder Lieferplaneinteilungen umgesetzt werden. Wird hingegen ein Planauftrag erzeugt, so kann bei der Umsetzung noch entschieden werden, ob eine interne Beschaffung (Produktion) über einen Plan- oder Prozessauftrag erfolgen oder – beispielsweise bei Kapazitätsengpässen – das Material in der Produktion doch fremdbeschafft werden soll. In diesem Fall kann der Planauftrag in eine Banf umgesetzt werden, aus der dann wiederum eine Bestellung oder Lieferplaneinteilung erzeugt wird (siehe Abbildung 1.1).
Abbildung 1.1: Beschaffung über die Disposition
Welcher der aufgezeigten Wege eingeschlagen wird, ist von verschiedenen Faktoren abhängig:
der Beschaffungsart im Materialstamm,
der erlaubten Beschaffungsart der Materialart (Einstellung im Customizing – siehe auch »Bestandsführung und Kontenfindung mit SAP ERP MM«, Kapitel 12.7, erschienen bei Espresso Tutorials 2014),
dem Erstellungskennzeichen im Planungslauf (Einstellung im Customizing, Werksparameter bzw. Dispositionsgruppen – siehe
Abschnitt 8.2
)
1.2 Voraussetzungen für die Disposition
Für eine Nutzung der Disposition auf Werksebene müssen im SAP-System einige Voraussetzungen geschaffen werden. Die folgenden Einstellungen sind hierbei zu pflegen:
Im Customizing muss das Werk für die Disposition aktiviert werden.
Im Customizing müssen die
Werksparameter
gepflegt sein.
Im Materialstamm muss die Dispositionssicht auf Werksebene mit dem
Dispositionsmerkmal
gepflegt sein.
1.2.1 Aktivierung der Disposition
Um die Bedarfsplanung zuzulassen, ist eine Aktivierung der Disposition auf Ebene des Werkes nötig. Diese Aktivierung wird im Customizing im Referenz-IMG unter Materialwirtschaft • Verbrauchsgesteuerte Disposition • Bedarfsplanung (Transaktion OMDU) eingestellt (siehe Abbildung 1.2).
Abbildung 1.2: Aktivierung der Bedarfsplanung
1.2.2 Die Werksparameter
In den Werksparametern werden, wie der Name bereits sagt, auf Ebene des Werkes diverse Einstellungen vorgenommen. In Abbildung 1.3 ist die Customizingtransaktion OMI8 dargestellt mit den Möglichkeiten der Anlage, Pflege, Löschung und des Kopierens auf ein anderes Werk.
Abbildung 1.3: Transaktion OMI8: Werksparameter
Die einzelnen Einstellungen zu den jeweiligen Parametern finden Sie im Abschnitt 8.2 in der Disposition beschrieben.
1.2.3 Das Dispositionsmerkmal
Das Dispositionsmerkmal wird dem Material im Materialstamm auf der Sicht Disposition 1 zugewiesen (siehe Abbildung 1.4).
Abbildung 1.4: Dispositionsmerkmal im Materialstamm
Zur Auswahl stehen zuvor im Customizing eigens erstellte bzw. in der SAP-Auslieferung vorhandene Dispomerkmale. Definition und Einstellungen zum Dispomerkmal werden im Abschnitt 8.3 (Customizing) beschrieben. Das Dispositionsmerkmal hat Auswirkungen auf:
das Dispositionsverfahren (
Abschnitt 1.4
),
die Fixierungsart des Planungsergebnisses (
Kapitel 5
),
ob regelmäßig disponiert wird (z.B. plangesteuerte Disposition),
die Prognoseverwendung (
Kapitel 6
),
die Berechnung des Sicherheits- und Meldebestands und
die Bildfolge des »großen Kopfes« (
Abschnitt 5.1
).
1.3 Planungsebenen der Disposition
Die Planung der Disposition findet, sofern nicht gesondert eingestellt, auf Werksebene statt. Das SAP-System lässt es zu, Lagerorte separat zu disponieren oder gar von der Disposition auszuschließen. Materialien, die sich in diesen Lagerorten befinden, werden bei einer Bedarfsplanung im Werk nicht als Bestand berücksichtigt. Zusätzlich lassen sich unterschiedliche Dispositionsbereiche einrichten, mit denen nur ausgewählte Ebenen geplant werden. Diese unterscheidet man in die Dispositionsbereichstypen:
Werk,
Lagerort und
Lohnbearbeiterdispositionsbereich.
Materialien, die Sie nicht explizit einem Dispobereich zuordnen, sind automatisch im Werksdispositionsbereich angesiedelt. Dieser ist obligatorisch und wird vom System mit Aktivierung der Bedarfsplanung in einem Werk angelegt. Die Anwendung und Einstellung der Dispositionsbereiche werde ich im Abschnitt 8.9 ausführlich behandeln.
1.4 Dispositionsverfahren
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen der plangesteuerten und der verbrauchsgesteuerten Disposition. Einen Überblick der verschiedenen Dispositionsverfahren gibt Abbildung 1.5.
Abbildung 1.5: Dispositionsverfahren
1.4.1 Die plangesteuerte Disposition
In der plangesteuerten Disposition werden über den aktuellen und zukünftigen Absatz und Verbrauch die Bedarfsmengen berechnet. Externe Bedarfe wie Kundenaufträge, Reservierungen oder Planprimärbedarfe fließen in die Berechnung ein. Vorteil der plangesteuerten Disposition ist, dass durch die Planung der exakten Bedarfsmengen mit einem niedrigeren Sicherheitsbestand gearbeitet werden kann. Sollen noch nicht vorhandene Bedarfe mit in die plangesteuerte Disposition eingerechnet werden, so ist dies über eine Prognose möglich. Die plangesteuerte Disposition eignet sich daher für A-Teile in der Produktion (ihr durchschnittlicher Wertanteil an den jährlichen Materialkosten liegt in der Regel zwischen 60 und 80 %) und deren benötigte Baugruppen und Komponenten.
1.4.2 Die verbrauchsgesteuerte Disposition
Im Gegensatz zur plangesteuerten orientiert sich die verbrauchsgesteuerte Disposition an den in der Vergangenheit verbrauchten Mengen eines Materials. Über die Prognose oder statistische Verfahren wird der zukünftige Bedarf errechnet. Da bei der verbrauchsgesteuerten Disposition der Impuls nicht aus der Produktion oder dem Vertrieb kommt, wird die Nettobedarfsrechnung nicht über einen Primär- oder Sekundärbedarf angestoßen, sondern durch eine Unterdeckung des im Materialstamm festgelegten Meldebestands bzw. durch ermittelte Prognosebedarfe, die aus Vergangenheitswerten auf die Zukunft hochgerechnet werden. Um eine reibungslose verbrauchsgesteuerte Disposition durchführen zu können, ist eine planvolle Bestandsführung erforderlich. SAP unterscheidet bei diesem Verfahren zwischen den folgenden Dispositionsverfahren:
manueller Bestellpunktdisposition,
automatischer Bestellpunktdisposition,
stochastischer Disposition und
rhythmischer Disposition.
Die verbrauchsgesteuerte Disposition ist für B- und C-Teile, beispielsweise Hilfs- und Betriebsstoffe oder DIN-Teile wie Schrauben gedacht.
Plangesteuerte oder verbrauchsgesteuerte Disposition?
Bei teuren Materialien und solchen mit unregelmäßigem Verbrauch empfiehlt sich die plangesteuerte Disposition, für günstigere Materialien mit relativ konstantem Verbrauch hingegen eignet sich das verbrauchsgesteuerte Verfahren.
1.5 Fazit
Mit der Disposition lässt sich die Beschaffung von Material vereinfachen und weitgehend automatisieren. Mit der Disposition im SAP-System steht dem Disponenten ein Werkzeug zur Verfügung, mit dessen Hilfe er komfortabel und schnell Bestellanforderungen, Planaufträge, Lieferplaneinteilungen und Reservierungen anlegen kann. Die tatsächliche Beschaffung (Bestellung) oder Produktion (Fertigungsauftrag) wird danach von den Abteilungen Einkauf bzw. Produktionsplanung umgesetzt.
Im folgenden Kapitel gehe ich ausschließlich auf die unterschiedlichen Dispositionsverfahren der verbrauchsgesteuerten Disposition ein. Die plangesteuerte Disposition werde ich in diesem Buch nicht weiter behandeln. Hierzu empfehle ich die Lektüre »Bedarfsplanung in der Produktion mit SAP PP« von Björn Weber, erschienen 2013 bei Espresso Tutorials.
2 Dispositionsverfahren in der verbrauchsgesteuerten Disposition
In diesem Kapitel lernen Sie die unterschiedlichen Verfahren der verbrauchsgesteuerten Disposition sowie deren Besonderheiten und wichtigste Einstellungen kennen. Dabei werden Ihnen grundlegende Begrifflichkeiten vermittelt, die für die Disposition im SAP-System wichtig sind. Für welches der vier vorgestellten Verfahren man sich letztendlich entscheidet, ist von den vorhandenen Daten im System abhängig. Die für einige Verfahren zwingend notwendige Prognose kann beispielsweise nur erfolgen, wenn Vergangenheitswerte zugrunde liegen.
2.1 Die manuelle Bestellpunktdisposition
2.1.1 Definition
In der manuellen Bestellpunktdisposition vergleicht das SAP-System den dispositiv verfügbaren Bestand mit dem Meldebestand im Materialstamm. Über das Dispositionskennzeichen »VB« im Materialstamm weist man das Dispositionsverfahren dem Material zu (siehe Abbildung 1.4). Der Melde- und Sicherheitsbestand wird bei dieser Dispositionsart manuell auf den Sichten Dispo1 (Meldebestand) und Dispo2 (Sicherheitsbestand) eingepflegt (vgl. Abschnitt 3.1).
Der Meldebestand
Der Meldebestand ist eine Bestandsmenge, bei deren Erreichen oder Unterschreiten eine Beschaffung ausgelöst werden soll, um sicherzustellen, dass das Material während des Beschaffungsprozesses stets in ausreichender Menge zur Verfügung steht
Der Sicherheitsbestand
Der Sicherheitsbestand dient zur Überbrückung des Materialbedarfs bei Verzögerung in der Beschaffung (Lieferverzögerung oder Probleme bei der Fertigung) und ist Bestandteil des Meldebestands.
Wird der Meldebestand erreicht oder unterschritten, soll nachgeordert werden. Im Idealfall wird mit Erreichen des Sicherheitsbestands der Wareneingang gebucht (siehe Abbildung 2.1)