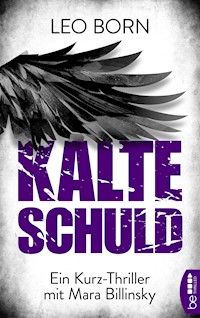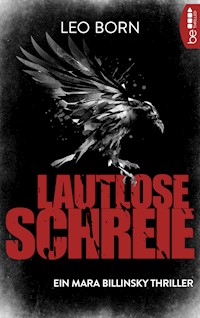9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Mara Billinsky
- Sprache: Deutsch
Frankfurt leidet unter dem heißesten Sommer seit Jahren - und das Verbrechen in der Stadt greift eiskalt um sich. Mehrere Morde und Vergewaltigungen machen Kommissarin Mara Billinksy zu schaffen. Und ihr Kollege Jan Rosen stößt im Internet auf verstörende Filme, in denen Menschen missbraucht und lebendig verbrannt werden.
Während die Hitzewelle bleiern über der Stadt hängt, tritt Mara zu lange auf der Stelle. Denn als zwei ihrer engsten Freunde verschwinden und der schwedische Ermittler Erik Nordin wieder vor ihrer Tür steht, weiß die sonst so toughe »Krähe« nicht mehr, wem sie noch trauen kann - und wer sie in eine tödliche Falle locken will ...
In ihrem achten Fall wird Frankfurts härteste Ermittlerin wortwörtlich zur Zielscheibe in einem perfiden Spiel, das nicht alle ihrer Wegfährten überleben werden.
PRESSE-STIMME
»Ähnlich spektakulär wie in den Werken europäischer Großmeister wie Jean-Christophe Grangé oder Stieg Larsson entspinnt sich (...) ein rasantes Karussell von Verdächtigungen und Verhaftungen, Actionszenen und Alleingängen, aus dem alle Beteiligten mindestens mit körperlichen und seelischen Narben hervorgehen. Zudem stößt dieser rabenschwarze Frankfurt- Thriller auch tief in die dunkelsten Abgründe menschlichen Handelns vor. (...) Zudem ist »Eisige Stille« so frisch geschrieben, dass es eher wie ein Debütroman wirkt und keinesfalls wie der achte Band einer Serie. Wenn Autor Leo Born dieses Niveau aufrechterhalten kann, dann hat dieses Frankfurter Thrillerformat durchaus Kultpotenzial und ragt weit heraus aus dem Einheitsbrei der Regionalkrimis.« (Manfred Hitzeroth, Oberhessische Presse)
Die bisherigen Fälle für Mara »Die Krähe« Billinsky:
Blinde Rache
Lautlose Schreie
Brennende Narben
Blutige Gnade
Vergessene Gräber
Sterbende Seelen
Schwarzer Schmerz
Darum lieben Thriller-Fans die Bücher von Leo Born:
»Leo Borns Schreibstil ist großartig. Man fliegt nur so durch die Seiten, weil man das Buch nicht zur Seite legen kann. Flüssig und locker, aber ebenso wortgewandt und packend.« (Bambarenlover, Lesejury)
»Der Autor hat es geschafft mich ab der ersten Seite an so sehr zu fesseln, dass ich das Buch kaum aus der Hand zu legen vermochte.« (Dirk64, Lesejury)
»Mir gefällt diese Thriller-Reihe richtig gut. Spannend schildert Leo Born die Ermittlungen der Einzelgängerin Mara Billinsky und greift dabei gleichzeitig heikle Themen auf.« (Nirak03, Lesekury)
Entdecke auch die neue Thriller-Reihe von Leo Born mit Jakob Diehl:
Lilienopfer. Dein Tod gehört mir
Racheherz. Der Schrecken in dir
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
CoverGrußwort des VerlagsÜber dieses BuchTitelPrologTeil 1: Wenn das Böse uns findet12345678910111213141516171819202122232425Teil 2: Warum wir uns im Dunkeln fürchten262728293031323334353637383940414243444546Teil 3: Wenn wir am Abgrund stehen47484950515253545556575859606162636465666768697071727374Teil 4: Was wir dem Tod schulden75767778798081828384858687888990919293949596979899100101102EpilogÜber den AutorImpressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Frankfurt leidet unter dem heißesten Sommer seit Jahren - und das Verbrechen in der Stadt greift eiskalt um sich. Mehrere Morde und Vergewaltigungen machen Kommissarin Mara Billinksy zu schaffen. Und ihr Kollege Jan Rosen stößt im Internet auf verstörende Filme, in denen Menschen missbraucht und lebendig verbrannt werden.
Während die Hitzewelle bleiern über der Stadt hängt, tritt Mara zu lange auf der Stelle. Denn als zwei ihrer engsten Freunde verschwinden und der schwedische Ermittler Erik Nordin wieder vor ihrer Tür steht, weiß die sonst so toughe »Krähe« nicht mehr, wem sie noch trauen kann - und wer sie in eine tödliche Falle locken will …
In ihrem achten Fall wird Frankfurts härteste Ermittlerin wortwörtlich zur Zielscheibe in einem perfiden Spiel, das nicht alle ihrer Wegfährten überleben werden.
Die bisherigen Fälle für Mara »Die Krähe« Billinksy:
Blinde Rache
Lautlose Schreie
Brennende Narben
Blutige Gnade
Vergessene Gräber
Sterbende Seelen
Schwarzer Schmerz
Darum lieben Thriller-Fans die Bücher von Leo Born:
»Leo Borns Schreibstil ist großartig. Man fliegt nur so durch die Seiten, weil man das Buch nicht zur Seite legen kann. Flüssig und locker, aber ebenso wortgewandt und packend.« (Bambarenlover, Lesejury)
»Der Autor hat es geschafft mich ab der ersten Seite an so sehr zu fesseln, dass ich das Buch kaum aus der Hand zu legen vermochte.« (Dirk64, Lesejury)
»Mir gefällt diese Thriller-Reihe richtig gut. Spannend schildert Leo Born die Ermittlungen der Einzelgängerin Mara Billinsky und greift dabei gleichzeitig heikle Themen auf.« (Nirak03, Lesekury)
Entdecke auch die neue Thriller-Reihe von Leo Born mit Jakob Diehl:
Lilienopfer. Dein Tod gehört mir
Racheherz. Der Schrecken in dir
eBooks von beTHRILLED – mörderisch gute Unterhaltung
LEO BORN
EIN MARA BILLINSKY THRILLER
Prolog
»Heutzutage würde die Kreuzigung live im Fernsehen übertragen werden.«
Er ließ seinen Worten ein raues, kehliges Lachen folgen.
Der Prinz hielt Audienz. Nicht in einem Palast, sondern in einer verlassenen Lagerhalle, in der es nach Mäusedreck roch. Er war ja auch kein Adliger, sondern der Prinz des Dschungels, wie er sich manchmal selbst nannte.
»Nein, nicht im Fernsehen«, korrigierte er sich. »Sondern im Netz. Und alle würden zusehen, wie man dem armen Kerl die Nägel durchs Fleisch treibt, und dabei Doritochips essen.«
Rafael Makiadi hing an Prince Banguras Lippen. Wie vom ersten Moment an, seit jenem Abend, als sie sich in einem Club über den Weg gelaufen waren. Bangura stammte aus Sierra Leone, und trotz seiner gerade mal dreißig Jahre hatte er anscheinend mehr gesehen als die meisten Achtzigjährigen.
Sie saßen in einer Ecke der Halle auf schiefen Campingstühlen, ein kurioses Bild in dem ansonsten völlig leeren Gebäude. Banguras Lachen, bei dem er seine prächtigen weißen Zähne zeigte, hallte von den hohen Wänden wider. Durch die verdreckten, teilweise zersplitterten Fensterscheiben fiel Tageslicht ein, das Staubpartikel flimmern ließ. Draußen erklang das Motorbrummen eines sich nähernden Autos. Von der nahen Stadt war hingegen an dieser von einem Waldstück abgeschirmten Stelle kaum etwas zu hören. Neben Banguras Stuhl lag eine große längliche Nylontasche, aus der er einen Sportbogen und mehrere Pfeile zog, um sie Rafael mit plötzlich fast feierlicher Miene zu präsentieren. Einige Sekunden verstrichen. Rafael stellte keine Fragen, weil er wusste, dass Prince Neugier verachtete.
»Das ist ein Compound-Bogen der High Country Archery«, erklärte der Prinz des Dschungels. »Die Pfeile haben eine mechanische Innerloc-Spitze.«
Rafael nickte, als könnte er irgendetwas mit den Begriffen anfangen.
»Ich zeige es dir, Bruder.« Bangura stand auf, und Rafael tat es ihm gleich.
Sie konnten hören, wie das Auto zum Halten kam, der Motor wurde ausgeschaltet. Es folgte eine dumpfe Stille.
»Siehst du? Ich lege den Pfeil ein, platziere die Nocke sorgfältig auf der Bogensehne.«
Rafael nickte wie zuvor.
»Versuch du es.« Bangura reichte ihm Pfeil und Bogen.
Rafael konzentrierte sich und tat, was verlangt wurde.
»Mach es ruhig mehrmals. Ein tolles Gefühl, damit zu schießen. Der lautlose Tod. Sehr erhaben.« Wieder blitzten die Zähne in dem ovalen Gesicht. Makellos dunkle Haut, kurz geschorene kohlschwarze Haare, ein silbern funkelnder Ohrstecker in der Form eines Dolchs.
Draußen wurden Autotüren mit trockenem Knall zugeschlagen.
»Kriegst du es hin?« Bangura lachte. »Die Frage ist nur, was jetzt noch fehlt. Na, was denkst du?«
Rafael nahm den Pfeil von der Sehne und ließ den Bogen sinken.
Schritte näherten sich.
»Was fehlt noch?«, wiederholte Bangura.
Rafael gab keine Antwort.
Quietschend ging die Seitentür auf. Zwei von Banguras Männern führten eine Person in die Halle, der man die Hände auf den Rücken gefesselt und eine einfache Stofftasche übergestülpt hatte, damit sie nichts sehen konnte.
Bangura versetzte Rafael einen spielerischen Klaps auf den Hinterkopf. »Es fehlt natürlich ein Ziel, du Dummkopf.«
In Rafael breitete sich jäh eine Eiseskälte aus. Er sog die Luft ein, versuchte sich nichts anmerken zu lassen.
»Der lautlose Tod«, wiederholte Bangura leise. Seine Stimme hatte auf einmal diesen gefährlichen, unberechenbaren Klang angenommen, den er anscheinend wie auf Knopfdruck aktivieren konnte.
Rafael wagte kaum, die gefesselte, eher zierliche Gestalt anzusehen, die vor einer der nackten Wände positioniert wurde, während sich ihre beiden Bewacher neben Prince stellten.
»Den Pfeil einlegen, die Nocke auf der Sehne platzieren«, ertönten die geflüsterten Anweisungen. »Na los!«
Rafael gehorchte.
»Was ist los? Zittern deine Finger?«
Rafael versuchte das Beben seiner Hände zu unterdrücken, doch es gelang ihm nicht.
»Cool bleiben, Bruder.« Der Prinz des Dschungels betrachtete ihn aufmerksam. »Ja, wir sollten es wirklich irgendwann mal ins Netz stellen.«
Einer der beiden anderen Männer zückte sofort das Handy, um zu filmen. »Früher jagte der Mensch, um zu leben – heute, um zu erleben«, fuhr Bangura fort. »Oder wie geht der Spruch? Ach, ist doch scheißegal.«
Rafael schluckte. Er starrte den staubigen Boden an.
»Du musst dein Ziel schon ins Visier nehmen, Rafael. Sonst wird das nichts mit dem Treffer. Na los!«
Widerstrebend wanderte Rafaels Blick langsam nach oben. Er sah die Doc-Martens-Stiefel des Opfers, die hautenge Jeans, die abgewetzte Lederjacke. Kein einziger Farbtupfer, alles in tiefem Schwarz. Wie das Gefieder einer Krähe.
Zum Glück war das schmale, blasse Gesicht, das Rafael so vertraut war, verhüllt. Jetzt in diese dunklen Augen zu schauen, dazu hätte er niemals die Kraft gehabt.
In seinem Leben gab es wenige Menschen, die ihm etwas bedeuteten. Diese Frau hier gehörte zu ihnen.
»Zeig uns den lautlosen Tod«, forderte Prince Bangura. »Schieß!«
Rafael spannte die Bogensehne. Er sah Kommissarin Mara Billinsky an. Nahm ihre Hilflosigkeit wahr, ihre Angst.
»Schieß, Rafael!«
Die Sehne gab den Pfeil frei. Ein surrender Laut zerschnitt die Stille in der Lagerhalle.
Teil 1
Wenn das Böse uns findet
1
Drei Wochen zuvor
Jan Rosen drückte eine Taste seines Laptops. Auf dem angeschlossenen Wandmonitor startete eine Filmsequenz mit einigen verwackelten Bildern.
Die Schreibtischlampe war dezent herunter gedimmt. Nur der Schein des Bildschirms brach das matte Halbdunkel des fensterlosen Raums. Es war noch früh am Morgen, er war allein, um ihn herum herrschte Stille.
»Shit! Du bist ein Maulwurf geworden.« Das hatte Mara Billinsky gesagt, als sie Rosen einmal kurz an seinem neuen Arbeitsplatz im Untergeschoss des Präsidiums besucht hatte.
Es war ihm leichtgefallen, ihren Spott mit einem Lächeln an sich abperlen zu lassen. Im Grunde mochte er genau das, was seine Kollegin zum kritischen Heben ihrer Augenbraue veranlasst hatte: Hier unten war er abgeschnitten vom Ermittlerteam, stand nicht mehr im Brennpunkt, vor allem aber war er weg von der Straße, die Mara so sehr liebte und die ihm selbst immer Schweißausbrüche und Magengeschwüre beschert hatte. Anstelle von Einsätzen im Bahnhofsviertel verbrachte er nun seine Arbeitstage in der beruhigenden Ruhe der Kellerräume. Keine gebrüllten Befehle, keine quietschenden Reifen, kein Dienst an der Waffe.
Weitere Fortbildungen warteten noch auf ihn, um zu einem vollwertigen Mitglied der IT-Mega-Nerd-Truppe zu werden, wie Mara sie nannte. Er konnte kaum in Worte fassen, wie heilfroh er war, hier gelandet zu sein.
Aber auch hier beinhaltete seine Arbeit oft allzu Schreckliches. Schon kurz nach Rosens Abteilungswechsel ließen seine neuen Kollegen die landesweit in der Presse besprochene Plattform Avento hochgehen, einen von Kassel aus betriebenen Kinderpornografie-Ring im Darknet, bei dem sich fast 90.000 User unter Tarnnamen registriert hatten. Allein zum Besitz oder der Verbreitung von kinderpornografischen Bildern gingen mehrere Tausend Hinweise pro Jahr ein. Es war ein Sumpf, dessen Tiefe höchstens zu erahnen war.
Die Bilder auf Rosens Monitor wurden schärfer, er lehnte sich zurück. Die Kamera fing einen Mann ein, dessen Handgelenke und Fußknöchel an einen einfachen Küchenstuhl gefesselt waren. Er war nackt, abgesehen von einem Kissenbezug, der über seinen Kopf gestülpt war, sodass er zwar atmen, aber nichts sehen und nicht erkannt werden konnte. Hinter ihm war ein weißes Bettlaken aufgespannt, um zu verhindern, dass verräterische Einzelheiten wie Möbelstücke oder andere Gegenstände zu sehen waren.
Der Mann wurde von einem nicht im Bild sichtbaren Strahler beleuchtet und blutete unterschiedlich stark aus mehreren Wunden. Sein Kopf war zur Seite gesunken, er atmete offenbar heftig und war wohl bei Bewusstsein.
Eine stark vermummte Gestalt näherte sich dem Unbekannten schräg von hinten.
Rosens Muskeln spannten sich unwillkürlich an. Sein Mund war trocken, er war versucht, den Film zu stoppen. Er zog die Kopfhörer über. Das taten alle seine Kollegen, damit mögliche Schreie und Weinkrämpfe von Opfern nicht im gesamten Büro mit angehört werden mussten. Jetzt war er zwar noch allein, aber schließlich konnten gleich weitere Mitarbeiter den Dienst antreten.
Die Gewalt im Netz erreichte allmählich eine Dimension, die ihn zutiefst erschütterte. Es tauchten immer mehr dieser ungespielten Szenen auf, die vor Brutalität trieften. Woher kam der Drang des Menschen, Gewalt auszuüben? Woher die Faszination dafür? Die Gestalt präsentierte der Kamera eine Plastikflasche, deren Inhalt sie über den Gefesselten ergoss. Der Kopfkissenbezug wurde getränkt. Der Mann zuckte erschrocken zusammen, riss den Kopf hoch und begann vor Entsetzen zu kreischen. Es waren keine artikulierten Laute, sondern ein fast tierisches Gebrüll, das bei Rosen Gänsehaut auslöste.
Die Gestalt entzündete ein Streichholz. Der Mann schrie immer lauter und wand sich verzweifelt auf dem Stuhl, ohne dass die Fesseln nachgaben.
Rosen biss unwillkürlich die Zähne zusammen.
Mit lässigem Schwung warf die Gestalt das brennende Streichholz auf das hilflose Opfer.
Rosens Hand zuckte reflexartig, und er drückte doch noch die rettende Taste, um den Film vom Monitor verschwinden zu lassen.
War es zuvor noch angenehm warm gewesen, schien es auf einmal unerträglich stickig im Raum zu sein. Er atmete tief ein und wieder aus. Jetzt hätte er gern ein großes Fenster gehabt, um es aufreißen und frische Luft reinlassen zu können.
Bereitwillig ließ er sich vom Halbdunkel schlucken, als könnte es ihn schützen. Reglos saß er da.
Die Welt da draußen ist böse, dachte er.
2
Mara Billinsky dachte an Erik Nordin, und sie verfluchte sich dafür.
Sie folgte in gemächlichem Tempo dem Straßenverlauf, den Blick düster nach vorn gerichtet. Einmal hielt sie kurz an, um die heruntergelassenen Rollläden zu betrachten und das daran festgeklebte Schild zu lesen, das über die Schließung informierte. Wieder ein richtig gutes Restaurant in Nähe des Hauptbahnhofs, das die Pforten dichtmachte.
Mara ging weiter.
Bis vor einiger Zeit hatte es noch Anstrengungen gegeben, aus dem berüchtigten Bahnhofsviertel ein Trend-Quartier zu machen, doch davon war nicht mehr viel zu spüren. Im Gegenteil, alles schien immer mehr vor die Hunde zu gehen.
Sie ließ den Blick kreisen. All die weggeworfenen Einwegspritzen. An jeder Ecke Müll. Und dann die Gestalten, die sich in alten Schlafsäcken oder auf bloßem Pflaster am Rand der Bürgersteige zusammenrollten. Sie wurden zahlreicher. Der wabernde Gestank, die Graffiti an den Hauswänden, der tosende Beat aus den Eingängen der Strip-Schuppen.
Drei Jugendliche, die Mara als Laden- und Handtaschendiebe kannte, gingen auf die andere Straßenseite, als sie sie erblickten. Aus einem Laufhaus stöckelte eine Blondine, um im chinesischen Lebensmittelladen direkt nebenan einen raschen Einkauf zu erledigen. Tauben pickten in Essensresten. Einige Straßen entfernt jaulte eine Polizeisirene auf, um gleich wieder zu verstummen.
Eine vertraute Atmosphäre von Gewalt und Verzweiflung lag in der Luft, schwebte wie eine Drohung durch die Häuserschluchten.
Mara kannte das. Manchmal wurde sie förmlich angezogen von diesen Straßen; hier spürte sie auf paradoxe Weise, dass sie am Leben war. Sogar jetzt, an ihrem ersten Arbeitstag nach einem kurzen Urlaub, war sie hier unterwegs, auch wenn es gar keinen Ermittlungsanlass dafür gab. Aber gelegentlich musste man nach seinen Spitzeln sehen, einfach nur die Augen und Ohren offen halten.
Vor dem sogenannten Konsumhaus an der Ecke Niddastraße stand eine Schlange von Junkies, die mit leerem Blick vor sich hinstarrten. Sie lief an ihnen vorbei und spähte zum Himmel. Die Sonne zeigte sich, es war warm geworden. Mara hätte gern die Lederjacke ausgezogen, doch dann wäre ihre Pistole, die im Hüftholster steckte, für jeden sichtbar geworden. Dabei wussten die meisten Leute hier ohnehin, wer sie war. Die Krähe. Die Billinsky. Die Bullen-Lady mit den langen schwarzen Haaren und den schwarzen Klamotten.
Ja, sie dachte an Nordin.
Und ja, sie verfluchte sich dafür.
Nach der Aufklärung einer Verbrechensserie, die in der Presse als die Silberturm-Morde bekannt wurde, hatte sie spontan eine Woche freigenommen, um zur Ruhe kommen zu können.
Nordin hatte ihr jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sechs Tage und sechs Nächte lang hatten sie von Lieferpizza und Sex gelebt. Abgeschottet von der Welt, zwei Einsame auf jener Insel, die Maras kleine düstere Wohnung bildete. Nun war er weg und doch ständig da. Seine kalten blauen Augen. Sein herausforderndes Grinsen. Der Geruch seiner Haut.
Der Schwede war zurück in seine Heimat geflogen, um sich dem Prozess zu stellen, bei dem untersucht werden sollte, ob seine Ehefrau, ebenfalls eine Polizistin, durch eine zufällige Kugel gestorben war oder ob er sie kaltblütig erschossen hatte.
Nordin war Teil einer noch recht neuen internationalen Ermittlertruppe, der inzwischen auch Mara angehörte. Sie waren damit betraut, einen im Verborgenen agierenden Verbrecher zu stellen, der sich in Deutschland unter dem Decknamen Polaris einen besorgniserregenden Ruf erworben hatte. Doch bisher hatte er es bestens verstanden, seinen wirklichen Namen, wie auch alle weiteren Details aus seiner Biografie, geheim zu halten. Es war, als versuchten sie, einen Geist einzufangen. Wie aus dem Nichts war mit dieser bislang erfolglosen Ermittlung Erik Nordin in Maras Leben gespült worden, nur um ein paar Wochen später schon wieder fortgerissen zu werden. Sie wusste nicht einmal, ob sie ihn jemals wiedersehen würde.
Scheiße!
Dieser verdammte, undurchschaubare Mistkerl.
An einem marokkanischen Stehimbiss machte sie halt, um sich mit Zaâlouk, einem Auberginensalat, von Nordin abzulenken. Was nur mäßig glückte. Auch ein anderer Mann fiel ihr ein, in ihren Augen eher noch ein Junge: Rafael Makiadi.
Sie hatte sich enorm für ihn eingesetzt, damit er nicht auf die schiefe Bahn geriet. Und gemeinsam mit Hanno Linsenmeyer, einem Sozialarbeiter, der Jahre zuvor dasselbe für Mara getan hatte, war es ihr sogar gelungen. Rafael befand sich nun in einem staatlich finanzierten Programm, das straffällig gewordene junge Menschen unterstützte, sich von ihrer kriminellen Vergangenheit zu lösen und eine geregelte bürgerliche Existenz aufzubauen.
Sie zog das Handy aus der Tasche und entdeckte, dass Rosen sich gemeldet, jedoch keine Sprachnachricht hinterlassen hatte. Aber jetzt war erst mal Rafael an der Reihe. Sie rief ihn an, die Mailbox-Ansage erklang, und sie bat um Rückruf. Gleich darauf versuchte sie es bei Hanno, der sofort dranging.
»Schön, von dir zu hören!«, rief er mit unverkennbar hessischem Zungenschlag. Er bereitete seinen Ausstieg aus dem Berufsleben vor, aber mit Rafael hatte ihn mehr verbunden als nur das rein Berufliche. Der Junge war ihm, genau wie Mara, mit seiner stillen, zurückgenommenen Art sehr ans Herz gewachsen. Es war Freundschaft, was diese drei vollkommen unterschiedlichen Charaktere verband.
»Hast du eigentlich mal wieder was von Rafael gehört?«, wollte sie wissen.
»Hm«, kam es nachdenklich von Hanno. »Der Junge macht sich etwas rar in letzter Zeit.«
»Grund zur Sorge?« Mara wurde der Espresso gebracht, den sie nach dem Salat noch rasch bestellt hatte.
»Ich glaube nicht. Er braucht wahrscheinlich einfach ein bisschen Ruhe. Ist ja auch völlig in Ordnung. Er hat die Mittlere Reife mit Bravour nachgeholt, und jetzt erledigt er einen Nebenjob in der kleinen Schraubenfabrik im Osthafen.« Hanno lachte. »Vielleicht ist er ja verliebt.«
»Ach? Ist da was im Busch?«
»Nicht, dass ich wüsste. Mich hat er jedenfalls in keine Geheimnisse eingeweiht. Er hat mir nur was von einem neuen Kumpel erzählt, mit dem er wohl viel Zeit verbringt. Er hat noch gesagt, wie er heißt, aber ich hab’s vergessen, das war so ein komischer Name.«
»Das ist alles?«
»Das ist alles.«
»Okay«, meinte sie mit einem vagen Achselzucken. »Klingt ja im Grunde nicht sehr besorgniserregend.«
Erneut lachte Hanno. »Du hörst dich fast an, als wäre es dir anders lieber.«
Sie unterhielten sich noch eine Weile, und Mara nippte dabei an der kleinen Kaffeetasse. Kaum war das Gespräch beendet, klingelte ihr Handy erneut. Sie rechnete mit Rosen, doch es war ihr Chef, Hauptkommissar Rainer Klimmt, mit dem sie sich nach anfänglichen, teilweise heftigen Scharmützeln auf erstaunliche Weise zusammengerauft hatte. Er vertraute ihr inzwischen völlig, aber das zeigte er natürlich nicht oder nur im äußersten Notfall.
»Sehnsucht nach mir?«, fragte sie.
»Wie nach einer Wurzelbehandlung beim Zahnarzt«, brummte er. »Trotzdem frage ich mich mal wieder, wo Sie sich herumtreiben.«
»In freier Wildbahn.«
»Heute ist doch Schluss für Sie mit Faulenzen, oder täusche ich mich?«
»Nein, das stimmt schon. Aber bevor ich ins Büro komme, wollte ich noch ’ne Runde durch die dunkle Seite der Stadt drehen. Zur Einstimmung sozusagen.«
»Was ist denn eigentlich mit Ihrer internationalen Truppe?«
»Gute Frage, nächste Frage.« Sie hatte nun wirklich nicht die geringste Lust, ausgerechnet mit Klimmt über Erik Nordin zu reden.
»Ihre freche Klappe hab ich am meisten vermisst«, brummte er.
»Ich freu mich auch, wieder an Bord zu sein.«
»Eigentlich rufe ich wegen Rosen an. Er hat vorhin durchgeklingelt und irgendetwas vom Darknet geredet. Ich hab ihn an Sie verwiesen.«
»Okay, ich rufe ihn gleich zurück.«
»Wie geht’s ihm seit dem Abteilungswechsel?«
Für Klimmt war eine solche Frage fast schon so etwas wie Gefühlsduselei, und Mara musste schmunzeln. »Ich habe den Eindruck, Rosen lebt regelrecht auf«, antwortete sie. »Als wäre eine Last von seinen Schultern gefallen. Wenn man bedenkt, dass er vor ein paar Wochen noch rumgelaufen ist wie der Tod auf Socken …«
»Dann fragen Sie ihn mal, was er will. Bei uns ist es ja momentan recht friedlich, jedenfalls seit der üblen Mordserie in der Hochfinanz. Und seit dieser Jogging-Geschichte in der Taunusanlage.«
»Da hat doch Schleyer mit einem Team ermittelt. Keine neuen Spuren?«
»Rein gar nichts.«
»Ja, insgesamt friedlich. Aber Sie wissen ja, Chef, wenn Sie so was sagen …«
Sie verabschiedete sich von ihm, um Rosen anzurufen. Schon beim ersten Läuten erklang seine Stimme: »Danke, dass du dich meldest, Billinsky. Ich war vorhin schon in deinem Büro.«
»Ich nicht. Also, Rosen, was gibt’s?«
»Schlimme Sachen. Und zwar immer mehr davon. Kannst du bei mir vorbeikommen?«
3
Nie in ihrem Leben war sie hilflos gewesen.
Im Gegenteil, sie war eine Macherin. Konsequent, lösungsorientiert, anpackend. Sie kam überall zurecht, wusste eigentlich immer, wie es weiterging.
Jetzt hatte sie Dreckklumpen im Mund, die Oberschenkel waren von ihrem eigenen Urin verklebt, ihre Fuß- und Handknöchel gefesselt. Wie ein Gegenstand ohne jeden Wert, so fühlte sie sich, als sie in die Grube geschoben wurde.
Nie hatte sie um etwas gebeten, sie hatte sich alles selbst erarbeitet, wenn nötig erkämpft. Jetzt flehte sie, bettelte sie, würdelos und verzweifelt.
Weit über ihr stand die Sonne als glühende Kugel am Himmel. Keine Wolken zu sehen, dafür Baumwipfel, Zweigwerk, ein paar Vögel, die unter endlosem Blau dahinzogen.
Sie schrie, sie jammerte, sie heulte. Ungläubig starrte sie nach oben. Auf das Blatt der Schaufel, von der Erde fiel. Direkt in ihre Augen, ihren Mund, auf die von Tränen verschmierten Wangen.
Sekunde für Sekunde, Schaufel für Schaufel, immer mehr Erde, die ihren Körper bedeckte, immer mehr davon, immer schwerer.
Sie kreischte erneut. So laut, dass ihr Hals schmerzte. Sie verschluckte sich, würgte Erde, ihre Augen brannten. Das Sichtfeld wurde kleiner und kleiner, der Himmel schrumpfte, die Sonne verschwand. Mit der nächsten Schaufelladung landete ein Regenwurm auf ihrem Gesicht, feucht und glitschig, sie schrie und musste schon wieder Dreck schlucken.
Hörte sie ein Lachen?
Sie rang nach Luft, und noch nie war ihr Luft so köstlich vorgekommen, sie sog mehr davon ein, noch ein wenig mehr, während der Himmel fast vollends verschwunden war.
So wie die Luft gleich verschwinden würde.
Und ihr Leben.
Das herrliche Blau dort oben. Einfach nicht mehr da. Die köstliche Luft ganz dünn. Ein allerletzter abgerissener Fetzen Himmel. Und alles war dunkel.
Sie war allein.
Allein mit dem Tod.
4
»Hallo, Maulwurf«, sagte Mara. Sie schaute sich flüchtig in dem lang gezogenen, nur von Kunstlicht erhellten Kellerbüro für mehrere Kollegen um und nahm neben Rosen Platz.
»Wo warst du vorhin eigentlich?«, wollte er wissen. »Hast Wiedersehen mit deinem Revier gefeiert, nehme ich an.«
»Du kennst mich nun mal. Und du warst im Darknet unterwegs, wie ich höre.«
Sie saßen an seinem Schreibtisch, Blickrichtung Wand, an der der große Monitor hing. Zwei von Rosens Kollegen waren ebenfalls anwesend, aber mit großen Kopfhörern und eigenen Monitoren in andere Welten abgetaucht.
Wortlos führte er ihr die komplette Filmsequenz vor, die er sich bereits in den Morgenstunden allein und mit ziemlicher Beklemmung angesehen hatte.
Er beobachtete sie beim Zuschauen. Ihren intensiven Blick, der typisch für sie war. Wer hätte damals an ihrem ersten Arbeitstag gedacht, dass diese kleine, eher grazile Frau die Abteilung derart aufmischen würde? Klimmt hatte sie loswerden wollen, nun schwor er auf sie, wenn er es auch nie zugeben würde. Noch immer hatte selbst Rosen das Rätsel namens Mara Billinsky nicht entschlüsselt, aber er gestand sich ein, dass ihr trotziges, unnachgiebiges Terrierwesen gewaltigen Eindruck auf ihn machte. Auch heute noch, vielleicht sogar mehr als zu Beginn.
»Wer ist der Mann?«, fragte Mara am Ende der Filmsequenz.
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung.«
»Dann brauche ich nach der vermummten Gestalt, die den armen Kerl angezündet hat, gar nicht erst zu fragen. Oder nach dem Ort, wo der Mord gedreht worden ist.«
Nach einem ratlosen Kopfschütteln erwiderte er: »Aber der Ball liegt erst mal hier in unserer Abteilung. Wir arbeiten daran, irgendwelche brauchbaren Informationen auszugraben.«
»Wie bist du auf den Film gestoßen?«
»Routinemäßige Recherchearbeiten. In letzter Zeit sind vermehrt Szenen im Darknet mit besonders drastischen Inhalten aufgetaucht.«
»Zu welchem Zweck wird der Dreck hochgeladen? Kohle, nehme ich an.«
»Richtig. Ein normaler User, der nicht über unsere polizeilichen Zugangsmöglichkeiten verfügt, bekommt einen Teaser serviert, also einen Filmausschnitt, der ihn neugierig machen soll.«
»Ein Appetithäppchen«, meinte Mara mit angewiderter Miene.
Rosen nickte. »Will er den ganzen Film sehen, muss er zahlen.«
»Du weißt, ich bin mehr die Frau fürs Grobe. Der digitale Kram ist …« Mara zeigte ein schiefes Grinsen.
»Und du weißt, dass ich mir in der Richtung einiges an Knowhow draufgeschafft habe.« Rosen grinste seinerseits. »Ich könnte dir einen inoffiziellen Crashkurs anbieten. Zumal das alles nicht nur für unsere Digital-Spezialisten von Bedeutung sein könnte, sondern auch für dich. Der Film mit dem brennenden Opfer legt das jedenfalls nahe. Es bestehen seit Längerem Verdachtsmomente, dass ein Server, der randvoll ist mit gesetzeswidrigen Inhalten, von Deutschland aus betrieben wird.«
»Wie seid ihr darauf gekommen?«
»Ganz einfach. Neben Englisch wurde für die User Deutsch als Nutzersprache angeboten. Aber nur kurz, dann nicht mehr. Wahrscheinlich hat man die Möglichkeit zur Sprachauswahl wieder gelöscht, um genau einen solchen Verdacht nicht aufkommen zu lassen.«
»Wie weit seid ihr?«
»Meine neuen Kollegen versuchen, online ihre Schlingen auszuwerfen. Soll ich ins Detail gehen?«
»Das ist wirklich nicht meine Welt«, wehrte sie ab. »Aber ich komm in Kürze gern auf dein Crashkurs-Angebot zurück.«
»Jederzeit.« Er nickte eifrig. »Die Kollegen stehen ohnehin noch ziemlich am Anfang.«
»Das heißt, es gibt noch keine Verdächtigen, denen man auf die Füße treten kann«, schloss Mara aus seinen Worten.
»Nein, aber ich kann dich auf dem Laufenden halten. Auch wenn weiterer Dreck, wie du es treffend nennst, bei uns angespült wird.«
Maras Handy klingelte, und sie zog es aus der Jacke.
»Hier Billinsky.«
Die angenehme Stimme von Capitaine de Police Colette Pelletier erklang, begleitet von einem weichen Akzent: »Willkommen zurück, Kollegin! Bon jour.«
Die Französin gehörte wie Mara zu der internationalen Einheit und hatte eine führende Rolle eingenommen.
»Wir sollten unbedingt ein Meeting abhalten«, fuhr Pelletier fort. »Allein schon um die weiteren Schritte festzulegen.«
»Ich bin wieder an Bord«, sagte Mara schlicht. Sie wollte sich erkundigen, ob die Kollegin etwas von Erik Nordin und seinem Prozess gehört hatte, verbiss sich aber gerade noch die Frage.
Sie einigten sich rasch auf einen Termin und beendeten das Gespräch.
Rosen musterte Mara, als würde auch ihm eine Frage zu Nordin auf der Zunge liegen, doch er blieb stumm. Ja, Rosen kannte sie tatsächlich. Er wusste, wann man sie auf bestimmte Themen besser nicht ansprach.
Sie verabschiedete sich von ihm mit einem beiläufigen Heben der Hand.
In dem Großraumbüro, in dessen hinterster Ecke ihr Schreibtisch untergebracht war, wurde sie von Hauptkommissar Klimmt erwartet. Er quetschte seinen ausladenden Körper in ihren Stuhl, was sie nicht leiden konnte. Sein Schnurrbart war ausgefranst, am Bauch spannte der Hemdstoff bedenklich.
»Was machen Sie denn hier, Chef?«
»Eine Rettungsaktion in eigener Sache.«
Sie lachte angesichts seiner griesgrämigen Miene. »Wieso? Genervt von unserem liebsten Staatsanwalt von Lingert, der an irgendwelchen Ermittlungsergebnissen seine Zweifel hat?«
»Nein, von einer Dame, die genauso bockig und hartnäckig zu sein scheint wie Sie.«
»Ach? So was gibt’s?« Mara platzierte ihr Hinterteil auf dem Rand des Schreibtischs.
»Machen Sie sich’s erst gar nicht gemütlich. Reden Sie mal mit ihr, ich hab schon versucht, ihr begreiflich zu machen, dass sie bei mir an der falschen Adresse ist.«
»Was will sie?«
»Meiner Meinung nach eine Vermisstenanzeige aufgeben.«
»Und ihrer Meinung nach?«
»Sie hat mich in meinem Büro überfallen und ununterbrochen etwas davon gefaselt, dass jemand ermordet worden sei.« Er zuckte mit den Schultern. »Eine Verrücke. Das ist Ihr Kaliber.«
Mara stellte sich hin. »Okay, dann höre ich mir sie mal an.«
Als sie das Büro ihres Chefs erreichte, war die Tür verschlossen. Sie klopfte an und betrat den Raum.
Eine Frau mit dunklen Augen, die fast so intensiv funkelten wie Maras, blickte ihr entgegen.
»Das wurde auch höchste Zeit«, sagte die Fremde.
»Wofür?«, fragte Mara.
5
»Ist sie nicht wunderschön?«, fragte Prince Bangura und zeigte auf die junge Frau, die auf dem Sofa schlief.
Rafael Makiadi nickte.
»Schau dir nur an, wie die blonden Haare um ihr schmales Engelsgesicht fließen. Am liebsten würde ich sie zeichnen.«
Er lachte auf diese Art, bei der man nicht wusste, ob er es ernst meinte oder einfach nur Quatsch machte.
Aber es stimmte, die Frau war tatsächlich auffallend schön. Unschuldig kam sie Rafael vor, seltsam rein und unverdorben. Nicht so wie die Leute, mit denen Prince sich ansonsten umgab.
Sie ließen die schlafende Frau allein und begaben sich ins Nebenzimmer, wo afrikanische HipHop-Musik aus den Boxen quoll und drei Typen aus Banguras Gefolge auf Fatboys fläzten und einen Joint kreisen ließen. Sie gesellten sich zu ihnen, rauchten aber nicht mit. Hin und wieder ein wenig Gras, häufig auch bunte Pillen, die man sich grinsend einwarf, aber davon abgesehen duldete der Prinz des Dschungels keine Drogen, vor allem keinen Alkohol. Sie alle tranken Energydrinks, fast die ganze Zeit über, ständig reichten sie einander Flaschen mit grellbunten Flüssigkeiten.
»Wer ist die Blonde?«, fragte Rafael.
»Hübscher Käfer, was?« Prince lachte. »Sie ist ein Geschenk.«
»Geschenk?«, wiederholte Rafael irritiert. »Für wen?«
»Du würdest gern ein bisschen an ihr herumknabbern, stimmt’s?«
»Nein, aber Hunger hätte ich schon«, versuchte Rafael das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.
Auf einmal mit tiefernstem Ausdruck rückte Prince’ Gesicht nahe an sein eigenes. »Du hast keine Ahnung, was Hunger ist. Grummelt dein Bäuchlein ein bisschen? Könntest du einen Bissen vertragen?« Er winkte ab. »Hunger ist, wenn dein Bauch beim Wassertrinken wehtut und du Krämpfe kriegst. Wenn es sich anfühlt, als würde dein Magen von innen mit Rasierklingen traktiert. Wenn deine Lippen staubtrocken sind und deine Glieder schmerzen.« Grübelnd nickte er vor sich hin und drehte die Musik beinahe unhörbar leise. »Ich habe Hunger erlebt, als ich von Kabati, unserem Dorf, aufbrach, um nach Mattru Jong zu gehen. Mattru Jong ist eine Stadt. Dort sollte ich mich für eine ausgezeichnete ausländische Schule anmelden. Mein Dorflehrer hatte gemerkt, dass ich ein schlaues Kerlchen bin. Ich war derjenige mit den besten Noten. Sprachen lernte ich mühelos, Mathematik war ein Kinderspiel, ich konnte Noten lesen, ich vergrub mich den ganzen Tag in den alten Büchern einer winzigen Bibliothek. Der Stolz der Familie, das war ich. Vor mir lag eine strahlende Zukunft.«
Rafael drückte sich bequemer in den Fatboy und wartete darauf, dass Bangura fortfuhr. Er konnte nie genug bekommen von diesen Geschichten.
»Es war ein ganz gewöhnlicher Nachmittag, ich war dreizehn, ich war guter Dinge, wie immer, das Leben war großartig. Die Gerüchte von der Revolutionsarmee, die mordend und vergewaltigend durchs Land zog, versuchte ich zu ignorieren. Ich war auf halber Strecke nach Mattru Jong, als ich Gewehrsalven hörte und panisch flüchtenden Menschen begegnete. Kabati gibt es nicht mehr, sagten sie. Alles in Flammen, alle tot. Du musst fliehen, sagten sie. Und das tat ich. Tagelang rannte ich durch den Dschungel. In zerstörten Dörfern fand ich manchmal Bananen oder ein wenig Maniok, ansonsten hungerte ich, rannte ich, versteckte ich mich.«
Nicht nur Rafael, auch die anderen hörten gebannt zu. Das schlafende Mädchen hatte Rafael so gut wie vergessen. Der Motorenlärm, die Elektromusik, das Gegröle, der ganze übliche Bahnhofsviertellärm, der durchs offene Fenster hereinströmte, wurde von Banguras Stimme überlagert.
»Ein Nachmittag hatte gereicht, um meine Zukunft zu zerstören. Ich lief und lief und lief, damit ich den Revolutionären nicht in die Hände fiel. Entweder Tod oder Rekrutierung, das wäre meine Wahl gewesen, falls sie mich erwischten. Ich rannte wie der Teufel.«
Wieder lachte er, und wieder wusste man nicht, was Ernst war und was nicht. Er erteilte den anderen drei Typen geflüsterte Befehle, worauf sie sich erhoben und grinsend nach nebenan gingen. Schließlich fuhr er fort: »Nguwor gbor mu ma oo, sagte ich mir. Gott hilf uns! Hilf uns allen, die wir auf der Flucht sind. Es war das letzte Mal, dass ich mich an den alten Herrn im Himmel gewandt habe. Weißt du, was dann geschehen ist?«
Rafael schüttelte den Kopf.
»Ich werde es dir erzählen, Bruder. Aber nicht heute.« Prince griff nach der Plastikflasche mit dem blauen Getränk und nahm einen Schluck, dann zog er die Schnürsenkel seiner Air Jordans fester zu. Sein eben noch verschleierter, in der Tiefe der Erinnerungen verlorener Blick wurde stechend klar. Sein Dolch-Ohrstecker blitzte. Er drehte die Musik laut auf und lauschte den Klängen mehrere Minuten lang, bis er sie ausschaltete und die Geräuschkulisse von draußen sofort wieder dominant wurde.
Als Prince aufstand, wies er Rafael an, ihm zu folgen.
Sie gingen ebenfalls zurück ins nebenan liegende Zimmer.
Die junge Frau war inzwischen wach – und vollkommen nackt. Völlig verängstigt kauerte sie auf dem Boden. Blut lief ihr aus der Nase, auch aus ihrer aufgeplatzten Unterlippe. Ihr rechtes Auge begann sich blau zu verfärben und dick anzuschwellen. Neben ihr lag ihre Kleidung, in Fetzen gerissen.
Die drei Männer standen da und grinsten wie zuvor, einer von ihnen hielt lässig ein Handy zwischen den Fingern, ohne jedoch aufs Display zu achten.
Prince reichte Rafael eine rote Skimaske.
»Was soll ich damit?«
»Was schon? Anziehen.«
Nach kurzem Zögern gehorchte Rafael.
»Und jetzt schnapp dir die Kleine. Besorg es ihr ordentlich. Ich will sie schreien hören.«
Erschrocken ruckte Rafaels Kopf zu ihm herum. »Was?«
»Ich sagte doch, sie ist ein Geschenk.«
»Aber …«
»Du bist immer noch zu weich, Junge. Du musst unempfindlich werden.« Prince nickte ihm auffordernd zu. »Du musst lernen, dass dich die Gefühle anderer einen feuchten Scheiß interessieren. Nimm das Leben und press alles aus ihm raus.« Er langte in Rafaels Schritt, zog den Reißverschluss der Baggy-Hose nach unten und zerrte die Gürtelschnalle auf. Er zeigte auf das Mädchen, das sie hilflos anstarrte. »Na los, Rafael! Gehörst du zu uns, oder bist du bloß ein kleiner Scheißer? Schau aus dem Fenster ins Viertel. Siehst du den Abfall, die Spritzen, die jämmerlichen Typen? Riechst du ihre Pisse? Du kannst dich jederzeit bei denen in die Reihe stellen. Oder du schnappst dir die Kleine. Zeig ihr und mir, dass du kein Schlappschwanz bist. Und zwar jetzt!«
Er gab ihm einen heftigen Stoß.
Widerwillig bewegte sich Rafael auf die Frau zu, die ihn hilflos anstarrte.
Die Sohlen seiner neuen Nike-Sneaker, ein Geschenk von Prince, schlurften über den Boden. Schweiß brach ihm unter der Maske aus. Er kniete sich neben die Frau und schob sich Hose und Unterhose herunter. Er griff nach ihren Oberarmen. Sie zappelte wild, versuchte ihn zu schlagen, er schlug zurück, packte fester zu, jetzt auch die Oberschenkel, presste sie auseinander. Sie kreischte, ihre Haut war kalt, er drängte sich zwischen ihre Beine.
Banguras Helfer hinter ihm feuerten ihn an, während der Prinz des Dschungels stumm blieb. Doch Rafael spürte seinen Blick im Rücken wie die Spitze einer Klinge.
Die Frau schrie nicht mehr, sie wimmerte nur noch. Rafael versuchte die kläglichen Laute zu ignorieren.
So kalt war ihre Haut, so verdammt kalt.
6
»Höchste Zeit, dass sich jemand darum kümmert«, sagte die Frau, die in Klimmts Büro stand, mit energischer Stimme.
Mara Billinsky musterte sie und wurde genauso direkt zurückgemustert.
Die Fremde trug Kleidung von unauffälliger, aber sicherlich kostspieliger Eleganz. Slipper, Stoffhosen, eine lässige hüftlange Jacke, alles in gedeckten Farben. Sie schien etwa vierzig zu sein, schlank, offensichtlich trieb sie regelmäßig Sport. Das dunkelblonde, knapp schulterlange Haar hatte sie zu einem praktischen Pferdeschwanz gebunden. Die starken Unterkiefer verliehen ihrem Gesicht etwas Herbes. In ihren Augen blitzte es aufmerksam, fokussiert.
Das kannte Mara. Von sich selbst.
»Ich bin Kommissarin Mara Billinsky. Und Sie sind?«
»Tessa Steinberg.« Vorwurfsvoll fügte die Frau hinzu:
»Ihr Chef hat sich ziemlich schnell verdünnisiert.«
»Obwohl verdünnisiert bei ihm kaum vorstellbar ist«, erwiderte Mara mit einem gelassenen Schmunzeln.
»Ich mag Humor, aber nur zum angemessenen Zeitpunkt.«
»Warum ist er jetzt unangemessen?«
»Weil ich meine Geschäftspartnerin vermisse.«
»Sie können eine Vermisstenanzeige …«
»Das hat mir der brummige Herr auch erklärt«, wurde Mara prompt unterbrochen. »Und ich habe das auch schon getan, es ist nur …«
»Dann wäre das ja erledigt«, revanchierte sich Mara. »Unsere Kollegen werden sich mit dem Fall beschäftigen.«
»Da ist was faul«, sagte Tessa Steinberg in einem harten, kategorischen Ton, der Mara hellhörig machte. Sie gehörte nicht zu den Beamten, die Leute, die aufgeregt und fordernd im Präsidium auftauchten, vorschnell als Nervensägen abtaten.
»Das hier ist die Mordkommission«, sagte sie fast beiläufig. Sie ließ sich auf der Kante von Klimmts Schreibtisch nieder und deutete auf die beiden Besucherstühle.
»Ich will nicht sitzen, ich will wissen, was los ist«, kam es von der Fremden, die tough wirkte, aber dennoch mitgenommen aussah. »Noch mal: Da ist was faul. Femke ist keine Frau, die wortlos ein paar Tage abtaucht, um auszuspannen und neue Kraft zu sammeln oder so etwas. Weder Kollegen noch Bekannte können sie erreichen, ihr Handy ist ausgeschaltet, auf E-Mails reagiert sie nicht.« Sie holte tief Luft. Es nahm sie tatsächlich mit, aber das wollte sie nicht zeigen. Auch das kannte Mara von sich.
»Sie erzählen mir jetzt sicher gleich, dass es häufig vorkommt, dass Leute für eine gewisse Zeit …«
»Nein, das erzähle ich Ihnen nicht«, unterbrach Mara sie erneut. Sie griff nach einem Schreibblock, der auf dem Tisch lag, und zog einen Kugelschreiber aus ihrer Jacke. »Der volle Name.«
»Femke de Jong. Zweiundvierzig Jahre alt. Geboren in Rotterdam. Seit Jahren lebt und arbeitet sie hier in Frankfurt. Kein Ehemann, keine Kinder, keine Beziehung.« Die Besucherin hielt ein iPhone der neuesten Generation hoch. Das Display zeigte das Foto einer Frau mit modisch kurz geschnittenen, rötlich blonden Haaren.
Weitere persönliche Angaben zu der Vermissten folgten, und Mara bemühte sich, so detailliert mitzuschreiben, wie Rosen es immer getan hatte.
»Wenn ich das richtig verstanden habe, verbindet Sie und Frau de Jong also eine geschäftliche Partnerschaft. Sie waren beide die Gründerinnen und fungieren als Geschäftsführerinnen einer Beratungsfirma namens J&S Consulting.«
»Bedingt.«
»Bedingt?«, wiederholte Mara mit gerunzelter Stirn.
»Zuletzt hat Femke das Unternehmen im Alleingang geführt. Ich hatte mich für einige Zeit zurückgezogen.«
»Warum?«
»Ich hatte privat nicht gerade eine traumhafte Zeit. Außerdem im Job jede Menge zu tun.« Die Frau sah Mara offen an. »Es wuchs mir über den Kopf. Ich litt an einem Erschöpfungssyndrom.«
»Sie haben das Privatleben angesprochen. Was …«
»Hören Sie zu, es war wirklich eine Scheißzeit.« In bissigem Ton setzte sie hinzu: »Ich war fertig. Okay? Soll ich Ihnen etwa eine Skizze zeichnen? Und es geht ja um Femke, nicht um mich.«
Mara ging nicht darauf ein. »Und jetzt sind Sie also wieder eingestiegen?«
Ein Nicken folgte. »Ja, aber so richtig erst letzte Woche. Mir fehlt noch der Überblick über die Projekte und Entwicklungen der letzten Monate.«
»Was genau macht Ihre Firma?«
»Wir beraten andere Firmen, wie sie besser werden können. Simpel formuliert.«
»Also wie man möglichst viele Mitarbeiter rausschmeißt, möglichst viel Steuern spart und möglichst viel Kohle macht?«
Zum ersten Mal huschte ein Schmunzeln über Tessa Steinbergs Gesicht. »So ähnlich.«
»Wann genau ist Ihr Kontakt zu Frau de Jong abgerissen?«
»Vor zwei Tagen.«
»Hm«, meinte Mara knapp.
»Ich weiß auch, dass das nicht sehr lange ist. Aber da ist noch etwas anderes.«
»Nämlich?«
»Vor einigen Wochen kam ein Freund von Femke und mir ums Leben. Unter sehr tragischen Umständen.«
»Welchen?«, fragte Mara in ihrer üblichen Pistolenschussart.
»Wir waren nicht nur freundschaftlich, sondern auch geschäftlich eng mit ihm verbunden, jedenfalls früher.« Sie holte Luft. »Es passierte an einem frühen Morgen. Unser Freund war auf seiner Laufrunde in der Taunusanlage. Er wurde auf eine Szene aufmerksam, bei der ein Mann eine junge Frau bedrängte. Bevor es zu einer Vergewaltigung kommen konnte, schritt er ein, um der Frau zu helfen. Der Täter setzte sich zur Wehr, schlug mit einem unbekannten Gegenstand zu und konnte fliehen. Bis heute weiß man nicht, wer das war. Wahrscheinlich wird überhaupt nicht mehr nach ihm gesucht.« Ein jäher Zorn brachte die Augen der Frau erneut zum Funkeln. »Unser Freund erlag seinen Kopfverletzungen.«
»Bernhard Keim«, ergänzte Mara.
»Ach? Sie sind darüber informiert?«
Die Jogging-Geschichte, wie Klimmt die Sache nannte. »Ich weiß keine Details. Meine Kollegen haben die Ermittlungen geleitet.«
»Die Vergangenheitsform ist sicher kein Zufall, oder? Ich hatte recht. Da wird nichts mehr unternommen.«
Mara machte nicht den Fehler, auf den Vorwurf einzugehen. »Was bringt Sie zu der Annahme, dass dieser Fall mit dem angeblichen Verschwinden von Femke de Jong in Verbindung steht.«
»Das Verschwinden ist nicht angeblich, es ist real. Sehen Sie, ich behaupte ja gar nicht, dass es da eine Verbindung gibt. Aber ich hatte nie in meinem Leben mit Gewaltverbrechen zu tun. Dann die schreckliche Sache mit Bernhard. Und nicht viel später ist plötzlich Femke verschwunden.« Zum ersten Mal schien ihre Verzweiflung, die sie vorher zu unterdrücken versucht hatte, offen durch. »Und ich habe schon viel erlebt, auch seltsame Zufälle, aber diesmal …«
Rosen hätte jetzt sicher die richtigen Worte gefunden, dachte Mara.
»Schon klar, Sie halten mich für eine Spinnerin, die Ihnen bloß die Zeit stiehlt. Und ich kann es Ihnen nicht einmal verdenken.«
Von ihrer demonstrativ zur Schau getragenen rauen Schale war tatsächlich nicht mehr viel übrig geblieben.
»Ich bin auch immer skeptisch, wenn es um seltsame Zufälle geht«, meinte Mara in verbindlicherem Tonfall.
Die Tür ging auf, und Klimmt schob sich langsam und breit wie ein Walfisch in den Raum. Sein Blick wanderte von Tessa Steinberg zu Mara. »Die Vermisstensache? Immer noch? Wie gesagt, wir sind die falsche Adresse …«
»Da steckt mehr dahinter«, sagte Tessa Steinberg. »Ich bin mir absolut sicher.«
»Denken Sie das auch, Billinsky?« Er musterte sie mit all der Skepsis, die er aufzubringen wusste, und das war bei Klimmt eine ganze Menge.
Mara verzichtete auf eine Antwort. Ihr Blick lag auf der Frau, die sich nun doch auf einen Stuhl sinken ließ, sichtlich müde und durcheinander.
7
Sie fuhren dem Abend entgegen, der als schwarzer Schleier den Himmel überzog. Prince saß am Steuer, Rafael auf dem Beifahrersitz. Sie waren jetzt nur noch zu zweit, was Rafael lieber war. Zu den anderen Typen in Banguras Gang hatte er bislang keinen Draht gefunden, und er bezweifelte, dass sich daran etwas ändern würde.
Der schwarze Porsche Cayenne war brandneu. Woher Prince den Wagen hatte, würde sein Geheimnis bleiben, wie es für ihn ohnehin normal war, Geheimnisse mit sich herumzutragen. Man wusste nie, was er vorhatte, doch gerade das stellte einen Teil der Faszination dar, die von ihm ausging.
Aus den Boxen von Bang & Olufsen tönte Final Form von Sampa the Great, dem in Sambia geborenen HipHop-Star, und Prince grölte mit: »… I’m out of shame, been passed it …«
Der Zwischenfall mit der jungen Frau lag Stunden zurück, Rafael hatte ihn aus seinem Bewusstsein gelöscht oder es zumindest versucht und sich nach außen hin so gegeben, als wäre nichts vorgefallen.
Auch Prince hatte kein Wort darüber verloren.
Sie befanden sich am Rande der Frankfurter Innenstadt, rechts von ihnen zog sich der Main dahin, ein Stück weiter bohrte sich die Skyline in den immer dunkler werdenden Himmel.
Prince steuerte den Wagen auf einmal nach rechts, um auf einem Halteverbotsstreifen zu parken. »Lass uns ein paar Schritte gehen.«
Sie folgten der Uferpromenade, wo kaum noch jemand unterwegs war. Der Fluss verströmte einen eindringlichen Geruch, es war noch warm von der Hitze, die während des Nachmittags geherrscht hatte.
Rafael musste daran denken, wie viel Zeit er inzwischen mit Prince verbrachte. Das Geld, die schnellen Autos, die coolen Bars und Clubs – er hatte sich weniger bewusst als vielmehr mit einer gewissen Beiläufigkeit tiefer in dieses Leben ziehen lassen. Was war die Alternative? Weiter dem lausigen Job in der Fabrik nachgehen? Hanno Linsenmeyer redete von anderen, besseren Schulen, jedes Mal, wenn sie sich sahen oder telefonierten, hatte er einen neuen Vorschlag. Was würde Hanno sagen, wenn er wüsste, was Rafael die ganze Zeit trieb? Und Mara Billinsky erst? Rafael wollte es lieber nicht wissen.
»Ich hatte einen Traum«, begann Prince unvermittelt in vertraulichem Ton und mit stärker durchdringendem Akzent zu erzählen, wie er es oft tat, wenn sie unter sich waren. »In dem Traum schiebe ich eine rostige Schubkarre vor mir her. Verdammt schwer, das Ding. Sie ist voll. Aber ich schaue nicht, was ich transportiere, ich will das nicht wissen. Um mich herum ist das Paradies. Mango- und Bananenbäume, etwas entfernt eine Kaffeeplantage. Doch es riecht nicht nach Früchten, sondern verbrannt. Und da ist außerdem ein Gestank, widerlich süßlich, und auch wenn ich ihn nicht kenne, weiß ich, was so stinkt. Erst dann merke ich, dass es überall brennt, da sind Qualmwolken, mehrere Feuer, Flammen stechen aus Hütten. Und ich schiebe immer weiter. Ich schwitze, mir tränen die Augen. Der Wind trägt das Schluchzen von Menschen zu mir, die ihre letzten Atemzüge ausstoßen. Ihre Körper sind verstümmelt, Hirnmasse dringt aus ihren Nasen und Ohren, ihre Eingeweide quellen durch Einschusslöcher in den Bäuchen. Die Augen der Sterbenden sind röter als das Blut, das aus ihnen fließt und meine Turnschuhe tränkt. Ich zwinge mich, diese Menschen nicht anzusehen, und erreiche einen kleinen Hügel.«
Er machte eine effektvolle Pause, ehe er fortfuhr: »Hier versuche ich den Toten, der in der Schubkarre liegt, auf den Boden zu wuchten, aber er bleibt einfach in der Karre. Ich muss mit beiden Händen drücken und schieben, bis auch er ein Teil des Leichenhügels ist. Mein Hirn fühlt sich an, als hätte man tausend Nadeln reingerammt, ich weiß nicht, ob es Tag oder Nacht ist, ich fühle nur den noch warmen Lauf meiner AK-47 auf dem Rücken. Jemand ruft mich, ich lasse die Karre und eile auf die brennenden Hütten zu. Davor treibt man Flüchtende zusammen. Erwachsene und Kinder, deren Furcht stärker riecht als das tote Fleisch der Ermordeten. Ich bleibe stehen, nehme mein Gewehr und ziele. Ich schieße. Plötzlich bin ich mir sicher, dass die Schüsse mich aus dem Traum reißen werden. Ich sehne den Moment herbei, an dem ich aufwache. Tatsächlich, auf einmal bin ich hellwach, vollkommen klar bei Verstand. Und weißt du, was das Verrückteste an dem Traum ist?« Urplötzlich lachte Prince laut auf, und der fast irre wirkende Ton bescherte Rafael eine Gänsehaut. »Na, was denkt du, Rafael?«
»Keine Ahnung«, erwiderte er vorsichtig.
»Dass es gar kein Traum ist.« Prince sprach weiter, leiser, verhaltener. »Nein, es war beschissene Wirklichkeit. Der Tod war mein Leben geworden. Bruder, so sieht es aus, wenn das Böse dich findet. Denn irgendwann haben sie mich natürlich erwischt. Die Rebellen. Sie waren versessen auf Frauen, die sie vergewaltigen, und auf Jungs, die sie rekrutieren konnten. Wir mussten uns in eine Reihe stellen. Wir zitterten. Buchstäblich. Ich meine es ernst, meine Knie schlotterten wie verrückt, ich dachte, ich habe keine Knochen mehr und falle gleich um. Sie legten eine Machete in den Staub und führten anschließend einen ausgemergelten, halb blinden Opa zu uns. Wir waren zu fünft. Halb verhungerte kleine Scheißer, die die Welt nicht mehr verstanden. Sie sagten, wer den Alten mit der Machete in Stücke haut, gehört zu ihnen. Der Rest wird bei lebendigem Leib verbrannt.«
Prince verfiel in ein längeres Schweigen.
Sie gingen weiter, inzwischen ganz allein, nicht einmal mehr vereinzelte Jogger waren noch zu entdecken. Nur auf den Mainbrücken schlängelte sich der zähe Feierabendverkehr wie eh und je dahin.
»Und was geschah dann, Rafael? Keine zwei Minuten später lag der jämmerliche Alte zerstückelt auf der Erde. Um ihn ein See aus Blut. Und die Rebellen lachten zufrieden.«
Rafael schwieg.
»Was denkst du, Rafael, wer von uns fünf Jungs war fähig, etwas so Verabscheuungswürdiges zu begehen?« Wieder lachte der Prince, und eine Antwort erübrigte sich. Er pfiff den Song von vorhin, dann sang er erstaunlich melodiös ein paar Liedzeilen: »… nah knock the walls off, fuck the whole key, we gonna hinge the whole door off …«
Sie erreichten eine weitere der vielen Brücken, deren Bogen den dumpfen Motorenlärm fast verschluckte, und befanden sich nun direkt darunter. Das Licht der Straßenlaternen streifte sie nur noch. Mit einer blitzschnellen Bewegung packte Prince Rafael und nahm ihn in den Schwitzkasten. Er wirbelte ihn um die eigene Achse, schleuderte ihn zu Boden und drückte ihn bäuchlings auf den harten Betonuntergrund, wobei er ihm gleichzeitig den Arm auf dem Rücken verdrehte.
Rafael war völlig überrumpelt, erschrocken schrie er auf.
Der Ärmel seines Hoodies wurde weit nach oben gerissen, eine Messerklinge blitzte in der Dunkelheit auf, drei rasche tiefe Schnitte, warmes Blut lief.
»Gleich wirst du richtig kreischen«, kündigte Prince an.
Das Knie im Rücken, der Arm schon fast ausgekugelt, das Brennen auf der Haut, das noch heftiger wurde, als Prince irgendetwas in die frischen Schnitte rieb.
»Das ist Salz«, erklärte Prince, und er hatte recht – Rafael kreischte tatsächlich laut auf. Noch mehr Salz, noch stärkere Schmerzen.
»Du darfst alles machen, Rafael, nur eine Sache nicht«, zischte Prince plötzlich ganz nah an Rafaels Ohr. »Versuch niemals wieder, mich zu verarschen. Du hast es der Kleinen nicht besorgt, bist nur ein bisschen auf ihr rumgerutscht. Ich weiß es, sie hat es zugegeben. Ich krieg alles raus, Bruder. Immer.«
Rafael stöhnte, sein Arm bestand aus Feuer, es tat weh. Und wie es wehtat.
Erst nach einer Weile ließ Prince von ihm ab. Er richtete sich auf und starrte auf ihn herab, jetzt wieder mit völlig emotionslosem, fast gelangweiltem Ausdruck. »Ich frag dich noch einmal, Rafael«, sagte er sachlich. »Zu wem willst du gehören? Zu all den Losern oder zu mir?«
Rafael keuchte. Überraschung und Schmerz trieben ihm Schweiß übers Gesicht. In seinen Augen standen Tränen, für die er sich schämte. Er wischte sie weg, seine Hand zitterte, seine Schulter, sein Arm, seine Haut taten immer noch weh. »Ich gehöre zu dir«, hörte er sich antworten.
Prince lachte. »Good Boy.«
»Du kannst dich auf mich verlassen.«
»Dann steh endlich auf, oder willst du hier die Nacht verbringen?«
Rafael kam auf die Beine, seine Knie fühlten sich weich an.
Prince war vorangegangen, und er beeilte sich, wieder an seiner Seite zu sein. Er spürte nicht nur den Schmerz. Auch etwas anderes nistete sich in seinem Bewusstsein ein. Er hatte sich entschieden. Für einen bestimmten Weg, auf dem es kein Zurück gab. Etwas in ihm zerrte ihn förmlich in diese Richtung, er konnte nichts dagegen tun. Er wollte es. Er hatte den Eindruck, dass er dafür geboren war, jedenfalls nicht für dieses andere Leben, das er sich anzueignen versucht hatte.
Prince hatte die Hände entspannt in die Hosentaschen geschoben. Von dem Messer, das wie durch einen Zaubertrick in seiner Hand gelegen hatte, war nichts mehr zu sehen, als hätte es gar nicht existiert. Er fing wieder an, den HipHop-Song zu singen: »It’s like I’m born great, I’d be mad too …«
8
Andere Ermittler würden sich fragen, warum sie sich darauf eingelassen hatten. Oder hätten sich eben erst gar nicht darauf eingelassen. Aber sie nicht. Sie war nun mal Mara Billinsky.
Es ging nicht darum, dass sie auf ihren Instinkt hörte, einer vagen Ahnung nachgab oder etwas in der Art. Schon gar nicht darum, dass es eigentlich nicht ihre Baustelle war, vermissten Personen nachzuspüren. Es ging darum, dass sie Polizistin war. Es ging um ihr Verständnis von diesem Job, der sie nach wilden Jugendjahren vor einem Dasein ohne Richtung und Perspektive gerettet hatte. Sie war ein Bulle, verdammt noch mal.
Deshalb saß sie in diesem Augenblick am Steuer ihres schwarzen Alfas. Deshalb hatte sie Tessa Steinberg, deren bestimmte Art sie auf gewisse Weise an sie selbst erinnerte, auf dem Beifahrersitz Platz nehmen lassen. Und deshalb befanden sie sich auf dem Weg zu dem Haus, in dem Femke de Jong wohnte.
Es war schon Abend, als sie Dreieich erreichten, eine südlich von Frankfurt gelegene Stadt, an deren Rand die Holländerin sich eine stattliche Villa hatte bauen lassen, zu der Tessa Steinberg einen Schlüssel besaß.
»Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie das tun«, sagte sie zu Mara, die mit einem beiläufigen Kopfnicken antwortete und direkt vor dem Gebäude parkte.
»Was ist mit Frau de Jongs Wagen?«
»Steht in der Garage, davon habe ich mich schon überzeugt.«
»Haben Sie bei der Gelegenheit auch das Haus betreten?«
»Ja, mich aber nur oberflächlich umgeschaut. Keine Spur von Femke. Kein Anzeichen, dass etwas Ungewöhnliches vorgefallen ist, das gebe ich zu. Aber trotzdem …« Sie fuhr mit der Hand durch die Luft.
»Dieses Trotzdem kenne ich«, meinte Mara, während sie zusammen ausstiegen.
Sie betraten die Villa, knipsten die Lichter an und schauten sich um, wobei Mara darauf achtete, so gut wie nichts zu berühren. Vom großen Entree mit Garderobe ging es direkt in einen riesigen Wohn- und Essbereich mit bodentiefen, edelholzgerahmten Fenstern und Wänden von über drei Metern Höhe. Sowohl das Erd- als auch das Obergeschoss waren mit Eiche-Landhausdielen ausgelegt, überall hing moderne Kunst an den Wänden. Es gab ein Designbadezimmer mit freistehender Wanne, ein mit Macbook und Flachbildmonitor ausgestattetes Büro und einen Ankleideraum mit begehbarem Wandschrank.
Nach der wortlos durchgeführten Begehung kehrten sie in den Wohnbereich zurück.
»Ich weiß«, sagte Tessa Steinberg zerknirscht. »Nichts deutet darauf hin, dass …«
Das Klingeln von Maras Handy unterbrach sie. Diese nahm den Anruf entgegen. »Was gibt’s, Chef?« Sie drehte sich weg von der Frau.
»Erst mal meine übliche Frage: Wo stecken Sie?«, wollte Klimmt wissen.
»Sie würden’s sowieso kaum glauben.«
»Hatten wir nicht gesagt, dass es in letzter Zeit ruhig war?«, meinte er sarkastisch. »Stellen Sie sich vor, ein jugendliches Pärchen hat beim romantischen Stelldichein am Waldrand etwas Bemerkenswertes entdeckt. Besser gesagt, der Hund, der dabei war. Hat was gewittert und angefangen zu buddeln.«
»Da war’s vorbei mit dem Date, schätze ich.«
»Genau. Zum Vorschein kam eine Leiche, die erst kürzlich verscharrt worden sein muss. Und zwar bei lebendigem Leib.«
»Shit«, stieß Mara leise aus. »Etwa eine Frau?«
»Richtig. Gefesselt und der Erde übergeben.«
»Könnte es sich um …«
»Es könnte nicht nur, sie ist es«, unterbrach er sie. »Femke de Jong.«
»Kein Zweifel?«
»Nicht der geringste. Billinsky, nicht nur Sie, auch ich habe das Foto auf dem Handy sehen dürfen.« Er brummte genervt auf, wie man es von ihm kannte. »Noch mal, wo treiben Sie sich rum? Ich will Sie beim Fundort haben. Sofort.«
Langsam drehte sie sich wieder zu Tessa Steinberg um.
Ihre Blicke trafen sich. Das Gesicht der Frau vor Mara erstarrte.
9
Der nächste Morgen brachte gleißenden Sonnenschein. Über den Dächern der Stadt und in den Häuserschluchten stand die Hitze wie Beton.
Der Sommer scheint es gut zu meinen, dachte Mara. Sie mochte den Herbst eindeutig lieber, die Nebelschwaden, die trüben Tage, die raue Luft, die in ihre Wangen biss. Das hatte immer schon besser zu ihrem Wesen gepasst als dieses verfluchte Postkartenwetter.
Sie stand an einem Flurfenster des Präsidiums und sah nach draußen ins nahezu wolkenlose Blau des Himmels. Ein Moment der Ruhe nach einer Nacht, in der es keine Möglichkeit gegeben hatte, sich für eine kurze Stunde Schlaf zurückzuziehen.
Sie nippte an dem Becher mit scheußlichem Automatenkaffee, der sie an Rosen denken ließ. Wie oft hatten sie gemeinsam von der Brühe getrunken und sich dabei ausgetauscht. Laut Klimmt war man auf der Suche nach einem Beamten, der Rosens frei gewordenen Platz in der Abteilung einnehmen sollte, aber das gestaltete sich schwierig. Wahrscheinlich nicht nur wegen des allgegenwärtigen Mangels an Personal, sondern auch weil der Hauptkommissar besonders kritisch war, wenn es darum ging, jemanden zu finden, der mit Mara Billinsky zusammenarbeiten sollte. Die Krähe war als zähe, dickköpfige Ermittlerin bekannt und als Teampartnerin gefürchtet. Sie wusste das, aber es kümmerte sie nicht.
Erneut nippte sie an dem fast leeren Becher. Ein Blick zur Uhr. Die Zeit war vorangestürmt. Wie so oft. Bereits kurz nach Mitternacht hatte Gerichtsmediziner Dr. Tsobanelis im Beisein von Klimmt und Mara die Obduktion durchgeführt, die keine neuen Erkenntnisse gebracht, jedoch allen noch einmal deutlich vor Augen geführt hatte, wie qualvoll Femke de Jongs Tod gewesen sein musste.
Mit Tessa Steinberg hatte Mara nicht mehr viel gesprochen. Die Freundin der Ermordeten war angesichts der Nachricht zu erschüttert gewesen. »Ich hatte von Anfang an so ein furchtbares Gefühl«, hatte sie nur leise ausgestoßen.
Noch ein Blick zur Uhr. Mara seufzte. Sie war schon fast wieder zu spät für das Meeting mit Colette Pelletier, auf das sie im Moment überhaupt keine Lust verspürte. Nebenbei fiel ihr auf, dass sie Tessa Steinbergs Auftauchen zumindest von den nutzlosen, nervtötenden Gedanken an Erik Nordin abgelenkt hatte.
Dieser verfluchte Wikinger, dachte Mara, trank den letzten Schluck und zerquetschte den Becher, ehe sie ihn auf dem Weg in den Konferenzraum in einen Mülleimer fallen ließ.
Sie wurde bereits von Pelletier erwartet, die wahrscheinlich auf die Sekunde pünktlich erschienen war. Nach einer kurzen Begrüßung saßen sie einander gegenüber. Vor der Französin stand ein Becher aus einer nahen Konditorei. Der Kaffee duftete herrlich, was Mara bewusst machte, dass sie Nachschub brauchte, allerdings auf keinen Fall aus dem Automaten.
»Schön, dich zu sehen.« Eine Kollegin, die auf Höflichkeit Wert legte, wofür sowohl Mara als auch Nordin, dieses alte Raubein, eher bedingt empfänglich waren.
Sie unterdrückte ein Gähnen und bekam es zumindest hin, der Französin halbwegs freundlich zuzunicken.
»Möchtest du einen Schluck?« Pelletier schmunzelte und hielt ihr den Kaffee hin. »Hab doch mitbekommen, dass du drauf geschielt hast. Kannst gern alles haben.«
Nicht nur eine höfliche, sondern auch eine sehr aufmerksame Kollegin. Mara schmunzelte ihrerseits, bedankte sich und konnte nicht widerstehen, einen großen Schluck zu nehmen.
»Du siehst also, ich bin noch in Frankfurt«, begann Pelletier, ihr weicher Akzent umschmeichelte die Silben. Der Duft teuren Parfüms wehte über die leere Tischplatte hinweg. Sie war ähnlich grazil wie Mara, aber ein deutliches Stück größer. Ihre kurze Jacke war aus hellem weichem Stoff, die Hose lässig und weit geschnitten, wie es gerade wieder in Mode kam. Beides wirkte neu.
Die sprichwörtliche französische Eleganz, hier saß sie leibhaftig am Tisch. Einen größeren Gegensatz zu Maras schwarzer Gestalt hätte man sich kaum vorstellen können. Aber im Laufe der letzten – wenn auch erfolglosen – Ermittlungen waren sie gut miteinander ausgekommen. Auch wenn Mara immer noch nicht so recht wusste, wie Pelletier es aufnahm, dass sie und Nordin sich nahe-, sehr nahegekommen waren. Inwieweit die Französin ihrerseits auf den rauen Charme des Schweden ansprang, vermochte Mara einfach nicht einzuschätzen.
»Natürlich bist du noch in Frankfurt«, nahm sie den Faden wieder auf. »Wieso auch nicht? Wir haben den Mann, hinter dem wir her sind, schließlich nicht erwischt. Ich bin es gewohnt dranzubleiben. Auch an Polaris.«
»Das bin ich ebenfalls.« Pelletiers Ausdruck wurde ernster. »Aber ich bin auch ein Profi, und das heißt, ich mache mir nichts vor. Wenn man die Fährte verloren hat, hilft es nicht, sich das Gegenteil einzureden. Gönnen wir uns eine Pause. Polaris wird wieder auf sich aufmerksam machen. Und dann sind wir zur Stelle. Ich bin überzeugt, dass er aus Frankfurt verschwunden ist. Sicher auch aus dem Grund, weil wir ihm Feuer – wie sagt man auf Deutsch?«
»Feuer unterm Hintern gemacht haben«, schlug Mara vor.