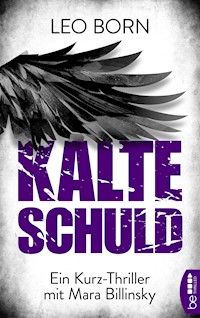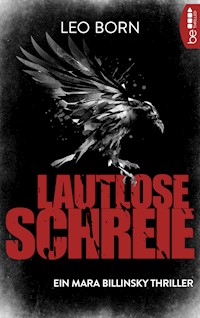9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Mara Billinsky
- Sprache: Deutsch
Eine grausame Mordserie hält Frankfurt in Atem. Der Täter schlägt scheinbar willkürlich zu, allerdings mit einer Ausnahme: Alle Opfer sind jung und erfolgreich. Ihre Ermittlungen führen Mara Billinsky und Jan Rosen zu einer ehemaligen russischen Ballett-Tänzerin, die etwas über die Morde zu wissen scheint. Doch selbst als ihr eigener Sohn verschwindet, schweigt sie eisern weiter. Aber Mara lässt nicht locker und gerät - ohne es zu ahnen - mitten in einen tödlichen Rachefeldzug ...
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchTitelTeil 1: Die Symbole des Todes12345678910111213141516171819Teil 2: Ein mörderisches Labyrinth20212223242526272829303132333435363738394041424344Teil 3: Das Blut von damals454647484950515253545556575859606162Teil 4: Der Schmerz, der bleibt6364656667686970717273747576777879808182838485868788Über den AutorImpressumÜber dieses Buch
Eine grausame Mordserie hält Frankfurt in Atem. Der Täter schlägt scheinbar willkürlich zu, allerdings mit einer Ausnahme: Alle Opfer sind jung und erfolgreich. Ihre Ermittlungen führen Mara Billinsky und Jan Rosen zu einer ehemaligen russischen Ballett-Tänzerin, die etwas über die Morde zu wissen scheint. Doch selbst als ihr eigener Sohn verschwindet, schweigt sie eisern weiter. Aber Mara lässt nicht locker und gerät – ohne es zu ahnen – mitten in einen tödlichen Rachefeldzug …
Teil 1
Die Symbole des Todes
1
Sie hatte ein Monster kennengelernt. Hatte ihm in die Augen geblickt und darin die Hölle gesehen. Eine stumpfe, farblose, erbarmungslose Hölle. Sie zitterte, ihr Körper bebte geradezu. Ihre Gedanken rasten und landeten doch immer in denselben dunklen Winkeln ihres Kopfes, der so sehr schmerzte. Kamen immer bei denselben Fragen an.
Wann war die Lösegeldforderung zu Hause eingegangen?
Wie hatten ihre Eltern reagiert?
Wann würde die Geldübergabe stattfinden?
Sie kauerte in der hintersten Ecke des Raumes, rollte sich in Fötushaltung auf der Matratze zusammen, deren Gestank sich mit dem Geruch ihres getrockneten Schweißes vermischte. Ihr war kalt. Doch sie wusste genau, dass sie sofort wieder am ganzen Körper heftig schwitzen würde, sobald sie die Schritte des Monsters hörte.
Nie hätte Sina Tannheim es für möglich gehalten, dass ein solches Wesen existieren konnte. Dass ausgerechnet sie ihm begegnen würde. Nie hätte sie es für möglich gehalten, dass man aus nichts anderem als aus Angst bestehen konnte, einer panischen, beinahe irrwitzigen Furcht.
Sie sog die Luft ein. Sie blinzelte, sah sich um in der mattschwarzen Finsternis, die sie umgab und die lediglich von einem hauchdünnen Streifen Helligkeit zerrissen wurde. Dort, am unteren Rand des von innen mit einer Sperrholzplatte verbarrikadierten Fensters, signalisierte ihr hellgraues Licht, dass es Tag sein musste. Wie lange befand sie sich mittlerweile hier? Wohl mehr als achtundvierzig Stunden. Knappe zehn Quadratmeter. Nackter Boden, nackte Wände. Für ihre Notdurft gab es einen Eimer, dessen verbeultes Blech schimmerte. Ein Heizkörper auf Rollen, betrieben mit einem brummenden Generator, sorgte dafür, dass sie nicht erfror. Dabei wäre der Tod vielleicht sogar eine Erleichterung.
Ja. Mehr als achtundvierzig Stunden Hölle.
Sina versuchte so ruhig wie möglich zu atmen und einen letzten Rest Hoffnung zusammenzukratzen. Bald musste es doch vorbei sein, sagte sie sich. Bald. Dann wäre sie frei. Zurück in ihrem alten Leben, das so geradlinig, unbeschwert und vielversprechend verlaufen war. Bis zu jenem Tag, an dem das Monster … nein, nicht daran denken, die Gedanken daran einfach nicht zulassen. Und doch hetzten ihr bereits wieder unaufhaltsam dieselben Fragen entgegen.
Wann war die Lösegeldforderung zu Hause eingegangen?
Wie hatten ihre Eltern reagiert?
Wann würde die Geldübergabe stattfinden?
Endlich gelang es Sina, gleichmäßiger zu atmen. Sie holte Luft, stieß sie aus, immer wieder, als wäre es das Einzige, wozu sie noch imstande war. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen.
Im nächsten Moment zerschellte ihre gerade wiedererlangte Ruhe wie hauchdünnes Glas.
Schritte.
Sie biss sich auf die Unterlippe, bis sie bitteres, metallisches Blut schmeckte.
Die Schritte kamen näher.
Dreimal hatte er ihr es schon angetan. Früher hätte sie wohl angenommen, das erste Mal müsste das Schlimmste sein. Doch so war es nicht. Mit jeder Sekunde Warten auf das nächste Mal wurde es quälender.
»Bitte nicht!«, flüsterte sie, die Augen zugepresst, die Finger ineinandergekrampft. »Bitte nicht!« Sie zog ihren Rock herunter, so weit es ging. Sie drückte die Innenseiten ihrer Schenkel fest zusammen und spürte dabei das Blut, das auf ihrer hellen Haut rostrot eingetrocknet war. Ihre Fingernägel waren abgebrochen, ihr Haar klebte am Kopf. Schon wieder Schweiß. Angstschweiß.
Die letzten Schritte. Das Öffnen der Tür, das von einem leisen Quietschen begleitet wurde.
Sina zitterte noch stärker. Sie hatte das Gefühl, sich übergeben zu müssen. Dass Furcht so wehtun konnte! Ein nicht allein seelischer, sondern tatsächlich körperlicher Schmerz.
Bitte nicht, bitte nicht!
Lieber sterben.
Oder war …?
Ein Gedanke durchzuckte sie, jäh wie ein Blitz: Würde er ihr womöglich sagen, dass das Lösegeld bezahlt worden sei? Dass alles vorüber sei?
Aber sie hatte ihn gesehen. Sein Gesicht. Die Fratze dieses Monsters. Sie konnte ihn beschreiben.
Die Tür wurde komplett aufgestoßen. Ein großes Viereck aus Tageslicht wurde sichtbar, in dessen Mitte die dunklen Umrisse des Mannes aufragten. Die Helligkeit blendete Sina. Aber nicht nur deshalb senkte sie sofort den Blick. Sie wagte es nicht, ihn anzuschauen, schielte nur zu seinen festen Schuhen.
Er ging kurz in die Knie, um den wieder mit Salzkräckern und getrockneten Apfelringen gefüllten Plastikteller sowie einen Pappbecher mit Wasser auf dem Boden abzustellen.
Sie spürte seinen taxierenden Blick wie eine Berührung.
Er richtete sich auf, kam auf sie zu.
Sie musste würgen, aber nur ein wenig Schleim drang aus ihrer Kehle. Sie spuckte.
Das Monster stand da und wartete geduldig.
Noch ein Würgen, noch ein bisschen Schleim. Sina betrachtete hilflos die kleine grünliche Lache neben der Matratze.
»Fertig?«, raunte er ihr zu. »Genug gekotzt?«
Weiterhin hielt sie die Lider gesenkt. Sie wimmerte.
Dann war er bei ihr. Ganz nahe. Zerrte ihren Rock nach oben. Seine eiskalten, harten Hände auf ihrer Haut. Seine Kraft. Sein Keuchen.
Lieber sterben.
2
Die Pullover in grellem Bordeaux oder Türkis gehörten der Vergangenheit an. Sie waren allesamt im Altkleidercontainer gelandet. Kommissar Jan Rosen trug inzwischen graue oder schwarze Longsleeves, gelegentlich einen dunklen Hoodie. Das passte auch besser zu der nachtblauen Wollmütze und der Jacke im Armeestil. Aber es ging um viel mehr als um einen neuen Look – es ging um einen neuen Rosen. So erhoffte er es sich zumindest. Um einen härteren, mutigeren, ehrgeizigeren Kriminalbeamten, als er es bisher gewesen war. Ihm war selbst nicht so ganz klar, warum er derart lange auf schrille Farben gesetzt hatte – vielleicht nur, um von seiner stillen, scheuen Art mit etwas Schreiendem abzulenken.
Er streifte sich die Mütze über, als er vor das Präsidium trat. Der Abend senkte sich über die Stadt. Am Himmel bildeten Wolkenfetzen ein wildes Muster. Der letzte Schneeregen lag kaum eine Stunde zurück. Es war noch einmal richtig kalt geworden, der Winter schien einfach kein Ende zu nehmen.
Einen Moment war Rosen versucht, nach oben zu den Fenstern des Großraumbüros zu spähen, das er mit anderen Beamten der Mordkommission teilte. Er meinte förmlich den Blick aus den beunruhigend dunklen Augen zu spüren, die seiner Kollegin Mara Billinsky gehörten.
»Gehst du wieder ins Bahnhofsviertel?«, hatte sie ihn vorhin gefragt, als er sich in den Feierabend verabschiedete.
Seine Antwort war nur ein vages Murmeln gewesen, ausgelöst durch den mitleidigen Ton, den er in ihrer Stimme wahrzunehmen meinte.
»Ich habe nichts vor, ich könnte dich begleiten«, hatte sie angeboten, doch er hatte sich rasch nach draußen auf den Flur geschoben.
Er wollte nicht, dass Billinsky ihn unterstützte. Er wollte nicht einmal, dass sie davon wusste, dass er mehrmals in der Woche in das eigentlich von ihm verhasste Viertel aufbrach, um die Straßen zu durchstreifen. Er hätte es ihr nie sagen sollen. Dass Anyana Lupescu seine Gedanken immer noch täglich beschäftigte. Dass er Anyana suchte. Nicht etwa gezielt, nicht systematisch, sondern einfach nur auf gut Glück, ohne Plan, was gar nicht zu seiner ansonsten überlegten, fast pedantischen Vorgehensweise passte.
Beim Einsteigen in seinen Audi entdeckte er aus den Augenwinkeln tatsächlich Billinskys schmale Gestalt am Fenster, und er glitt schnell hinters Steuer. Auf der Fahrt musste er wie so oft über sie nachdenken. Das lag nicht nur daran, dass Mara die ganze Abteilung gehörig durcheinandergewirbelt hatte. Vor allem war sie ihm nach wie vor ein Rätsel, obwohl sie nun schon eine ganze Weile zusammenarbeiteten.
Gelegentlich, bei einem gemeinsamen Glas Wein nach Dienst, schien ihre raue Schale Risse zu bekommen. Aber immer wenn er meinte, dass sie nun wirklich einmal etwas von ihrem Innenleben preisgeben würde, machte sie gleich wieder dicht. Sie wurde die Krähe genannt, früher spöttisch, mittlerweile mit gewissem Respekt. Dank ihrer dunklen, hart und direkt blickenden Augen und ihrer ebenso schwarzen Klamotten ein treffender Spitzname – bisweilen allerdings wirkte sie auf Rosen auch ganz anders. Dann strahlte sie etwas Verletzliches, beinahe Zerbrechliches aus.
Ein Rätsel eben. Er würde wohl nie schlau aus ihr werden.
Mara verschwand aus seinen Gedanken, als er den Wagen am Rand des Bahnhofsviertels in eine enge Lücke bugsierte und kurz darauf die Moselstraße hinabschlenderte, die Hände tief in den Jackentaschen vergraben. Ihm wurde bewusst, dass er gar nicht den Kopf hob, um die Umgebung und die Passanten zu betrachten. Mach dir nichts vor, sagte er sich stumm, du suchst Anyana doch überhaupt nicht mehr.
Vor einigen Monaten hatte er sich in die rumänische Zwangsprostituierte verliebt. Sie hätte als Zeugin gegen einen Gangsterboss aussagen sollen, war jedoch kurz vor Prozessbeginn aus Angst untergetaucht.
Hals über Kopf hatte es Rosen erwischt, stärker denn je. Aber wie er sich nun eingestand, hatte er die Hoffnung, sie aufzuspüren, längst aufgegeben. Wieso zog es ihn also immer noch regelmäßig in diesen Teil der Stadt? Nur wegen der traurigen Aussicht, sonst allein zu Hause sitzen und melancholischen Jazz von Chet Baker hören zu müssen?
Es war noch kälter geworden. Neonlichter zuckten um ihn herum, Gelächter erklang, vorbeifahrende Zuhälter ließen die Motoren ihrer aufgemotzten Schlitten dröhnen. Aus den Eingängen der Stripschuppen und Laufhäuser wummerten Technobeats.
Jan Rosen ging weiter und weiter, in Wirklichkeit jedoch trat er auf der Stelle. Einmal hatte er Mara Billinsky aus einer mehr als brenzligen Situation retten können – das war sein großer Moment gewesen, da hatte es ausgesehen, als könnte er aus seinem Schattendasein im Team ausbrechen und endlich mehr Anerkennung erhalten. Doch im Laufe der Zeit hatte er sich wieder Zentimeter für Zentimeter in sein Schneckenhaus zurückgezogen und war erneut der Mann für die Recherche, für den Schreibtisch geworden, nicht für die Front. Die Chance war da gewesen, aber er hatte nicht beherzt genug zugepackt, er war nicht hartnäckig genug drangeblieben.
Unwillkürlich musste er erneut an Billinsky denken. Sie mit ihrer forschen, frechen, manchmal fast rücksichtslosen Art war erst der Auslöser für ihn gewesen, sich zu verändern. Ein Ansporn. Ein Weckruf. Sollte er ihr dankbar dafür sein oder sie deswegen eher verfluchen? Er wusste es nicht so recht, und das alles nagte an ihm. Jan Rosen musste endlich eine Antwort finden, welchen Weg er denn nun einschlagen wollte.
Die Kälte setzte ihm zu. Er betrat einen türkischen Stehimbiss und bestellte einen Tee und einen Döner. Kurze Zeit später war er schon wieder auf der Straße, missmutig und ein wenig müde. Ein Betrunkener rempelte ihn an, ein Transvestit warf ihm spöttisch eine Kusshand zu. Rosen senkte den Blick, und die Sinnlosigkeit seiner Ausflüge in dieses Viertel war auf einmal geradezu erdrückend. Es wurde wirklich Zeit, nach Hause zu verschwinden. In seiner Wohnung war es einsam, aber wenigstens warm.
Zwei Frauen und ein Mann, die aus einem Hauseingang neben einem Sexshop herauskamen, fielen ihm auf. Der Kerl hatte beide Frauen hart am Arm gepackt und schimpfte auf sie ein. Diese Zuhältertypen mit ihren Muskelbergen und Tätowierungen widerten Rosen an. Er verlangsamte unbewusst seinen Schritt und hielt mitten in der Bewegung inne.
Eine der Frauen erinnerte ihn an Anyana. Aber so selten kam das auch nicht vor. In diesen Straßen gab es eben viele Mädchen wie sie, mit aufreizendem Gang, kurvigen Figuren und knapper Kleidung, selbst bei solcher Witterung. Die Frau hatte dunkelbraunes Haar, auch wie Anyana, aber deutlich kürzer, nur bis zu den Schultern.
Rosen beschleunigte schon wieder. Er war fast an dem Zuhälter vorbei, der die Frauen gerade mit Beleidigungen eindeckte, als ihm etwas auffiel.
Erneut erstarrte er.
Dann wirbelte er herum.
Selbst auf die Entfernung war es zu erkennen: das leicht herzförmige Muttermal auf der Wange der Brünetten.
»Mein Gott!«, stieß Rosen hervor.
Der Zuhälter riss die Fondtür eines geparkten schwarzen BMW auf und stieß die Frauen auf die Rückbank. Dann knallte er die Tür zu. Sein Blick erfasste Rosen, der wie angewurzelt dastand und ihn anstarrte.
»Was glotzt du denn so?«, rief der Mann. Er war groß, breitschultrig und hatte ein sorgfältig gestutztes Kinnbärtchen.
Rosen brachte keinen Ton heraus. Das Muttermal. Es war da gewesen. Er hatte es doch gesehen.
Oder?
Die hinteren Scheiben waren getönt. Er hätte alles dafür gegeben, ins Innere spähen zu können. Der Typ präsentierte Rosen den Mittelfinger. Er schob sich auf den Fahrersitz, knallte die Autotür zu und startete den Motor.
»Halt!«, hörte sich Rosen rufen, er hob sogar den Arm und wurde neugierig von einigen Passanten beäugt.
Der Wagen fuhr los.
War es Anyana? Saß sie tatsächlich in diesem Auto? Oder wurde er langsam verrückt?
»Halt!«, rief er noch einmal. »Stopp!«
3
Lautlos öffneten sich die Aufzugtüren. Paulina betrat den Flur, der zur einzigen Wohnung des obersten Stockwerks führte. Im ganzen Gebäude war es still. Ein anonymer, unpersönlicher und schmuckloser Kasten, erbaut in den Siebzigern.
Die Sohlen ihrer gefütterten Stiefel mit den flachen Absätzen verursachten nicht das leiseste Geräusch auf dem hellbraunen, kaum abgelaufenen Teppich. Sie war in unauffälligen, eher dunklen Farbtönen gekleidet. Ihr Gesicht versteckte sie hinter einer großen Sonnenbrille und einer schwarzen Wollmütze, die sie tief in die Stirn gezogen hatte und die ihr langes blondes Haar komplett verhüllte. Keine einzige Strähne lugte unter dem Rand hervor.
Vor der Tür blieb Paulina stehen, um den Schlüssel, den sie bei ihrem letzten Besuch behalten hatte, aus der Manteltasche zu ziehen. Sie öffnete die Wohnungstür, verschwand im Inneren und schloss sie leise hinter sich. Grauenvoller Gestank schlug ihr entgegen. Doch nach einem kurzen Luftanhalten gelang es ihr, das auszublenden. Es gab Schlimmeres auf der Welt als üble Gerüche, oder etwa nicht?
Sich hier aufzuhalten, stellte ein beträchtliches Risiko dar und war nicht einmal absolut notwendig. Dennoch war sie nicht etwa unbedacht hierher aufgebrochen, sondern hatte sich informiert und dabei zu ihrer Überraschung festgestellt, dass das, was sich in diesen vier Wänden abgespielt hatte, noch immer nicht an die Öffentlichkeit gedrungen war.
Ja, ein stilles Haus, ein anonymes Haus. Und das spielte ihr in die Karten.
In den letzten Wochen war sie ständig von dem Gedanken geplagt worden, dass sie etwas übersehen hatte und womöglich die Papiere nicht gründlich genug durchgegangen war. Die Sache hatte ihr einfach keine Ruhe gelassen.
Es gelang ihr auch weiterhin einigermaßen, den Geruch an sich abprallen zu lassen. Sie betrat das kleine Arbeitszimmer und durchsuchte den Schreibtisch. Das Leder ihrer Handschuhe strich über brüchig und gelblich gewordene Blätter. Sie schaltete den Computer ein und tippte das Passwort ein, das sie bei ihrem ersten Besuch erfahren hatte. Aber da fand sich nichts Neues, was ihr hätte weiterhelfen können.
Anschließend überprüfte sie den nach wie vor offen stehenden Safe. Eine größere Summe Bargeld hatte er enthalten, doch die hatte sie bereits an sich genommen. Sie betrachtete das einfache Chromregal und machte sich erneut am Schreibtisch zu schaffen. Nichts. Keine Adressbücher. Keine hastig hingekritzelten Telefonnummern. Keine sonstigen Notizen.
Paulina suchte das benachbarte Wohnzimmer auf. Es war recht groß, enthielt jedoch nur wenige Möbel. Sie widerstand der Versuchung, die Balkontür aufzureißen und frische Luft hineinzulassen, auch wenn sie ganz bestimmt niemandem aufgefallen wäre, weder einem Bewohner der ähnlich hohen Nachbargebäude noch einem möglichen Passanten, der aus einem zufälligen Impuls heraus nach oben gespäht hätte.
Beiläufig ließ sie den Blick über die Dächer wandern, über diese abweisende, unnahbare, hinterhältige Stadt. So war ihr Frankfurt immer vorgekommen. Ein paar Semester hatte sie an der Goethe-Universität studiert, doch das lag lange zurück. Sie wandte sich vom Fenster ab und betrachtete das einzige Gemälde, das sich in der gesamten Wohnung befand. Vor violettem Hintergrund zeigte es eine ganz in Weiß gekleidete, gesichtslose Ballerina, eingefangen in einer Pirouette. Das von einem wuchtigen Rahmen gehaltene Kunstwerk passte nicht zum kahlen Rest der Wohnung.
Nun durchsuchte sie das Bad und das winzige Zimmer mit dem Gästebett, das wirkte, als wäre es niemals von irgendjemandem benutzt worden. Dann die Küche: die Schränke mit dem wenigen Geschirr, die Schubladen mit dem wenigen Besteck, den fast leeren Kühlschrank.
Zurück ins Wohnzimmer. Alles war aufgeräumt. Nichts stach ihr ins Auge. Sie roch den Staub der vielen Jahre, die ereignislos vorübergezogen sein mussten. Sie versuchte sich vorzustellen, wie der Mann hier einen Tag nach dem anderen verbracht haben musste. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Leere. Eintönigkeit. Vor der Welt verborgen.
Paulina seufzte. Was für eine Schnapsidee. Sie hatte nichts übersehen, sie war schon beim ersten Mal gründlich genug gewesen. Was auch sonst?
Dennoch ging sie auch noch ins Schlafzimmer. Hier war der Gestank übermächtig. Sie presste hart die Lippen aufeinander und kniete sich neben das Bett, um den Nachtschrank zu überprüfen, auf dem noch zerfledderte Zeitungen lagen, deutsche und internationale.
Nichts. Sie stand auf und nahm sich den Kleiderschrank vor. Auch hier nichts Auffälliges.
Ja, eine Schnapsidee.
Doch penibel und hartnäckig, wie sie war, begab sie sich noch einmal in das Arbeitszimmer. Die einzigen Gegenstände, die sie außer dem Schlüssel und dem Bargeld an sich genommen hatte, waren alte Leitzordner gewesen. Auf dem Chromregal sah man noch, wo sie gestanden hatten: exakte Linien im Staub. Paulina zog ein Papiertaschentuch aus der Manteltasche und wischte die Spuren sorgfältig weg, damit kein cleverer Polizist darauf kommen konnte, dass hier etwas entwendet worden war.
Sie stand da, umgeben von Stille, und dachte nach. Zu allen Personen, die auf ihrer Liste standen, hatte sie Angaben in den Ordnern gefunden. Nur zu einer nicht. Ein vages Lächeln umspielte ihre Lippen, als ihr das Gemälde wieder einfiel. Von Neuem betrat sie das Wohnzimmer. Sie nahm das Bild von der Wand und untersuchte es genauer. Auf der Rückseite, eingeklemmt zwischen Rahmen und Leinwand, stieß sie auf einen Umschlag. Sie öffnete ihn und überflog die Blätter und Fotografien, die er enthalten hatte.
Erneut musste sie lächeln. Ihr Instinkt hatte sie nicht getrogen. Trotz der Gefahr, trotz des Risikos hatte sie noch einmal hierherkommen müssen, und es hatte sich gelohnt. Sie schob alles zurück in den Umschlag und verstaute ihn in ihrer Innentasche. Jetzt verfügte sie auch über Informationen, die die letzte Person auf der Liste betrafen.
Wer hätte es gedacht? Der Kerl war also ein sentimentaler Hund gewesen: ein Umschlag hinter einem Gemälde. Sogar Fotos. Wie romantisch! Und wie lächerlich.
Sie hängte das Bild wieder auf.
Als Paulina die Wohnung verließ, musste sie am Schlafzimmer vorbei, dessen Tür nach wie vor offen stand. Sie warf keinen Blick mehr in den Raum, in dem der Mann auf dem Bett lag. Tot, stinkend, verwesend.
4
Der Motor des Taxis röhrte laut. Aus dem Radio drang indische Musik, die der turbantragende Fahrer leise gedreht hatte, als Dennis Malik auf der Rückbank Platz genommen und seine Adresse in Bockenheim genannt hatte. Jetzt war die Straße frei, der Wagen beschleunigte, rechts und links an den Fenstern schossen die Gebäude regelrecht vorbei.
Dennis schloss die Augen und merkte, dass sich sein Mund zu einem Grinsen verzog. Er war berauscht. Nicht nur von reichlich Gin-Tonic, sondern vor allem von der pulsierenden Gewissheit, unaufhaltsam zu sein. Das Studium war vorbei, er hatte mit grandiosen Noten abgeschlossen, die letzte Party lag hinter ihm, und in Kürze würde er zu einer ausgedehnten Neuseelandreise aufbrechen, nach deren Ende er seine erste Arztstelle anzutreten hatte. Nicht irgendwo, sondern im sonnigen Kalifornien, wo er bereits einige Semester studiert hatte. Die Welt stand ihm offen. Wie auf einem Silbertablett lag sie vor ihm, er musste nur noch zugreifen. Die Zukunft, das Leben. Jetzt konnte es losgehen.
Es war fast vier Uhr morgens, dennoch war er versucht, das Smartphone aus der Manteltasche zu ziehen, um seine Eltern anzurufen. Er verdankte ihnen so viel, und er wollte sie an seinem Glücksgefühl teilhaben lassen, selbst um diese Tageszeit. Doch sein Verstand gewann die Oberhand, er ließ das Handy stecken.
Sie erreichten die Konrad-Broßwitz-Straße, in der ihm sein Vater eine schicke Dachwohnung besorgt hatte. Dennis bezahlte, gab ein großzügiges Trinkgeld und stieg aus. Auch die harsche Frankfurter Kälte konnte seiner Hochstimmung nichts anhaben, als er in der Hosentasche ungeschickt nach dem Schlüssel wühlte. Er dachte an L. A., an den Strand von Santa Monica. An The Ivy, das Promi-Restaurant am Robertson Boulevard in Beverly Hills, und an The Perch in der Hill Street mit dieser unglaublichen Roof Top Bar. Er dachte an all die hübschen kalifornischen Blondinen. Wie hätte er da frieren können?
Pfeifend fuhr er im Aufzug nach oben. In der Wohnung stieg er aus den Halbschuhen und ließ den Mantel achtlos auf den Boden fallen. In seinem Kopf drehte es sich ein wenig. Noch immer pfiff er vor sich hin, laut und falsch. Erst im Wohnzimmer knipste er das Licht an, dimmte es jedoch gleich stark herunter. Die Ecke, in der das neue Ledersofa stand, blieb vollkommen von Dunkelheit erfüllt.
Noch einen Gin zum Abschluss?, fragte er sich stumm, als er stehen blieb, fast schon in der Mitte des Raumes. Da war doch noch eine Flasche Hendrick’s, oder? Ein merkwürdiges Gefühl erfasste ihn. Ein unangenehmes Gefühl. Seine fröhliche Trunkenheit verlor sich schlagartig. Er drehte sich um.
Ein Mann stand neben der Zimmertür.
Dennis starrte ihn völlig perplex an.
Der Kerl war groß, breitschultrig. Und sein Gesicht war …
Mein Gott!, schoss es Dennis durch den Kopf. Ein Monster!
Was sollte das? Ein Einbruch? Nie hätte er damit gerechnet, dass … Aber Moment mal, nichts war durchwühlt worden, alles befand sich an seinem Platz. Dennis’ Gedanken schlugen wilde Purzelbäume. Und dazu zerrte diese Stille an seinen Nerven.
»Wie sind Sie hier reingekommen?«, fragte er mit einer Stimme, die ihm ganz fremd war, so lächerlich dünn hing sie in der Luft.
»Das war kein Problem«, lautete die ruhige, sachliche Antwort des Mannes.
Und nun? Dennis wusste nicht, was er tun sollte. Eine fast absurde Situation. Hätte er nicht so viel Angst gehabt und wäre es hier nicht um ihn gegangen, hätte er womöglich laut loslachen müssen.
Aber es ging um ihn.
Der Fremde trat zu. Völlig ansatzlos. Er traf Dennis genau zwischen die Beine. Schmerz durchzuckte Dennis. Ein Faustschlag erfolgte so schnell, dass er ihn gar nicht sah. Er wurde quer durchs Zimmer geschleudert und landete auf dem Teppichboden, den seine Mutter liebevoll ausgesucht hatte.
Dennis war nie geschlagen worden, in seinem ganzen Leben nicht, und er konnte kaum fassen, was da innerhalb von Sekunden über ihn hereingebrochen war. Die Angst in seinem Inneren rang mit seinem Verstand, der einen klaren Gedanken hervorzubringen versuchte.
Blut lief ihm aus der Nase. War sie gebrochen? Er betastete sie vorsichtig, fühlte die klebrige Flüssigkeit.
»Hoch mit dir!«, befahl der Fremde, von dessen Handschuh ebenfalls Dennis’ Blut tropfte.
Dennis gehorchte, fast schon mechanisch. Sein Blick wanderte von den roten Tupfern auf dem Teppich zu der Fratze des Mannes.
»Mein Bargeld«, hörte Dennis sich stammeln. »Es ist nicht viel in der Wohnung. Ehrlich.«
»Ich will deine Scheine nicht.«
»Ich habe keine Wertgegenstände«, sagte er hilflos.
»Drauf geschissen.«
»Meine Kreditkarte ist im Geldbeutel. In der Manteltasche. Der Mantel ist …«
»Ich will deine Kreditkarte nicht.«
Der Eindringling musterte ihn. Nicht etwa feindselig oder auch nur angespannt, sondern eher mit einer überheblichen Neugier. »Du hast bisher ein schönes Leben gehabt, oder?«, fragte er. »Sorgenfrei? Mit jeder Menge Spaß?«
Dennis starrte ihn hilflos an. Seine Angst wurde immer größer.
»Und nun wartet eine schöne Zukunft auf dich, stimmt’s? Du bist wirklich ein beneidenswertes Kerlchen.«
Der nächste Hieb mit der Faust kam wiederum fast ansatzlos, und Dennis wurde gegen die Wand geschleudert. Noch ein Schlag. Er sackte zusammen. Seine Wange berührte den weichen Teppich, die Nase blutete noch stärker.
»Ich versteh das alles nicht«, jammerte er. »Warum?«
»Weil ich deine Tränen sehen will. Und deine Pisse, die dir vor Angst an den Beinen klebt.«
Es stimmte. Dennis hatte uriniert – und es gar nicht gemerkt.
Ein Geräusch ertönte. Ganz leise. Das Rascheln von Stoff, gefolgt vom Quietschen teuren Leders. Die Laute kamen von der im Dunkel liegenden Ecke des Wohnzimmers. Dennis spähte dorthin.
Auf dem Sofa saß jemand. Offensichtlich die ganze Zeit schon.
Die Person erhob sich und trat ins Licht.
Kalte Augen betrachteten ihn. Augen, die keinem Monster gehörten. Aber das machte alles nur umso verwirrender.
Was sollte das?, fragte sich Dennis erneut, in immer größerem Entsetzen. Er verstand nichts. Die Welt spielte verrückt. Hatte sich innerhalb eines Wimpernschlags von Weiß in Schwarz verfärbt.
»Meine Kreditkarte«, begann er in seiner Verzweiflung von Neuem. »Sie ist …«
»Vergiss endlich die Karte, vergiss das Geld, das sagte ich dir doch schon.« Der Fremde griff in seine Jackentasche und holte eine Rolle Klebeband hervor. »Es geht um etwas anderes. Um eine ganz andere Währung.«
»Und was soll das sein?«
»Auch das sagte ich dir bereits. Tränen. Deine Tränen.«
Sekunden schlichen vorbei, langsam, ganz langsam.
Dennis hatte tatsächlich Tränen in den Augen. Sie tropften auf den Teppich, genau wie das Blut. »Ich hab niemandem etwas getan.«
Es kam keine Antwort.
»Was wollt ihr denn nur von mir?« So weinerlich, verletzlich, schwach, gar nicht mehr seine Stimme.
»Was wir wollen?« Das Monster starrte ihn an. »Nur eine einzige Sache. Eine Kleinigkeit. Nicht weiter bedeutend.«
»Was immer es ist, ich gebe es euch.«
»Natürlich tust du das.«
»Und was ist es?«, stammelte Dennis.
»Dein Leben.«
5
Im Wohnungsflur war es schon entsetzlich gewesen, aber hier im Schlafzimmer …
Mara Billinsky hielt den Atem an. Sie spürte, wie sich ihr der Magen umdrehte. Unwillkürlich legte sie den Handrücken unter die Nasenlöcher, sie musste würgen und unterdrückte es. Der faulige Gestank hing als unsichtbare Wolke in der Luft, derart aggressiv und kraftvoll, wie sie nie zuvor etwas gerochen hatte.
Erneut versuchte sie die Luft anzuhalten, auch wenn das letztlich nicht viel nützte.
Rosen hatte ihr per WhatsApp mitgeteilt, dass er sich verspäten würde. Besser für ihn. Der Anblick einer Leiche war immer schwer zu verkraften, handelte es sich jedoch um ein Opfer, das bereits seit Wochen tot sein musste, überstieg das jegliche Grenze des Erträglichen. Mara versuchte sich auf die Einzelheiten zu konzentrieren, alles als schlichte Fakten in ihrem Kopf abzuspeichern, auch wenn das verdammt schwer war.
Der Mann lag auf dem Bett. Auf dem Laken hatten sich Rinnsale Wege gebahnt, rosa verfärbt vom Cholesterin: Körperflüssigkeit, die aufgrund der Raumwärme ausgetreten war. Ein grauer Haarschopf. Das Gesicht und der Körper waren wegen der welligen Berglandschaft aus zahllosen Maden kaum erkennbar. Ein helles T-Shirt und eine rote Jogginghose klebten am Körper. Die Füße waren nackt und beinahe sichelförmig gekrümmt, die Zehen wie eingerollt. Auf den Sohlen und den Knöcheln zeichneten sich Totenflecken als dunkle rot-violette Muster ab.
Mara musste da durch. Sie hatte keine Wahl. Die Hand über Nase und Mund gestülpt, beugte sie sich vor, um das Gesicht unter dem Gewusel der Maden noch einmal aus der Nähe betrachten zu können. Verklebte Augenlider, angefressene Pupillen. Die Lippen waren aufgeplatzt. Der Kiefernmuskel trat hart wie ein Tau hervor. Das Gerinnen von Muskelproteinen fing in den Lidern an, am Hals, am Kiefer. Sämtliche Muskeln im Körper wurden starr und fixierten die Leiche zunächst in der Stellung, in der sie sich befand.
Trotz des schlimmen Zustands des Leichnams konnte man den langen Schnitt erkennen, mit dem jemand dem Mann die Kehle durchtrennt hatte.
Mara richtete sich wieder auf.
In dieser Wohnung hatte nur eine Person gelebt, und aller Wahrscheinlichkeit nach handelte es sich bei ihr um das Opfer. Simon Jenal. Alleinstehend, keine Kinder. Hier wohnhaft seit etwas mehr als achtzehn Jahren. Das war im Moment alles, was Mara über ihn wusste. Die spärlichen Erkenntnisse über Simon Jenal hatte ihr ein Gespräch mit dem Hausmeister gebracht. Er war es auch gewesen, dem der Gestank als Erstem aufgefallen war, woraufhin er gleich die Polizei unterrichtet hatte.
Die Spezialisten der Kriminaltechnik huschten in ihren hellen Schutzanzügen und Plastiküberschuhen um Mara herum, leise, emsige Gestalten, die etwas von Gespenstern an sich hatten. Einer der Männer machte sich an den gekrümmten Fingern des Toten zu schaffen. Ein trockener Laut erklang, als würde ein Zweig gebrochen werden, dann ein Rascheln, ein Klicken und drei Piepser in schneller Folge. Das war der mobile Fingerabdruck-Scanner, ein Spritzguss-Eingabegerät mit einem Adapter für ein iPhone. Eine App auf dem Smartphone verarbeitete den Scan in ein hochauflösendes Bild und übermittelte die Daten direkt an die Zentrale, wo sie mit Hunderttausenden gespeicherten Abdrücken verglichen wurden.
»Die Finger sind in einem schlechten Zustand«, meinte einer der Kriminaltechniker, die Stimme aufgrund seiner Maske gedämpft. »Sieht so aus, als ob der Scanner nicht in der Lage wäre, die Rillen zu erkennen.«
»Ist das genau aus diesem Grund herbeigeführt worden?«, fragte Mara.
Der Mann nickte. »Ziemlich sicher. Das liegt keineswegs nur an den Verwesungserscheinungen. Offenbar hat man ihm ganz gezielt die Fingerkuppen versengt.«
Mara zwang sich zu einem letzten prüfenden Blick auf den Toten und verließ das Schlafzimmer. Sie nahm sich einen Raum nach dem anderen vor, ganz in Ruhe, konzentriert, immer noch den grässlichen Gestank in der Nase.
Um einmal kurz innehalten zu können, stellte sie sich an eines der Fenster und schaute auf die Parkanlage, die viele Etagen unter ihr lag und von strahlenförmig angeordneten Beeten geschmückt wurde. In der Mitte stand eine Sonnenuhr, Kieswege führten zu der gegenüberliegenden Mauer mit dem prächtigen Wandbrunnen. Aus den beiden speienden grotesken Gesichtern, die ein Medusenhaupt einrahmten, sprudelte kein Wasser, dafür war es zu kalt. Im Sommer war es recht schön hier, fast beschaulich, obwohl man praktisch nur einen Steinwurf von der City und der großen Einkaufsstraße, der Zeil, entfernt war.
Vom Eingang her, wo ein uniformierter Beamter als Wache postiert war, drangen Stimmen zu Mara. Sie folgte dem Flur und empfing Jan Rosen, der gerade eintraf, mit einem unmissverständlichen Blick.
»So schlimm?«, meinte er.
»Schlimmer.« Sie hob warnend die Hand. »Erspar dir den Anblick. Ich habe mich bereits ausgiebig umgesehen. Und Fotos werden wir sowieso noch bekommen.«
»Ich schaff das schon«, erwiderte er, bereits kalkweiß im Gesicht. In der Mordkommission gab es einen Running Gag, der sich auf Rosens sensiblen Magen bezog. Mara wusste also, warum sie ihn jetzt am Ärmel seiner Armeejacke packte und entschlossen vom Flur ins Wohnzimmer zog.
Sie machte eine Geste, die den gesamten Raum einschloss. »Was sagst du dazu?«
»Wozu?«
»Zu der verdammten Einrichtung.«
»Hm. Sehr aufgeräumt.« Er sah sich gewissenhaft um. »Und sehr sachlich, würde ich es mal nennen. Fast kärglich.«
Mara zog eine Augenbraue in die Höhe. »Aufgeräumt. Sachlich. Kärglich«, wiederholte sie dumpf.
»Stimmt es etwa nicht?« Er bedachte sie mit einem abwartenden Blick.
»Sicher, Rosen, es stimmt. Aber es klingt so zaghaft. Hier sieht es doch aus, als wäre in diesen vier Wänden nie gelebt worden. Nichts steht herum. Da hängen keine Fotos an den Wänden, kein Kalender mit Notizen zu irgendwelchen Terminen. Es gibt keine Bücher, keine Zeitschriften. Zuerst dachte ich, hier sei erst vor ein paar Wochen jemand eingezogen. Oder dass der Mieter die Wohnung immer nur ein paar Tage pro Woche nutzte und in Wirklichkeit woanders lebte. Dafür allerdings wäre sie wieder zu groß. Also, ich finde, da wirkt manche Knastzelle einladender.« Sie schüttelte grüblerisch den Kopf. »Das ist ein Gefängnis. Nur ohne Gitter.«
In knappen Worten fügte sie die Eckpunkte an, die bei der Unterhaltung mit dem Hausmeister herausgekommen waren.
»Die Wohnung sieht tatsächlich nicht aus wie seit fast zwei Jahrzehnten in Gebrauch«, stimmte Rosen zu.
»Als hätte ein Roboter hier gewohnt. Außer diesem Gemälde mit der Ballerina findet sich absolut nichts Emotionales.«
»Vielleicht ist einiges gestohlen worden. Ich habe den offen stehenden Safe bemerkt.«
»Selbst wenn – das ändert nichts an meinem Eindruck. Nicht einmal ein einziges Foto gibt es hier, von irgendeiner alten Flamme, einem putzigen Hundchen, einer tollen Ferienreise oder von was auch immer.«
Rosen zuckte vage mit den Schultern, wie es typisch für ihn war. Seine Lippen bildeten einen schmalen Strich.
»Das kommt mir verdammt komisch vor«, murmelte Mara mehr zu sich als zu ihm. »Diese unpersönliche Wohnung. Der Mord. Ich meine, das war nicht einfach nur ein simpler Raubüberfall.«
»Dein berühmtes Gespür, was?«, wagte er einen kleinen Vorstoß in Sachen Spott.
»Berühmt ist es nicht, aber wenigstens ab und zu liege ich damit richtig.« Sie trat nahe ans Fenster. »Und an diesem Tatort leuchten sämtliche Alarmlampen in meinem Dickschädel knallrot, das kann ich dir sagen.«
»Wie lange ist der Mann tot?«
»Die Kollegen meinen, bestimmt seit einigen Wochen. Die zu Beginn eintretende Leichenstarre hat nach einer gewissen Zeit nachgelassen, und der Körper ist ein wenig in sich zusammengesunken. Anfangs war die Heizung womöglich nicht eingeschaltet gewesen oder nur sehr schwach. Du erinnerst dich, als es für einige Tage plötzlich unverhältnismäßig warm wurde.«
Er nickte. »Die Kälte in der Wohnung hat den Verwesungsprozess verlangsamt, schätze ich.«
»Richtig. Dann aber, als es draußen wieder saukalt wurde, hat sich die Heizung automatisch eingeschaltet. In allen Räumen ist es auch jetzt sehr warm. Die Fenster sind ausnahmslos geschlossen.«
»Was den Verwesungsprozess wiederum beschleunigt hat.«
»Genau. Der Gestank wurde heftiger und breitete sich bis in die unteren Stockwerke aus.« Mara sah sich ratlos um. »Offenbar ein Mann, der nicht gerade über viele Freunde verfügte. Er ist von niemandem vermisst worden. Kein Mensch hat sich Sorgen um ihn gemacht. In der gesamten Zeit – womöglich kein einziger Besucher.«
»Nicht einmal eine Putzfrau.«
»Also hat er eigenhändig für Ordnung gesorgt. Was auf einen nicht unbedingt vermögenden Mann schließen lässt – ebenso wie die Einrichtung hier.«
Rosen suchte ihren Blick. »Wieso hätte man also ausgerechnet ihn ausrauben und dabei nicht einmal vor einem Mord zurückschrecken sollen?«
»Das frage ich mich schon die ganze Zeit.«
»Vielleicht haben ihm die schönen Dinge des Lebens nicht viel bedeutet, und er thronte in dieser nüchternen Schlichtheit auf einem Berg von Bargeld.«
»Immerhin hat er sich die monatliche Miete leisten können. Was hier, in der Eschenheimer Anlage, sicher nicht ganz billig sein dürfte.« Mara spielte mit einer Strähne ihres schwarzen Haars. »Wir müssen mehr erfahren über diesen Herrn.«
Ein Schweigen entstand.
»Dieser Geruch«, sagte Rosen dann mit einem Kopfschütteln. »Den kriegt man aus den Klamotten, aber man wird ihn nie wieder los.«
»Ich weiß, was du meinst.« Sie stand da und betrachtete das Gemälde mit der Ballerina. »Rufst du den Chef an und gibst ihm die ersten Infos durch? Ich sehe mich noch einmal ganz genau hier um.«
Er musterte sie. »Ich kann mich auch umschauen. Wirklich, das ist schon okay.«
»Rosen«, erwiderte sie nachdrücklicher. »Geh doch einfach in den Hausflur. Da hast du mehr Ruhe beim Telefonieren.«
Er trottete davon, und sie sah ihm kurz hinterher, ehe sie erneut die einzelnen Zimmer unter die Lupe zu nehmen begann.
Später, nachdem sie getrennt voneinander, jeder mit dem eigenen Wagen, ins Präsidium zurückgefahren waren, saßen sie in ihrem Großraumbüro, das durch mobile Trennwände in Zweierzonen eingeteilt war, an direkt gegenüberliegenden Schreibtischen. Rosen tippte auf seine Tastatur ein, eifrig auf der Suche nach möglichen Spuren, die Simon Jenal in der digitalen Welt hinterlassen haben könnte.
Unentwegt kreisten die Bilder aus dem stillen Haus in der Eschenheimer Anlage durch Maras Kopf. Manchmal wurde man an einem Tatort rasch von einem bestimmten Gefühl erfasst und konnte sich recht gut vorstellen, was sich abgespielt hatte – und auch, aus welchem Grund. Manchmal jedoch wurde man von Ungewissheit eingehüllt und schien in ein schwarzes Loch zu starren. Wie im Falle von Simon Jenals Todeswohnung.
»Gibt es eigentlich Neuigkeiten über die junge Frau, die vermisst gemeldet worden ist?«, fragte Rosen, ohne den Blick vom Monitor zu heben. Es war ein Fall, über den sie schon mehrfach gesprochen hatten.
»Die Rechtsanwältin?« Mara sah auf. »Nein. Anscheinend nichts Neues.«
»Die angehende Rechtsanwältin«, korrigierte er mit altbekannter Beflissenheit. »Jetzt sind es vier Tage, seit man Sina Tannheim zuletzt gesehen hat. Ein Tag ist noch nicht besorgniserregend, vielleicht auch nicht zwei oder gar drei. Gerade bei Menschen Mitte, Ende zwanzig. Aber mal ganz ehrlich, ich fürchte, Sina Tannheim könnte von einem Vermisstenfall zu einem Fall für uns werden.«
Mara nickte nur. »Sprechen wir wieder über sie, wenn es so weit ist.« Nach wie vor wurde sie von den Eindrücken in Simon Jenals Wohnung geplagt, nach wie vor war es, als würde sie in einen finsteren Abgrund blicken.
»Auch einen Kaffee, Rosen?« Sie stand auf, um sich auf den Weg zu dem Getränkeautomaten in einem der anderen Flure zu machen.
»Nein, vielleicht später.«
Sie verließ das Büro und folgte dem Korridor. Aus einem der angrenzenden Räume kam jemand, verabschiedete sich nach innen mit einem schnellen Auf Wiedersehen – und prallte mit dem Rücken gegen Maras rechte Schulter.
»Verzeihung«, kam es von dem Mann.
Da erst merkte sie, um wen es sich handelte.
Ausgerechnet er, schoss es ihr durch den Kopf.
Aus einem ersten Impuls heraus wollte er weiterhasten, dann jedoch hielt er inne. Sie standen einander gegenüber. Mara Billinsky und Staatsanwalt Christian von Lingert. Seit Wochen, sogar seit Monaten waren sie sich aus dem Weg gegangen. Bei unumgänglichen beruflichen Terminen hatten sie sich dem jeweils anderen gegenüber sachlich, rein professionell verhalten und aneinander vorbeigesehen.
Jetzt war ein Ausweichen unmöglich.
Einige Sekunden vergingen in peinlichem Schweigen, Kollegen eilten an ihnen vorüber. Sie sahen sich noch immer in die Augen.
Schließlich war es Mara, die mit ironischem Unterton die Stille beendete: »Vielleicht sollten wir aufhören, uns so kindisch zu benehmen.«
Er senkte den Blick, nickte kaum sichtbar. »Es wäre an der Zeit.«
Seine ausgeprägten Geheimratsecken, das streng nach hinten gekämmte, stellenweise bereits grau schimmernde Haar und die Brille mit einem altmodischen Gestell ließen den Staatsanwalt älter wirken, als er mit seinen Ende dreißig war. Er war kein unbedingt attraktiver Mann, aber jemand mit Persönlichkeit. Jemand, der aus der Menge herausstach. Aus seinem hart geschnittenen Gesicht sprang die Nase schmal und kantig hervor. Am auffälligsten waren die tief liegenden Augen, die einen beunruhigenden Blick auszusenden vermochten. Nicht allerdings in diesem Moment.
»Wir hätten wohl irgendwann mal miteinander reden müssen«, meinte er ungewohnt ausweichend.
»Das haben wir verpasst«, entgegnete Mara schlicht.
Wie immer war er in einen Maßanzug gehüllt, der wie eine zweite Haut saß. Seidenkrawatte mit perfekt gebundenem Windsorknoten. Schwarze Halbschuhe, auf denen sich kein Staubkorn fand. Anfangs hatten ihn seine mühelose Eleganz und sein Auftreten an ihren Vater erinnert, was bei Mara unweigerlich Ablehnung ausgelöst hatte. Ihm war es nicht anders gegangen, was sie betraf. Man konnte sich tatsächlich kaum zwei Menschen vorstellen, die weniger zusammengepasst hätten. Doch einmal, als Maras Welt kopfstand und sie intensiv mit von Lingert zusammenarbeiten musste, war es passiert, das Unglaubliche. Es war zu einem One-Night-Stand mit dem Staatsanwalt gekommen. Zu allem Überfluss stellte sich heraus, dass ihre beiden Familien durch eine gemeinsame blutige Vergangenheit verbunden waren.
»Es ist viel passiert«, sagte er nun, wiederum in defensivem Ton.
»Zu viel.«
»Es war mir einfach nicht möglich, das alles auch nur ansatzweise auszublenden.«
»Verständlich.«
»Das wird immer zwischen uns stehen.«
»Ich weiß.«
Erst schien er noch etwas erwidern zu wollen, doch dann wandte er sich abrupt ab und setzte sich in Bewegung.
Mara verharrte an Ort und Stelle, ohne ihm hinterherzusehen, sondern starrte stattdessen auf die leere Wand. Als seine Schritte verklungen waren, begab sie sich zum Kaffeeautomaten. Mit dem Becher in der Hand stand sie noch eine Weile am Fenster. Sie dachte an von Lingert. Besser so, sagte sie sich. Besser, dass es vorbei war, ehe es richtig angefangen hatte. Es wäre zu kompliziert gewesen, zu unsicher, zu verrückt.
Sie betrachtete ihr Spiegelbild in der Scheibe. Die tiefschwarzen Haare, die ihr auf die Schultern fielen und das schmale Gesicht mit dem hellen Teint umrahmten. Die Narbe auf der Wange. Die Piercings an Oberlippe und Braue. Die etwas zu große, abgewetzte schwarze Motorradlederjacke. Ja, das war sie. Billinsky, die Krähe. Sie hatte sich ihren Platz im Präsidium hart erkämpfen und Situationen überstehen müssen, die ihr an die Nieren gegangen waren. Aber sie konnte zäh sein, viel zäher, als man es im ersten Moment denken mochte.
Sie trank einen Schluck Kaffee, drehte sich um und lief los. Auf dem Rückweg ins Büro verbot sie sich erneut, auch nur eine einzige weitere Sekunde über Staatsanwalt von Lingert nachzugrübeln. In Gedanken kehrte sie zurück in Simon Jenals Wohnung – und zu den vielen Fragezeichen, die sie mit diesem grauenerregenden Tatort verband.
Als sie ihren Platz erreichte, fiel ihr auf, dass Rosen nicht mehr mit der üblichen Konzentration auf die Tastatur einhämmerte, sondern seltsam versonnen vor sich hin starrte. Er hatte ordentlich kurz geschnittenes, bereits schütteres Haar und eher weiche Gesichtszüge. Seine in sich gekehrte Art kam in diesem Moment besonders stark zum Ausdruck.
Sie setzte sich und stellte den Becher mit dem Rest des Kaffees vor sich auf dem Schreibtisch ab. »Was ist los? Was beschäftigt dich?«
Rosen straffte sich, winkte ab. »Ach, ich hatte kürzlich ein komisches Erlebnis. Und das spukt mir im Kopf herum.«
»Magst du’s erzählen?«
»Hm. Es war, als hätte ich einen Geist gesehen.«
»Offenbar einen netten, so verträumt, wie du gerade gewirkt hast.«
Er gab keine Antwort, sondern zeigte nur ein scheues Lächeln.
Maras Bürotelefon klingelte. Auf dem Display leuchtete Hauptkommissar Klimmts Nummer. »Hallo, Chef«, sagte sie.
»Billinsky, kommen Sie in mein Büro«, brummte er. »Sofort.«
»Rosen auch?«
»Einer von euch genügt.«
»Was gibt’s denn?«
»Noch ein Mord.«
Damit war das Gespräch beendet.
Mara erhob sich abrupt. »Ich muss zum Chef.«
6
Rasch senkte sich der Abend über die Stadt. Als wäre ein riesiger dunkler Schleier über die Dächer gestülpt worden. Verkehrslärm dröhnte dumpf und monoton, ein kalter Wind rauschte.
Jan Rosen ließ den sechsgeschossigen Gebäudekasten hinter sich, der ihm gerade bei Finsternis immer wie eine Kriegsfestung aus vergangenen, wesentlich roheren Zeiten erschien. Aber ging es heutzutage wirklich weniger roh zu? Oder hatte man im Laufe der Zeit nur scheinbar angenehmere Methoden entwickelt, seinen Mitmenschen Schaden zuzufügen? Er hielt inne und zog sich die Mütze zurecht. Schluss mit den törichten Gedanken, sagte er sich. Was ist los mit dir?
Ein seltsames Gefühl beschlich ihn. Als würde er beobachtet werden. Er sah sich um. Niemand zu entdecken. Eine neuerliche Windböe zerrte an ihm. Er blickte zurück – diesmal befand Billinsky sich nicht am Fenster, sie war sicher noch bei Klimmt. Rosen war aufgebrochen, ohne auf ihre Rückkehr zu warten, schließlich hatte ihn keiner hinzugebeten. Das Gebäude wirkte auf einmal geradezu erdrückend auf ihn. Ein vertrautes Gefühl. Sein Vater war Kriminalbeamter gewesen, ebenso sein Onkel. Beide hatten perfekt in ein Leben als Bulle gepasst. Aber warum hatte er diesen Weg eingeschlagen? Nur weil er nicht den Mut gefunden hatte, seinem alten Herrn zu sagen, dass er sich etwas anderes wünschte? Und wie hatte dieser Wunsch überhaupt ausgesehen? Lange her war das, sehr lange.
Rosen verscheuchte auch diese Gedanken und setzte seinen Weg fort, hin zu der Seitenstraße, in der er morgens seinen A4 abgestellt hatte. Nein, heute nicht, sagte er sich, als er seinen in einem dunklen Metallicblau lackierten Wagen erreichte. Heute nicht ins Bahnhofsviertel, sondern einfach nur nach Hause. Doch der verrückte Moment, als er glaubte, Anyana Lupescu gesehen zu haben, wog schwer. Würde er es ausgerechnet nach diesem Erlebnis fertigbringen, nicht ins Viertel zu fahren?
Er öffnete die Fahrertür, und im selben Moment hörte er einen Ruf: »Rosen!«
Erschrocken wirbelte er herum.
Wiederum war niemand zu entdecken.
Hatte er sich die dünne, vom Wind beinahe verschluckte Stimme nur eingebildet? Irritiert spähte er noch einmal ins trübe abendliche Nichts, das ihn umgab. Nein, da war niemand.
Er wollte endgültig hinters Steuer gleiten, als er erneut mitten in der Bewegung innehielt.
»Rosen!«
Wieder drehte er sich um, diesmal langsamer, angespannt, mit einem flauen Gefühl in der Magengrube. Aus dem Schutz eines ganz in der Nähe geparkten Kleinbusses löste sich eine Gestalt. Seine Anspannung wurde noch größer.
Die Gestalt kam auf ihn zu.
Jetzt erkannte er sie. Er traute seinen Augen kaum. »Himmel!«, murmelte er. »Das gibt’s doch nicht.« Er spürte, wie eine Welle der Erleichterung über ihn hinwegschwappte.
Anyana Lupescu blieb vor ihm stehen, gehüllt in einen Mantel, die Schuhe hochhackig, die Haare ein deutliches Stück kürzer als früher. Und ihr Blick genauso, wie er ihn sich unzählige Male in Erinnerung gerufen hatte.
Er bekam eine Gänsehaut. Und das lag nicht etwa an der lausigen Kälte.
»Rosen«, sagte sie. Ganz leise. Auch wie früher. Nie hatte sie ihn beim Vornamen genannt. Nur einmal hatten sie sich geküsst. Rosens einziger erotischer Moment in vielen Jahren.
»Ich habe dich gesehen, im Bahnhofsviertel«, kam es über seine Lippen, nervös, flattrig. »Aber ich war mir nicht sicher, ob du es warst, ich habe gerufen und …« Er schnaufte. »Ich habe es wohl einfach nicht glauben können.«
Anyana lächelte auf diese zurückhaltende, abwägende Art, die ihn ganz verrückt machte – und die er einfach nicht mit den schrecklichen Dingen in Einklang brachte, die sie mit ihren gerade mal vierundzwanzig Jahren bereits erlebt hatte.
»Ich habe dich auch gesehen.« Sie lächelte etwas freier. »Vom Auto aus. Als wir losgefahren sind.«
Zu gern wollte Rosen sie in die Arme schließen, aber er konnte nur stocksteif dastehen und insgeheim seine Unbeholfenheit verfluchen.
»Ich habe mich immer gefragt, wie es dir wohl geht.« Anyana musterte ihn mit ihrem typischen Lächeln.
»Damals bist du einfach abgehauen«, erwiderte er. Es klang wie ein Vorwurf. So war es gar nicht gemeint, und er ärgerte sich schon wieder über sich selbst. »Ähm«, beeilte er sich anzufügen, »ich meine, du hattest eine Heidenangst, na klar, wer hätte das Ganze schon so einfach durchziehen können? Eine Zeugenaussage gegen einen der gefährlichsten … Also, das muss ein höllischer Druck gewesen sein.«
Halt bloß die Klappe!, befahl er sich lautlos.
»Du bist sehr süß, Rosen. So anders als die Männer, mit denen ich es sonst zu tun habe.«
Er verzog den Mund zu einem säuerlichen Grinsen. Das kannte er. Wenn man ihm ein Kompliment machen wollte und er dennoch nicht recht glücklich darüber war.
Sie kam auf ihn zu und schmiegte sich an ihn, ganz selbstverständlich, unbefangen, so wie er niemals würde sein können.
»Ich habe dir nie Danke gesagt«, flüsterte sie. »Dabei hast du so viel für mich getan.« Sie sah zu ihm hoch.
Rosen nickte und presste die Lippen aufeinander, aus Befürchtung, wieder Unsinn zu reden.
Sie löste sich von ihm.
Als er sich von seiner Überraschung ein wenig erholt hatte, gelang es ihm, sie aufmerksamer zu betrachten. Das unverkennbare Muttermal in Herzform wirkte größer, weil ihr Gesicht schmaler geworden war. Unter der dick aufgetragenen Schminke kam unreine Haut zum Vorschein, die um die wunderschön geschwungenen Wangenknochen spannte. Die Augen drückten Müdigkeit aus, eine tiefe Erschöpfung, die eher zu einem älteren Menschen gepasst hätte, und das schnitt Rosen ins Herz. Ein Leben, wie Anyana und ihre Leidensgenossinnen es führten, zehrte an den Kräften, an der Seele.
»Wie geht es dir?« Angesichts ihres Anblicks klang Rosens Frage lächerlich, und er fuhr fort, ehe sie antworten konnte: »Ich meine, äh, wo wohnst du? Was, hm, machst du?« Er sah, was sie machte. Sie führte das gleiche Leben wie damals.
Ein leises, trauriges Lachen erklang. »Na ja, wohnen kann man es eigentlich nicht nennen. Einer Prinzessin könnte man meine Unterkunft sicher nicht anbieten.«
»Der Kerl mit dem Kinnbart und dem schwarzen BMW. War das dein Zuhälter?«
Sie nickte. »Fedor.« Ein Schatten fiel über ihr Gesicht. »Aber es ist nicht ganz so schlimm wie früher.« Ein vages Schulterzucken. »Hm. Wahrscheinlich genauso schlimm. Könnte ich nur raus aus diesem Leben. Wenn man das überhaupt Leben nennen kann. Ich bin der Besitz von jemand anders.« Ernst erwiderte sie seinen Blick. »Durch dich hatte ich eine Chance. Scheiße! Hab’s verbockt.«
»Vielleicht kann ich dir ja jetzt helfen.«
»Das wäre doch nur Zeitverschwendung.« Sie winkte ab. »Mir ist nicht zu helfen, Rosen.«
Erneut berührte ihn die Art, wie sie seinen Namen aussprach, auch wenn sie nie Jan sagte. Nur seine Mutter, die seit dem Tod seines Vaters allein lebte und die er zu selten anrief und noch seltener in ihrer Wohnung in Mainz besuchte, nannte ihn beim Vornamen.
Er schluckte und überlegte krampfhaft, was er vorbringen konnte.
Sie lächelte und wirkte gleich noch verletzlicher. »Es war schön, dich wiederzusehen Ich hoffte, ich würde dich treffen. Um mich endlich bedanken zu können. Na ja, ich dachte, wenn ich dich irgendwo finde, dann hier.« Anyana lächelte und wirkte gleich noch verletzlicher, verlorener. »Ja. Es war schön, dass wir gesprochen haben.«
Sie machte Anstalten zu gehen. Er wollte sie aufhalten und griff nach ihrem Arm. Würde er sie jetzt nicht stoppen, wäre es für immer vorbei, das spürte er.
Sein Smartphone klingelte.
Anyana drückte sanft seine Hand weg und entfernte sich.
»Warte!«, rief er.
Verzweifelt starrte er aufs Display seines Handys. Es war Mara Billinsky.
»Was?«, fragte er kurz angebunden, wie es sonst eher sie tat.
»Bist du schon nach Hause gegangen, oder holst du dir was zu essen? Deine Jacke ist weg, dein Computer ist … Wie auch immer, wir müssen in die Parkstraße.« In knappen Worten erläuterte sie ihm den Grund.
»Ich komme«, sagte er automatisch, den Blick auf Anyanas Rücken gerichtet, die schon ein ganzes Stück weg war. Er trennte die Verbindung, steckte das Handy fahrig in die Jackentasche und hastete ihr hinterher. Erneut packte er sie am Arm, fester als gewollt.
Wieder standen sie einander gegenüber, jetzt recht nah an der Adickesallee, über die der dichte Verkehr hinwegdröhnte.
»Anyana«, rief er gegen den Motorenlärm an. »Wohin gehst du? Ins Bahnhofsviertel?«
»Klar. Eigentlich darf ich gar nicht unterwegs sein. Wenn er wüsste, dass ich …« Sie ließ den Satz offen und winkte abermals ab. »Mach’s gut, Rosen.«
»Nein, Anyana, du gehst nicht!« Er überraschte sich fast mehr mit seiner jähen Entschlossenheit als sie.
»Aber, Rosen …«
Er deutete zu seinem Audi, dessen Tür noch offen stand. »Ich muss zu einem Tatort. Aber vorher bringe ich dich noch schnell zu mir.«
»Zu dir?« Sie machte runde Augen. »Das geht nicht.«
»Doch.«
»Das kann ich nicht einfach machen.« Mit jäher Härte fügte sie an: »Ich muss heute Nacht arbeiten, Geld verdienen, die Beine breit machen. So sieht mein Leben nun mal aus. Du weißt das.«
»Anyana, du gehst nicht dahin!«
Der Wind peitschte um sie herum, die Autos brummten.
»Wie denkst du dir das? Glaubst du, ich könnte mir einfach einen Abend freinehmen wie gewöhnliche Menschen? Das ist unmöglich, Rosen. Und außerdem ist es viel zu gefährlich. Für mich. Für dich.«
»Anyana, du gehst nicht dahin!«, wiederholte er.
7
Die Angst hatte nicht nur nachgelassen, sie hatte sich aufgelöst.
Zuvor noch so übermächtig, war sie etwas anderem gewichen. Etwas, das vielleicht noch schlimmer war, einem Taubheitsgefühl, das sich in Sina Tannheim ausgebreitet hatte, nicht nur in ihrem Körper, auch in ihrem Herzen.
Wenn das Monster auftauchte, zuckte sie noch immer zusammen, wallte die Furcht wieder auf, jedoch nur kurz. Dann ließ sie das, was folgte, einfach über sich ergehen. Der Schrecken, das Unglaubliche war zum Alltag geworden. Nein, es gab keinen Alltag mehr. Es gab gar nichts mehr. Auch sie gab es eigentlich nicht mehr, nur noch ihre frühere Hülle.
Wie lange befand sie sich jetzt schon hier? Wie viele Tage waren verstrichen? Sina spähte mit leerem Blick zu dem dünnen Streifen grauer Helligkeit am unteren Rand des verbarrikadierten Fensters. War es morgens, mittags oder bereits gegen Abend? Sie war ungewaschen, sie konnte den Schmutz und den Schweiß auf ihrer Haut riechen, auch das Blut an den Oberschenkeln, aber sie ekelte sich nicht, sie registrierte es lediglich, ohne eine Reaktion darauf hervorbringen zu können.
Urplötzlich, wie aus dem Nichts war es wieder vorbei mit der Lautlosigkeit, die sie einhüllte: Schritte, gleich darauf die Geräusche, wenn die Tür geöffnet wurde, das Schlüsselrascheln, das Quietschen der Scharniere.
Sie zuckte zusammen, ein Zitteranfall, dann war gleich wieder alles taub in ihr, und sie kauerte reglos in ihrer Ecke.
Das Monster betrat den Raum. Diesmal allerdings kam es nicht auf Sina zu. Nein, der Mann verharrte einen Schritt vor dem Eingang und betrachtete sie mit seltsamem Ausdruck, als wäre sie ein Haustier, das sich einfach nicht an die neue Umgebung zu gewöhnen vermochte.
Oder täuschte sie sich? Schimmerte da womöglich Mitleid in seinen Augen auf?
Die Stille bekam etwas Erdrückendes.
Warum näherte er sich nicht?
Ein Geräusch erklang, hinter ihm. Wiederum Schritte, noch ganz leise.
Sinas Kehle wurde trocken. Was hatte das zu bedeuten? Sonst war er immer allein zu ihr gekommen. Er trat ein Stück zur Seite, um jemandem Platz zu machen. Die Schritte wurden lauter.
Wer war das?
Und jäh glomm irgendwo in den dunklen Tiefen von Sinas geschundener Seele etwas auf, an das sie nicht mehr geglaubt hatte. Hoffnung. Schwach und zittrig wie die Flamme einer Kerze beim Aufkommen eines Luftzugs.
War das Lösegeld bezahlt worden?
Kam sie endlich frei?
Die zweite Person betrat Sinas kleines Gefängnis.
Sina starrte in ein attraktives Gesicht mit eindrucksvoll großen Augen.
Ja, da war sie, Hoffnung, eine verzweifelte, fast schmerzhafte Hoffnung, dass es doch noch zu einer Wendung kommen könnte.
Niemand äußerte etwas.
In Sina stiegen Tränen auf. Die ersten seit vielen Stunden oder gar Tagen. Sie straffte ihren Oberkörper. »Das Lösegeld«, brachte sie mühsam hervor. Ihre rissig gewordenen Lippen taten weh. »Ist es bezahlt worden?«
Das Monster kam einen weiteren Schritt auf sie zu und verharrte erneut.
»Das Lösegeld«, wiederholte Sina leise und verzweifelt.
Der Mann ging in die Knie, um ihr direkt ins Gesicht zu blicken. »Schätzchen, wir haben keine Lösegeldforderung gestellt.«
Sina verstand seine Worte, aber sie begriff ihren Sinn nicht.
Keine Lösegeldforderung.
Sie musste die einzelnen Silben in ihrem Kopf abermals zusammensetzen, eine nach der anderen, doch noch immer war alles ein einziges erschreckendes Rätsel.
»Aber warum nicht?«, fragte sie.
Er stellte sich wieder hin und verdeckte Sina die Sicht auf die zweite Person, von der er sich nun etwas reichen ließ.
Es handelte sich um ein Messer mit einer langen Klinge.
»Du hast dich auf dein Leben gefreut, was?«, meinte das Monster. »Vergeblich, Schätzchen. Dein Leben endet hier und jetzt. Alles ist vorbei.«
Sina spürte das Schlagen ihres Herzens. Nie war ihr bewusst gewesen, wie schön dieses Gefühl war, diese Gewissheit, dass man ein Herz hatte und dass es Blut durch den Körper pumpte.
»Alles ist vorbei«, wiederholte das Monster.
8
Er war jung, attraktiv, sportlich. Und er war tot.
Seine Augen wirkten unnatürlich groß, weit aufgerissen im Moment eines letzten Schmerzes. Der Mund war vollständig unter einem breiten, robusten Klebestreifen verschwunden, der seine Schreie abgewürgt hatte. Mit einem weiteren Streifen waren seine Handgelenke auf den Rücken gefesselt worden.
Keine Frage, es war recht lange ruhig gewesen in der Stadt, doch jetzt begann Frankfurt wieder verrücktzuspielen. Erfüllt von düsteren Vorahnungen und erneut umweht vom gnadenlosen Duft des Todes, stand Mara Billinsky in einer Mietwohnung eines Mehrparteienhauses. Es befand sich in der Parkstraße, direkt an der Ecke zum Grüneburgweg, der das Westend durchzog. Keine preisgünstige Gegend, und auch innerhalb der vier Wände wirkte nichts billig. Ganz in der Nähe war Mara aufgewachsen. Ihr Vater lebte nach wie vor in demselben Haus, in dem sie beide einst ihre Kämpfe ausgefochten hatten und das er von seinem Vater geerbt hatte.
Genau wie vor Kurzem in Simon Jenals Wohnung in der Eschenheimer Anlage huschten Kriminaltechniker um Mara herum. Es wurde nicht viel gesprochen; so war es immer, wenn alles noch unter dem unmittelbaren Eindruck eines gewaltsam beendeten Menschenlebens stand.
Dennis Malik. So lautete der Name des Opfers. Viel mehr wusste Mara noch nicht über ihn. Und dass es eine Weile gedauert hatte, bis ihn der letzte Atemzug erlöst hatte.
Sein Gesicht war mit etlichen Schlägen malträtiert worden. Die Augen geschwollen, das Nasenbein offenbar gebrochen, Platzwunden am Jochbein, außerdem über dem Auge. Man hatte sein schickes Hemd aufgerissen. Überall lagen die abgesprungenen Knöpfe herum, und sein Oberkörper war übersät von weiteren Wunden, wohl Messerstichen. In die Haut seiner Stirn war etwas geritzt worden, offensichtlich die Form eines Sarges. Auch auf seiner Brust prangte ein geritztes Symbol: ein Grabstein. Ein Schnitt durch die Kehle hatte Malik schließlich ins Jenseits befördert.
»Hallo, Billinsky«, ertönte eine leise Stimme.
Mara sah nicht auf, sondern betrachtete weiterhin den Toten, insbesondere die Hautritzungen.
Jan Rosen stellte sich neben sie.
Sie hörte, dass er schluckte.
»Diesmal musst du keinen Vorwand suchen, um mich rauszuschicken«, meinte er gepresst. »Ist schon okay.«
»Klimmt brauchen wir heute auch nicht anzurufen – er weiß, wo wir sind. Er war es nämlich, der mich hierhergeschickt hat.« Erst jetzt musterte sie ihn. »Übrigens, du bist spät. Warst du etwa doch schon auf dem Heimweg?«
»Ja, war ich«, nuschelte er nur.
»Ist ja auch egal.« Mara deutete auf das Opfer. »Dennis Malik. Als ihn seine Mutter zwei Tage lang nicht erreicht hat, ist sie hierhergefahren. Sie hat die Wohnung mit ihrem eigenen Schlüssel betreten, ihren Sohn entdeckt und gleich darauf die Kollegen verständigt. Dann ist sie zusammengebrochen. Ich habe sie noch kurz sprechen können, aber eine richtige Befragung war nicht möglich. Sie befindet sich jetzt in der Uniklinik, wird medizinisch versorgt und muss sich erst mal erholen.«
»Das kann ich mir vorstellen.«
»Dennis Malik studierte Medizin«, fuhr Mara fort, den Blick nach wie vor auf den Ermordeten gerichtet. »Das heißt, er hat sein Studium wohl kürzlich beendet.«
»Drei Zimmer, großzügig geschnitten. Parkstraße 4. Keine schlechte Adresse für einen Studenten«, merkte Rosen an.
»An Geld scheint in der Familie nicht gerade Mangel zu herrschen«, erwiderte sie mit vielsagendem Blick. »Die Ohrringe der Mutter waren wahrscheinlich teurer als mein Auto.«
Er sah sich im Wohnzimmer um. »Hier hat sich alles abgespielt, oder?«
»Das denke ich auch. Keine Blutspuren in einem der anderen Räume.« Sie holte Luft. »Entweder hat Malik seinen Mörder freiwillig hereingelassen, ihn mitgebracht, oder der Mörder hat sich auf geschickte Weise Zutritt verschafft und einfach gewartet, bis Malik daheim aufgetaucht ist.«
»Vielleicht auch die Mörder.«
»Möglich.« Mara nickte grüblerisch.
»Mal sehen, was die Spurensicherung noch finden wird.«
»Lass uns die anderen Wohnungen abklappern, Rosen.«
Jede der fünf übrigen Eingangstüren wurde ihnen bereitwillig geöffnet. Allerdings hatte keiner der Bewohner in den vergangenen Tagen etwas Auffälliges gesehen oder gehört. Niemand hatte einen oder mehrere Fremde bemerkt oder konnte sonst etwas Hilfreiches beisteuern. Dennis Malik wurde als ruhig und höflich beschrieben, näheren Kontakt jedoch hatte es nicht zu ihm gegeben.
Nach einem weiteren Besuch am Tatort und einem Gespräch mit den Kollegen der Spurensicherung traten Mara und Rosen vor das Gebäude, um an die frische Luft zu gelangen und dem Geruch des Todes für einen Moment zu entkommen.
Mara verspürte das eigentlich doch längst schon besiegte Verlangen nach einer Zigarette. Ihr halbes Leben lang hatte sie geraucht, erst vor Kurzem damit aufgehört – doch in Situationen wie dieser, an Orten wie diesem drang die alte Sucht wieder an die Oberfläche. Es war kalt, die Luft roch nach Schnee. Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Die viel zu dünne Lederjacke und der dick gefütterte Kapuzenpullover, den sie darunter trug, reichten gegen den Frankfurter Winter nicht aus.
Sie dachte beiläufig an den sizilianischen Wein, den sie sich eigentlich für einen ruhigen Abend zu Hause gekauft hatte, den Etna Rosso DOC, einen charaktervollen Roten, wie gemacht für ein paar einsame Stunden mit düsterer Musik und melancholischen Gedanken. Aber daraus würde nichts werden.
Uniformierte Beamte sicherten das Haus. An den erleuchteten Fenstern ringsum sah man die Umrisse von Menschen, die neugierig nach draußen spähten.
»Sie werden den Leichnam gleich abtransportieren.« Mara betrachtete die Umgebung. Genau an der Ecke befand sich die in der Stadt recht bekannte »Autorenbuchhandlung Marx & Co.«, gegenüber ein kleines Bistro.
»Und dann?«, meinte Rosen, der von einem Fuß auf den anderen trat.
Sie taxierte ihn im Schein einer Straßenlaterne. »Na ja, ich werde wieder ins Präsidium fahren und mich mit dem Chef besprechen. Falls er überhaupt noch da ist.« Sie zeigte ein kurzes schmales Grinsen. »Und du wirst nach Hause gehen. Oder dorthin, wo es dich die ganze Zeit schon hinzieht.«
Verdutzt sah er auf. »Äh, wie meinst du das?«
»Rosen, ich kenne dich. Seit du eingetroffen bist, sind deine Gedanken ganz woanders.«