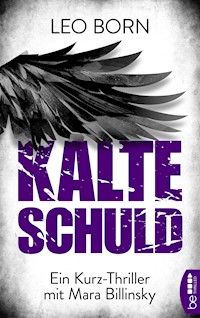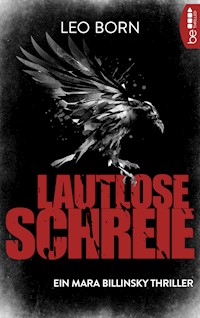
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Mara Billinsky
- Sprache: Deutsch
Was ist der Preis für ein Leben?
An einem eiskalten Morgen auf einem Feld nahe Frankfurt macht die Polizei eine grausame Entdeckung: Die Leichen von sieben Kindern. Und die Opfer müssen vor ihrem Tod ein furchtbares Martyrium durchgemacht haben. Darauf deuten frische Operationsnarben an ihren Körpern hin. Mara Billinsky ist zutiefst erschüttert - und zugleich fest entschlossen. Sie will den Täter um jeden Preis fassen. Dabei verärgert sie mit ihren eigenwilligen Ermittlungsmethoden und ihrer sturen Art nicht nur ihren Chef - sondern auch den neuen Staatsanwalt. Doch die "Krähe", wie Mara von ihren Kollegen genannt wird, bleibt hartnäckig und kommt so einem Verbrechen auf die Spur, dessen Ausmaße sie fassungslos machen ...
"Ein Thriller der Extra-Klasse" (Bambarenlover, Lesejury)
"Durch seine atemberaubenden, realistischen und detaillierten Beschreibungen beschert Leo Born den Lesern regelmäßig Gänsehaut" (Pandora 2711, Lesejury)
"Achtung: Suchtgefahr!" ('Tweed, Lesejury)
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumTeil 1: Kinderaugen123456789101112131415161718192021Teil 2: Blutroter Winter22232425262728293031323334353637Teil 3: Ein Stück Leben383940414243444546474849505152Teil 4: Am Abgrund53545556575859606162636465666768Über dieses Buch
An einem eiskalten Morgen auf einem Feld nahe Frankfurt macht die Polizei eine grausame Entdeckung: Die Leichen von sieben Kindern. Und die Opfer müssen vor ihrem Tod ein furchtbares Martyrium durchgemacht haben. Darauf deuten frische Operationsnarben an ihren Körpern hin. Mara Billinsky ist zutiefst erschüttert – und zugleich fest entschlossen: Sie will den Täter um jeden Preis fassen. Dabei verärgert sie mit ihren eigenwilligen Ermittlungsmethoden und ihrer sturen Art nicht nur ihren Chef, sondern auch den neuen Staatsanwalt. Doch die »Krähe«, wie Mara von ihren Kollegen genannt wird, bleibt hartnäckig und kommt so einem Verbrechen auf die Spur, dessen Ausmaße sie fassungslos machen …
Bewegend, erschreckend und unglaublich spannend – Mara Billinsky ermittelt wieder!
Über den Autor
Leo Born ist das Pseudonym eines deutschen Krimi- und Thriller-Autors, der bereits zahlreiche Bücher veröffentlicht hat. Der Autor lebt mit seiner Familie in Frankfurt am Main. Dort ermittelt auch – auf recht unkonventionelle Weise – Kommissarin Mara Billinsky. »Lautlose Schreie« ist nach »Blinde Rache« der zweite Band mit der ungewöhnlichen Ermittlerin.
Leo Born
Lautlose Schreie
Ein Mara-Billinsky-Thriller
beTHRILLED
Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Arno Hoven
Lektorat/Projektmanagement: Rebecca Schaarschmidt
Covergestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Dmitriev Lidiya | Midiwaves | Yeghishe Serobyan | KHIUS
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5275-7
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Teil 1
Kinderaugen
1
Er senkte die Lider, um sich zu sammeln und tief durchzuatmen.
Sofort nahm er den Geruch des Desinfektionsmittels stärker wahr. Sekunden verstrichen, bis er die Lider wieder hob. Er konnte auch den Schweiß riechen. Das Blut. Und die Angst. Todesangst. Sie erfüllte den Raum wie etwas, das mit Händen zu ertasten war.
Er sah kurz zu dem Strahler an der Decke, der alles in grelles Licht tauchte. Den Mundschutz vor die Lippen setzen, die Handschuhe aus Natur-Latex überstreifen. Erneut durchatmen.
Langsam drehte er sich um.
Diese unerträgliche Stille, die an seinen Nerven zerrte.
Jemand trat beiseite, um ihm den Blick auf den Operationstisch freizugeben.
Er setzte sich in Bewegung, ging mit langsamen Schritten auf den Chromtisch zu und wünschte sich in diesem Moment, am anderen Ende der Welt zu sein.
Oder tot.
Sein Blick erfasste den Patienten, der rücklings auf dem Tisch lag, festgeschnallt an Hand- und Fußgelenken. Ein Junge von vielleicht elf oder zwölf Jahren, der plötzlich den Kopf drehte und ihn anstarrte. Große dunkle, runde Augen, in denen sich eine gewaltige Furcht offenbarte.
Abrupt hielt er inne.
»Wo ist der Anästhesist?« Seine Stimme, die ihm fremd und hart vorkam, zerschnitt die angespannte Ruhe ringsum.
»Er ist nicht da«, antwortete ein Helfer, der aufreizend ruhig klang.
»Wieso nicht?«, fragte er entgeistert.
»Er ist verhindert.«
»Wollt ihr mich verarschen?«
»Keine Sorge. Es wurden Vorkehrungen getroffen.«
»Vorkehrungen? Schafft mir einen Anästhesisten heran!«
»Das ist wirklich kein Problem. Alles wird reibungslos ablaufen.«
»Ach? Kein Problem? Was soll das heißen? Kein Problem?« Eine Panik breitete sich in ihm aus, die aus jeder seiner Silben drang.
»Der Kleine kann schreien, so laut er will«, erwiderte der andere unverändert gelassen. »Trotzdem wird kein Ton über seine Lippen kommen.«
»Warum?«, schrie er mit schriller Stimme. Auf seiner Stirn bildete sich eiskalter Schweiß.
Die Augen des Jungen starrten ihn weiterhin gebannt an. Angstzerfressen, verzweifelt, wehrlos.
»Seine Stimmbänder sind gelähmt«, erklärte der Helfer in sachlichem Tonfall.
»Wie bitte?«
»Diphterietoxin. Man hat es ihm gespritzt. Mehrfach. Sie können es mir glauben: Seine Stimmbänder sind gelähmt. Wir werden seine Schreie nicht hören. Niemand wird sie hören.«
Er fühlte, wie ihm schlecht wurde. Sein Magen schien sich zu einer Kugel zusammenzuballen. Er war überzeugt, dass er sich gleich würde übergeben müssen. Ein widerlich säuerlicher Geschmack breitete sich in seiner Mundhöhle aus.
»Kann der Junge uns verstehen?«, brachte er mühsam heraus.
»Nein, er spricht Ihre Sprache nicht.«
Er schluckte und wollte etwas antworten, doch er wusste nicht, was er hätte vorbringen können. Die weißen Wände, die Stille, das Flackern in den Augen des Jungen. Er unterdrückte ein Würgen.
»Wir sollten anfangen«, sagte der Helfer.
Er wollte losrennen. Nichts wie raus hier! Alles in ihm drängte zur Tür. Aber er blieb auf der Stelle stehen, regungslos, wie paralysiert. Der Schweiß strömte an seinem Gesicht herab, seine Hände unter dem Natur-Latex waren dagegen wie von einer Eisschicht überzogen. Als würde er sie nie wieder benutzen können.
»Lassen Sie uns endlich beginnen.« Die Stimme wurde drängender.
Diese großen runden Augen. Diese beschämende Angst in ihnen. Die bebenden Lippen, die sich zu einem Schrei verzerrten, der lautlos war – und den er doch in seinen Eingeweiden fühlen konnte.
Er begann heftig zu zittern, und alles löste sich in dem Moment auf, als ihm eine Hand sanft über den Kopf strich.
Hilflos blinzelte er in die jäh über ihn gekommene Finsternis.
Der Gestank des Desinfektionsmittels, die Gerüche von Schweiß und Blut, die Augen des Jungen – nichts davon war noch da. Nur Dunkelheit. Und die Finger, die sein Haar streichelten.
»Ein Traum«, raunte sie ihm zu. »Nur ein Traum.«
Er atmete heftig. Sein Herz trommelte in der Brust.
Sie zog ihre Hand zurück. »Schlaf weiter.«
»Ja«, gab er zurück, tonlos, kaum hörbar.
Als gleich darauf ihr gleichmäßiges Atmen zu hören war, zog er die Decke von seinem Körper. Mit langsamen, nahezu lautlosen Bewegungen stieg er aus dem Bett. Im Haus herrschte Stille. Die vertrauten Konturen des Schlafzimmers hoben sich gegen die Schwärze der Nacht ab: der Kleiderschrank, das Bett, das Viereck des Fensters, die offenstehende Tür, durch die er nach draußen schlich.
Auf nackten Fußsohlen ging er über den Parkettboden ins Bad. Geräuschlos machte er die Tür zu. Er knipste eine kleine Lampe an, die einen dezenten Lichtschein in den Raum warf. Den Kopf hielt er gesenkt, eine ganze Weile, und nur widerwillig hob er schließlich das Kinn, um sich dem Anblick seines eigenen Gesichtes im Spiegel zu stellen.
Er musterte sich. Die dünnen Falten, die sich um die Augen und die Mundwinkel gebildet hatten. Den schmalen, harten Strich, den die Lippen formten.
Wie hatte es nur so weit mit ihm kommen können? Wann war er an den Punkt gelangt, an dem sein Leben eine andere Richtung genommen hatte? Und wieso hatte er es überhaupt nicht bemerkt, dass er dabei war, ins Bodenlose zu stürzen?
Er hatte ihre Stimme noch im Ohr. Nur ein Traum.
Nein, sagte er sich stumm. Es war eben nicht nur ein Traum gewesen. Sondern eine Erinnerung. Eine von vielen. Erinnerungen, die ihn Nacht für Nacht heimsuchten, die sein Innerstes zerfraßen, die wüteten wie bösartige Geschwüre.
Er schaltete das Licht wieder aus und war dankbar für die Dunkelheit, die ihn sofort umschloss. Und doch sah er alles nur noch deutlicher vor sich.
Den Abgrund, der sich vor ihm auftat.
Die Gesichter. Das Leiden. Das Blut.
Kein Albtraum konnte schlimmer sein als das, was er erlebt hatte.
Als das, was er getan hatte.
2
Tote Augen starrten sie an.
Ein eisiger Schauer rieselte Mara Billinsky den Rücken hinunter. Etwas in ihr drängte sie dazu, den Blick abzuwenden, doch sie widerstand dem Impuls. Eingehend betrachtete sie die beiden Leichen. Die Haut der Wangen war grau und matt wie getrockneter Lehm, das Haar stumpf und mit Dreckklumpen verklebt; die Beine und Arme waren seltsam verrenkt, die gekrümmten Finger wirkten wie Krallen.
Zum Teil waren die Körper noch bedeckt von schwerer Erde und Schneematsch. Als versuchten sie, sich auf gespenstische Weise aus dem Grab herauszuwühlen, in dem man sie verscharrt hatte.
Mara blendete die leisen Gespräche der Kollegen um sie herum aus, lieferte sich voll und ganz dem erschütternden Anblick aus. Sie war darum bemüht, jede Einzelheit in sich aufzunehmen. Gerade die Details waren das, was besonders tief ging, was Spuren hinterließ. Etwa die billigen Ohrstecker und das rosafarbene Blümchen-Armband des Mädchens oder die knallgelben, mit bunten Tupfern verzierten Socken, die der Junge an den Füßen trug und die fast unnatürlich grell herausstachen.
Das waren die Dinge, an die man sich erinnern würde. Erst recht in Momenten, in denen man am wenigsten damit rechnete. Leichen ansehen zu müssen war immer etwas Beklemmendes. Doch wenn es sich um Kinder handelte, war es noch schlimmer, dann traf es einen bis ins Mark.
Mara schätzte den Jungen auf höchstens acht, das Mädchen auf sechs. Leben, die gar nicht gelebt worden waren.
Schwer zu sagen, wie lange die beiden hier schon gelegen haben mochten. Das würden die Spezialisten herausfinden müssen. Bisher waren jedoch noch nicht alle Beamten von der Kriminaltechnik eingetroffen. Jedenfalls schien die kalte Erde die toten Kinder gut erhalten und den Verwesungsprozess verzögert zu haben.
Nach einer Weile hob Mara wieder den Blick, drehte sich nach links und rechts, um auch die Umgebung auf sich einwirken zu lassen. Hinter ihr befanden sich die Gebäude von Frankfurt-Oberrad. Weit vor ihr erhob sich die Frankfurter Skyline. Durch die Entfernung und die vor Kälte scheinbar vibrierende Februarluft kam sie Mara eigenartig unwirklich vor, eine Fata Morgana aus Stahl und Glas. Um sie herum breitete sich eine trostlose Ebene aus. Wie ein erstarrter brauner Ozean mit einer Gischt aus vereinzelten schmutzig weißen Schneeflecken. Es war ungenutztes Brachland, auf dem nichts gedeihen konnte. Früher hatten hier landwirtschaftliche Lagerhallen gestanden, die allerdings abgerissen worden waren. Eine menschenleere Gegend.
Ein ganzes Stück weiter, wo die Erde fruchtbarer war, nahmen weitläufige Felder verschiedener Gärtnereibetriebe ihren Anfang. Dort wurden Feldsalat und Rauke angebaut, aber vor allem die Kräuter für die berühmte Frankfurter Grüne Soße. Jan Rosen, Maras Kollege, hatte sie in seiner wie üblich beflissenen Art darüber informiert, als sie hierhergefahren waren.
Jetzt stand Rosen etwas abseits bei dem Rentner, der bei einem ausgedehnten Querfeldeinausflug mit seinem Schäferhund beinahe über die beiden Toten gestolpert war und die Polizei per Handy informiert hatte. Gewohnt rücksichtsvoll befragte Rosen den Mann, dessen Gesicht kalkweiß war.
Das zeitweilige Ansteigen der Temperaturen und die heftigen Regenfälle während der letzten Tage hatten die Erde aufgewühlt und so den grausigen Fund erst ermöglicht. Mittlerweile herrschten wieder Minusgrade. Ein eisiger Wind riss an Maras schmaler, fast zierlicher Gestalt. Doch die Kälte, die ihr am meisten zusetzte, rührte von den toten Augen her, die sie zu betrachten schienen.
Wer hatte diese Kinder verscharrt?, fragte sie sich. Wem waren sie im Weg gewesen?
Es war Glück, dass man sie in dieser Einöde überhaupt gefunden hatte. Auf der Fahrt hierher waren Mara und Rosen nach der Ortsausfahrt von Oberrad lediglich an einem einzigen Gebäude vorbeigekommen: einem in die Jahre gekommenen, offensichtlich leerstehenden dreistöckigen Kasten mit Mansarddach. Wirklich ein Niemandsland.
Kurz nach ihnen war auch ihr Chef eingetroffen, Hauptkommissar Rainer Klimmt. Er unterhielt sich gerade mit zwei Leuten von der Spurensicherung, die den Fundort mit einem rot-weißen Plastikband kenntlich gemacht hatten. Als er bemerkte, dass Mara ihn musterte, stapfte er über den vereisten Boden auf sie zu, grimmig und missmutig, wie meistens. Vor allem, wenn er mit ihr zu tun hatte.
»Und?« Bei seinen Fragen an Mara benutzte er zumeist nicht mehr Wörter, als notwendig waren.
»Wir sind auch erst vor ein paar Minuten angekommen. Zwei Kinder …«
»Das sehe ich selbst«, unterbrach er sie. »Wie sind sie gestorben?«
»Das können wir noch nicht sagen.« Sie spähte in den Nachmittagshimmel, der sich verdunkelte. Aschgraue Wolken verbissen sich ineinander. Womöglich würde es neue Schneefälle geben.
»Irgendeinen Hinweis auf ihre Namen, ihre Herkunft?«, wollte Klimmt wissen.
»Bevor wir mit einer ersten gründlicheren Untersuchung beginnen können«, entgegnete Mara betont sachlich, »müssen wir warten, bis sie vollkommen von der Erde befreit sind. Aber das dauert sicher noch, weil man mit besonderer Vorsicht vorgehen …«
»Schon gut«, fiel er ihr zum zweiten Mal ins Wort.
Ihm wäre es lieber, Mara nicht mehr in seinem Team zu haben. Doch nachdem es ihr gelungen war, bei einer aufsehenerregenden Mordserie die Täterin zu stellen, hatte er momentan keine Argumente für ihren Rauswurf.
Klimmt deutete auf den Rentner in der wetterfesten Kleidung, der nach wie vor von Jan Rosen befragt wurde. »Der Mann dort: Hat er die Toten entdeckt?«
Mara gab keine Antwort. Etwas, das lediglich ein paar Meter entfernt war, hatte ihre Aufmerksamkeit erregt. Sie ging los, ließ Klimmt einfach wortlos stehen und nahm aus dem Augenwinkel wahr, dass ihm diese Respektlosigkeit nicht passte, was sie allerdings nicht im Geringsten kümmerte.
Reifenspuren.
Und gleich daneben Fußabdrücke, die eine oder vielleicht auch zwei Personen hinterlassen hatten.
Mara bewegte sich genau darauf zu. Das Gelände wurde ein wenig abschüssig. Sie rutschte auf etwas aus und konnte gerade noch verhindern, auf ihrem Hinterteil zu landen.
Unwillkürlich sah sie nach unten und entdeckte einen hellen Fleck auf dem matschigen Untergrund.
Sie erstarrte.
Eine menschliche Hand ragte aus der Erde hervor, als wollte sie Mara einen Hinweis geben.
Darauf war sie ausgerutscht.
Die beiden Kinder waren offenbar nicht die Einzigen, die in dieser tristen Landschaft ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten.
Mara drehte sich um. Sie sah zu Klimmt, der sie beobachtet hatte, und winkte ihn mit einer knappen Handbewegung heran. »Kommen Sie.«
Ihr Blick richtete sich wieder nach vorn. Nur einige Meter entfernt konnte sie im Matsch roten Kleidungsstoff erkennen. Und ein Stück weiter einen schwarzen Haarschopf. Mara schluckte. Und noch ein Stück weiter gab die Erde abermals Stoff frei: Dem ersten Eindruck nach handelte es sich um den Ärmel einer blauen Jacke.
»Was ist denn?«, hörte sie hinter sich Klimmts brummige Stimme.
»Das ist ein verdammter Friedhof«, sagte sie, mehr zu sich selbst als zu ihm.
Er erschien neben ihr und blieb stehen. »Was?«
»Die beiden Kinder sind nicht die einzigen.« Mara bedachte ihn mit einem kurzen harten Blick aus ihren dunklen Augen, ehe sie weiterschritt. Sie hatte sich nicht getäuscht. Hier waren noch weitere Leichen verscharrt worden. Eine neuerliche Windböe zerrte an ihr. Klimmt rief ihr etwas hinterher, aber sie achtete nicht darauf.
Ein furchtbares Gefühl erfasste sie.
Auf einmal war sie sich ganz sicher, dass dieser Fund nur der Auftakt war. Der Auftakt zu etwas Größerem. Etwas Grauenerregendem. Mara konnte plötzlich das Unheil spüren, das von dieser Stelle inmitten des Niemandslandes ausging. Wieder lief ein eiskalter Schauer über ihren Rücken.
3
Die Stimmen der menschlichen Bluthunde ließen Shaqayeg aus dem Schlaf hochschrecken. Ihre Lider flatterten. War es Tag oder Nacht? Dieses große kalte Zimmer war immerzu ein finsteres Loch. Eine weitere Station auf ihrem Weg in die Hölle.
Sie fuhr sich übers Gesicht. Als ihre Hand zu zittern begann, wurde sie sich wieder der Kälte bewusst, die ihr unter die Haut gekrochen war. Und sie spürte aufs Neue den Hunger, der in ihrem Magen nagte wie ein Wurm. Kälte und Hunger: ihre einzigen beständigen Begleiter, wenn man von der Angst absah, die so tief in ihr saß, dass sie sie manchmal sogar vergaß.
Ihre Augen hatten sich so an die Dunkelheit gewöhnt, dass sie zunächst nichts erkennen konnte, als der Lichtstrahl einer Taschenlampe durch das Zimmer tanzte. Dann aber sah sie menschliche Umrisse. Da waren sie, die Bluthunde: die Männer, denen sie ausgeliefert war und die ihr Schicksal in den Händen hielten. Ihres und das der anderen abgerissenen Gestalten, die sich hier zusammenkauerten. Auf löchrigen Teppichen und Decken, die nicht im Geringsten vor der unbarmherzigen Kälte des gefliesten Bodens schützten. Sie froren, zitterten, hungerten; und oftmals verfielen sie in eine Apathie, die der Furcht vor dem Tod etwas von ihrem Schrecken nahm.
Das Bellen der Bluthunde wurde aggressiver, bösartiger. War irgendetwas vorgefallen? Was war los? Eine Hand packte Shaqayeg an der Schulter und riss ihre dürre Gestalt mühelos empor. Ein paar Sekunden lang stand sie mühsam auf wackligen Beinen, dann wurde sie in den Flur gedrängt. Ihr Blick fiel auf die offene Kellertür, aus der ein Geruch nach oben drang, der ihr vom ersten Moment an unheimlich gewesen war. Durch die Haustür ging es nach draußen.
Sie wurde von nächtlicher Finsternis und eisiger Luft empfangen. Über ihr wölbte sich ein wolkenverhangener Himmel, der nur ganz vereinzelt Sterne funkeln ließ.
Einige Momente lang stand sie nur da, inmitten einer Traube schlotternder Menschen. Was hatte das zu bedeuten? Hieß es Abschied nehmen von diesem Haus des Gestanks?
Die Eingangstür wurde mit einem dumpfen Knall zugeschlagen. Und wie aus dem Nichts war die Angst wieder ganz gegenwärtig in Shaqayeg. Die Bedrohung des Todes hatte all ihre Wucht zurückgewonnen.
Sie werden uns umbringen, sagte sie sich.
Die Bluthunde schrien Anweisungen, schoben sie vorwärts, trieben sie an. Über Schneematsch hinweg wurden sie zu einem Lastwagen gebracht. Auf der Ladefläche drängten sie sich dicht aneinander – die Nähe war der einzige Schutz vor der Kälte. Die Plane wurde heruntergelassen, und eine neue zermürbende Dunkelheit umfing sie alle. Sie fielen gegeneinander, als der Laster anfuhr und über den zerklüfteten Boden hinwegruckelte.
Nach einigen Minuten bewegte sich das schwerfällige Gefährt gleichmäßiger – offenbar hatten sie eine asphaltierte Straße erreicht. Shaqayeg schloss die Augen. Sie hörte den Motor und die Stimmen, die in einer fremden Sprache leise und monoton vor sich hin redeten. Gebete. Was sonst? Sie hatte die Wortfetzen so oft gehört, dass sie fast meinte, den Inhalt verstehen zu können. Sie selbst betete nicht. Was sollte das bringen in einer Welt, in der es keinen Gott gab?
Das Fahrzeug beschleunigte. Der Fahrtwind riss an der Plane, die heftig zu klatschen begann. Der Motor wurde lauter und überdeckte die Stimmen.
Shaqayeg musste daran denken, dass sie weniger geworden waren. Zuerst hatte sie das für ein gutes Zeichen gehalten. Man hatte ihnen ja auch mit Nachdruck begreiflich gemacht, dass die Ersten von ihnen bereits richtige Unterkünfte bezogen hätten – und in einem neuen, besseren Leben angelangt wären. Doch inzwischen zweifelte sie an jedem Wort, das die Männer äußerten. An jedem ihrer Blicke, jeder ihrer Gesten.
Sie hätte nicht einschätzen können, wie lange sie bereits unterwegs waren, als auf einmal das Tempo deutlich verringert wurde. Der Lastwagen beschrieb noch einige Kurven, der Untergrund wurde wieder tiefer und schwerer, dann kam das Fahrzeug zum Stehen.
Alle mussten von der Ladefläche hinunterspringen.
Im ersten Moment war Shaqayeg überzeugt, dass sie dort angekommen waren, wo die Fahrt begonnen hatte: Vor ihnen schälte sich die Silhouette eines Hauses aus der Dunkelheit. Doch rasch wurde ihr klar, dass es sich um ein anderes Gebäude handelte.
Erneut wurden Anweisungen gebellt, der Lichtstrahl der Taschenlampe bohrte sich in die Nacht. Die Tür des Hauses wurde geöffnet. Also doch nicht – das Ende?
In der Ferne leuchteten die Lichter einer Stadt. War das Frankfurt? Den Namen hatte Shaqayeg zuletzt häufig gehört. Wie eine Großstadt kam ihr dieser Ort allerdings nicht vor. Sie befanden sich gewiss irgendwo auf dem Land.
Gleich darauf mussten sie sich in einer Reihe aufstellen. Im Gänsemarsch ging es auf das schwarze Viereck des Eingangs zu. Der nächste Höllenschlund wartete darauf, sie alle zu verschlucken.
Ein kleiner Junge fiel zu Boden, nur einige Meter vor Shaqayeg.
Alle hielten inne.
Einer der Bluthunde sprang herbei und zog den Jungen hoch. Doch der Kleine sank sofort wieder zu Boden. Zwei ältere Jungen wollten ihm jetzt ebenfalls helfen. Ein Durcheinander entstand, die Bluthunde wurden wütend.
Plötzlich setzte sich Shaqayeg langsam in Bewegung. Sie agierte nur aus dem Instinkt heraus, nicht mit ihrem Verstand, nicht mit ihrem Mut, den sie ohnehin längst eingebüßt hatte. Sie schob sich weg, Schritt für Schritt fort von der langen Reihe unglückseliger Gestalten. Einige von ihnen nahmen wahr, was sie tat, zeigten jedoch keinerlei Reaktionen.
Noch ein Schritt, noch einer – vorsichtig, lautlos. Sich unsichtbar machen … Eins werden mit der Nacht, die auf einmal nicht mehr eine weitere Bedrohung darstellte, sondern eine Verbündete.
Noch ein Schritt, noch einer, noch einer. Sie hielt die Luft an, das Herz hämmerte in ihrer Brust.
Plötzlich zerteilte der Strahl der Taschenlampe die Finsternis. Er hüpfte auf und ab, bewegte sich in ihre Richtung. Ein Bluthund schrie. Und Shaqayeg gehorchte wieder ihrem Instinkt: Sie rannte los, mitten hinein in das tote, kalte Nichts der Umgebung.
Hinter ihr das Gebrüll der Männer. Dann peitschten Schüsse. Kugeln zischten an ihr vorbei. Aber sie hastete weiter und weiter und immer weiter, genau auf die Lichter der Stadt zu.
Aus der Ebene wuchsen plötzlich winterlich kahle Sträucher und Bäume. Shaqayeg ließ sich von dem Gehölz verschlucken. Weitere Schüsse, weitere Rufe. Sie stolperte, fiel und kroch auf allen vieren weiter, sprang dann wieder auf und lief durch den Wald, dessen Bäume nicht sonderlich dicht beieinanderstanden und den Blick rasch wieder freigaben auf die Stadt.
Shaqayegs Lungen brannten, ihre Beine schmerzten, hinter ihren Schläfen pochte es. Doch sie achtete nicht darauf, sondern rannte wie nie zuvor in ihrem Leben.
Kamen die Männer näher?
Shaqayeg hatte das Gefühl, jeden Moment zusammenzubrechen; ihre Beine schienen nachzugeben.
Ja, sie kamen näher. Immer näher und näher.
4
Von ihrem Fenster im Hotel Atlantik in Hamburg konnte Evelyn Hornauer über die zugefrorene Alster blicken. Buden waren aufgestellt und Fußgänger auf dem eisigen Untergrund unterwegs. Kleine dunkle Punkte auf dem weiten Weiß. Ein Hamburg, das Evelyn fremd und neu war.
Sie kannte die Stadt bislang nur im Sommerlicht. Schöne Erinnerungen an ihre früheren Jahre, an helle, durchsichtige Nächte. Tanzende Schatten unter dichtbelaubten Bäumen. Überfüllte Straßencafés in alten Stadtteilen. Und so viel Wasser. Jede Menge Brücken. Hatte sie nicht irgendwo gelesen, dass es in Hamburg mehr Brücken gab als in Venedig? Herrliche Wochenendtrips hatten sie und ihr Mann Kai erlebt – damals, als sie nur verliebt und noch nicht verheiratet gewesen waren.
Verliebt waren sie auch heute noch. Aber die Liebe reichte manchmal nicht aus, um alles zu bewältigen.
An diesem Tag war Hamburg wie erstarrt. Der Wind heulte durch die Straßenfluchten, und die Fassaden der alten Kaufmannshäuser an der Alster wirkten abweisend in ihrer hanseatischen Strenge. Der Anblick spiegelte die Einsamkeit wider, die sich seit ihrer Ankunft in Evelyns Brust festgesetzt hatte. Ein Gefühl der Verlorenheit, der Vergeblichkeit. Als wäre am Ende doch alles hoffnungslos.
Sie hätte heulen können.
Doch dazu ließ sie sich nicht hinreißen. Sie hatte darauf bestanden, die Sache allein zu erledigen; Kai hatte zu viel zu tun. Zwei Tage sollte alles in Anspruch nehmen, nicht mehr. Sie hatte die abgesprochene Anzahlung dabei.
Und jetzt – jetzt meldete sich dieser Mann nicht mehr, der Fremde, der plötzlich in ihr Leben getreten war und neuen Mut in ihr und Kai geweckt hatte. Ein weltmännischer Herr namens Peter Engel, in elegantem Anzug, mit manikürten Fingernägeln und vollendeten Manieren. Er hatte auf das Hotel Atlantik als Treffpunkt bestanden.
Wieso tauchte er hier nicht auf? Und warum nur ließ er noch nicht einmal etwas von sich hören?
Evelyn wandte sich vom Fenster ab und blickte gedankenverloren im Zimmer umher. Zum hundertsten Mal überprüfte sie ihr Handy. Nein, er hatte nicht angerufen. Mehrfach hatte sie es bei ihm versucht, gestern und heute, aber jedes Mal nur seine Mailbox erreicht. Sie hatte ihm zwei Kurzmitteilungen geschickt – ohne eine Antwort zu erhalten.
Morgen früh würde sie nach Hause zurückfliegen müssen. Sollte der Fremde nicht wieder auf der Bildfläche erscheinen, dann … Ja, was dann?
Sie sah sich schon, wenn sie am kommenden Tag Kai gegenübertreten würde. Wenn sie beide diesen niederschmetternden Blick wechseln würden, der jedes Wort des Trostes im Keim erstickte.
Der Fremde war ihre letzte Hoffnung gewesen. Evelyn fühlte sich am Ende ihrer Energien. Ihre Angst wurde wieder stärker und drohte sie zu lähmen. Sie atmete tief durch und ließ sich auf dem Bett nieder.
Gleich würde Kai anrufen und fragen, wie es heute gelaufen wäre, nachdem sie ihm am Vorabend hatte mitteilen müssen, dass der Fremde nicht im Hotel aufgetaucht war.
Ob sie die Kraft haben würde, ihm zu antworten, dass es keinerlei Neuigkeiten gab? Dass sie, wie es schien, umsonst nach Hamburg geflogen war? Sie sah Kai vor sich. Zunächst den Kai von damals, während ihrer ausgelassenen Wochenenden in Hamburg, und dann den Kai von heute, der sie stets mit einer besorgten, unglücklichen Miene anschaute.
Schon klingelte ihr Telefon.
Wie sollte sie es ihm beibringen?
Sie erhob sich, ergriff ihr Handy, betrachtete das Display – und es war, als würde sie blitzartig einen Energiestoß erhalten und dadurch neue Kraft gewinnen.
Der Anrufer war nicht Kai.
Es war Peter Engel.
»Hallo!«, rief sie.
»Hallo, Evelyn, wie schön, Ihre Stimme zu hören.« Da war sie wieder: diese sanfte, musikalische Art zu sprechen, der leicht singende Akzent, der auf Evelyn irgendwie angenehm wirkte.
»Ich habe mehrmals versucht, Sie zu erreichen«, sagte sie atemlos.
»Es tut mir schrecklich leid, meine liebe Evelyn.« Er seufzte. »Doch bei mir geht gerade alles drunter und drüber.«
»Sie verspäten sich? Kein Problem, Peter, ich kann warten. Egal, wie lange es dauert.«
Ein kurzer Laut des Bedauerns. »Evelyn, ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen.«
Sie öffnete den Mund, doch kein Ton kam über ihre Lippen.
»Mir ist etwas dazwischengekommen«, fuhr er fort. »Und es war mir einfach nicht möglich, Sie zu benachrichtigen. Sie ahnen nicht, wie leid mir das tut.«
»Was soll das heißen?«
»Dass ich gar nicht in Hamburg bin, Evelyn.«
Sie war wie vom Donner gerührt. »Was?«
»Es ist mir überaus peinlich.«
»Was soll das heißen?«, fragte sie abermals; ihre Stimme war tonlos, leer.
»Nun ja, im Moment kann ich Ihnen nicht behilflich sein. Aber wer weiß, wie es in einer Woche oder zwei aussieht. Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich etwas Neues weiß.«
Kurz darauf war das Telefonat vorbei, so schnell, dass Evelyn es gar nicht fassen konnte.
Innerhalb von Sekunden stürzte ihre ganze Welt in sich zusammen.
Erneut erklang der Klingelton.
Sie hatte das Telefon noch in der Hand, stand am selben Fleck wie zuvor. Das Display leuchtete auf. Diesmal war es Kai.
Was sollte sie ihm sagen?
5
Der Anblick in der Einöde bei Oberrad ließ Mara Billinsky immer noch nicht los. Auch nach einer Reihe von Dienstjahren konnte sie so etwas nicht einfach abschütteln, egal wie viel Hornhaut das eigene Herz mittlerweile haben mochte.
Sie hatte schlecht geschlafen und war mitten in der Nacht wieder aufgestanden, um die Gesichter der Toten mit einigen Gläsern Donne del Sole und dem Dröhnen von Punkrock aus der Musikanlage zu verjagen. Doch das hatte nicht geklappt, die Eindrücke wurden mit jedem Schluck des samtigen sizilianischen Rotweins nur noch intensiver. Die Wirkung des Alkohols beschwor außerdem Erinnerungen an Carlos Borke herauf – an die kurze Zeit, die ihr gemeinsam mit ihm geschenkt worden war. Verdammter Borke, dachte sie. Warum hatte sie es nur zugelassen, dass er ihr Herz stehlen konnte? Und warum hatte alles auf so schreckliche Art enden müssen?
Inzwischen war es früher Morgen, doch der fehlende Schlaf machte sich kaum bemerkbar. Mara war hellwach, als sie den Flur des Präsidiums hinabeilte. Sie fühlte sich wie angestachelt, regelrecht herausgefordert; sie konnte es nicht abwarten, endlich loszulegen. Denn mit Schreckensbildern wurde man am Ende nur auf eine einzige Art fertig: indem man sich in einen solchen Fall reinwühlte, ihn löste und den oder die Täter dingfest machte.
Ein Blick zur Uhr – die Besprechung würde gleich anfangen. Angespannt fragte sie sich, ob es bereits erste Ergebnisse zu verkünden gab. Die Leichen waren die ganze Nacht lang obduziert worden. Wer waren diese Kinder?, fragte sie sich wohl zum tausendsten Mal, seit die toten Augen sie am Vortag angestarrt hatten. Sieben Kinder. Allein die Anzahl schnürte einem die Kehle zu.
In der Tür des Besprechungsraumes stand Hauptkommissar Klimmt: das schütter werdende Haar verstrubbelt, der Walrossschnurrbart zerzaust, das Kinn unrasiert, die Wangen bleich. Offenbar hatte auch er in der zurückliegenden Nacht kaum Ruhe gefunden, nur dass ihm das mittlerweile äußerlich ziemlich zusetzte.
Er schien in einer gereizten Stimmung zu sein, als er ihr entgegensah, und sie wusste nicht, ob seine schlechte Laune allein mit dem gestrigen Leichenfund oder mal wieder mit ihrer Person zusammenhing. Jedenfalls hielt sie seinem Blick stand, darin war sie schließlich geübt.
»Morgen, Chef.« Sie stoppte abrupt, da er sich nicht von der Stelle rührte, um sie in das Zimmer zu lassen.
»Kleine Planänderung, Billinsky. Ich muss das Team anders einteilen.«
»Ach?« Mara zog eine Augenbraue in die Höhe.
»Schleyer, Patzke und ich: Wir werden uns mit den verscharrten Kindern beschäftigen.«
»Das ist ein schlechter Scherz, oder?« Mit einem Schlag war ihr Ton eisig. »Wollen Sie tatsächlich so weitermachen?«
Er schnaufte genervt. »Was meinen Sie damit?«
»Sie können mich nicht kaltstellen, Sie können mich nicht auf ewig …«
»Niemand will Sie kaltstellen«, fiel er ihr ins Wort. »Sie müssen sich um eine andere Sache kümmern.«
»Ach ja? Was gibt es denn so Dringendes für mich zu tun? Sind wieder einmal aus einem Haus billige Schmuckstücke gestohlen worden?« Damit spielte sie darauf an, dass sie kürzlich von Klimmt für eine Weile zum Einbruchsdezernat abgestellt worden war, um sich mit nicht gerade spektakulären Wohnungseinbrüchen herumzuschlagen.
»Keine Angst, Billinsky«, murmelte Klimmt. »Es geht allem Anschein nach um einen brutalen Mord. Dürfte also ganz nach Ihrem Geschmack sein.«
Sie runzelte die Stirn und musterte ihn misstrauisch, verkniff sich aber eine Antwort.
»Rosen wird Sie unterstützen. Er wartet auf Sie im Büro. Und er kennt die Einzelheiten.« Klimmt verzog die Lippen zu einem säuerlichen Grinsen. »Verlieren Sie keine Zeit.«
»Das tue ich nie – wissen Sie doch«, gab sie bissig zurück.
Ohne ein weiteres Wort drehte sie sich um und marschierte davon. In ihrem Rücken spürte sie Klimmts Blick.
Rosen erwartete Mara am Eingang ihres Großraumbüros und tänzelte nervös von einem Fuß auf den anderen. »Da bist du ja.« Er trug einen Rollkragenpullover in einem derart schillernden Türkiston, dass Mara sich dazu zwingen musste, nicht ständig darauf zu starren.
»Um was handelt es sich, Rosen?«
»Hm, um eine ziemliche blutige Geschichte.« Er griff rasch nach seiner Winterjacke, zog sie an und hielt ihr dann die schwarze Motoradlederjacke hin, die sie selbst bei Minustemperaturen trug – sie gehörte zu Mara wie eine zweite Haut.
Wenig später fuhren sie mit Maras schwarzem Alfa in Richtung Stadtmitte. Rosen versorgte sie mit den wenigen Einzelheiten, die ihm bislang bekannt waren. Wiederum nur kurze Zeit später standen sie nebeneinander in einer Suite des Hotels Frankfurter Hof.
Sie war etwa sechzig Quadratmeter groß und luxuriös eingerichtet im Stil der bekannten Frankfurter Architektin Bergit Gräfin Douglas. Antike Möbel, ein großes Bad aus Marmor mit modernem Flachbildfernseher über der Wanne, ein beeindruckender Ausblick auf die Frankfurter Skyline. Man musste siebenhundert Euro pro Nacht auf den Tisch legen, um es sich hier gemütlich machen zu dürfen. Auch das hatte Rosen Mara mit seiner allseits bekannten Gründlichkeit mitgeteilt.
Das gegenwärtige Bild, das die Suite bot, hatte allerdings nichts mit exklusivem Wohlbehagen zu tun.
Es herrschte Chaos. Grün glitzernde Scherben einer Champagnerflasche, Kaffeemaschine, Teekocher, Papiere, Kleidungsstücke – alles lag wild durcheinander auf dem Boden. Die Ecke, in der sich die Sitzgruppe befand, war gesprenkelt mit Blut. Etliche rote Spritzer auf den umgekippten Stühlen und dem kleinen, ebenfalls umgeworfenen Rundtisch. Mittendrin lag ein Mann auf dem Rücken, die Gliedmaßen von sich gestreckt, den Mund leicht geöffnet. Er hatte schwere Kopfverletzungen erlitten, aus denen eine Menge Blut geströmt und dann im Teppich eingetrocknet war. Direkt daneben befand sich ein Sektkühler aus funkelndem massiven Edelstahl, dessen Oberfläche ebenfalls voller Blut war. Der Teppich darunter war noch ein wenig nass von den geschmolzenen Eiswürfeln.
Die Augen des Mannes starrten leer zur Decke. In ihnen spiegelte sich das blanke Entsetzen wider, das ihn im letzten Moment seines Lebens erfasst hatte.
Also schon wieder ein Bild des Grauens.
Unweigerlich sprangen Maras Gedanken zurück zum Vortag. Was mochten Klimmt und sein Team inzwischen über die verscharrten Kinder wissen?
Die Kollegen von der Spurensicherung begannen in der Suite gerade wortlos und routiniert mit ihrer Arbeit. Uniformierte Polizeibeamte waren ebenfalls vor Ort. Einer von ihnen führte in diesem Augenblick einen Mann um die fünfzig herein: Geheimratsecken, graumeliertes Haar, dunkelblauer Anzug.
Jan Rosen ließ Mara den Vortritt, wie üblich.
»Billinsky, Mordkommission«, sagte sie zu dem Herrn im Anzug.
Gelassen wartete sie ab, bis sein pikierter Blick über ihre pechschwarzen langen Haare, die Piercings an Oberlippe und Braue, die abgewetzte Lederjacke und die knallengen schwarzen Jeans bis zu ihren Doc-Martens-Stiefeln gewandert war – und wieder bei ihren tiefschwarz geschminkten Augen landete, die Menschen mit einer irritierenden Eindringlichkeit ins Visier zu nehmen wussten.
»Sind Sie, äh …«, murmelte der Mann konsterniert, »sind Sie von der Poli…«
»Bin ich«, fiel Mara ihm ins Wort. »Und Sie sind?«
»Der Hoteldirektor. Hildebrandt. Armin Hildebrandt.«
Mara wies zu Rosen. »Mein Kollege: Kommissar Rosen.«
Hildebrandt nickte in dessen Richtung, offenbar ein wenig erleichtert, dass Rosens Anblick seiner Vorstellung von einem Kripobeamten näherkam.
»Wo können wir uns in Ruhe unterhalten?«, fragte Mara.
»In meinem Büro«, erwiderte der Hoteldirektor.
»Gut. Dann warten Sie bitte dort auf uns. Wir möchten erst noch unseren Kollegen ein paar Fragen stellen.«
Etwa eine Viertelstunde später betraten sie das in schlichter Eleganz gehaltene Büro. Hildebrandt stand vor seinem Schreibtisch und sah ihnen entgegen.
»Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen«, eröffnete Jan Rosen das Gespräch.
»Das ist doch selbstverständlich.«
»Wie hieß der Gast, der in der Suite zu Tode kam?«, wollte Mara als Erstes wissen.
»Was für eine Tragödie.« Hildebrandt schüttelte den Kopf. Er war bleich, wirkte allerdings gefasster als bei ihrer ersten Begegnung. »Und das in diesem Haus. Meine Güte. Das ist wirklich …« Seine Stimme versiegte.
»Wie hieß der Mann?«, fragte Mara erneut.
»Reto Botteron.« Hildebrandt blickte stur an ihr vorbei. Er musste wohl immer noch verdauen, dass jemand, der so aussah wie Mara, tatsächlich der Kriminalpolizei angehörte.
»Wie lange war er Gast Ihres Hauses?«
»Seit zwei Tagen. Die Suite war die komplette Woche von Herrn Botteron gebucht.«
»Zum ersten Mal?«
»Nein.« Jetzt sah er Mara kurz an. »Er ist schon häufiger bei uns gewesen.«
»Immer dieselbe Suite?«
»Ja, meistens schon.«
»Ein Franzose?«
»Nein, Schweizer. Aber aus dem französischen Teil des Landes.«
Hildebrandts Augen suchten Jan Rosen, als wäre es ihm lieber, wenn der für ihn offenkundig seriöser wirkende Kommissar die Fragen stellen würde. Doch Mara machte unverdrossen weiter mit ihrem Stakkato. Das war typisch für sie: Es ging ihr nie schnell genug.
»Seine Adresse?«
»Äh, er kam aus Vevey.« Hildebrandt kratzte sich am Kinn. »Ich werde Ihnen alle zu Herrn Botteron gespeicherten Daten zur Verfügung stellen.«
»Besten Dank«, warf Rosen ein, wie gewöhnlich die Höflichkeit in Person.
»Wer hat den Toten gefunden?«, fragte Mara. »Und wann?«
»Eine Mitarbeiterin unseres Reinigungspersonals. Heute Morgen. Sie wollte saubermachen. Normalerweise hatte Herr Botteron das ›Bitte nicht stören‹-Schild an die Tür gehängt, wenn er vormittags in der Suite gewesen war. Das Schild hing nicht, und so …«
»Wie heißt die Frau?«
»Ekatarina Svetlakova. Ich habe sie beruhigt, in ein Nebenzimmer gebracht und gebeten, dort erst einmal zu warten. Sie war sehr aufgeregt, aber ich sagte ihr, Sie würden gewiss mit ihr sprechen wollen.«
»Richtig, das müssen wir unbedingt«, meldete sich Rosen zu Wort. »Danke.«
»Ich nehme an, sie hat zuerst Sie verständigt?«, vermutete Mara.
»Frau Svetlakova? Ja. Ich bin umgehend in die Suite gegangen, um mich selbst zu vergewissern – und habe dann sofort die Polizei angerufen.«
»Welchem Beruf ging Herr Botteron nach?«, folgte rasch Maras nächste Frage.
»Er war ein … Also, ich glaube, er handelte mit Wertpapieren. Mit absoluter Sicherheit kann ich das jedoch nicht sagen … Äh, möchten Sie nicht Platz nehmen?« Er deutete auf die beiden Besuchersessel vor dem Schreibtisch und ließ sich dann in seinen Drehstuhl aus schwarzem Leder sinken. Rosen setzte sich ebenfalls.
Mara jedoch blieb stehen. »Haben Sie sich oft mit Herrn Botteron unterhalten?«
»Ein paar Mal.«
»Um was ging es?«
»Nun ja, um Allgemeines«, antwortete Hildebrandt etwas hilflos. »Das Wetter, Restaurants in Hotelnähe. Ich fragte natürlich, ob er zufrieden mit unserem Service wäre. Solche Sachen eben.«
»Also nichts Privates?«
»Aber nein«, erwiderte der Hoteldirektor. »Der Herr war ein Gast. Was denken Sie, junge Dame?«
»Ich denke noch gar nichts, ich frage bloß.« Mara warf einen beiläufigen Blick aus dem Fenster auf den trüben Frankfurter Himmel. »Nach Angaben unserer Kollegen, die den Leichnam gerade untersuchen, liegt der Todeszeitpunkt wohl mehrere Stunden zurück. Die Leichenstarre hat bereits eingesetzt.«
»Üblicherweise ist sie nach einem Tag stark ausgeprägt«, ergänzte Rosen auf seine verbindliche Art. »Wenn der Tote in einer guten körperlichen Verfassung war, kann das auch früher passieren.«
»Es steht noch nicht fest«, fuhr Mara fort, »aber wir gehen von einem Tatzeitpunkt gestern Abend aus.«
»Aha«, stieß Hildebrandt hervor.
»Auf keinen Fall weit nach Mitternacht.« Mara hob eine Augenbraue. »Wie es in der Suite aussieht, muss es zu einem erheblichen Kampf gekommen sein. Und so etwas findet sicherlich nicht in aller Stille statt.«
Hildebrandt nickte.
»Gab es keine Beschwerden über Krach? Etwa von Bewohnern einer benachbarten Suite. Oder der darunterliegenden Räume?«
»Nein.«
»Das wüssten Sie?«
»Und ob. Das Nachtpersonal ist verpflichtet, mich darüber zu unterrichten. Es gab nichts dergleichen.«
»Wir werden mit allen sprechen müssen, die zu Ihrem Personal gehören. Auf jeden Fall mit allen, die gestern hier waren. Bitte geben Sie uns eine Liste mit den Namen aller Angestellten und den Dienstplan.«
»Natürlich.«
»Mit wem hatte Herr Botteron in den letzten Tagen Kontakt?«, fuhr Mara mit ihren Fragen fort. »Bekam er in den letzten Tagen Besuch in seiner Suite?«
»Ich bitte Sie. Wir überwachen unsere Gäste doch nicht«, antwortete der Hoteldirektor in vorwurfsvollem Ton.
»Wie war es sonst, wenn er hier war? Besuche? Treffen? War er immer allein hier?«
Hildebrandt räusperte sich. »Soweit es mir bekannt ist, hatte Herr Botteron regelmäßig geschäftliche Termine. Allerdings nicht im Hotel. Er war sehr diskret. Und überaus höflich. Ein höchst angenehmer Gast unseres Haues. Umso tragischer ist es, dass …«
»Gestern Abend hatte Herr Botteron aber offensichtlich Besuch hier in Ihrem Hotel. Haben Sie eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte?«
»Gewiss nicht«, gab der Hoteldirektor gepresst zurück. Nicht nur der Tote in der Suite, auch Maras direkte Art schien ihm zu schaffen zu machen.
»Ich gehe davon aus, dass es zumindest im Foyer eine Überwachungskamera gibt.«
»Sicher.«
»Wir müssen die Aufnahmen von gestern sehen. Den kompletten Tag, vierundzwanzig Stunden.«
»Selbstverständlich.« Hildebrandt hob nervös die Hände. »Äh, jetzt hätte ich eine Frage. Wann kann ich die Suite … Also, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte nur wissen, wann wir Herrn Botterons Suite wieder …«
»Wir werden Sie zu gegebener Zeit unterrichten, keine Sorge.« Mara blickte zu Rosen. »Hast du noch was auf dem Herzen?«
Er schüttelte den Kopf.
»Das wär’s für den Moment, Herr Hildebrandt. Aber wir werden Sie nachher erneut brauchen. Bitte kümmern Sie sich darum, dass wir die Aufnahmen ansehen können. Jetzt wollen wir mit Frau Svetlakova sprechen.« Mara sah erneut zu Rosen. »Kannst du das allein übernehmen?«
Verdutzt blickte er auf. »Äh. Ja, klar. Und was machst du?«
»Ich möchte mir noch einmal die Suite ganz genau anschauen.« Mara fuhr sich kurz durch ihr Haar. »Herr Hildebrandt, wo ist das Zimmer, in dem sich Frau Svetlakova aufhält?«
»Im Stockwerk von Herrn Botterons Suite. Am Ende des Flures gibt es eine Tür mit der Aufschrift ›Privat‹.«
»Dann mal los«, meinte Mara.
»Vielen Dank für alles, Herr Hildebrandt«, sagte Rosen und beeilte sich dann, Mara zu folgen, die das Büro schon verlassen hatte und den Flur Richtung Aufzug entlangmarschierte.
»Warum bist du eigentlich immer so?«, fragte er im Gehen.
»Immer wie?«
Der Hall ihrer Schritte wurde von einem dezent gemusterten Teppich geschluckt.
Rosen machte eine vage Geste mit der Hand. »So … kurz angebunden.«
»Weil wir keine Zeit haben.«
»Ich meine auch eher: Warum bist du immer so hart?«
»Hart?«, wiederholte Mara spöttisch.
»Na ja, der Hoteldirektor hat ja nichts getan, und …«
»Ich habe ihm auch nichts getan«, unterbrach sie ihn. »Ich bin nicht hart, sondern nur faktisch.«
»Faktisch?« Seine Stirn kräuselte sich.
»Was dagegen?« Sie betraten den Fahrstuhl, und die Türen schlossen sich. »Hier ist jemand gewaltsam zu Tode gekommen. Ich stelle klare Fragen. Und erwarte klare Antworten. Er ist der Hoteldirektor, kein Angehöriger. Weißt du, Rosen, Samthandschuhe stehen mir einfach nicht.«
»Das ist mir auch schon aufgefallen.« Er schmunzelte.
Die Aufzugtüren schoben sich wieder auf, und die beiden traten in den Korridor.
»Bis gleich, Rosen.« Mara hielt inne. »Und sei nicht zu hart bei der Befragung.« Sie lächelte frech.
Er ging auf die Stichelei nicht ein, sondern fragte: »Warum soll ich’s eigentlich allein machen? Etwa weil du denkst, bei der Frau ergibt sich sowieso nichts Interessantes?«
Doch Mara war schon weitergeeilt. Kurz darauf befand sie sich wieder in der Suite, in der Reto Botteron zu Tode gekommen war. Die Kollegen der Kriminaltechnik waren weiterhin in ihre Arbeit vertieft, ruhig und konzentriert.
Mara stand da und besah sich alles eingehend.
Irgendetwas stimmte hier nicht.
Aber sie kam nicht darauf, was das sein konnte.
Sie zog ihr Smartphone aus der Jackentasche und machte Fotos aus mehreren Perspektiven, obwohl sie wusste, dass sie von den Kollegen bessere Bilder erhalten würde. Anschließend stand sie erneut da, ihre dunklen Augen auf das Szenario des Todes gerichtet. Doch ihr wollte partout nicht einfallen, was genau ihr merkwürdig vorkam.
6
Immer wieder dieser Traum.
Der Junge rücklings auf dem Tisch festgeschnallt. Die runden Augen. Die Angst in ihnen. Und der Mund, der sich zu einem Schrei verzerrte, zu einem verzweifelten Kreischen, das man fühlen, jedoch nicht hören konnte.
Immer wieder dieser Traum. Selbst wenn er nur mal für ein paar kurze Minuten einnickte, den Hinterkopf in den zerschlissenen Kopfkissenbezug gedrückt.
Immer wieder dieser Junge … der allerdings für viele Kinder stand.
Um wach zu bleiben und den Schlaf fernzuhalten, schüttete er Unmengen von Cola in seinen Scotch. Oder er tigerte im Zimmer auf und ab – der schäbigsten, erbärmlichsten Behausung, in die er je einen Fuß gesetzt hatte. Aus dem Flur drangen gelegentlich Stimmen und Schritte gedämpft zu ihm. Jedes Mal, wenn er so etwas hörte, sprang er voller Panik auf oder zuckte beim Gehen nervös zusammen, den Blick auf die Tür gerichtet, als würde gleich ein Sondereinsatzkommando hereinstürmen und sich auf ihn stürzen.
Ein Bett, ein Schrank, ein uraltes Fernsehgerät, dessen Gehäuse mit Klebestreifen zusammengehalten wurde. In der Ecke ein Waschbecken, in das er pinkelte, um das Gemeinschaftsbadezimmer am Ende des Flures so selten wie möglich aufsuchen zu müssen. Genauso hatten es mit Sicherheit vor ihm schon etliche andere Gäste dieser Absteige gemacht. Jedenfalls roch das Waschbecken ekelerregend. Er hätte gern täglich geduscht, wie er es gewohnt war, aber die Nasszellen in diesem Haus waren einfach widerlich.
Von der Frau, die ihn vor Kurzem noch völlig verrückt gemacht hatte, träumte er nicht mehr. Kein einziges Mal. Auch von sonst niemandem – nur von dem Jungen. Erinnerungen an bessere Zeiten umwehten ihn ab und zu wie ein Luftzug, doch lösten sie sich rasch wieder auf. Er hatte alles verloren. Seine Vergangenheit, seine Zukunft. Das Leben war ihm zwischen den Fingern zerronnen.
Manchmal stand er für ein paar Minuten am Fenster, abgeschirmt von der Gardine, um nach draußen auf die Straße zu spähen und das Leben vorbeipulsieren zu lassen. Gegröle von Betrunkenen, Gelächter, Gekeife, die brummenden Motoren der Autos. Alles vermischte sich zu einem ständigen dumpfen Dröhnen. Und wenn er sich wieder auf die durchgelegene Matratze des Bettes fallen ließ, schlich sich von Neuem der Schlaf an, vor dem er sich mittlerweile fürchtete. Denn mit ihm kamen, wie er nur zu gut wusste, die lautlosen Schreie zu ihm zurück.
7
Eine Nacht des Zitterns.
Vor Kälte, vor Furcht.
Sie war siebzehn. Doch es kam ihr vor, als wäre sie uralt. Als hätte sie innerhalb kurzer Zeit so viel gesehen und so viel erlebt, dass ihr Inneres grau und verbraucht geworden war. Sie fühlte sich leer. Sie fühlte sich erschöpft, kraftlos, hoffnungslos. Und sie hatte so stark gefroren wie nie zuvor in ihrem kurzen, langen Leben. Ihre Zähne waren aufeinandergeschlagen; sie hatte es spüren und hören können. Am ganzen Leib hatte sie gezittert.
Diese Nacht würde ihr noch lange in den Knochen stecken. Falls sie denn noch lange zu leben hatte.
Zusammengekauert hatte sie gewartet, Stunde um Stunde, nur schwach verborgen von den kahlen Wintersträuchern, doch zumindest geschützt von der Dunkelheit, in die noch eine ganze Weile die gelben Strahlen der Taschenlampen hineingestoßen waren wie überdimensionierte Messerklingen.
Die menschlichen Bluthunde hatten sie nicht aufspüren können.
Jetzt kroch der Morgen heran, der mit seinem Fächer aus fahlem Licht nach und nach die Trostlosigkeit der Gegend enthüllte.
Shaqayeg spähte vorsichtig zwischen den Zweigen hindurch.
Sie entdeckte das Gebäude, von dem sie weggerannt war, ziemlich weit entfernt am Horizont. Vor Anspannung hatte sie gar nicht bemerkt, wie weit sie gelaufen war.
Shaqayegs steife, kalte Glieder schmerzten, als sie sich aufrichtete. Sie erhob sich vorsichtig, fast zögerlich, als könnte selbst jetzt noch einer der Männer aus dem Nichts auftauchen und sich auf sie stürzen. Ihr Atem tanzte in Wölkchen vor ihrem Gesicht.
Die Helligkeit trieb sie an, Schritt für Schritt. Ihr Magen, der noch in der Nacht häufiger geknurrt hatte, blieb nun still und fühlte sich nur noch merkwürdig taub an. Weiter, immer weiter, ging sie auf die Häuser zu, deren Lichter ihr nachts aufgefallen waren.
Sie hatte sich nicht getäuscht: Es handelte sich um eine kleine Ortschaft. Der erste Orientierungspunkt, den sie wahrnahm, war ein großes Gebäude. Sie ging darauf zu und fand heraus, dass es der Bahnhof des Ortes war. Sie las das Schild, das bei den Gleisen aufgestellt war: Nieder-Roden. Sie vermochte das Wort nicht auszusprechen, aber sie hatte sich in den letzten Wochen mit der deutschen Sprache vertrauter machen können, mit ihrem Klang, ihrer Härte. Manchmal hatten Shaqayegs Bewacher, die Bluthunde, auch auf Englisch miteinander geredet, was sie besser verstand.
Weitere Menschen trafen am Bahnhof ein. Es wurde noch heller, auch wenn der Himmel schwer und trübe über den Dächern hing. Die anderen Leute beachteten sie nur mit einem abwertenden Seitenblick, starrten dann durch sie hindurch, als gäbe es Shaqayeg nicht.
Auf einer digitalen Anzeige wurde eine Bahn angekündigt, die nach Frankfurt am Main fuhr. Diesen Ortsnamen kannte sie nicht nur, sie wusste auch, wie man ihn aussprach.
Die Bahn traf ein. Mit klopfendem Herzen stieg Shaqayeg ein. Sie drückte sich in eine Ecke, stand da und starrte immer wieder in alle Richtungen. Sie kam sich vor wie ein in die Ecke gedrängtes exotisches Tier. Erneut waren die Menschen darauf bedacht, sie zu ignorieren. Erst während der Fahrt kam ihr in den Sinn, dass ein Fahrkartenkontrolleur sie ansprechen könnte. Ein kalter Schreck erfasste sie. Was sollte sie dann tun? Doch es tauchte niemand auf, der ein Ticket verlangte.
Am Hauptbahnhof in Frankfurt, wo die meisten Passagiere ausstiegen, verließ auch Shaqayeg den Waggon. Mitten in der Stadt war sie, vollkommen verloren zwischen all den vorbeihastenden Körpern. Sie ging weiter, langsam, eingeschüchtert, ohne Ziel. Keiner sah sie, keiner nahm auch nur die geringste Notiz von ihr, während sie von den Eindrücken überwältigt wurde. Ihr Blick fiel auf junge Leute, alte Menschen, teuer gekleidete Passanten, arme Schlucker sowie Bettler, die an Hausecken hockten und verkrüppelte Füße präsentierten.
Sie marschierte, bis sie keinen einzigen Schritt mehr gehen konnte und die Erschöpfung wieder so übermächtig wurde wie in der Nacht zuvor. Dann ließ sie sich auf eine Bank sinken und betrachtete im Sitzen den Strom aus Menschen, der an ihr vorüberzog. Ihr Hunger kehrte zurück als kleine, wilde Bestie, die mit spitzen Zähnen in ihre Innereien biss.
Die Stunden verrannen, und sie nickte manchmal ein, ohne es recht zu merken. Dann war sie wieder auf den Beinen, nur um die Kälte in ihr ein wenig zu vertreiben. Sie trank Wasser aus einer Pfütze, ganz flink, damit es niemandem auffiel, aber die Leute starrten ohnehin an ihr vorbei. Später stieß sie auf eine halb volle Cola-Flasche, die auf dem Boden lag. Sie trank sie in einem Zug leer, und der Zucker ließ vor ihren Augen Sternchen aufblitzen, als hätte sie eine Droge zu sich genommen.
Dunkelheit senkte sich schließlich herab, überall stachen die Neonbuchstaben noch intensiver hervor, und der einsamste Tag ihres Lebens neigte sich dem Ende entgegen. Nur ein paar Straßenzüge vom Hauptbahnhof entfernt, zog sie sich in den Hauseingang eines dunklen, hässlichen Baus zurück, wo sie sich auf den kalten Boden setzte und den Rücken gegen die Wand lehnte. Ihr Blick glitt über ihre ausgelatschten Adidas-Sportschuhe, bei denen es sich bestimmt um gefälschte Ware handelte, ihre löchrigen Jeans und ihren altmodischen, abgewetzten Anorak, den sie irgendwo auf der Flucht zugesteckt bekommen hatte.
Shaqayeg meinte Tränen zu spüren, doch es kamen keine. Sie war zu ausgelaugt, um zu weinen. Sie war leer, vollkommen leer.
Zwei Schatten fielen auf sie, die sich kaum vom Rest des ohnehin dunklen Hauseingangs abhoben.
Männer. Nein, Jugendliche. Grinsende Visagen. Kapuzenjacken. Basecaps. Schwere Schnürstiefel. Einer sagte etwas zu ihr. Der andere lachte.
Shaqayeg sah die beiden an. Sie spürte, dass sich etwas in ihr zusammenkrampfte, und sie wusste sofort, was das war. Ein Gefühl, das sie so lange schon begleitete: Angst.
Der Erste näherte sich, trat ihr ansatzlos in den Oberschenkel. Der Schmerz machte sie wacher, klarer. Der halbwüchsige Kerl griff in ihre Jacke, wühlte in der Innentasche, dann in den Hosentaschen.
Doch da gab es nichts, was einen Diebstahl gelohnt hätte.
Shaqayeg dachte schon, sie wäre die beiden gleich los, doch da schob sich die Hand erneut unter ihren Jackenaufschlag. Diesmal, um ihre kleinen Brüste zu betatschen. Erneut ein Kommentar, erneut das hämische Lachen.
Sie nahm all ihren Mut zusammen und spuckte dem Kerl ins Gesicht.
Seine Züge erstarrten. Hasserfüllt glotzte er auf sie herab. Er schnappte sie sich mit festem Griff und zog sie auf die Beine. Dann versetzte er ihr einen Schlag, der sie wieder auf den Boden beförderte. Hilflos sah sie nach oben, direkt in sein Gesicht. Er konnte kaum älter sein als sie, aber er wirkte so hart, so gnadenlos.
Noch einmal trat er zu, jetzt in ihre Seite. Sie schrie auf, schrill und fremd, sodass der Laut ihr selbst durch und durch ging.
Wieder ein Tritt. Gelächter. Wortfetzen.
Aus dem Augenwinkel sah sie im Liegen, dass auf einmal eine dritte Person erschienen war. Noch ein Jugendlicher.
Er sagte etwas zu den beiden anderen, die ihn daraufhin auszulachen schienen.
Und dann kam der erste Schlag – schnell und präzise wie von einer Maschine.
8
Mara Billinsky stand im Frankfurter Nordend am Merianplatz und wurde langsam sauer. Es war morgens, ziemlich frostig, und über den Dächern türmten sich scharfgezackte Wolken.
Mit Mühe und Not hatte sie sich eine Stunde für Rafael Makiadi abgezwackt, und nun ließ er sich nicht sehen. Sie fluchte lautlos in sich hinein und rieb die Hände aneinander, um sie zu wärmen.
Fast den gesamten Vortag hatte sie gemeinsam mit Jan Rosen im Frankfurter Hof verbracht und so viele der Hotelangestellten wie nur möglich befragt. Auch mit Hoteldirektor Hildebrandt hatten sie noch einmal ausführlich gesprochen. Etwas Handfestes war nicht dabei herausgekommen. Reto Botteron schien sich bei jedem seiner Aufenthalte unauffällig verhalten zu haben. Umso mehr galt es dranzubleiben – die ersten achtundvierzig Stunden nach einem Mord wurden als entscheidende Zeitspanne angesehen, um einen Fall mit Erfolg abschließen zu können.
Mit klammen Fingern tippte Mara die zweite WhatsApp an Rafael. Mit der nachdrücklichen Bitte, endlich am Treffpunkt aufzutauchen, da sie nur wenig Zeit hatte und bald ins Büro fahren musste.
Doch erneut keine Reaktion von ihm.
Ihrer beiden Lebenswege hatten sich auf kuriose Weise gekreuzt: Mara hatte dem siebzehnjährigen Rafael dabei geholfen, seine gerade eingeschlagene Laufbahn als Einbrecher aufzugeben, während er sie bei der Aufklärung einer Mordserie mit hilfreichen Tipps unterstützt hatte. Aus anfänglich gegenseitiger Ablehnung war eine Freundschaft geworden.
Inzwischen lebte Rafael in einem Heim. Im Rahmen eines Förderprogramms für straffällig gewordene Jugendliche erhielt er Unterricht, um die größtenteils verpasste Schulzeit nachzuholen. Außerdem bemühte er sich um einen Ausbildungsplatz. Kurve gerade noch gekriegt, könnte man sagen. Mara wusste, was das hieß: Auch sie war einst nur knapp einem Schicksal als Außenseiterin und Kriminelle entgangen.
»Mist«, knurrte sie, als sie von einem Fuß auf den anderen trat. Keine Spur von Rafael. Länger hatten sie sich nicht mehr getroffen, und deshalb hatte Mara die Verabredung unbedingt einhalten wollen. Sie wusste, dass sie zu einer wichtigen Stütze für den Jungen geworden war und er oft ihren Rat suchte. Und nun wurde sie von ihm versetzt.
Schließlich gab sie auf und eilte zu ihrem in der Nähe abgestellten Alfa, um ins Präsidium zu fahren. Dort angekommen, machte sie sich auf den Weg in das Großraumbüro, in dem sie von Jan Rosen erwartet wurde.
»Gut, dass du da bist.« Er winkte sie zu sich und zeigte auf seinen Bildschirm. »Ich wollte dich schon anrufen.«
Mara rollte ihren Stuhl neben seinen und setzte sich.
Auf Rosens Monitor liefen die Aufnahmen der Hotelüberwachungskamera.
»Ich hab schon viereckige Augen«, murmelte er. »Aber es scheint, als hätte es sich gelohnt.« Er kehrte zu einer ganz bestimmten Stelle des Videos zurück.
Mara betrachtete den Bildschirm: das Foyer des Hotels in etwas unscharfem Schwarz-Weiß. Die Überwachungskamera war über der Rezeption angebracht, sodass man alles schräg von oben sah.
»So«, sagte Rosen leise. »Wie du siehst, sind wir jetzt beim Bildmaterial angelangt, das vorgestern, kurz vor zweiundzwanzig Uhr, aufgenommen wurde.« Als wäre es notwendig gewesen, wies sein Zeigefinger auf die eingeblendete Uhrzeit und das Datum.
Die beiden sahen, wie von links ein elegant gekleideter Herr ins Bild trat, bei dem es sich unzweifelhaft um Reto Botteron handelte. Ein zweiter Mann hatte ihn bereits in der Eingangshalle erwartet. Begrüßung per Handschlag, Worte wurden gewechselt. Dann schritten die beiden gemeinsam aus dem Bild.
»Sie gehen nicht Richtung Ausgang«, betonte Rosen, »sondern auf den Fahrstuhl zu.« Nun ließ er die Filmaufnahme rasch vorlaufen. »So.« Beiläufig nahm er einen Schluck Kaffee zu sich. »Und jetzt: kurz vor Mitternacht.« Erneut schnellte sein Zeigefinger unnötigerweise zur Anzeige der Uhrzeit.
Der Mann, der zuvor auf Botteron gewartet hatte, kam mit schnellen Schritten aus Richtung des Lifts ins Bild und hastete an der Rezeption vorbei zum Ausgang.
»Der hat’s ja mächtig eilig«, kommentierte Mara leise.
»Und er trägt eine Aktentasche, die er vorher nicht dabeihatte.«
Maras Augenbrauen zogen sich zusammen. »Weißt du schon irgendetwas über ihn?«
Rosen ließ die Filmaufnahme mit einem Mausklick verschwinden und öffnete eine Bilddatei. »Ich habe sein Gesicht vergrößern lassen und einen Screenshot gemacht. Hier, bitte schön.«
Beide besahen sich einige Sekunden lang schweigend das leicht unscharfe Profilbild eines knapp vierzigjährigen Mannes mit dunklem Kinnbart und sorgfältig kahlrasiertem Kopf.
»Jetzt brauchen wir nur noch den Namen dieses Herrn«, merkte Mara an.
»Ich bleibe dran«, grummelte Rosen. »Gib mir ein bisschen Zeit.«
»Die haben wir nie. Weißt du doch.«
»Besser gesagt, unser Kollege Lischke braucht noch Zeit. Er hat auf seinem Rechner ein spezielles, gerade erst weiterentwickeltes Programm installiert, mit dem er das eingescannte Foto von Unbekannten analysieren kann. Dieses Programm …«
»Schon gut, Rosen, bitte keine ausufernden Details über Computer-Schnickschnack.«
Er schmunzelte. »Übrigens, du bist ja gar nicht neugierig, was die Befragung von Ekaterina Svetlakova ergeben hat.«
»Lass mich raten. Sie hat an Botterons Tür geklopft, und als sie keine Reaktion erhielt, hat sie die Suite betreten. Sie hat den Toten und das Chaos gesehen, hat geschrien und Hildebrandt informiert. Und sie hat nichts angefasst, und ihr ist auch nichts aufgefallen.«
»Richtig geraten«, antwortete Rosen. »Mehr kam nicht heraus. Bei den anderen Angestellten war’s ähnlich. Wenn ich daran denke, wie viel Zeit nutzlos draufgegangen ist, sie alle zu vernehmen.«
»Wie sieht’s in der Online-Welt aus? Hast du da inzwischen mehr über Botteron herausgekriegt?«
Er verzog den Mund. »Nein, immer noch nicht.«
Mara zeigte ihm die Tatortfotos, die sie selbst gemacht hatte. Und sie warf einen weiteren Blick auf die Aufnahmen, die von der Spurensicherung angefertigt worden waren.
»Kommt mir so vor«, sagte Rosen, »als ob du nach irgendetwas suchst.«
»Wenn ich nur wüsste, nach was.«
Maras Handy klingelte. Sie dachte sofort an Rafael, doch im Display erschien Hanno Linsenmeyers Nummer.
»Hanno«, rief sie. »Ist etwas mit Rafael?« Sie entfernte sich einige Meter von Rosen.
»Was soll denn mit ihm sein?«
Hanno war ein in die Jahre gekommener Sozialarbeiter mit einem Herzen so groß wie ganz Hessen. Er hatte Rafael in seinem Hilfsprogramm für Jugendliche untergebracht, die auf die schiefe Bahn geraten waren, und darüber hinaus viel für ihn getan. Und vor Jahren auch Mara zur Seite gestanden, als sie im Leben jeglichen Halt verloren hatte.
»Rafael hat mich heute versetzt«, erklärte Mara. »Wir waren verabredet und … Na ja, er ist nicht …« Sie brach den Satz ab.
»Und deswegen wirst du gleich unruhig?« Hanno lachte sanft. »Cool bleiben, Mara. Nur weil er einmal …«
»Schon gut«, fiel sie ihm ins Wort. »Es liegt mir eben etwas an ihm.« Kaum war ihr diese Äußerung über die Lippen gekommen, wurde ihr bewusst, wie sehr das stimmte. Und dass sie es nie zuvor ausgesprochen hatte.
»Mir auch, Mara. Aber auf ihn ist Verlass, da habe ich keine Zweifel.«
»Er macht sich also weiterhin gut, ja?« Sie sah aus dem Fenster. Ein dichter Schneeregen ließ die Stadt grau und schroff und tot erscheinen.
Hanno lachte erneut. »Klar doch. Zwar hat er manchmal keine Lust aufs Lernen und würde lieber die Sau rauslassen, aber mal ehrlich: Ich bin froh, wie er sich entwickelt.«
»Wer weiß, vielleicht ist er einfach nur verknallt.«
»Wäre ja mal an der Zeit.«
Auch Mara musste lachen. »Wir klingen schon wie Mami und Papi, was?«
»Wir klingen wie die Freunde, die wir für Rafael sind. Übrigens, nicht nur er, sondern auch du kannst stolz sein auf dich. Es war klasse, wie du dich für ihn eingesetzt hast.«
»Hanno, lass lieber das Gesülze«, meinte Mara. »Bei mir zieht das nicht. Weißt du doch. Sag mal, wieso hast du eigentlich angerufen?«
»Ich dachte, wir beide könnten mal wieder zusammen essen gehen. Gern auch mit Rafael. Frankfurter Schnitzel mit Grie Soß’? Wie wär’s?«
»Gute Idee«, stimmte Mara zu. Doch bei dem Stichwort Grüne Soße musste sie wieder an Oberrad und die Felder denken. An das, was man dort gefunden hatte. An die toten Augen der Kinder.
Sie verabredeten sich für kommenden Samstag, und Mara beendete das Gespräch. Als sie sich wieder umdrehte, stand Hauptkommissar Klimmt an ihrem Schreibtisch.
»Gibt’s was?«, erkundigte sie sich mit diesem spitzen Unterton, der sich sofort bei ihr einschlich, wenn sie mit ihm sprach.
»Das frage ich Sie«, gab er zurück. »Die Sache im Hotel. Wer ist der Tote? Irgendwelche Spuren? Verdächtige? Ich erfahre überhaupt nichts.«
»Also, es ist so …«, begann Mara, wurde jedoch sofort von ihm unterbrochen.
»Kommen Sie mit zu mir rüber«, beschied er ihr. »Da können wir uns in Ruhe unterhalten.« Er deutete auf Schleyer und Stanko, die an ihren Schreibtischen im selben Büro saßen und in Telefonate vertieft waren.
»Soll ich auch dabei sein?«, erkundigte sich Rosen.
»Machen Sie ruhig weiter.« Klimmt beachtete ihn kaum. Wie üblich.
Mara folgte ihrem Chef und starrte dabei auf sein breites Kreuz und seinen Stiernacken. Seit über zwölf Jahren lag die Hauptverantwortung in der Abteilung bei ihm. Eine Zeit, die nicht spurlos an ihm vorübergegangen war. Er war schneller gereizt, schneller müde, schneller krank und schneller auf Streit aus als früher. Und noch immer schonte er sich nicht im Geringsten – ein Bulle durch und durch. Warum nur, fragte sich Mara, schaffen wir es einfach nicht, uns zusammenzuraufen?
Er ließ sich schwer in seinen Drehstuhl fallen, und Mara schloss die Tür. Vor seinem Schreibtisch blieb sie stehen: allein schon deshalb, weil sie wusste, wie sehr es ihm auf die Nerven ging, dass sie sich nicht setzte und er zu ihr nach oben sehen musste. Sie konnte einfach nicht anders.
»Dann legen Sie mal los«, forderte Klimmt sie auf.
»Der Getötete hieß Reto Botteron. Geboren und wohnhaft in Vevey, französische Schweiz. Siebenundvierzig Jahre alt. Schweizer Staatsbürger, schätzen wir.«
»Schätzen Sie?«, blaffte Klimmt.
»Herr Botteron hat es vortrefflich verstanden, kaum Spuren zu hinterlassen. Auch in der virtuellen Welt. Er hat sich als Wertpapierhändler ausgegeben, und dieser Betätigung ist er auch zeitweise nachgegangen. Aber er hatte wohl weitere Einnahmequellen.«
»Klingt ja alles recht dünn.« Klimmt schob sich eine Zigarette zwischen die Lippen. Dass im gesamten Gebäudekomplex Rauchverbot herrschte, hatte ihn nie gekümmert. »Also, Billinsky, was ist da los gewesen, in diesem verdammten Hotelzimmer?«