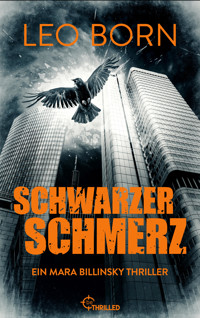19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Thriller und Krimis von beTHRILLED als XXL-Sammelbände für extra viel Spannung
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die ersten drei Fälle für die unverwechselbare Frankfurter Kommissarin Mara Billinsky - düster, atmosphärisch und hochspannend!
Blinde Rache: Tattoos, schwarze Kleidung, raue Schale: Mara Billinsky eckt an. Auch bei ihren neuen Kollegen in der Frankfurter Mordkommission, von denen sie nur "die Krähe" genannt wird. Niemand traut Mara den Job wirklich zu, schon gar nicht ihr Chef, der sie lieber auf Wohnungseinbrüche ansetzt. Aber dann erschüttert eine brutale Mordserie die Mainmetropole. Mara sieht ihre Chance gekommen. Sie will beweisen, was in ihr steckt. Auf eigene Faust beginnt sie zu ermitteln - und kommt dem Täter dabei tödlich nah ...
Lautlose Schreie: An einem eiskalten Morgen auf einem Feld nahe Frankfurt macht die Polizei eine grausame Entdeckung: Die Leichen von sieben Kindern. Und die Opfer müssen vor ihrem Tod ein furchtbares Martyrium durchgemacht haben. Darauf deuten frische Operationsnarben an ihren Körpern hin. Mara Billinsky ist zutiefst erschüttert - und zugleich fest entschlossen. Sie will den Täter um jeden Preis fassen. Dabei verärgert sie mit ihren eigenwilligen Ermittlungsmethoden und ihrer sturen Art nicht nur ihren Chef - sondern auch den neuen Staatsanwalt. Doch die "Krähe", wie Mara von ihren Kollegen genannt wird, bleibt hartnäckig und kommt so einem Verbrechen auf die Spur, dessen Ausmaße sie fassungslos machen ...
Brennende Narben: Die Vergangenheit lässt Kommissarin Mara Billinsky keine Ruhe: Sie will endlich die Mörder ihrer Mutter zur Rechenschaft ziehen. Und auch im Job findet Mara keine ruhige Minute. Eine bestialisch ermordete Edel-Prostituierte und ein Bombenanschlag auf der Autobahn halten die gesamte Frankfurter Mordkommission in Atem. Doch plötzlich wird aus der Jägerin die Gejagte, als ein geheimnisvoller Anrufer die Kommissarin warnt, dass der "Wolf" in der Stadt ist und sie im Visier hat! Als Mara endlich erkennt, dass sie und ihre Kollegen nur Spielfiguren in einem kaltblütigen Krieg sind, ist es für "die Krähe" fast zu spät ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1537
Ähnliche
Inhalt
CoverGrußwort des VerlagsÜber dieses BuchTitelBlinde RacheTeil 1: Krähenflug1234567891011121314151617181920Teil 2: Krähenwut21222324252627282930313233343536373839Teil 3: Krähenmut4041424344454647484950515253545556575859606162636465Lautlose SchreieTeil 1: Kinderaugen123456789101112131415161718192021Teil 2: Blutroter Winter22232425262728293031323334353637Teil 3: Ein Stück Leben383940414243444546474849505152Teil 4: Am Abgrund53545556575859606162636465666768Brennende NarbenTeil 1: Der Biss der Ratte1234567891011121314151617Teil 2: Die Beute des Wolfs1819202122232425262728293031323334Teil 3: Das Geheimnis des Schwans353637383940414243444546474849Teil 4: Das Gespür der Krähe505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879Über den AutorWeitere Titel des AutorsImpressumLiebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Blinde Rache
Tattoos, schwarze Kleidung, raue Schale: Mara Billinsky eckt an. Auch bei ihren neuen Kollegen in der Frankfurter Mordkommission, von denen sie nur »die Krähe« genannt wird. Niemand traut Mara den Job wirklich zu, schon gar nicht ihr Chef, der sie lieber auf Wohnungseinbrüche ansetzt. Aber dann erschüttert eine brutale Mordserie die Mainmetropole. Mara sieht ihre Chance gekommen. Sie will beweisen, was in ihr steckt. Auf eigene Faust beginnt sie zu ermitteln - und kommt dem Täter dabei tödlich nah …
Lautlose Schreie
An einem eiskalten Morgen auf einem Feld nahe Frankfurt macht die Polizei eine grausame Entdeckung: Die Leichen von sieben Kindern. Und die Opfer müssen vor ihrem Tod ein furchtbares Martyrium durchgemacht haben. Darauf deuten frische Operationsnarben an ihren Körpern hin. Mara Billinsky ist zutiefst erschüttert - und zugleich fest entschlossen. Sie will den Täter um jeden Preis fassen. Dabei verärgert sie mit ihren eigenwilligen Ermittlungsmethoden und ihrer sturen Art nicht nur ihren Chef - sondern auch den neuen Staatsanwalt. Doch die »Krähe«, wie Mara von ihren Kollegen genannt wird, bleibt hartnäckig und kommt so einem Verbrechen auf die Spur, dessen Ausmaße sie fassungslos machen …
Brennende Narben
Die Vergangenheit lässt Kommissarin Mara Billinsky keine Ruhe: Sie will endlich die Mörder ihrer Mutter zur Rechenschaft ziehen. Und auch im Job findet Mara keine ruhige Minute. Eine bestialisch ermordete Edel-Prostituierte und ein Bombenanschlag auf der Autobahn halten die gesamte Frankfurter Mordkommission in Atem. Doch plötzlich wird aus der Jägerin die Gejagte, als ein geheimnisvoller Anrufer die Kommissarin warnt, dass der »Wolf« in der Stadt ist und sie im Visier hat! Als Mara endlich erkennt, dass sie und ihre Kollegen nur Spielfiguren in einem kaltblütigen Krieg sind, ist es für »die Krähe« fast zu spät …
Leo Born
Blinde Rache – Lautlose Schreie – Brennende Narben
Drei packende Thriller mit Mara Billinsky in einem eBook
Leo Born
Blinde Rache
Ein Mara Billinsky Thriller
Teil 1
Krähenflug
1
Seine beiden Bodyguards saßen schon seit einiger Zeit im Auto vor dem Haus. Und von der hübschen Dunkelhaarigen war nur noch ein Hauch ihres schweren Parfüms übrig geblieben. Zwei Stunden hatte er sich mit ihr vergnügt, dann hatte er sie wieder gehen lassen. Nicht ohne ihr ein großzügiges Bündel Scheine in die Hand gedrückt zu haben. Warum auch nicht, sie gefiel ihm immer noch. Selbst nach mehreren Monaten wurde er ihr keineswegs überdrüssig – was untypisch für ihn war.
Nun war er allein.
Ivo Karevic genoss es, am Ende des Tages keinen Menschen mehr um sich zu haben, nichts als den seidenen Hausmantel zu tragen, den er sich in Moskau besorgt hatte, und barfuß über die neuen tiefen Teppiche in diesem erst vor Kurzem angeschafften Haus zu gehen. Ein goldener Käfig, den er sich mit Bedacht errichtet hatte, ein Ort des Rückzugs, den niemand betreten durfte außer seiner Leibgarde, seinen engsten Vertrauten und den Frauen, die er sich gönnte und von denen seine Gefolgsleute einen schier unerschöpflichen Vorrat zur Verfügung stellen konnten.
Die Ruhe, die Sicherheit. Hier konnte Karevic sich fallen lassen, für eine ganze Nacht oder nur für ein paar Stunden, Kraft schöpfen, sich entspannen.
Ein Geräusch ließ ihn aufsehen.
Er starrte in das riesige Wohnzimmer, in dem Glas, dunkles Leder und blitzendes Chrom dominierten.
Nein, da war nichts, er musste sich getäuscht haben.
Langsam erhob er sich aus dem Sessel, um sich an der Bar einen Whisky einzuschenken. Selten trank er Alkohol, er rauchte nicht, nahm keine Drogen, schließlich war er ein Mann, der sich unter Kontrolle haben musste. Heute jedoch ließ er sich den vierundzwanzig Jahre alten Malt besonders schmecken. Es lief ja auch alles bestens. Er hatte ein wichtiges Geschäft auf den Weg gebracht, das ihm mit überschaubarem Aufwand eine enorme Menge Geld einbringen würde.
Ja, es lief hervorragend. In Ruhe durchatmen und morgen Abend alles unter Dach und Fach bringen.
Wieder – ein Geräusch.
Ein Knacken, ein … Was war das?
Karevic stellte den Whisky auf dem Glastisch ab. Mit einem Mal vollkommen konzentriert, bewegte er sich lautlos über den Teppich und blickte den langen Flur hinab, der zu seinem Schlafzimmer und weiteren Räumen führte.
Alles still.
Ein Stück weit folgte er dem Gang, vorbei an einer Tür, hinter der sich ein begehbarer Kleiderschrank verbarg, dann hielt er inne.
Immer noch – Totenstille.
Karevic winkte lässig ab. Ein Schmunzeln umspielte seine Mundwinkel. Was ist los mit dir?, fragte er sich stumm. Wirst du alt?
Er drehte sich um und nahm wieder Kurs aufs Wohnzimmer. Mit den Gedanken war er erneut bei dem morgigen Treffen, als die Tür zu dem Schrank aufsprang.
Noch ehe er wusste, was geschah, spürte er einen Schmerz im Arm. Eine jähe Hitze durchfuhr ihn, jede Faser seines Körpers, rasend schnell. Er fühlte ein Brennen, alles in ihm loderte, dann wurde es schwarz um ihn.
Als er die Augen aufschlug, glomm noch immer die Hitze unter seiner Haut, hatte jedoch nachgelassen. Er blinzelte und brauchte einige Zeit, um sich zurechtzufinden.
Er befand sich wieder im Wohnzimmer. Der Seidenmantel war verschwunden, Karevic war jetzt nackt. Bäuchlings hatte man ihn auf einen der Ledersessel verfrachtet. Seine Arme umschlossen die Rückenlehne, auf der sein Kinn ruhte. Die Handgelenke waren gefesselt – mit einem Kabel, wie er feststellen konnte, als er mühsam über die Lehne hinweg nach unten spähte. Sein Mund war geknebelt. Um seine Hüfte und die Sessellehne spannte sich eine Kette, die ihm kalt in die Haut schnitt. Der linke Oberarm tat weh – man hatte ihn allem Anschein nach mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt.
Wie lange mochte er besinnungslos gewesen sein?
Karevic schnaufte, sein Speichel tränkte den Stoff des Knebels. Erst jetzt, ganz langsam, stieg Wut in ihm auf. Eine gewaltige Wut, fast so stark wie die Hitze von vorhin.
Wer war derart dreist, ihm das anzutun? Wer war so verrückt, ihm das anzutun?
Er drehte den Kopf nach links – niemand da. Dann nach rechts. Zwei Augen starrten ihn an, zwei Augen, die ihn schon einmal betrachtet hatten, er erinnerte sich sofort.
»Was soll das?«, entfuhr es ihm völlig verblüfft. Doch der fest verschnürte Knebel machte aus den Worten nur einen einzigen unverständlichen Laut.
In den Augen schimmerte eine Kälte auf, die ihn im Innersten traf.
Viele Menschen hatte er in seine Gewalt gebracht, sehr viele. Was hatte ihn ihr jämmerliches Winseln angewidert, ihre Feigheit, ihr Zittern. Und immer war ihm klar gewesen, dass ein solches Ende auch auf ihn warten konnte. Nie hatte er Furcht verspürt – oder auch nur für möglich gehalten, dass er Furcht haben würde. Jetzt allerdings kroch sie durch seine Eingeweide, schwamm sie in seinem Blut: nackte Angst. Todesangst.
Die beiden kalten Augen behielten ihn unentwegt im Blick. Hilflos starrte er in das Gesicht, in dem sich nichts regte. Nichts außer einem schmalen Lächeln.
Karevic schrie auf, voller Angst, Zorn, Hilflosigkeit, Ungläubigkeit. Doch erneut wurde seine Stimme von dem Knebel verschluckt. Er klang so erbärmlich wie all die Opfer, die er immer verachtet hatte. Schweiß strömte ihm aus den Poren, in Sekundenbruchteilen war er klatschnass.
Sein Blick erfasste einen Totschläger, der lässig von einer Hand gehalten wurde.
Er schloss die Augen.
»Sie werden sterben«, drang eine Stimme leise zu ihm. »Aber wie haben Sie es einmal so schön ausgedrückt? Der Tod ist etwas Außergewöhnliches. Man erlebt ihn nur ein einziges Mal, und deshalb sollte man ihn sehr lange genießen dürfen.«
Noch einmal sah Ivo Karevic auf.
Sie waren so unglaublich kalt, diese Augen, die ihn anstarrten.
Eiskalt.
2
In Momenten wie diesem mochte sie Frankfurt am meisten. Wenn die Nacht erstarb und der Morgen langsam und fahl heraufzog. Sie stand auf der Fußgängerbrücke, die Eiserner Steg genannt wurde. Das Licht der Bankentürme spiegelte sich im noch dunklen Wasser des Mains, der besonders eindringlich seinen Geruch verströmte. Ein herbstlicher Wind rauschte heran und ließ sie frösteln.
Das war Frankfurt, ihr Frankfurt, rau, schroff, herausfordernd, und jetzt war sie wieder hier. Mara Billinsky verschränkte die Arme vor der Brust, um sich vor der kühlen Luft zu schützen. Sie ließ den Anblick noch ein wenig länger auf sich wirken – die Atmosphäre erinnerte sie an früher. Sie hatte seit einiger Zeit dafür gekämpft, von Düsseldorf zurück in ihre Heimatstadt versetzt zu werden, und nun war sie fest entschlossen, auch etwas daraus zu machen.
»Willkommen zu Hause«, flüsterte sie sich selbst zu, fast unhörbar leise, ein schmales Lächeln auf den Lippen.
Noch knappe drei Stunden blieben Mara, bis ihr Dienst beginnen würde. Ihr erster Tag an der alten und zugleich neuen Wirkungsstätte. Die meisten Menschen hätten wahrscheinlich darauf geachtet, so viel Schlaf wie nur möglich zu finden, um bestens ausgeruht zu sein. Aber Mara war nie wie die meisten gewesen. Und die Nacht hatte sie immer als eine Verbündete gesehen, sie brauchte nicht viel Schlaf, ganz und gar nicht, sie war versessen darauf, wach zu sein. Versessen darauf, endlich anfangen zu können. Hier, in ihrer Stadt.
In den zurückliegenden Stunden war sie bei einem Punkrockkonzert in einem kleinen, engen Kellerclub auf der anderen Flussseite gewesen, hatte die alten Zeiten aufleben lassen, anschließend weitere Clubs besucht und sogar einige vertraute Gesichter entdeckt, jedoch mit niemandem gesprochen. Es war ihr Rendezvous, ihr Wiedersehen mit Frankfurt, da durfte keiner stören. Sie hatte nur zwei Gläser Rotwein und ansonsten ausschließlich Cola getrunken, um ihre Sinne wach zu halten. So war die Zeit vorübergeflogen. Es war eine schöne Nacht gewesen.
Trotz der deutlich spürbaren Kälte verzichtete Mara auf eine Taxifahrt. Sie legte den ganzen Weg zu ihrer kleinen Wohnung zu Fuß zurück, nahm eine Dusche, trank schwarzen Kaffee. Dazu ließ sie Musik laufen, zu laut für die Tageszeit. Metallica, Social Distortion, Pearl Jam, Songs voll unbändiger Energie, die ihr Kraft geben sollten. Gewiss würden sich bald die ersten Nachbarn beschweren.
Pünktlich erschien sie im Präsidium, in diesem riesenhaften sechsgeschossigen Gebäudekomplex, der im trüben Licht des Morgens, umgeben von Nebel, wie eine Kriegsfestung wirkte.
Sie fühlte sich bereit – für alles, was kommen mochte.
Kaum etwas hatte sich verändert. Einige der Drucke in den schmucklosen, billigen Rahmen waren noch dieselben, obwohl vier Jahre vergangen waren. Es roch sogar noch so, wie Mara es in Erinnerung hatte: nach Putzmitteln, nach dem abgewetzten Kunststoffboden, nach harter Polizeiarbeit und schlechtem Kaffee, nach Routine, nach jäh ausbrechenden Stresssituationen. Nach Schwerverbrechen. Nach dem Schweiß von Menschen, die hier an einem entscheidenden Punkt ihres Lebens angelangt waren.
Das war genau der Ort, an den sie ihrer Meinung nach gehörte.
Also los, sagte sie sich und betrachtete alles mit entschlossener Miene.
Das übliche Alltagsdurcheinander nahm langsam Gestalt an. Zivile wie auch uniformierte Beamte passierten Mara, dampfende Becher in der Hand, vertieft in Gespräche. Telefone klingelten, Türen fielen ins Schloss.
Blicke blieben an ihr hängen. Sie erkannte verschiedene Leute wieder, aber auch Fremde musterten sie eingehend. Mit Sicherheit hatte sich herumgesprochen, dass eine frühere Kollegin die offene Stelle in der Mordkommission besetzen würde. Und auch, um wen genau es sich dabei handelte: Mara hatte sich hier während ihrer ersten Jahre als Kriminalpolizistin nicht gerade viele Freunde gemacht.
Sie bog in den nächsten Gang und betrat ein Großraumbüro, in dem sechs Schreibtische paarweise einander gegenüber angeordnet waren. Nur an einem davon saß jemand, es war ja noch recht früh: ein Beamter in ihrem Alter, um die dreißig. Sie spürte, wie sein Blick vom Kopf bis zu den Füßen an ihr herabwanderte. Und gleich wieder hinauf: von den schwarzen Doc-Martens-Schnürstiefeln über die knallenge schwarze Jeans und die schwarze, etwas zu große Motorradlederjacke bis hin zu den glatten, tiefschwarz gefärbten Haaren, die ihr auf die Schultern fielen – und durch den hellen Teint noch dunkler wirkten.
»Äh, guten Morgen«, sagte der Mann.
Mara nickte ihm nur kurz zu, um sich dann im Büro umzusehen.
Er stand auf. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Das Gegenteil ist der Fall«, erwiderte sie. »Ich soll euch helfen.«
»Ach?«, entfuhr es ihm verblüfft.
Offenbar hatte man ihn nicht eingeweiht. Aus den Augenwinkeln bemerkte sie, wie er ihre Piercings an Oberlippe und Braue begutachtete.
»Sie sind die neue … Kollegin?« Er hatte es endlich begriffen und wirkte noch verdutzter.
Erst jetzt musterte Mara ihn eingehender. Er trug teure, blitzsaubere Halbschuhe, eine graue Stoffhose und einen V-Pullover in einem scheußlichen Fliederfarbton. Rundes Gesicht, schütter werdendes blondes Haar, mittelgroße, schlanke Gestalt. Er erweckte nicht gerade den Eindruck, ein Teufelskerl zu sein.
Mara streckte ihm die Hand hin, und er ergriff sie zögerlich.
»Mara Billinsky.«
»Äh. Jan Rosen.«
Ganz kurz senkte er verlegen die Lider, als ihn ihre von schwarzem Kajal umrahmten Augen erfassten.
»Keine Sorge«, meinte sie, »ich bin es gewohnt, dass die Leute mich nicht für einen Bullen halten.«
Er deutete auf den Platz gegenüber seinem eigenen. »Das ist Ihrer.«
»Okay.« Sie legte ihre beutelförmige schwarze Ledertasche auf dem Schreibtisch ab und schob auch ihr Hinterteil darauf.
Nachdem Jan Rosen noch ein paar Sekunden ratlos auf der Stelle gestanden hatte, ließ er sich wieder auf seinem Drehstuhl nieder.
»Willkommen zurück«, tönte es auf einmal nicht sonderlich herzlich durch das Büro.
Hauptkommissar Rainer Klimmt kam auf Mara zu. Er war damals ihr Chef gewesen – und jetzt war er es erneut. Wie sie mitbekommen hatte, war er alles andere als begeistert über ihre Rückkehr. Ob er auch gezielt dagegen opponiert hatte, wusste sie allerdings nicht.
Ein Händedruck, kürzer und fester als der von Rosen. Um Klimmts stechende Augen hatten sich zahlreiche Falten eingegraben, seit sie sich zuletzt gesehen hatten.
Sie taxierten sich für einen langen Moment, ehe Klimmt sagte: »Ich werde nachher mit Ihnen die Runde machen und Sie allen vorstellen.«
Mara nickte.
»Und jetzt können Sie erst mal in Ruhe ankommen, sich ein bisschen umsehen.«
»Ruhe brauche ich nicht.« Ein leichtes Grinsen huschte über Maras Gesicht. »Und den Laden hier kenne ich ja schon.«
Klimmt seufzte kaum hörbar. »Na gut, Billinsky, kommen Sie mit in mein Büro.« Er warf dem anderen Beamten einen flüchtigen Blick zu. »Hey, Rosen, stellen Sie für Ihre neue Kollegin ein Dossier zusammen.«
»Dossier? Was für eins?«
»Die Langfingersachen.«
Klimmt marschierte los, Mara folgte ihm.
»Langfingersachen?«, wiederholte sie skeptisch.
»Eine Serie von Wohnungseinbrüchen«, entgegnete er beim Gehen, den Blick nach vorn gerichtet.
»Was wurde gestohlen?«
»Alles Mögliche. Bargeld, Uhren, Schmuck, Laptops, das Übliche halt.«
»Kam es dabei zu Gewalttaten?«
»Eigentlich nicht.«
Klimmt hatte noch immer die untersetzte Figur und den starken, breiten Nacken, der einiges einzustecken vermochte. Doch er war fülliger geworden, sein graues Haar hatte sich gelichtet, die Haut am Hinterkopf schimmerte durch. Mara war früher mehr als einmal mit ihm aneinandergeraten, und sie schärfte sich ein, darauf zu achten, dass es nicht schon in den ersten Tagen zum Zusammenstoß kam.
In seinem Büro schloss er die Tür, nachdem auch sie hereingekommen war.
»Wohnungseinbrüche?« Mara zog eine Augenbraue in die Höhe. »Ich dachte, ich wäre bei der Mordkommission.«
Klimmt ließ sich in seinen Stuhl fallen und deutete beiläufig auf den anderen Platz. »Die Kollegen sind unterbesetzt. Man hat mich um Unterstützung gebeten.«
»Klingt ja großartig.« Mara verzog den Mund. Sie setzte sich nicht.
Er wollte etwas erwidern, doch ein Summen kam ihm zuvor. Rasch zog er sein Handy aus der Hosentasche. Beim Blick aufs Display zeigte sich Überraschung auf seinem Gesicht. Oder Widerwille. Oder beides.
»Hallo? Sind Sie das, Borke? Hatten wir nicht vereinbart, dass Sie mich nicht …« Klimmt ließ den Satz unvollendet und hörte jetzt mit mürrisch gerunzelter Stirn zu.
Mit einer nachdrücklichen Handbewegung wies er Mara an, ihn allein zu lassen.
Sie verließ das Büro – und war ziemlich bedient. Erst die komische Sache mit den Einbrüchen, die ihr nicht passte, und jetzt wurde sie einfach abserviert.
Großartig, sagte sie sich, das ist ja ein richtiger Superstart.
3
In den Straßen und auf den Bürgersteigen herrschte der übliche Trubel. Touristen und Dealer, Spießer und Junggesellenabschiede. Carlos Borke ließ sich von der Menge treiben. Überall erklangen Stimmen, Gegröle und Gelächter. Dazu wummerten die Beats der Musik, die aus den Gebäuden nach draußen quoll. Der Herzschlag dieser Stadt war ein dumpfes Trommeln.
Ab und zu streiften ihn Blicke, grüßten nickende Köpfe in seine Richtung. Borke war ein Teil dieser Welt, er kannte jeden Mülleimer, jeden Laternenpfahl, die ganze Gegend war ihm so vertraut, dass er sie auch mit verbundenen Augen hätte durchqueren können.
Bis zu dem Treffen blieb ihm noch Zeit. Er war gern sehr früh dran, um die Lage zu peilen und die Sinne zu schärfen, erst recht, da er nicht die geringste Ahnung hatte, was sie von ihm wollten.
Rasch hatte sich die Dunkelheit über Frankfurt ausgebreitet. Sternenglitzer zerschnitt den Nebel in viele kleine Fetzen, die über den Dächern schwebten.
Weiterhin ließ Borke sich vom Gewimmel tragen, mied von jetzt an aber sorgsam Gestalten, die ihm bekannt vorkamen. Er trug einen knielangen Ledermantel im Vintagelook, Jeans und spitz zulaufende, knöchelhohe Stiefel. Und über dem kahl rasierten Schädel eine seiner etlichen Wollmützen, auf die er auch bei Sommerhitze nicht verzichtete. Nach einigen Minuten erreichte er den Treffpunkt, eine kleine, auf den ersten Blick völlig unscheinbare, leicht heruntergekommene Bierkneipe an der Ecke.
In Wirklichkeit war Henry’s Pinte jedoch eine wichtige Anlaufstelle im Bahnhofsviertel. Hier wurden keine Drogen, Waffen oder Edelsteine unter den Tischplatten weitergereicht, niemals, hier wurde mit etwas gehandelt, das ebenso wertvoll sein konnte: mit Gerüchten. Es wurden Neuigkeiten verbreitet, Unstimmigkeiten ausgeräumt, Warnungen ausgesprochen.
Carlos Borke beobachtete den Eingang von Henry’s Pinte eine ganze Weile, ehe er die Kneipe betrat. Fünfzig bis sechzig enge Quadratmeter, deren Zentrum von einem Vierecktresen eingenommen wurde, rechts und links davon Nischen, in denen man zu viert sitzen konnte. Erstaunt stellte Borke fest, dass er trotz seines überpünktlichen Erscheinens bereits erwartet wurde.
In der hintersten der rechts gelegenen Nischen saßen zwei Männer nebeneinander, Rücken an der Wand. Sie sahen ihm entgegen. Ohne ihnen je zuvor begegnet zu sein, wusste er sofort, dass sie seine Verabredung waren.
Er nahm ihnen gegenüber Platz.
Vor jedem von ihnen standen eine Espressotasse und ein Wasserglas. Sie waren mit eleganten Anzügen bekleidet. Schwarze, kurz geschnittene Haare, glatt rasierte Gesichter, die keinerlei Emotionen verrieten. Aufmerksam tasteten sie ihn mit ihren Blicken ab. Niemand äußerte einen Ton, Sekunden verstrichen.
Die Bedienung tauchte auf, Borke bestellte ebenfalls einen Espresso. Und erst als er sein Getränk erhalten hatte, machte einer der beiden Fremden den Mund auf: »Es läuft nicht.«
Ganz ruhig, fast beiläufig waren die Worte ausgesprochen worden.
Borke strich sich über das winzige Spitzbärtchen, das er sich direkt unter der Unterlippe stehen ließ, eine gewohnheitsmäßige Bewegung. »Was läuft nicht?«
Die Männer grinsten.
»Was schon? Dein Geschäft.«
Er lachte auf, machte eine flüchtige Geste mit der Hand, die Gelassenheit demonstrieren sollte. Er merkte, dass sich Nervosität in ihm ausbreitete. »Mein Geschäft? Euer Geschäft, meinst du wohl.«
»Du hast es in die Wege geleitet.«
»Ich habe einen Kontakt hergestellt. Und basta. Ab jetzt geht mich das nichts mehr an. Ab jetzt ist das euer Spiel.«
»Richtig. Den Kontakt hergestellt«, wiederholte der Mann, der etwa Mitte vierzig war, während der zweite, der unerschütterlich schwieg, höchstens Ende zwanzig sein konnte. Bei ihm handelte es sich um einen richtigen Schrank. Breite Schultern, riesenhafte Hände, er war bestimmt über eins neunzig.
»Und für den Kontakt hast du ja auch dein Geld bekommen«, fügte der Ältere hinzu.
»Na klar. So war es abgemacht.« Unter seiner Mütze begann Borke zu schwitzen, was nicht an der stickigen Wärme lag, und er hoffte, sie würden es nicht bemerken. Dieses Gespräch nahm einen merkwürdigen Verlauf, er musste hellwach sein, jede einzelne seiner Silben abwägen. Was ist hier los?, fragte er sich alarmiert.
»Richtig«, sagte der Mann im exakt gleichen Tonfall wie zuvor. »So war es abgemacht.« Er machte eine Pause. »Nur dass der Kontakt nicht mehr da ist.«
Borke straffte sich. »Was soll das heißen? Nicht mehr da? Ihr habt doch mit der anderen Seite bereits gesprochen.«
»Richtig. Haben wir.«
»Wo ist dann das Problem?«
»Du hörst nicht zu. Der Kontakt ist nicht mehr da.«
»Und was soll ich …?«
»Du sollst den Kontakt wiederherstellen«, unterbrach ihn der Mann.
»Aber das kann ich nicht. Ich habe …«
»Doch du kannst.«
»Ich bin raus aus dem Geschäft«, beharrte Borke. Sie würden doch nicht versuchen, ihn sich vorzuknöpfen? Hier in Henry’s Pinte? Das war neutraler Boden im Viertel, hier floss nie Blut. Bisher jedenfalls.
»Nein, du bist nicht raus.« Der Mann verzog den Mund zu einem teuflischen Grinsen. »Sieh mal unter dem Tisch nach.«
»Was?«
»Na los!«
Borke spähte unter die Tischplatte. Der größere der beiden Fremden hielt in der Hand eine Gartenschere. Eine ganz gewöhnliche, wie man sie in jedem Baumarkt fand.
Langsam richtete Borke sich wieder auf. »Und? Wollt ihr einen Kleingärtnerverein gründen?«, brachte er fertig zu sagen.
»Mein Begleiter wird dir einen Finger abschneiden«, erwiderte der Ältere ungerührt. »Dann den nächsten. Und so weiter. So lange, bis du den Kontakt wiederhergestellt hast.«
Irgendwie gelang es Borke, seine Stimme halbwegs unbeeindruckt klingen zu lassen. »Aber das kann ich wirklich nicht. Glaubt ihr, ich habe eine Brieffreundschaft mit der anderen Seite? Oder dass die mir ihre Visitenkarten zugesteckt haben?«
»Nach den Fingern geht es mit den Zehen weiter. Oder mit anderen Dingen, die mein Begleiter an dir entdeckt.« Der Mann ließ die Worte wirken, ehe er fortfuhr: »Nun kannst du gehen. Deinen Espresso übernehmen wir.«
Carlos Borke erhob sich. Ohne noch etwas zu äußern, zog er sich zurück. Diesmal steckte er aber so richtig in der Klemme. Als er ins Freie trat, streifte er die Mütze ab und fuhr sich über den Kopf. Er war endgültig in Schweiß ausgebrochen. Kalte Herbstluft hüllte ihn ein. Und wie er in der Klemme steckte!
4
»Du musst cool bleiben«, versuchte Hanno Linsenmeyer sie zu beruhigen.
»Leicht gesagt«, gab Mara genervt zurück. »Seit drei Wochen bin ich jetzt hier – und was mache ich? Kleinkram. Dabei könnten meine Kollegen Unterstützung gut brauchen.«
Sie standen vor der Außenwand des in Regenbogenfarben gestrichenen Jugendzentrums. Über fünfzig war Hanno inzwischen, mit zu langen, strähnigen, mausgrauen Haaren und ausgewaschener, abgetragener Kleidung. Für Mara war er immer eine wichtige Stütze gewesen – die einzige. Ihr Halt in den harten Zeiten, als sie als Jugendliche beinahe auf die schiefe Bahn geraten wäre. Hanno war als Sozialarbeiter tätig und engagierte sich auch weit über seine Arbeitszeit hinaus, vor allem für Jugendliche, die straffällig geworden waren. Ein Mensch mit Idealen – und dem Mut, sich dafür einzusetzen.
»Ich habe mich darauf eingestellt«, sprach sie weiter, »dass es Spannungen geben, dass es auch mal krachen würde. Besonders zwischen Klimmt und mir. Aber dass der Typ mich einfach aufs Abstellgleis schiebt, also, damit hat er mich kalt erwischt.«
»Vielleicht siehst du zu schwarz.«
»Wohnungseinbrüche«, hielt sie ihm mit düsterem Zorn entgegen. »Mann, Hanno, das ist doch echt nicht zu fassen.«
»Und die anderen Kollegen?«
»Die schneiden mich.« Sie schüttelte den Kopf. »Einer von denen ist ein richtiger Milchbubi – aber kein Bulle.«
Hanno schmunzelte. »Na, den Blick kenne ich doch.« Er legte den Arm um ihre Schultern. Ihr wurde bewusst, dass er der einzige Mensch war, bei dem sie Berührungen zuließ. Wann hatte sie zuletzt einen Freund gehabt? Einen richtigen Freund? Es war Jahre her.
»Hab einfach Geduld«, riet Hanno ihr. Nur um gleich anzufügen: »Ach, was sage ich da? Du und Geduld …«
Mara musste lachen.
»Schade, Mara, dass du immer so eisig dreinschaust. Du bist nämlich hübsch – wenn du mal lächelst.«
»Komm mir bloß nicht so.«
»Auch auf die Gefahr hin, dass du wieder sauer wirst: diese Einbrüche.«
»Ja?«
»Hast du nicht gesagt, dass du Erfolg hattest? Ihr habt jemanden festgenommen, richtig?«
Mara nickte. »Eine Jugendbande ist für mehrere Wohnungseinbrüche verantwortlich. Zwei der Mitglieder haben wir geschnappt. Und deshalb bin ich heute auch zu dir gekommen.«
»Ach?« Er sah sie an. »Wie kann ich dir helfen?«
»Es geht um einen Jungen. Soweit ich weiß, hast du ihn bei einem deiner Projekte unter die Fittiche genommen. Und ich habe auch gehört, dass er sich heute bei dir herumtreiben soll.«
»Sein Name?«
»Rafael Makiadi. Sechzehn Jahre alt.«
»Klar, den kenne ich.«
»Sein Name ist mehrmals gefallen. Ich möchte nur mal mit ihm reden.«
»Allerdings glaube ich nicht, dass er rückfällig geworden ist. Ich sehe ihn sogar auf einem recht guten Weg. Ein schwieriger Typ – aber ein besonderer.«
»Was macht ihn denn besonders?«, hakte Mara nach.
»Hm. Vielleicht einfach nur die Tatsache, dass er seine Mutter liebt.« Hannos Miene blieb bierernst.
Maras Augenbraue hob sich. »Du willst mich wohl auf den Arm nehmen.«
Ein verstohlenes Schmunzeln umspielte seinen Mund. »Du wirst mir nicht glauben, aber es war keineswegs zynisch gemeint.« Nachdenklich fügte er hinzu: »Weißt du, Mara, ich habe so oft mit Jungs zu tun, die schon als Dreizehnjährige völlig verroht sind. Die keine Skrupel kennen, die dir, ohne mit der Wimper zu zucken, eine Flasche über den Kopf ziehen. Jungs, die keine Bindungen haben, die nie so etwas wie Vertrauen oder ein Miteinander kennengelernt haben. Einsame kleine Wölfe, die zubeißen, wenn die Gelegenheit kommt, völlig egal, wie gut du vorher zu ihnen warst.«
Mara musterte ihn halb spöttisch, halb liebevoll. »Okay. Und unser Rafael gehört also nicht dazu. Er liebt ja seine Mutter.«
»Wenn du es sagst, klingt es anders.« Hanno blickte versonnen drein. »Rafael schämt sich für seine Mutter. Sie lebt in einer jämmerlichen kleinen Bude und trinkt zu viel und hat das Sorgerecht für ihn verloren. Er erwähnt sie nicht, nie, mit keiner Silbe. Er besucht sie kein einziges Mal. Aber dann, wenn er vergisst, dass er sie eigentlich totschweigen will, kommen derart liebevolle, verständnisvolle Worte von ihm, dass ich jedes Mal staunen muss. Er hat Angst davor, ihr Auge in Auge gegenüberzutreten, weil es ihn zu sehr schmerzt. Etwas Gutes steckt in Rafael, und ich will verhindern, dass das kaputtgemacht wird.«
»Seinen Vater liebt er nicht?«
»Er hat wohl keine Erinnerung an ihn, weil er sich irgendwann aus dem Staub gemacht hat. Aber Rafael wartet auf ihn.«
»Er wartet auf ihn?«
»Er ist fest überzeugt davon, dass sein Vater eines Tages aus dem Nichts auftauchen wird, um ihn in ein anderes Leben mitzunehmen. Das verkündet er immer wieder.«
»Was weißt du über den Vater?«
»Nichts. Außer dass er wohl aus Afrika stammt.«
»Kannst du mich jetzt zu Rafael bringen?«
Hanno ging voran. »Komm mit.«
Sie betraten das Gebäude. Es hatte sich nicht viel verändert, seit Mara vor Jahren zuletzt hier gewesen war. Farbenfrohe Wände, ein Aushang mit neuen Gemeinschaftsprojekten und einer Tauschbörse, dumpfer, deutsch gesungener Hip-Hop aus wuchtigen Boxen, ein großzügig geschnittener Aufenthaltsraum, den sie durchquerten. Hanno bedeutete Mara, kurz zu warten, und verschwand durch eine Tür. Mara sah sich um. Jugendliche beim Abhängen, Quatschen, Darts- und Billardspiel, manche in Sesseln, andere einfach im Schneidersitz auf dem Laminatboden, auf dem mehrere Teppiche lagen.
»Na, Schwarze Witwe«, rief ihr einer der Billardspieler in frechem, doppeldeutigem Ton zu. »Lust auf ein Spielchen?«
Die Unterhaltungen verebbten, überall feixende Gesichter.
»Heute nicht.« Mara warf ihm aus ihren dunklen Augen einen kalten Blick zu.
»Wann dann?« Der Typ wollte die Sache nicht auf sich beruhen lassen.
»Wenn du irgendwann mal groß genug bist und dich rasieren musst.«
Gelächter und Gejohle brandeten auf.
Hanno stand wieder neben ihr. »Rafael ist im Nebenzimmer. Er bleibt gern für sich.« Ein kurzes Heben der Schultern. »Hab Geduld mit ihm.«
Mara grinste. »Da haben wir’s wieder: ich und Geduld.«
Sie glitt durch die noch offene Tür in den direkt anschließenden Raum, der wesentlich kleiner war. Poster von Rappern, ein kniehoher Tisch, darauf leere Colaflaschen. Ein großes, selbst gemaltes »Nazis raus«-Plakat. Zwei weitere Sessel. In einem davon saß Rafael Makiadi. Irokesenhaarschnitt, Nike-T-Shirt, Hosen mit Tarnmuster und eine Motorradlederjacke wie die von Mara – nur in auffällig strahlendem Weiß. Er war nicht sonderlich groß, schmal die Schultern, zart die Hände, die in seinem Schoß lagen.
Doch was sie vor allem wahrnahm, waren seine Augen, die sie aus einem fast mädchenhaft hübschen Gesicht mit dunklem Mischlingsteint musterten, traurige, misstrauische, ablehnende Augen, die eher zu einem Erwachsenen als zu einem Sechzehnjährigen passten – auf jeden Fall zu jemandem, der schon zu viel im Leben mit angesehen hatte. Irgendetwas an seiner Art, sie zu betrachten, kam ihr bekannt vor, dabei war sie ihm nie zuvor begegnet.
»Ich bin Mara Billinsky. Kriminalpolizei.«
Keine Antwort.
»Ich ermittle wegen der Wohnungseinbrüche.«
Unverändert lag Rafaels Blick auf ihr, sein Mund ein dünner, abweisender Strich.
»Ich muss dich zu einigen Daten befragen. Also. Der letzte Samstag, besser gesagt, die Nacht auf Sonntag. Wo warst du da?«
Ein knappes Achselzucken. »Hab ich vergessen.«
In den zurückliegenden drei Wochen hatte sie solche Fragen zu Hunderten gestellt – und solche Antworten zu Hunderten erhalten. Zuletzt hatte sie mit zunehmender Gelassenheit darauf reagiert. Doch bei ihm erwachte Wut in ihr, wie sie irritiert feststellte. Sie taxierte Rafael noch eine Weile, bevor sie sich in den zweiten Sessel setzte.
»Hör zu, Rafael, ich will dir nicht auf den Keks gehen.«
Kein Wort. Und keinerlei Reaktion in seiner Miene.
»Aber ich werde mich auch nicht abspeisen lassen.«
Wiederum – kein Ton von ihm.
Ihre Stimme wurde schärfer: »Rafael, bei uns in der Zelle sitzen einige deiner Kumpel – und die haben Sehnsucht nach dir.«
»Ich habe keine Kumpel.« Die Art, wie er das aussprach, entging Mara nicht – eine Ernsthaftigkeit und Düsternis, die sie nicht kaltließ. Und dennoch wurde ihre Wut auf ihn nur noch größer. Es war dieses Aufreizende, das ihr auf die Nerven ging. Warum kannst du nicht gelassener bleiben?, fragte sie sich, verwundert über sich selbst.
Nach einer weiteren Stille wurde ihr Tonfall noch schärfer: »Die Nacht von Samstag auf Sonntag. In Sachsenhausen ist in zwei Wohnungen eingebrochen worden.«
Schweigen.
»Ich hab keinen Bock mehr auf euch kleine Mister Cools«, entfuhr es ihr. »Mit der Masche wirst du jedenfalls nicht weit kommen.«
»Und ich hab keinen Bock mehr auf Leute, die mir Predigten halten.«
»Glaub mir, ich bin kein Pfarrer«, zischte sie. »Ich predige nicht.«
Er seufzte, rollte kurz mit den Augen, spöttisch, überdrüssig, gelangweilt, wie ein alter Gangster, der jede schmutzige Pfütze auf der Welt kannte. Nicht schlecht, wie er das machte, das musste sie diesem mickrigen Kerlchen lassen. Sie stellte weiterhin Fragen, er verzichtete weiterhin auf Antworten. Es war weniger ein Gespräch als ein Ringkampf.
Nach einigen Minuten gesellte sich Hanno zu ihnen, schweigend, fast verstohlen, mit einem aufmunternden Lächeln für Rafael.
»Wenn du hier nicht mit mir sprechen willst, muss ich dich mitnehmen, Rafael. Und dann wirst du den Mund aufmachen. Das tun nämlich alle. Früher oder später.«
»Wie wäre es, Mara«, schlug Hanno vor, »wenn du mir ein paar Minuten allein mit Rafael gibst? Und anschließend kannst du noch mal …«
»Okay«, unterbrach sie ihn. »Einverstanden.«
Und tatsächlich, nach der kurzen Unterhaltung mit Hanno ließ sich Rafael Makiadi doch noch einige Worte entlocken. Er gab Auskunft über seinen Verbleib in den vergangenen Wochen. Offenbar war er dank Hannos Zutun in einem Heim untergebracht worden, und dort würde man bestätigen können, dass er zum Zeitpunkt der letzten Einbrüche in seinem Zimmer gewesen war.
Mara kündigte mit Nachdruck an, dass sie alles überprüfen würde. Sie stand auf, verabschiedete sich mit einem kurzen Nicken, doch Rafael sah stur an ihr vorbei.
Hanno begleitete sie nach draußen zu ihrem schwarzen Alfa Romeo.
»Was hast du über den Jungen gesagt?«, meinte sie spitz. »Auf einem guten Weg? Sieht mir nicht so aus.«
»Abwarten.«
»Ziemlich abgebrühtes Kerlchen.«
»Mag sein«, erwiderte Hanno zurückhaltend.
Mara öffnete die Autotür. »Nächstes Mal werde ich ihn nicht so …« Sie vollendete den Satz nicht, wusste aber, dass das Funkeln in ihren Augen genug sagte.
Er räusperte sich. »Weißt du, der Kleine ist mir irgendwie wichtig geworden. Klar, das gilt für die meisten dieser Jungs. Aber Rafael … Na ja, ich glaube, in ihm schlägt ein gutes Herz.«
Mara glitt hinters Steuer. »Da täuscht man sich leicht.«
»Sei nicht immer so argwöhnisch.«
»Doch, bin ich«, gab sie zurück, jetzt aber immerhin wieder mit einem Lächeln.
Sie startete den Motor, setzte aus der Parklücke, und im Geiste erschien Rafaels Gesicht vor ihr. Sie wusste jetzt, weshalb er eine unzweifelhafte Wirkung auf sie gehabt hatte. Seinen harten, feindseligen Blick kannte sie nämlich nur allzu gut. Dieser Blick war genau wie ihr eigener. Damals, in einer Vergangenheit, die alles andere als schön, alles andere als einfach für sie gewesen war. Entschlossen trat sie das Gaspedal durch, beschleunigte den Wagen, als könnte sie so den Erinnerungen entwischen.
In den nächsten Tagen mühte sie sich weiter mit den Ermittlungen zu den Einbrüchen in Sachsenhausen ab. Mühsames Auffinden möglicher Zeugen, mühsame Gespräche, wenn man sie denn hatte. Rafael allerdings kam tatsächlich nicht als Täter infrage: Sein Alibi war – zumindest in diesem Fall – wasserdicht. War er wirklich auf einem guten Weg, wie Hanno Linsenmeyer vermutete? Manchmal ertappte sich Mara dabei, dass sie an den verschlossenen Jungen dachte, wie auch jetzt gerade, als sie am Schreibtisch saß und einige Zeugenaussagen miteinander abglich.
Hauptkommissar Klimmt kam auf sie zu, nur aus den Augenwinkeln nahm Mara ihn wahr. Der Bildschirm ihres Laptops flackerte. Ihr Schreibtisch war ein Durcheinander: etliche mit Notizen vollgekritzelte Blätter und Zettel, Ausdrucke mit Adresslisten. Dazu Fotos von Wohnungen, in die eingebrochen worden war, und von Verdächtigen, die als Täter infrage kamen.
Der Platz gegenüber war leer, Jan Rosen war irgendwo im Gebäude unterwegs.
Klimmt stellte sich neben sie.
Mara hob den Kopf und sah ihm in die Augen. Müde wirkte er, die Haare standen ab, der Teint war farblos, die Falten hatten sich während der vielen Überstunden, die hinter ihm lagen, tiefer eingegraben.
Mit einer lässigen Bewegung warf er noch einige weitere Fotografien auf ihren Schreibtisch.
Mara ergriff sie und betrachtete sie eine nach der anderen, bis sie zur letzten gelangte. Sie hielt sich noch einmal die erste dicht vor die Augen: ein Wohnzimmer. Im Zentrum der Aufnahme war ein Ledersessel zu sehen, darauf bäuchlings ein nackter Mann. Der Körper klemmte zwischen den Armlehnen, die Arme umschlangen die Rückenlehne, der Kopf ruhte seitlich darauf. Eine Kette war um die Hüften geschlungen, um ihn in der Position zu halten – jedenfalls als er noch am Leben gewesen war. Auf der Haut des Mannes und rund um den Sessel gab es massenweise dunkelrote Flecken, im hellen Teppich vor dem Sessel außerdem eine weitere, sehr große Lache von der gleichen Farbe.
»Was verkehrt herum in seinem Hinterteil steckt«, sagte Klimmt, »ist eine Saugglocke.«
»Schwer zu übersehen«, erwiderte Mara trocken.
»Die Gerichtsmedizin hat bei der Obduktion festgestellt, dass die Wucht, mit der das Griffholz eingeführt wurde, auch die Blase perforiert hat. Kopf, Arme, Schultern und Rücken«, sprach Klimmt betont sachlich weiter, »weisen dreiundzwanzig Platzwunden auf. Gut möglich, dass sie von einem Totschläger stammen.«
Mara äußerte nichts.
»Welcher der Schläge am Ende für den Tod verantwortlich war, kann man nicht mit Sicherheit festlegen.«
Sie besah sich erneut die übrigen Fotos, alles Nahaufnahmen, darunter die mit Kabeln gefesselten Handgelenke des Ermordeten, das von einem grauenhaften Tod verzerrte Gesicht, einige der Platzwunden.
»Wie hieß der Mann?«, wollte sie wissen.
»Nur ein paar Meter von ihm entfernt«, überging Klimmt ihre Frage, »gibt es einen Tresor voller Wertpapiere und Bargeld. Nicht aufgebrochen worden.«
»Wie hieß der Mann?«
»In einer Kommodenschublade fand man weitere 15.770 Euro in bar.«
»Ist sein Name ein Staatsgeheimnis?«
»Er hieß Ivo Karevic.«
Mara musste nur ganz kurz überlegen. »Kroatische Mafia. Einer der Bosse.« Sie stutzte. »Da sind Sie doch schon eine Weile dran, oder?«
»Ab sofort ist das Ihr Fall. Rosen wird Sie unterstützen.«
»Sonst niemand?«
»Nein, sonst niemand. Sie erhalten alle Informationen von den Kollegen. Es gibt auch noch mehr dieser hübschen Bildchen.«
Skeptisch taxierte sie Klimmt, dessen Miene ausdruckslos war. »Wie komme ich plötzlich zu der Ehre?«
Ein wölfisches Lächeln. »Ein Mordfall. Das wollten Sie doch die ganze Zeit.«
»Kein Wunder, ich bin bei der Mordkommission.«
»Na dann, ran an den Feind.«
»Woher der Sinneswandel?«
»Damit ich den nicht bereue, sollten Sie lieber anfangen.«
»Und die Einbrüche?«
»Werden wir sehen.«
Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um. Sie blickte ihm nach, bis er in seinem Büro verschwunden war. Dann betrachtete sie erneut die Fotos, wieder eines nach dem anderen, konzentriert, auf jedes einzelne Detail fokussiert.
Jan Rosen näherte sich ihrem Schreibtisch mit dieser typisch vorsichtigen Art – als müsste er sich dafür entschuldigen, dass er sich hier aufhielt. Sein Blick huschte verwundert über die Fotografien.
»Wenn ich fragen darf …«
»Dürfen Sie«, unterbrach sie ihn, ohne von den Tatortfotos aufzublicken.
»Die Bilder kenne ich. Sind Sie jetzt etwa an der Sache dran, Billinsky?«
»Nicht ich.« Jetzt sah sie ihn direkt an. »Sondern wir.«
»Ach?« Seine Kinnlade klappte herunter. Das musste er wohl erst mal verkraften. »Echt? Das gibt’s doch nicht. Als hätte ich nicht genug Arbeit am Hals.«
»Nur nicht zu viel Euphorie zeigen, Rosen.« Mara wandte sich wieder ihrem Schreibtisch zu.
Den ganzen Nachmittag sammelte sie sämtliche Informationen, die die Kollegen, die bislang mit dem Fall Ivo Karevic betraut worden waren, zusammengetragen hatten. Wie grauenhaft Karevics letzte Stunden verlaufen sein mussten, war offensichtlich. Doch ansonsten gab es jede Menge Fragezeichen. Keine Fingerabdrücke, keinerlei DNA-Spuren. Offenbar hatte Karevic den oder die Täter freiwillig ins Haus gelassen, da sich niemand gewaltsam Zutritt verschafft hatte. Keines der Zimmer war durchsucht worden. Die große Summe an Bargeld und weitere Wertgegenstände, etwa einige besonders teure Uhren, wiesen darauf hin, dass es nicht um Raub ging. Nichts war mitgenommen worden.
Waren Revierkämpfe der Grund für den Mord? Ein Vorstoß, um das Terrain von Karevics Bande zu erobern? Deshalb auch die Brutalität der Tat? Um ein unmissverständliches Zeichen zu setzen? Um alle, die mit Karevic paktierten, darauf hinzuweisen, was ihnen blühen konnte?
Kein einziger Verdächtiger war ermittelt worden. Und zu Karevic selbst gab es ebenfalls kaum etwas Handfestes. Ihm schien es stets gelungen zu sein, im Verborgenen zu bleiben. Sicher, er war einer der Köpfe der kroatischen Mafia gewesen, das wusste man, aber eine konkrete Gesetzesübertretung war ihm nie nachgewiesen worden.
Wo sollte Mara ansetzen?
Sie stand unangekündigt in Klimmts Büro, um ihn zu befragen. Immerhin war er persönlich in die Ermittlungen eingebunden gewesen. Doch selbst jetzt zeigte er ihr die kalte Schulter. »Wenn es mehr zu erzählen gäbe, Billinsky«, blaffte er, »würde es in den Berichten stehen.«
Sie funkelte ihn an. »Aber es muss doch …«
»Mehr war eben nicht herauszukriegen«, unterbrach er sie barsch. »Jetzt sind Sie an der Reihe.«
Sauer rauschte sie wieder aus dem Raum. Sie suchte weitere Kollegen auf, jedoch ohne Erfolg. Achselzucken, Gleichgültigkeit. Hinter ihrem Rücken imitierte einer von ihnen ein Vogelkrächzen, was Gelächter auslöste. Mara winkte nur ab und zog sich an ihren Schreibtisch zurück. Sie hatte längst mitbekommen, dass man sie insgeheim »die Krähe« nannte. Du hast gewusst, sagte sie sich, dass es nicht einfach werden würde – dass es scheiß-schwer werden würde. Beschäftige dich nicht mit solchen Idioten, sondern mit dem Job.
Sie vergrub sich wieder in die Fakten des immerhin schon fast vier Wochen zurückliegenden Mordes. Es gab die alte Regel, dass ein Fall kaum gelöst werden konnte, wenn man nicht in den ersten achtundvierzig Stunden nach der Tat entscheidend vorankam. Vielleicht war es besser, nicht allzu sehr an Regeln zu denken. Sie wühlte sich weiter durch die polizeilichen Datenbanken, notierte sich Einzelheiten, suchte auch im Internet.
Es war schon nach Einbruch der Dunkelheit, als sie bemerkte, wie Jan Rosen möglichst unauffällig in Klimmts Büro verschwand und die Tür hinter sich schloss. Nur fünf Minuten später tauchte er wieder auf, sein braves Versicherungsvertretergesicht sichtlich zerknirscht.
»Ich mach dann mal Feierabend«, bemerkte er nur, ohne sie anzusehen.
Schmunzelnd verfolgte Mara, wie er sich mit hängenden Schultern davonmachte. Anschließend blieb sie noch über drei Stunden. Den Fall, der so urplötzlich in ihrem Schoß gelandet war, sah sie als Chance. Darauf hatte sie doch gewartet. Sie versuchte sich dem Mann namens Ivo Karevic zu nähern, aber wie immer bei solchen Typen war das nicht einfach. Leute wie Karevic besaßen keine Arbeitsverträge, keine Gehaltsabrechnungen, keine Versicherungspapiere, sie waren nirgendwo gemeldet, nirgendwo eingetragen, sie hinterließen so gut wie keine Spuren. Mara verfolgte im angelegten Dossier die wenigen Vorgänge auf seinem Konto, obwohl klar war, dass er noch über weitere, bisher unentdeckte verfügen musste. Sie las Punkt für Punkt, was in seinem Haus gefunden worden war, und überprüfte die Männer, die seiner Bande zugerechnet wurden. Nur fünf von ihnen waren mit Namen und Aussehen bekannt. Schließlich musste Mara sich regelrecht zwingen, nach Hause zu gehen.
Am darauffolgenden Morgen war sie als Erste im Büro. Sie machte weitere Einträge in ein abgegriffenes Notizbuch, das sie immer mit sich herumschleppte – oft war sie für diese altmodisch wirkende Angewohnheit belächelt worden, von Kollegen, die sich digital Notizen machten. Doch das Niederschreiben war ihr in Fleisch und Blut übergegangen.
Gewissenhaft legte sie eine Liste mit offenen Fragen an, die ziemlich lang wurde. Irgendwie musste sie reinkommen in diese verdammte Sache. Vier Jahre Abwesenheit von Frankfurt hatten dafür gesorgt, dass sie kein Netzwerk an Informanten mehr hatte, über keine Verbindungen in die Szene verfügte. Sie würde bei null anfangen. Und sie hatte nur eines, was ihr helfen konnte: ihre Entschlossenheit.
Als Jan Rosen sich auf seinen Platz ihr gegenüber setzte, war sie völlig vertieft und nahm ihn kaum wahr. Sie sprang auf, um sich bei den Kollegen Karevics persönliche Dinge anzusehen, die man hierher mitgebracht hatte, darunter einen Hausschlüssel, den sie unbedingt an sich nehmen wollte. Dann zurück an den Schreibtisch.
Der Vormittag zog vorbei.
»Ich gehe in die Kantine«, sagte Rosen. Wieder trug er einen seiner fürchterlichen Pullover, heute in einem Brombeerton. »Sind Sie dabei?«
Mara war überrascht, dass jemand um ihre Gesellschaft bat. Das lag wahrscheinlich daran, dass Rosen innerhalb von Klimmts Truppe ziemlich auf sich allein gestellt war. Oder weil er einfach zu gut erzogen war, um allein loszumarschieren.
»Keinen Hunger«, sagte sie.
Er nickte, als hätte er nichts anderes erwartet.
Als er aufstand und gehen wollte, bemerkte sie beiläufig: »Hat wohl nicht geklappt gestern Abend?«
Rosen hielt inne und runzelte die Stirn. »Ich verstehe nicht.«
»Na, Sie waren doch bei Klimmt, um Ihr Köpfchen aus der Schlinge zu ziehen.«
»Äh. Bitte?«
»Na ja, die Schlinge, mit mir zusammenarbeiten zu müssen.«
Er wurde rot wie ein kleiner Junge. »Quatsch«, brachte er über die Lippen.
»Kein Problem, Rosen. Ich nehme mich der Sache auch allein an.«
»Das ist, äh, wirklich Quatsch.«
»Guten Appetit, Kollege!«
Bedröppelt machte er sich auf in die Kantine.
Klimmt hatte sicher eine Menge Spaß, dachte Mara, als er darauf kam, mir ausgerechnet Jan Rosen zur Seite zu stellen.
Einige Zeit später – Rosen saß ihr wieder schweigsam wie ein Gemälde gegenüber – unternahm Mara den ziemlich aussichtslosen Versuch, etwas Ordnung auf ihrem Schreibtisch zu schaffen. Dann streifte sie sich die Lederjacke über.
»Doch noch Hunger?«, fragte Rosen vorsichtig.
»Nein, ein Date.«
»Ach? Mit wem, wenn ich fragen …«
»Sie dürfen«, stoppte sie ihn. »Mit einem gewissen Malovan.«
Rosen machte große Augen. »Malovan?«
»Nur dass er noch nichts davon weiß.«
»Er gilt als Karevics rechte Hand.«
»Deswegen möchte ich mich mit ihm unterhalten.«
»Lassen Sie’s lieber, Billinsky. Klimmt und die anderen haben schon versucht, ihm auf den Zahn zu fühlen. Die sind nicht mal einen Steinwurf an ihn herangekommen.«
»Na und?« Mara warf sich ihre Tasche über die Schulter und suchte darin nach dem Autoschlüssel.
Unentschlossen erhob sich Rosen vom Stuhl. Er nahm seine Jacke von der Lehne, nur um sie gleich wieder darüberzulegen. »Das ist … Wie soll ich sagen?«
»Schwachsinn«, schlug Mara vor.
Er nickte zögerlich. »So was in der Art.«
»An irgendeiner Stelle muss man mal in den Wald schießen.«
»Wie gesagt, Klimmt und die anderen sind nicht an Malovan herangekommen.«
»Wie gesagt: Na und?« Mara hatte den Schlüssel gefunden. Ohne ein weiteres Wort ging sie los. Aus den Augenwinkeln nahm sie wahr, dass Rosen noch einmal nach seiner Jacke griff – und sie doch auf dem Stuhl hängen ließ. Er verharrte auf seinem Platz und blickte starr auf seinen Monitor.
Feigling, dachte sie.
5
Die Nacht ballte sich schwarz vor dem Fenster, das er vorsichtig öffnete. Keiner der drei anderen, mit denen er das Zimmer teilte, wachte auf. Er schob sich über den Sims und sprang auf das Vordach des Eingangsbereichs. Geübt war er darin, ein reines Kinderspiel.
Bei der Rückkehr würde er sich auf das kleine Dach hinaufziehen und einen der drei Zimmerkumpels mit einem Anruf wecken – und der würde ihm dann ein Seil hinablassen, mit dessen Hilfe er rechtzeitig vor dem Wecken wieder im Bett wäre. Auch kein Problem.
Leer lagen die nächtlichen Straßen vor Rafael Makiadi. Er pumpte die frische Luft in seine Lungen, wurde sofort wacher, lebendiger. Noch zwei Kreuzungen, dann erreichte er die Bornheimer Bibliothek. Von dort brachte ihn ein Fußweg zu dem etwas versteckt dahintergelegenen Kindergarten. Das war ihr Treffpunkt. Lässig schwang er sich über den Maschendrahtzaun.
Er wurde bereits erwartet. Sie waren zu dritt. Tayfun fläzte sich auf der steinernen Tischtennisplatte, die anderen waren um ihn herum gruppiert. Hinter ihnen hoben sich Schaukeln, eine Rutschbahn und ein Klettergerüst gegen die Finsternis ab.
»Hey, Raf.«
Sie drückten ihre rechten Fäuste gegeneinander. Tayfun schwafelte etwas von einer neuen Kiste, die auf welchem Wege auch immer in seinen Besitz gelangt war, irgendein Sportflitzer. Er war neunzehn, der Anführer, zumindest derjenige mit der größten Klappe.
»Habt ihr was geplant?«, fragte Rafael, um das Geplapper von dem Auto zu unterbrechen, das ihn nicht juckte. »Heute Nacht?«
»Was denkst du, Alter, warum ich wollte, dass du herkommst?« Tayfun lachte laut. »Kronberg, sag ich nur.«
Rafael betrachtete einen nach dem anderen. »Vielleicht sollten wir mal eine Pause einlegen.«
»Pause? Hast du’n Schuss? Du hast dich schon das letzte Mal in Sachsenhausen gedrückt.«
»Ich hab mich nicht gedrückt. Ich hatte Besseres zu tun.«
»Heute hast du nichts Besseres zu tun. Also bist du dabei.«
»Die Bullen rücken uns immer mehr auf den Pelz. Bei mir war eine Bullen-Lady.«
»Wie? Bei dir?«
»Als ich bei Hanno war.« Er fügte hinzu: »Die haben mich verpfiffen.«
»Wer?«
»Keine Ahnung. Irgendeiner von denen, die sie geschnappt haben.«
»Scheiß drauf, Mann.«
»Da scheiß ich ganz bestimmt nicht drauf«, erwiderte Rafael ruhig.
»Kronberg«, wiederholte Tayfun und glitt von der Tischtennisplatte. »Zwei Häuser. Ärzte oder so. Und die sind weg.«
»Wenn’s wahr ist.«
»Echt, Mann. Die sind weg. Alles ausgekundschaftet.«
Die anderen beiden stimmten zu.
Rafael zögerte.
»Was ist, Raf?« Tayfun schlug ihm kumpelhaft gegen den Oberarm. »Willst du lieber zurück ins Bettchen? Willst du pennen – oder leben?«
Rafael gab keine Antwort.
»Oder willst du immer noch darauf warten, dass dein Alter in einer Limousine vorfährt, dich einsteigen lässt und mit dir abrauscht?«
Er warf ihm einen giftigen Blick zu. »Irgendwann wird er kommen. Was dagegen?«
»Aber vorher können wir doch ein Ding drehen.«
»Erwähne meinen Vater nie wieder, okay? Und das Ding könnt ihr auch ohne mich drehen.«
»Schiss in der Hose?« Tayfun grinste. »Kronberg ist nicht Frankfurt, Raf. Das ist ein Spaziergang, eine ganz lockere Sache.«
»Nichts ist locker«, sagte Rafael leise.
Die drei standen da und warteten auf ihn.
Rafael sah stumm in die Dunkelheit.
»Kommst du jetzt mit oder nicht?«
6
Es roch nach Tod.
Egal ob es sich um eine armselige Behausung oder ein großes, schickes Eigenheim wie dieses handelte, jeder Ort, an dem sich ein schweres Verbrechen zugetragen hatte, verströmte diesen kalten, toten Geruch.
Ein Schauer rieselte an Maras Wirbelsäule hinunter.
Und das obwohl sie sich jetzt schon eine ganze Weile in Karevics Haus umgesehen hatte. Sie erwartete nicht, auf etwas zu stoßen, das andere übersehen hatten. Es ging einfach darum, sich hier aufzuhalten, die Atmosphäre einzuatmen.
Ivo Karevic. Vor sechsundvierzig Jahren im ehemaligen Jugoslawien geboren. Seit fast zwei Jahrzehnten in Deutschland. Allmählicher Aufstieg innerhalb der Organisation. Furchtlos, clever. Fast immer war es ihm gelungen, seinen Namen aus den verbrecherischen Geschäften, mit denen er Geld scheffelte, herauszuhalten. Und jetzt war er abserviert worden.
Es gab keine Hinweise darauf, dass es im Milieu momentan brodelte oder größere Kämpfe ausgetragen wurden. Morde in diesem Umfeld waren oft eine saubere Sache. Ein Schuss, und alles war vorbei. Meist ging es schlicht und einfach darum, einen Gegner aus dem Weg zu räumen.
Warum hatte man ihn gefoltert?, fragte sich Mara. Um ihm ein Geheimnis, eine Information zu entlocken? Oder wollte da jemand einen besonders eindrucksvollen Startschuss abfeuern? War es der Auftakt zu einem Bandenkrieg? Klimmt ging davon aus, wie Mara wusste, und auch sie hatte keine andere Erklärung.
Wer waren Karevics Feinde? Wer seine Verbündeten? Im Leben hatte er es der Polizei schwer gemacht, weil er es verstanden hatte, überaus vorsichtig vorzugehen und keine Fußabdrücke zu hinterlassen. Und im Tod schien es nicht anders zu sein.
Sie verließ das Haus. Seit sie Jan Rosen am Schreibtisch zurückgelassen hatte, waren mehrere Stunden vergangen. Die ganze Zeit hatte sie abwechselnd vor einem Haus am Mainufer verbracht, in dem Malovan laut den Akten eine Dachwohnung bezogen hatte, und vor einem unauffälligen Café in der City, das Karevic und Malovan angeblich in unregelmäßigen Abständen als Treffpunkt nutzten. Aber – umsonst. Keiner der Männer, deren Fotos sie sich am Vorabend eingeprägt hatte, war auf der Bildfläche erschienen.
Inzwischen fuhr Mara die Hanauer Landstraße entlang. Große Betonkästen, in denen Werbeagenturen, Tonstudios und Druckereien untergebracht waren, einige Restaurants, Fast-Food-Läden, großflächige Baustellen. Im Rückspiegel streckte sich die Europäische Zentralbank, umkränzt von Nebelfetzen, in ihrer eigenwilligen Schrägarchitektur einsam dem düsteren Abendhimmel entgegen. Mara bog nach links ab, gleich darauf nach rechts und folgte der Parallelstraße. Kaum Verkehr, eine dunkle, fast schnurgerade verlaufende Häuserschlucht.
Sie parkte den Wagen, stieg aber nicht aus, sondern behielt einen sechsstöckigen Backsteinbau im Auge. In der obersten Etage befand sich ein exklusives, überaus teures Fitnessstudio, in das man nur mittels eines vierstelligen Codes Einlass fand. Karevics spärlichen Kontoverbindungen zufolge war er einer der wenigen Kunden gewesen. Wie Mara wusste, hatten Klimmt und Kollegen dem Studio eines Abends einen Besuch abgestattet – ohne allerdings einen Verdächtigen anzutreffen. Doch sie hatte so wenige Anhaltspunkte, dass sie keinen davon auslassen durfte. Und außerdem waren vier Wochen vergangen, in denen die polizeilichen Ermittlungen im Fall Karevic immer zurückhaltender geführt worden waren. Womöglich krochen die Ratten langsam wieder aus ihren Löchern.
In jedem Fall war Geduld gefragt.
Mara ließ die Scheibe herunter, sofort drang kalte Luft zu ihr herein. Das half, munter zu bleiben. Die Innenraumbeleuchtung warf einen Strahl auf ihre Notizen, die sie immer wieder überflog und hier und da ergänzte.
Sie ließ das Radio bewusst aus, die Stille tat ebenso gut wie die Kälte. Minuten verrannen. Sie dachte nach, grübelte, vertrat sich nur ab und zu die Beine. Nach über vier Stunden – es war mittlerweile halb zwei Uhr nachts – näherte sich ein dunkler Porsche Cayenne, der direkt vor dem Backsteingebäude parkte. Drei Männer stiegen aus und verschwanden, Sporttaschen über den Schultern, zügig in dem Haus.
Mara lächelte.
Einer von ihnen hatte wie Malovan ausgesehen.
Wiederum knappe zwei Stunden später verließen die Männer das Haus. Sie verstauten die Taschen in ihrem Auto, stiegen jedoch nicht ein.
Maras Fuß lag auf dem Gaspedal, sie war bereit zu starten.
Die Fremden schienen zu beratschlagen. Auf einmal setzten sie sich in Bewegung, die Straße hinab, fort von Mara, ganz gemächlich, weiterhin in eine Unterhaltung vertieft. Mara schob sich geräuschlos aus dem Alfa und nahm in einigem Abstand die Verfolgung auf.
Es war verdammtes Glück, Malovan quasi auf einem Tablett serviert zu bekommen. Eine Entschädigung für die letzten, trostlosen Wochen? Sie durfte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Klimmt war in der ganzen Zeit nie auch nur in die Nähe von Malovan gekommen.
Die drei Männer, bekleidet mit langen Mänteln, unterhielten sich nach wie vor miteinander, einer links von Malovan, einer rechts. Noch mehr Nebel hatte sich gebildet, die Sicht wurde schlechter. Mara legte an Tempo zu. Gerade noch erfasste sie, dass die drei nach rechts abgebogen waren, hinein in einen der zahlreichen, zwischen Bürogebäuden liegenden Durchgänge, über die man zur Hanauer Landstraße gelangte.
Mara lief etwas schneller – und hielt abrupt inne. Nichts mehr zu sehen von den dreien.
Plötzlich ein Geräusch hinter ihr.
Sie drehte sich um und starrte in die Gesichter der Männer, die in dem kaum beleuchteten Durchgang schlecht zu erkennen waren.
Erst als sie langsam auf sie zuschritten und bleiches Mondlicht zu ihnen drang, konnte sie ihre Züge deutlicher wahrnehmen.
Zwei Schritte vor Mara hielten sie an.
Sie versuchte ruhig zu bleiben, sich zu konzentrieren.
Grau meliertes, dichtes, welliges Haar, scharfe Züge, eine auffallend schmale, hervorspringende Nase, ein spitzes Kinn. Bei dem Mittleren handelte es sich um Malovan, jetzt war sie endgültig davon überzeugt.
Nur ob es Glück war, ihm über den Weg zu laufen, da war sie sich nicht mehr so sicher wie eben noch.
»Was soll das? Schickt uns Nova eine kleine Lady hinterher?«, meinte derjenige, der links stand, ein junger Mann, etwa Mitte zwanzig, mit einem dünnen, perfekt ausrasierten Kinnbart. Ein hämischer Ton, ein starker Akzent, schwer zu verstehen.
Malovan schenkte ihm einen unmissverständlichen Blick und warf ihm einen Brocken in einer anderen Sprache hin, wahrscheinlich Kroatisch. Ab jetzt würde er wohl die Klappe halten.
»Niemand schickt mich«, sagte Mara. Ihre Stimme war klar, zitterte kein bisschen, und das gab ihr Sicherheit.
Malovan betrachtete sie, nahm alles in sich auf, von ihrer Lederjacke bis hin zu den Doc Martens. Eiskalt war sein Blick, aber dennoch mit einer kaum verhohlenen Neugier. Als wüsste er nicht, ob er alarmiert sein oder schmunzeln sollte.
»Was schleichst du uns hinterher, Punkmädchen?«
»Weder Punk noch Mädchen. Ich bin Polizeioberkommissarin Mara Billinsky.«
Er musterte sie noch aufmerksamer. »Hat man Ihnen auch eine Waffe gegeben, Polizeioberkommissarin Mara Billinsky? Vielleicht eine Wasserpistole?«
Unbeeindruckt hielt sie seinem Blick stand.
»Was wollen Sie von mir, Lady?«
»Reden.«
»Dann reden Sie.«
»Ivo Karevic. Wieso war er Ihnen im Weg?« Ein Schuss ins Blaue, schließlich hatte sie nichts in der Hand. Außerdem war sie noch nie ein Freund von Geplänkel gewesen.
Malovan zeigte ein beinahe sanftes Lächeln, während seine Augen unverändert blieben. »Keine Ahnung, was Sie meinen.«
»Wieso musste er auf diese Art sterben? Und wieso wurde er nicht irgendwo verscharrt? Offensichtlich spielte es keine Rolle, dass seine Leiche rasch gefunden werden würde.«
»Ich kenne keinen Ivo Karevic.«
»Womöglich haben Sie ihn einfach nur kurz vergessen?« Mara brachte es fertig, ihn anzugrinsen. »Er war Ihr Boss.«
Es ging schnell, verdammt schnell. Ohne ein Zeichen, ohne eine Silbe Malovans packten die beiden anderen Männer Mara an den Oberarmen, wirbelten sie herum und drückten sie mit voller Wucht gegen eine Hauswand. Ihre Dienstwaffe wurde aus dem Holster gezogen, das sie am Gürtel trug.
»Merken Sie sich eins, Polizeioberkommissarin Mara Billinsky. Ich kenne keinen Ivo Karevic.« Malovans Gesicht war ihrem Haar ganz nahe, seine Nase berührte es, sie fühlte seinen Atem auf der Wange. »Und ab jetzt sollten Sie mir nicht mehr hinterherschleichen. Das ist nur zu Ihrem Besten.«
Ihre Pistole landete mit metallischem Klacken auf dem Boden.
Malovans Schritte entfernten sich. Mara schluckte. Einer der Männer lachte. Doch dann lösten sich die Griffe. Weitere Schritte bewegten sich von ihr weg.
Sie war allein. Nach einem tiefen Luftholen bückte sie sich, um die Waffe aufzuheben. Ihr entging nicht, dass ihre Hand dabei zitterte.
Jetzt erst heißt es, sagte sie sich, willkommen zurück in Frankfurt.
7
Wieder eine Verabredung, der er nicht gerade mit Leichtigkeit entgegensah.
Die aber dennoch wichtig sein konnte. Überlebenswichtig.
Er selbst hatte auf dieses Treffen ja gedrängt. Drängen müssen.
Aber warum wollten sie ihn ausgerechnet hier sehen? Der Ort schien ein Scherz zu sein. Wollten sie sich lustig über ihn machen? Würden sie ihn versetzen?
Carlos Borke betrat die winzige, schummrige Lokalität, die nicht im Rotlichtviertel, sondern in Messenähe lag. Nur ein paar Minuten von hier entfernt gab es einen Straßenstrich, ansonsten reihten sich unauffällige, etwas heruntergekommene Wohnblöcke aneinander. Es ging ein paar Stufen nach unten, dann stand er mitten im Kleinen Elch. Keine Gäste, dafür war es noch zu früh, nicht einmal zehn Uhr abends. Hinter dem Tresen hielten sich drei Männer auf, die sich mit Lockenperücken und Frauenklamotten aufgedonnert hatten.
Warum hier?, fragte Borke sich erneut.
Eines der drei gelockten Wesen stöckelte mit forschendem Blick auf ihn zu. »Hallöchen«, sagte eine tiefe Stimme.
»Na, alles klar?«, murmelte Borke. Es war Jahre her, seit er im Kleinen Elch gewesen war, der bei Schwulen sehr beliebt war, normalerweise jedoch nicht bei kroatischen Gangstern.
»Ich bin Lorraine, Süßer.«
»Freut mich, Lorraine.«
»Du wirst erwartet.«
»Wo?« Borkes Blick tastete die billigen dunkelroten Plüschsofas und -sessel ab, die unbesetzt waren und von roten Lämpchen nur schwach beleuchtet wurden.
»Es gibt ein Nebenzimmer.« Ein raues Lachen. »Für besonders intime Momente.«
»Nicht viel los heute«, sagte Borke. Er versuchte ein wenig Zeit zu gewinnen, um sich zu akklimatisieren, soweit das möglich war, einfach um etwas mehr Sicherheit zu gewinnen.
»Ach, das wird schon noch. Wart mal ein Stündchen ab, dann tanzt hier der Bär.«
Er folgte der sich allzu heftig in den Hüften wiegenden Lorraine um die winzige Bühne herum, auf der hin und wieder Travestievorführungen gezeigt wurden, und dann in den angesprochenen Nebenraum.