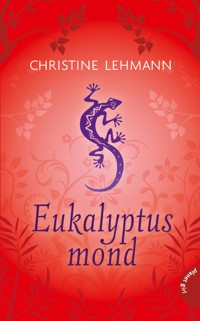Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Stadt im Jagdfieber: Der spannungsgeladene Hundekrimi "Eiskalte Fährte" von Christine Lehmann jetzt als eBook bei dotbooks. In ausweglosen Situationen werden die zu Helden, denen man es am wenigsten zugetraut hätte … Eine Stadt in Angst: In Kynopolis schlägt ein heimtückischer Giftmörder zu, der Jagd auf Vierbeiner macht – aber auch vor Menschen nicht zurückschreckt. Die junge Hunde-Dame Füchschen, die gerade erst von einer Bilderbuchfamilie aus dem Tierheim gerettet wurde, hofft inständig, in Sicherheit zu sein. Aber dann taucht der Streuner Gris auf, den Füchschen aus dem Zwinger kennt. Und sie weiß: Wo er auftaucht, wird es gefährlich! Gibt es gar einen Zusammenhang mit dem Mörder? Füchschen beginnt, ihre Spürnase unter Beweis zu stellen. Aber bringt sie sich damit in tödliche Gefahr? Spannend wie der Bestseller FELIDAE, mitreißend wie die Erfolgsserie von Spencer Quinn: Ein einmaliges Erlebnis für Krimifreunde und Hundeliebhaber – hier geben die Spürnasen den Ton an! Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Eiskalte Fährte – Ein Hundekrimi" von Erfolgsautorin Christine Lehmann. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
In ausweglosen Situationen werden die zu Helden, denen man es am wenigsten zugetraut hätte … Eine Stadt in Angst: In Kynopolis schlägt ein heimtückischer Giftmörder zu, der Jagd auf Vierbeiner macht – aber auch vor Menschen nicht zurückschreckt. Die junge Hunde-Dame Füchschen, die gerade erst von einer Bilderbuchfamilie aus dem Tierheim gerettet wurde, hofft inständig, in Sicherheit zu sein. Aber dann taucht der Streuner Gris auf, den Füchschen aus dem Zwinger kennt. Und sie weiß: Wo er auftaucht, wird es gefährlich! Gibt es gar einen Zusammenhang mit dem Mörder? Füchschen beginnt, ihre Spürnase unter Beweis zu stellen. Aber bringt sie sich damit in tödliche Gefahr?
Spannend wie der Bestseller »Felidae«, mitreißend wie die Erfolgsserie von Spencer Quinn: Ein einmaliges Erlebnis für Krimifreunde und Hundeliebhaber – hier geben die Spürnasen den Ton an!
Über die Autorin:
Christine Lehmann, geboren 1958 in Genf, wuchs in Stuttgart auf. Heute pendelt sie zwischen ihrer Heimatstadt und Wangen im Allgäu. Christine Lehmann ist Nachrichtenredakteurin beim SWR und schreibt seit vielen Jahren erfolgreich in den verschiedensten Genres – von Krimis und historischen Romanen über Jugendbücher bis zu romantischen Liebesgeschichten. Außerdem arbeitet Sie an verschiedenen Sachbüchern und Hörspielen.
Von Christine Lehmann erschienen bei dotbooks bereits die Romane »Die Inselträumerin«, »Die Rache-Engel«, »Die Liebesdiebin«, »Der Winterwanderer«, »Die Liebesträumerin«, »Die Strandträumerin« und »Das Rabenhaus«.
Zwei ihrer Romane sind auch als Sammelband unter dem Titel »Die Rache-Engel & Die Liebesdiebin« erhältlich.
Unter Madeleine Harstall erscheinen bei dotbooks ihre Romane »Die Töchter der Heidevilla« und »Die Brückenbauerin«.
Mehr Informationen über Christine Lehmann finden sich auf ihrer Website: www.christine-lehmann.blogspot.de
***
eBook-Neuausgabe August 2018
Dieses Buch erschien bereits 1994 unter dem Titel »Kynopolis« bei Goldmann.
Copyright © der Originalausgabe 1994 by Wilhelm Goldmann Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von Shutterstock.com/mazura 1989 und Robert Adrian Hillman
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-277-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Eiskalte Fährte« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Christine Lehmann
Eiskalte Fährte
Ein Hundekrimi
dotbooks.
Kapitel 1
Wenn sie kamen, merkte ich das, lange bevor sie an meiner Tür schnüffelten. Die Plattnase am Eingang fing an zu heulen, das Pseudoäffchen im Zwinger neben ihm quietschte, der Rattenfänger jaulte auf. Das Geschrei setzte sich fort bis zu mir. Jeder von uns verhielt sich so, wie er glaubte, daß er am besten die Aufmerksamkeit der Besichtiger auf sich lenken konnte. Plattnase maunzte mit faltigem Gesicht, legte die Ohren an und wackelte mit seinem stumpfen Hintern, jede Faser demütige Erregung. Das kleine aprikosenfarbige Äffchen hüpfte und sprang wie ein Ball, schüttelte die langen Ohren und kreischte. Still stand neben ihr in seinem Zwinger der alte, hüftlahme Schäfer, schlug mit dem Schweif und verfolgte mit geblähten Nüstern und scharfem Blick die Hochnasen, die an seiner Tür vorbeigingen. Die beiden flauschigen Welpen beneidete ich um ihre Unbefangenheit. Sie bettelten. Sie kugelten sich vor Freude und leckten alles, was durch den Maschendraht langte. Andere trappelten aufgeregt hin und her oder schmiegten sich an den Zaun, in der Hoffnung gestreichelt zu werden. Struppi warf sich tobend gegen den Draht. Die Langhaarige riß den schmalen Kopf in den Nacken und heulte. Sie war eine Beißerin, aber so schön, daß manche Besichtiger lange vor ihrem Zwinger verweilten. Stummelbein kläffte rauh. Nur meinem Nachbarn, dem Wilden, war der Rummel gleichgültig. Er blieb zusammengerollt in der hintersten Ecke seiner Kammer liegen und hob nicht einmal den Kopf.
Und ich? Es ist mir peinlich, es zuzugeben. Beim ersten Mal, ich war gerade erst eingeliefert worden und voller Zorn und Bitterkeit, bellte ich, was meine Lunge hergab. Erst nach einer Weile begriff ich, daß wir nicht lärmten, um die Eindringlinge, die an unseren Zellen vorbeischnüffelten, zu vertreiben. Nein, es war ein wütendes und verzweifeltes allgemeines Betteln und Winseln. Und jedesmal, wenn die Abholer kamen, ergriff mich dieselbe beschämende Erregung. Ich konnte nicht liegen bleiben wie der Wilde neben mir. Das Getöse spülte über mich hinweg, und ich tobte mit.
Dabei fürchtete ich mich vor den fremden Hochnasen. Zwar war auch das Heim mit seinen engen Zellen kein Ort, an dem ich freiwillig geblieben wäre. Aber diese Fremden, diese skeptischen Besichtiger, diese strengen, anspruchsvollen Abholer, von denen so viele nach Unverstand, nach klebriger Tierliebe, nach Herrschsucht, Leinen, Maulkörben, Prügel oder nach flüchtiger Begeisterung, nach Besitzgier, Gefängnis und Vereinnahmung stanken, waren mir nicht geheuer.
Ich wartete auf meine alte Dame. Aufgewachsen bin ich in einer kleinen Wohnung im dritten Stock. Am Teppich meiner Dame habe ich meine Zähne ausprobiert. Jeden Tag ging sie mit mir stundenlang in den Wald. Pünktlich servierte sie mir mein Futter. Und abends schmusten wir auf dem Sofa. Sie hatte mir versprochen, mich niemals zu verlassen. Aber sie hatte es nicht gehalten. Zuerst legte sie sich tagelang ins Bett, dann verschwand sie, und ihre Tochter kam, um mich rauszuschaffen und zu füttern. Dann brachten sie mich hierher ins Heim. Sie gehörten zu den Verächtern.
Unter den Hochnasen gibt es so viele verschiedene Sorten wie unter uns Nasen. Sie lassen sich nicht nur in Halter und Verächter einteilen. Unter den Verächtern gibt es Hasser, Schläger, aber auch Gleichgültige und Ängstliche. Und auch die Halter sind verschieden. Am schlimmsten sind die Unverständigen. Sie werden euch immer dann streicheln, wenn ihr es nicht wollt, nie verstehen, was euch interessiert, euch vom schönsten Dreck fortreißen, mit Schokolade füttern und parfümieren. Sie werden euch auf den Arm nehmen, wenn ihr einem anderen Anuben guten Tag sagen wollt. Und sie werden euch mit ihrer Liebe an allem Wesentlichen hindern. Die Herrscher werden von euch bedingungslosen Gehorsam fordern und euren Gehorsam immer dann verlangen, wenn gerade ein guter Duft euer Interesse fordert. Ihr werdet euch euer Leben lang überwinden und selbstverleugnen müssen. Dagegen ist es ein Glück, einem Gleichgültigen zu gehören. Er läßt euch laufen. Ihr könnt streunen. Dafür könnt ihr nie sicher sein, daß ihr regelmäßig zu fressen kriegt. Zuweilen ist die Haustür den ganzen Tag verschlossen und alles Betteln vergeblich. Niemand hört euch. Ihr werdet nicht gebürstet und nicht zum Tierarzt geschafft. Schön, denkt jetzt vielleicht so mancher von euch: Der Tierarzt ist die schlimmste Variante der Hochnasen. Aber wenn ihr Husten habt oder einen verkorksten Magen, werdet ihr schnell begreifen, daß der Tierarzt eine Notwendigkeit ist. Und wenn euch erst der Speichel aus den Lefzen fließt und eure Pfoten euch nicht mehr gehorchen, dann wißt ihr, was eine Tollwutimpfung wert ist. Vor den Schlägern müßt ihr davonlaufen. Ich weiß, daß das nicht so einfach ist. Niemand von uns kann sich seinen Halter aussuchen. Und wenn er euch erst einmal hat, dann müßt ihr ihm treu sein. Die meisten von uns haben so viel Angst, ihre Futtergeber zu verlieren, daß sie selbst dann bei ihnen bleiben, wenn sie gedrillt werden, wenn man ihnen an den Ohren zieht, sie tritt, an den Pfoten durch die Luft wirbelt, ins Wasser wirft, sie anbrüllt, ihnen mit der Leine eins überzieht, auch wenn sie sich längst auf den Rücken geworfen haben.
Ich versuchte, den beiden Welpen beizubringen, daß sie sich nicht allen Abholern anbiedern durften. Sie sollten erst einmal in Ruhe schnüffeln, was sie wert waren. Aber die Welpen lachten nur und hängten sich in mein Fell. Ich warnte sie: »Die Hochnasen holen euch nicht beide. Ihr werdet getrennt.« Aber die Bälger japsten nur übermütig und verbissen sich in meine Rute. »Was macht das schon? Es wird bestimmt lustig werden.« O unschuldige Jugend, für euch erzähle ich meine Geschichte.
Das Heim hatte etwa dreißig Zwinger. Manche Zellen waren doppelt belegt. Die Zwinger umschlossen eine kleine Wiese. Die meisten von uns wurden vormittags nach dem Füttern auf die Wiese gelassen. Nur die Beißer blieben in ihren Zellen. Es gab keine Möglichkeit zu entkommen. Ein zweifacher Zaun ging um das Gelände. Das Tor, durch das die Heimleiterin und die Besichtiger kamen, war doppelt ausgelegt. Zu den Häusern und Stuben jenseits der Zäune kamen wir nie. Auch nie in den Wald auf der anderen Seite, aus dem der Duft nach Wild und anderen Köstlichkeiten in den Zwinger wehte.
Am Anfang war ich so blöd wie alle, die hierherkommen und bis dahin behütet bei ihren Damen, Riesen oder Familien gelebt hatten. Ich dachte, wir seien alle Freunde. Erst als ich nur knapp den Zähnen der großen, langhaarigen Beißerin entgangen war, begriff ich, daß wir bestenfalls Leidensgenossen, eigentlich aber Konkurrenten waren. Jeder war auf den eigenen Vorteil bedacht. Die täglichen Besichtigungstouren der Abholer schafften einen Wettbewerb um die Gunst der Hochnasen, der unser Leben vollständig beherrschte. Wenn die Heimleiterin kam, galt es, ihre Hände für sich zu gewinnen. Denn ihr Wohlwollen konnte die Entscheidungen der Abholer beeinflussen. Und obwohl ich, wie schon gesagt, keinen besonderen Wert darauf legte, von irgendwem abgeholt zu werden, drängelte ich genauso wie alle anderen um die Beine der Leiterin, sprang an ihr hoch, wedelte sie an, quietschte herum, schubste andere weg, die ebenfalls um ihre Gnade warben. In einer solchen Situation der persönlichen Ungewißheit beherrscht uns gewissermaßen das Anubische in einem viel größeren Maß, als wenn die Verhältnisse klar sind. Die Leiterin war die einzige Konstante in unserem Leben. Und darum fühlten wir uns alle von ihr abhängig.
Aber schlimmer noch als dieses Gedrängel und die unwillkürliche Erregung, in die wir uns mehrmals täglich im Werben um die Hochnasen versetzten, war für mich die Zelle. Ein Geviert aus Beton, glatt und versifft, darin ein hölzerner Unterschlupf, in dem der geballte Gestank von Fell, Violensekret, Stroh und Mißmut wucherte. Das erste, was mein Nachbar, der Wilde, nach meiner Einlieferung tat, war, daß er das Bein hob und –durch den Maschendraht in meine Zelle pinkelte. Er blickte mich mit seinen gelben Augen an und grinste. Auf der anderen Seite, die mit einem vollgeschifften Brett verschalt war, knurrte eine Gefleckte, die sich offenbar an die alte Regel hielt, wonach Fähen einander immer hassen. Ich konnte sie nicht sehen, aber ihr Geifer quoll förmlich durch alle Ritzen. Der einzige Platz, der mir anfangs einigermaßen sicher schien, war der an der Zwingertür, durch die nachts ein kalter Wind blies. Die ersten Tage verbrachte ich dort. Das Futter schlang ich in meiner Angst vor den Nachbarn so schnell herunter, daß ich es mehrmals auskotzen und neu schlingen mußte.
Ich bin nicht besonders mutig, das gebe ich zu. An die Gefleckte traute ich mich nie heran. Sie wurde zum Glück auch nie mit uns auf den Hof gelassen. Aber den Wilden, der seinen Freigang stets damit zubrachte, die Zäune nach Lücken abzusuchen, stellte ich eines Tages zur Rede. Das heißt, ich versuchte es. Er war ein struppiger Graubart, nicht viel größer als ich, aber drahtig und von einer Wolke rüder Verachtung umgeben, die es einer guterzogenen Fähe wie mir schwermachte, sich ihm zu nähern. Ich stellte mich ihm dennoch in den Weg und sagte um eine Nuance zu aufgeregt: »Würde es dir etwas ausmachen, nicht immer in meinen Zwinger zu pinkeln?«
Der Wilde hob den Schädel und schaute mich mit seinen gelblichen Augen an. Ich blinzelte sofort beiseite, um ihm keinen Anlaß zum Angriff zu bieten.
»Ja«, sagte er.
»Aber mir macht es auch etwas aus«, sagte ich schrill.
Er hob die Nase nicht vom Boden und grunzte: »Reg dich nicht auf, du wirst sowieso bald geholt, du hübsches Füchschen. Wie heißt du?«
Mini.«
Er grinste. »So hat dich deine Dame gerufen, was? Hast nicht mal einen Anubennamen, Füchschen.«
»Und wie heißt du?«
»Gris.« Er drehte mir seine Lunte zu. Und ich zog mit gesenkter Rute von dannen. Ich war damals noch nicht gewohnt, mir Achtung zu verschaffen. Überdies war der Wilde älter als ich. Kaum war Gris wieder in seinem Zwinger, hob er erneut das Bein gegen meinen Zaun, obwohl er doch draußen genug Gelegenheit dazu gehabt hatte. Ich knurrte verzweifelt. Aber es war, da ich meine sinnlose Angst nicht unterdrücken konnte, ein kümmerliches, singendes Knurren, über das der Wilde nur lachte. Eine geifernde Beißerin auf der einen und einen arroganten Pinkler auf der anderen Seite, es war anfangs die Hölle. Auch deshalb, weil wir nur einmal am Tag herauskamen und darum nur die Wahl hatten, die eigenen Bedürfnisse zu verkneifen oder in die eigene Zelle zu scheißen. Dadurch verkleisterte sich der Zwinger dann zu einem schmierigen Loch, dessen einzig sauberer Platz das Dach der Hütte war. Einmal am Tag wurden die Zwinger mit Wasser ausgespritzt. Dann war der einzige trockene Platz wiederum das Dach der Hütte. Doch dieser Platz war alles andere als ein gemütlicher Schlafplatz. Denn die Gefleckte konnte mich dort sehen und warf sich bellend gegen den Maschendraht. Ich wußte zwar, daß der Zaun sie hinderte, mich zu zerreißen, aber ein geblecktes Gebiß und ständiges Geknurre in unmittelbarer Nähe trug nicht zu meiner Entspannung bei. Noch nie in meinem Leben hatte ich es nötig gehabt, mich zu verteidigen oder mich mit größeren und älteren Anuben anzulegen.
Eines Morgens, nachdem der Wilde seinen Urin in meine Zelle abgeschlagen hatte, pinkelte ich zurück. Das klingt leichter, als es war. Schließlich hatte ich bis dahin als friedliebende Fähe noch nie das Bein gehoben. Und ich hatte Schwierigkeiten mit der Balance. Aber ich traf. Der Wilde war so verblüfft, daß er aufsprang, sich an den Zaun stürzte, auf dem glatten Boden ausrutschte und direkt in die Maschen und in meinen Strahl schlitterte.
»Du Aas!« brüllte er. »Das wirst du mir büßen.« Er schüttelte die Pfoten, weniger drohend, als verärgert über den fremden Geruch. Ich lachte. Aber lustig war das nicht. Denn der nächste Freigang kam. Und die Leiterin öffnete die Tore stets der Reihe nach und darum Gris' Zwinger vor meinem. Er baute sich vor meiner Tür auf. Und ich hatte nur die Wahl, drinnen oder draußen gerauft zu werden. Gris war doppelt so breit und kräftig wie ich. Meine einzige Chance war die Flucht. Und dazu brauchte ich Platz. Also wuschte ich, kaum hatte die Heimleiterin den Riegel zurückgezogen, zwischen ihren Beinen ins Freie, schneller, als der Wilde schauen konnte. Ich bin klein, aber wendig. Und ich war schneller als der Wilde. Er kriegte mich nicht. Schließlich schüttelte er seine ausgefransten Ohren und gab sich den Anschein, als habe er gar nicht vorgehabt, mich zu verbeißen. Allerdings wurde mir der Freigang verleidet, weil ich nun ständig aufpassen mußte, daß mich der Wilde nicht erwischte.
So ging das einige Tage. Der Pinkelkrieg tobte. Morgens streckte sich Gris und gähnte. Dann stolzierte er an meine Käfigseite, spritzte, löste sich aber nicht völlig. Ich pinkelte zurück. Er setzte ein paar Tropfen drauf. Ich ebenfalls. Anfangs gewann er, weil er mit seinem Urin besser haushalten konnte. Aber dann gewann ich, denn die Blase einer Fähe ist größer als die eines Rüden, und ich soff mich abends ordentlich voll. Unser Pinkelkrieg fand Aufmerksamkeit. Und so manche Nachbarn begannen das gleiche Spiel, so daß die Pisseschwaden morgens durch die Käfige zogen und sogar der Hochnase auffielen. Es war ekelhaft, aber ich zwang mich, die Nerven zu behalten. Eines Tages gähnte und streckte sich der Wilde, kam an meinen Zaun und sagte: »Wir müssen verhandeln.«
Ich stellte mich schlafend.
»He du«, knurrte er.
Ich hob nur ein Ohr.
»Du Aas, komm her. So kann das nicht weitergehen. Ich biete dir nur einmal Waffenstillstand an.«
Ich bequemte mich herbei. Der Wilde gab sich friedlich und schaute mich nicht an. Sein grauer Bart stand ihm struppig ums Maul.
»Also«, sagte ich spitz.
»Wenn du aufhörst, höre ich auch auf«, sagte er herablassend.
»Du hast angefangen«, sagte ich.
»Aber du hörst auf«, grollte er.
»Ich höre auf, wenn du aufhörst«, sagte ich. »Kein Problem.«
Aber da war doch ein Problem. Der Kerl mußte dringend. Er wechselte unruhig von einer Pfote auf die andere und zuckte mit den Ohren. »Also bitte!« befahl er.
»Bitte was?«
Es war dem Wilden sichtlich peinlich. Im Gegensatz zu ihm sind wir Hausanuben gewohnt, nicht nur unsere Notdurft genau zu beobachten, sondern auch darüber zu reden. Wir wurden von den Hochnasen eisern erzogen, nicht überall hinzupinkeln. Mich hat meine Dame als Welpe mehrmals mit allen vier Pfoten und meiner Schnauze durch eine meiner Pfützen gezogen. Das war so widerlich, daß ich lernte, auf Orte auszuweichen, die nicht das Revier der Dame beschmutzten. Wenn die Hochnasen mit uns rausgehen, dann in der Hauptsache, damit wir in den Grünanlagen und Wäldern unser Geschäft verrichten. Wenn es geschehen ist, sind sie stets äußerst zufrieden und erleichtert. Sie fühlen sozusagen mit uns mit und nehmen regen Anteil an unseren Ausscheidungen. Der Rüde hatte offenbar eine ähnliche Erziehung nicht genossen und war ziemlich schamhaft. Er war stets Herr über sein Geschäft gewesen, hatte sich zum Lösen ins Gebüsch zurückgezogen und ansonsten markiert. Es fiel ihm schwer, darüber zu reden. Ich wußte, was er meinte, wollte dem ungehobelten Kerl aber nicht entgegenkommen. Darum stellte ich mich begriffsstutzig.
»Also los«, grollte er. »Nun mach schon.«
»Was denn?«
»Du mußt zuerst«, knurrte er.
»Das könnte dir so passen«, lachte ich. »Ich kann mich beherrschen.«
Der Wilde zog sein Gesicht zusammen. Ihn drückte die Blase. »Woher weiß ich, daß ich dir trauen kann«, sagte er verkniffen.
»Dein Risiko«, sagte ich.
Doch für einen Rüden im besten Alter gibt es ein eisernes Gesetz: Niemals nachgeben. Wer einmal nachgibt, hat für immer verloren. Ehe er sich woanders verausgabte und ich ihm dann in sein Areal pinkelte, würde er den Krieg weiterführen. Und das wollte ich nicht.
»Also gut«, sagte ich. »Ich versprech's.«
»Vertrauen ist gut«, murmelte er, »Vorsicht besser. Du zuerst.«
»Hör mal«, erklärte ich ihm. »Ich hasse es, in meine Zelle zu pinkeln. Ich warte, bis wir draußen sind.«
»Du Aas«, grollte er in seiner Not. »Bist ein feiner Pinkel. Ein wohlerzogenes Schoßtier. Dich hat man sicher zweimal die Woche gebadet. Wenn du mich reinlegst, dann kannst du was erleben. Das schwöre ich dir.« Und er schritt mit steifen Beinen durch seinen Zwinger und spritzte sich hinter der Hütte nach draußen ab.
Dann wurde die Gefleckte mitgenommen. Auch wenn ein ziemlich lauter Stummelbeiner in ihre Zelle kam, so wurde mein Leben im Heim nun direkt erträglich. Die Welpen wurden, wie ich vorhergesagt hatte, einzeln abgeholt. Das übrige Balg heulte die ganze Nacht. Und nicht anders machte es das geholte Kleintier bei seinen neuen Haltern. Es waren, soweit ich riechen konnte, echte Unkomplizierte gewesen, mit einer Wolke von Kindern, Omas und Opas im Schlepp. Darüber wenigstens konnte ich den übriggebliebenen Welpen trösten, daß es seine Schwester gut haben würde. Aber als ihn dann ein Riese aus dem Zwinger auf den Arm nahm, wurde mir bange für den Kleinen. Riesen sind an sich nicht schlecht, sie haben nur keine Übersicht über ihre Quadratfüße und Keulenarme. Und wenn ein Welpe das nicht gleich kapiert, so muß er schmerzhaft lernen, den Füßen aus dem Weg zu gehen. Riesen sind oft freundlich, aber rammdösig. Und der Welpe, den sich der Riese ausgesucht hatte, war ebenfalls nicht der Hellste. Ich sah Knochenbrüche voraus.
Mein neuer Nachbar war ein aufdringlicher Kläffer, den ich beim Freigang anknurren und anfauchen mußte, damit er seine Nase von meinem Schwanz nahm. Er war ein geiler Bock, der sich sozusagen immer in Hitze befand, egal ob die Fähe, die er bedrängte, gerade in der Ranz war oder nicht. Mit solchen Rüden kann man keine vernünftige Unterhaltung führen.
Mein anderer Nachbar war dafür wortkarg. Einmal, als die Hochnasen durch waren und wir winselnd wie immer an den Törchen gestanden hatten, fragte ich Gris, ob er denn nicht hier raus wolle. Zuerst rührte er sich nicht, dann stand er plötzlich auf und setzte sich näher an den Maschenzaun, der uns trennte.
»Hör mal, Füchschen«, knurrte er. »Euer aller Gewinsel ist Torheit. Warst du schon mal im Heim?«
»Nein.«
»Die Hoffnung, daß es nur noch besser werden kann, ist Dummheit. Du weißt nie, was die Abholer aus dir machen. Vielleicht kommst du in ein neues Gefängnis. Vielleicht will jemand nur dein Fell. Hübsch ist es ja.«
Ich schüttelte mich.
»Hast du schon mal was von den Fängern gehört? Dachte ich mir. Dann weißt du auch nichts von den weißen Sälen. Nein? Was lernt ihr eigentlich heutzutage noch?« Der Wilde machte Anstalten, sich wieder zusammenzurollen.
»Was sind die weißen Säle?« fragte ich.
»Laß nur. Ich will dich nicht beunruhigen«, grunzte der Kerl.
Zu spät. Ich war schon drauf reingefallen. »Nun sag schon!«
Grau legte seine rauhen Vorderpfoten säuberlich nebeneinander, zog die Stirn in Falten und erklärte genüßlich: »Im weißen Saal stehen Käfige, kleiner als hier, mit Anuben, Katzen, Ratten und Mäusen. Du gehörst den Tierärzten. Aber sie quälen dich nicht, um dich gesund zu machen. Sie schneiden und spritzen an dir herum. Und hinterher wächst dir eine Beule im Bauch, dir tränen die Augen, und du fühlst dich hundeelend. Keiner kommt da lebend raus.«
Mir sträubte sich das Fell. »Das gibt es nicht«, sagte ich. »Woher willst du das wissen?«
»Ich weiß es.«
»Woher?«
»Jemand hat es mir erzählt.«
»Der hat gelogen.«
»Aber«, sagte er, »genau wissen kannst du es nicht.«
»Und du glaubst«, sagte ich, gegen meinen Willen ängstlich, »daß die Abholer uns dorthin bringen?«
»Wahrscheinlich nicht.« Der Struppige blinzelte hämisch. Es war ihm gelungen, den Keim des Mißtrauens in mein Herz zu setzen. Bisher hatte ich mich für relativ klug und wissend gehalten. Aber offensichtlich gab es Dinge, von denen ich nicht mal eine Ahnung hatte. Um mich an dem hochnäsigen Kerl zu rächen, sagte ich spitz: »Und du hast Angst, daß dich einer dorthin holen könnte.«
»Das gelingt niemandem«, sagte er. »Wer mich holt, hat mich nicht lange.«
»Klar hast du Angst«, sagte ich, Rüden kann man immer provozieren, wenn man ihnen Angst vorwirft.
»Dummes Huhn«, grollte Grau. »Was weißt du schon von Angst. Bist dein Leben lang gehegt, gepflegt und gefüttert worden. Ich war schon dreimal hier. Bin schon dreimal abgeholt worden. Ich sage dir, es ist egal, wo man dich gefangen hält.«
»Aber von hier kommst du nicht weg. Du brauchst einen, der dich holt.«
»Schlaues Füchschen«, spottete der Wilde.
»Aber du bist wohl nicht besonders schlau, da sie dich immer wieder kriegen«, sagte ich.
»Davon verstehst du nichts«, sagte Grau verschnupft. »Du bist eine Fähe.«
»Was hat das damit zu tun?«
»Eine Fähe kann nicht richtig streunen. Wenn sie dicke geht, ist es aus. Sie muß in die Kiste.«
»Quatsch«, sagte ich, weil mir kein Argument einfiel. Ich hatte zwar von Streunern schon gehört. Meine Dame hatte sie immer gefürchtet, vor allem dann, wenn ich ranzig war. Sie scheinen aus dem Nichts aufzutauchen, Fähen zu decken und dann wieder zu verschwinden. Sie sind an keine Leine gebunden und oft ziemliche Raufer. Auch meinem Nachbarn sah man seine überstandenen Kämpfe an den zerfetzten Ohren an.
»Es sei denn«, fuhr Grau fort, »du bist neutralisiert.«
»Was?«
Der Wilde grinste. »Beim heiligen Anubis, wo hast du nur gelebt? Du weißt ja gar nichts.« Er legte seine Pfoten übereinander und setzte zu einer weiteren Erklärung an. »Deine Halter schaffen dich zum Tierarzt. Der spritzt dich in Schlaf. Hinterher tut dir der Bauch weh, und du kannst dir nur noch die Fäden aus der Wunde ziehen. Danach bist du keine Fähe mehr. Du kommst nie wieder in Ranz. Kein Rüde interessiert sich mehr für dich.«
»Das ist sicher kein Nachteil«, sagte ich kühl. Aber der Graue lächelte. Er roch meine Angst und sah, daß sich mir das Nackenhaar kräuselte. Ich wünschte, ich hätte ihn nicht zum Reden gebracht. Er wußte anscheinend nur Gruselgeschichten. Aber mein Glauben an die Hochnasen war dahin. Ich brauchte einige Tage, ehe ich mich wieder ans Törchen traute, wenn die Abholer kamen. Dann hatte der Wilde Erbarmen. Er kam an den Zaun und sagte: »Hör mal. Ich geb dir einen Rat. Wenn dich einer mitnehmen will, der dir nicht gefällt, dann beiß ihn einfach.«
»Ich kann nicht beißen«, jammerte ich.
»Dann wird es Zeit, daß du deine Beißhemmung überwindest. Die meisten Senkrechten haben viel zu viel Angst vor unserem Gebiß, als daß sie dich schlagen. Aber wenn du nicht beißen kannst, dann schnappe wenigstens und knurre. Die Hochnasen hassen es, von den Nasen gehaßt zu werden.«
Ich war eigentlich ein friedliebender zurückhaltender Anube. Nur in meinen Welpentagen hatte ich die riesigen Hochnasen angeknurrt, ehe ich begriffen hatte, daß es unter ihnen üblich ist, Fremde in den Bau zu lassen. Sollte ich meine Welpensitten wieder annehmen? Das paßte nicht zu dem Arrangement, das wir mit den Hochnasen getroffen haben. Der jahrhundertealte Vertrag sieht Mißtrauen nicht vor. Die Hochnasen sind darauf angewiesen, daß wir ein Leben lang zutraulich und treu sind. Sie setzen gewöhnlich alles daran, uns zahm zu machen und unser Vertrauen zu gewinnen. Und wenn wir es ihnen nicht geben, verlieren sie die Lust und verstoßen uns. Der Wilde war offensichtlich ein Gesetzloser. Er hatte den Vertrag gebrochen. Er hing an keiner Leine. Doch dafür mußte er auch bezahlen. Keiner fütterte ihn. Keiner schützte ihn. Und im Winter hatte er keinen Ofen.
Immerhin benahm ich mich ein wenig vernünftiger, wenn die Abholer kamen. Mich ergriff die allgemeine Hysterie nicht mehr. Ich blieb zwar nicht liegen, wie Gris, aber ich schmeichelte mich auch nicht mehr ein. Jeder Abholer konnte schließlich ein Feind sein. Und ich verfluchte mein schönes Fell. Oft blieben die Hochnasen bei mir stehen und lobten meine Schönheit und Niedlichkeit. »Schau mal, wie süß! Eine kleine Lassie! Wie heißt er denn?« sagten sie. Und die Leiterin pries mich als liebes Tier an. Mit manchen Kindern wäre ich wohl gern mitgegangen. Aber wenn ein Fieser kam, knurrte ich. Dabei lernte ich eine der wesentlichen Eigenschaften der Hochnasen kennen, die ich bislang nur als Zuneigung verkappt erfahren hatte: Sie glauben, es gelänge ihnen immer, uns zur Freundschaft zu zwingen. Und je mehr wir protestieren, desto hartnäckiger werden sie. Sie füttern und streicheln so lange, bis wir uns unterwerfen. Und wir unterwerfen uns immer irgendwann. Kaum einer von uns hält es durch, ein Leben lang den Halter zu hassen. Irgendwann siegt unsere Erbärmlichkeit. Es ist falsch zu glauben, wir könnten ein Leben lang auf Gesellschaft, Sicherheit, Wärme und Zärtlichkeit verzichten. Die Hochnasen erwischen uns immer. Ich begriff bald, daß in manchen Fällen mein Knurren eher das Gegenteil bewirkte, als ich beabsichtigte. Es schreckte nicht ab, es forderte heraus. Ehe ich mich versah, hing ich am Strick eines Quälers. Ich quietschte so entsetzt, daß die anderen in ihren Zellen zu kläffen anfingen.
»Hilf mir«, flehte ich den Wilden an. Aber dem fiel nichts ein. Stumm stand er am Gitter. Das Halsband würgte mich fast. Aber gegen die Brutalität eines Quälers kann man nichts ausrichten. In meiner Not ließ ich mich auf den Rücken fallen. Aber der Mann riß mich auf die Pfoten. Ich taumelte herum wie ein blöder Tollwütiger. Wenn die Heimleiterin angesichts meines Elends nicht eingegriffen hätte, wäre ich vielleicht jetzt ein Krüppel, ein winselndes Wesen, das den Schwanz unterm Bauch trägt. Jedenfalls wurde mir klar, daß es besser ist, Desinteresse zu zeigen als Ablehnung. Wenn du nicht geholt werden willst, schau die Hochnasen nicht mit deinen traurigen Augen an. Leg die Ohren an, statt sie zu stellen. Das wirkt immer gleichgültig. Gegen Gleichgültigkeit sind die Hochnasen nicht gefeit.
Andererseits wollte ich auch nicht mein Leben im Zwinger verbringen. Und als eines Tages eine kam, ein Mädchen, Sabine hieß sie, umgeben von Gerüchen nach Katze, Haarwaschmittel und Freundlichkeit, gab ich nach. Ich wedelte, beschnüffelte ihre beringte Hand und wurde genommen. Ich kam an die Leine und verließ das Heim. Als ich ging, war es still im Zwinger. Der Wilde hatte sich vollständig in sein struppiges Fell vergraben, weder Nase noch Augen und Ohren waren sichtbar.
Kapitel 2
Draußen wartete Mama. Sie roch nach Katze und Fisch. In meiner Freude, endlich wieder einen Fußweg vor mir zu haben, zog ich nach links und rechts. Immer an Mama vorbei. Und das nahm sie mir übel. Sie war zwar eine Gleichgültige, aber sie wollte nicht mißachtet werden. Sabine nahm mich kurz und führte mich an die aufgerissene Autotür. Da rein. Ich habe Sesselkabinen nie gemocht. Sie vernichten Raum und Zeit. Es gibt sie in zwei Varianten. Meine Dame hatte mir eingeschärft, daß ich ihnen aus dem Weg ging. Bei ihr hießen sie »Auto kommt«. Ich wurde an den Wegrand gestoßen, mußte mich hinsetzen, mich ins Gebüsch, ins Gras ducken. Wenn ein Auto kommt, heißt es gefrieren, erstarren, stillhalten. Wie wenn ein großer Beißer naht, den du nicht provozieren darfst. Dabei zweifle ich, daß sich die rollenden Dinger überhaupt ärgern lassen. Ein kräftiger, schneller und mutiger Rüde, der Autos mehr fürchtete als Beißer und Schläger, hat mir einmal erzählt, daß er von einem der Dinger geschlagen oder gebissen worden sei. Er wußte selbst nicht, was es eigentlich gewesen war. Er weigerte sich, Sesselkabinen zu besteigen, denn er sagte, sie seien dasselbe wie Autos, und er traue ihnen nicht. Innen bestehen die Autos nur aus Polstern. Und sie haben einen eigenen Geruch, der dich gegen alle Außengerüche abschirmt. Autos können den Ort, an dem sie dich schlucken, blitzschnell abschneiden und dir nach einer Zeit einen neuen Ort öffnen, der durch keine Spur mit dem alten verknüpft ist. Sie sind meist mit Tierärzten, Tierheimen oder fremden Wohnungen verbunden. Und du wirst nie begreifen, wie sie es machen. Trotz des jedesmal ungewissen Ausgangs dessen, was die Senkrechten eine Autofahrt nennen, haben die Kabinen auch angenehme Züge. Du kannst einen Anuben verbellen, ohne fürchten zu müssen, daß er an dich herankommt. Die Kabine verschont dich sogar mit dem Geruch des anderen. Sie macht dich zum Überlegenen, ganz egal, wie alt du oder der andere ist.
»Wie heißt er denn?« fragte Mama und grabschte mir ins Fell.
»Mini«, sagte Sabine, »und er ist eine sie. Vier Jahre alt.« Sabine hielt mich auf ihrem Schoß fest und kraulte mich beruhigend. Das war zwar nicht nötig, aber durchaus angenehm. Sie parfümierte mich mit ihrem Waschmittelgeruch. Das ist die Art der Hochnasen, uns in ihren Besitz zu nehmen. In Sabine pochte ein kräftiges Herz. Ihr gehörte ich, und niemand anderem. Mama war eher skeptisch.
Wir fuhren in die steile Straße. Das war, soweit ich auf den ersten Geruch feststellen konnte, ein dicht besiedeltes Revier. An jedem Baum, jeder Ecke, jedem Zaun, jedem Mäuerchen der riechbaren Umgebung schwelten die Duftmarken zahlloser Rüden und Fähen. Hinter den Zäunen erstreckten sich große Gärten. Ein Stück die Straße hinauf erhob sich ein schwarzer Schäfer, der an eine Hütte gekettet war. Die Straße herab kullerten Düfte eines Waldes, die sich an den parkenden Autos und Bäumen stießen und kräuselten. Sabine zog mich an der Leine in einen Garten. Doch ehe ich ihn erschnüffeln konnte, mußte ich weiter ins Haus. Treppen. Ein glatter, kleiner Flur mit Schuhen und Mänteln, dahinter Sauberkeit, Essigreiniger, frische Staubsaugerwolken. Sabine machte mich von der Leine los. Ich konnte in aller Eile das Gelände sondieren. In der Küche gutes gekochtes Fleisch, das vom Tisch herabdampfte, zwei blanke Näpfe, einer mit Wasser gefüllt, mein Freßplatz, gewienerte Schränke, glatter Boden. Im Flur Katzengeruch, aber keine Katze zu sehen, außerdem Spuren eines kleinen Scheißerchens, das für die Welpen der Hochnasen typische Gemisch aus Creme, Wäsche und Exkrementen. Das Sesselzimmer staubfrei, aufgeräumt, ordentlich mit einem Katzensessel. Ein Zimmer voll dunkler Holzmöbel, Rasierwasser, offenbar tabu für die anderen Familienmitglieder, das war Papas Revier. Treppauf Sabines Zimmer, voller aufgeregter kleiner Wirbel aus Kleiderstaub, Parfüm, Plastik, Büchern, Heften, Unordnung und Trotz. Sabine komplimentierte mich auf eine frischgewaschene Wolldecke zu Füßen ihres Bettes. Dies sollte mein Schlafplatz sein. Zwei Türen verschlossen. Dahinter der Schlafplatz von Mama und Papa und das Nest des Welpen.
Nach der ersten eiligen Inspektion wandte ich mich meinen neuen Haltern zu. Und ich kann sagen, ich war nicht unzufrieden. Das Haus mit dem Garten und der Katze war vielversprechend. Meine direkte Vorgesetzte, Sabine, schien unkompliziert. Mama hielt die Speisekammer in bester Ordnung. Blieb abzuwarten, was für mich abfiel. Der Fraß im Heim war gerade geeignet gewesen, den Hunger zu stillen, ein Brei aus Flocken mit unangenehm harten Klümpchen darin, die im Schädel krachten, wenn man draufbiß, ohne dabei das Gebiß ernstlich zu fordern.
Doch zunächst durfte ich nicht in der Küche bleiben, wo Mama mit dem Braten hantierte, sondern mußte wieder an die Leine und hinaus. Auch den Garten durfte ich noch nicht besichtigen. Sabine zerrte mich auf die steile Straße. Leider haben die Hochnasen kein Gefühl für den Vorrang des inneren vor dem äußeren Revier. Bevor ich ins Revier der anderen vorgedrungen wäre, hätte ich lieber zunächst den Garten in Besitz genommen und abgegrenzt. Die Hochnasen haben zwar eine ausgeprägte Nestkultur. Aber für territoriale Abgrenzung haben sie keinen Sinn. Sie holen sich Fremde in ihren Bau. Und außerhalb des Baus gibt es keine Reviere. Klar, daß Sabine nicht verstand, daß ich meine Markierungen zunächst lieber im Garten gesetzt hätte, statt dort, wo andere Anuben sich längst ihre Vorherrschaft gesichert hatten. Überdies war ich an der Leine und darum grundsätzlich im Nachteil. Sobald wie möglich mußte ich Sabine überreden, mich von der Leine zu lassen. Das geht am schnellsten, wenn man sich anständig benimmt. Kein Herumziehen, kein Herumspringen, vielmehr peniblen Gehorsam, sobald die Halterin ruft. Man muß sich nur am Anfang ein bißchen beherrschen. Dabei habe ich schon viele Anuben getroffen, die sich ins Geschirr legen, als müßten sie ihre Halter durch den Wald ziehen. Und wenn man sie laufen ließ, verschwanden sie sofort. Solche Idioten kommen nie von der Leine los. Sie sind ihr Leben lang an den Strick gebunden. Vermutlich ist es ihnen sogar lieber so. Sie sind dann sozusagen frei von jeder Verantwortung, sie müssen sich nie an die Regeln halten. Wenn sie anderen begegnen, werfen sie sich ihnen entgegen, als gelte es, sie zu zerfleischen, werden aber von der Leine zurückgehalten. Kein freier Anube würde so protzen. Leinenanuben lernen nie, wie eine ordentliche Begrüßung abläuft. Sie benutzen ihre Halter, um zu verhindern, daß sie je wirklich mit anderen Anuben Rang und Verhalten abklären müssen. Solche Leinendeppen sind oft Beißer, mindestens aber Flegel. Es ist leicht, ihnen aus dem Weg zu gehen. Problematisch ist es umgekehrt, wenn du selber an der Leine hängst. Ein Flegel schwänzelt um dich herum, steckt seine Nase unter deinen Schwanz, auch wenn du ihn noch so sehr einkneifst, und du kannst ihn nicht abschütteln, solange du um die Beine deiner Halterin kreisen mußt. Und manchmal kannst du von Glück sagen, wenn du zu groß bist, um hochgenommen zu werden. Nur den Unerfahrenen oder hoffnungslos Kindischen erscheint es sicherer, einem anderen Anuben auf dem Arm des Halters zu begegnen. In Wahrheit hast du deine Ehre verloren, wenn man dich auf den Arm nimmt. Und wenn du dem Anuben später zu Pfote begegnest, so lacht er dich im besten Fall aus, im schlimmeren fällt er über dich her, um dich zu demütigen.