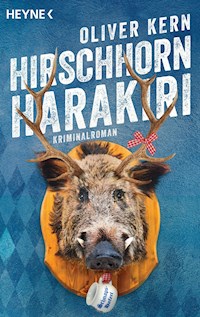9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fellinger-Serie
- Sprache: Deutsch
Fellinger ist ein kerniger Typ: Grantelig und geradeaus. So, wie die Leute eben sind. Dort, wo er lebt. In einer Kleinstadt im Bayerischen Wald. Fellinger wollte immer Polizist werden. Hat nicht geklappt. Sein Knie. Und überhaupt. Jetzt ist er Lebensmittelkontrolleur. Eines Tages beschwert sich ein anonymer Anrufer über das chinesische Restaurant im Bezirk. Vor Ort stellt Fellinger fest, dass die schwarze Soße eklig, aber unbedenklich ist. Ganz anders sieht es da im Kühlhaus aus. Dort hängt ein toter Hund am Haken. Heikel wird die Sache, als sich herausstellt, dass die Halterin verschwunden ist. Fellinger fängt an zu ermitteln … und hört nicht mehr auf!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
OLIVER KERN
EISKALTER HUND
FELLINGERS ERSTER FALL
KRIMINALROMAN
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
PEKING
Ich mag ihn ja selber nicht.
Rein vom Ansehen und von der Sympathie her rangiere ich damit noch hinter der Politesse und dem Pharmareferenten. Unmittelbar vor dem FIFA-Präsidenten, wenn man es auf den Punkt bringen möchte. Wahrscheinlich ist den Leuten, die ich aufsuche, sogar der Gerichtsvollzieher lieber. Der klebt allenfalls mal einen Kuckuck. Das lässt einem Spielraum, man kann existentiell noch weiterwursteln. Ich hingegen, ich mache die Bude dicht, wenn sich der vorgefundene Zustand nicht mit den Bestimmungen vereinbaren lässt. In Berufung auf die Paragrafen drei bis acht LMHV, der Lebensmittelhygiene-Verordnung, drehe ich dann quasi alle Hähne zu, einschließlich des Geldhahns. Und wenn es ums Geld geht, hört der Spaß bekanntlich auf.
Und dann stehe ich da.
Nein, ich mag ihn nicht. Aber es hat sich halt so ergeben. Nicht wegen der Bezahlung, die könnte freilich besser sein. Na ja, immerhin bin ich verbeamtet. Die Mama freut’s, dass sie einen Beamten in der Familie hat.
Persönlich bin ich darauf nicht so stolz, von Erwartungen will ich gar nicht erst anfangen. Geld ist nicht alles. Karriere auch nicht. Allerdings könnte beides helfen. Speziell bei den Frauen.
Womit wir beim Thema wären. Frauen. Bei Frauen kommt es überhaupt nicht gut an. Da machst du keinen Stich, wenn du sagst, was du machst. Weshalb ich dann besser gar nichts sag. Also rein privat betrachtet.
Natürlich kriege ich Angebote. Einschlägige. Aus der Verzweiflung heraus. Aber die anzunehmen verbietet sich; das wäre Amtsmissbrauch, und da bin ich eisern. Im Dienst gibt es keine Freunde und keine Freude.
Den Satz sollte ich mir patentieren lassen.
Nein, beliebt sind die Kollegen und ich nicht. Die in der Zentrale bezahlen uns seit Kurzem sogar Selbstverteidigungskurse. Seit diesem Vorfall vor einem halben Jahr. Da wurde im Bezirk Neutraubling einem Kollegen in den Finger gehackt. Mit einem Küchenbeil. Wohlgemerkt, der Finger war nicht ganz ab. Er konnte die Hand gewissermaßen noch zurückziehen. Allerdings nicht schnell genug. Nur angehackt also. Wobei, was heißt schon »nur«? Schlimm war’s trotzdem, auch wenn es lediglich den kleinen Finger der linken Hand getroffen hat. Den, den ein Rechtshänder am allerwenigsten braucht. Dennoch sähe es unästhetisch aus, wäre er weg gewesen. Zum Glück konnte er wieder angenäht werden. Wobei ich gehört habe, dass die Nerven durch sind.
Nein, ich mag ihn nicht, den Beruf.
Und ja, im Dienst bin ich ein Korinthenkacker.
Freilich, beim Kellerwirt, da schau ich schon nicht so genau hin, weil wenn ich genau hinschauen würde, wüsste ich womöglich hinterher nicht mehr, wohin ich sonntags zum Frühschoppen gehen soll. Diese meine Nachsicht ist dem Kellerwirt bekannt. Nervös ist er trotzdem immer, wenn ich offiziell komme.
Warum der Kellerwirt Kellerwirt heißt, kann ich mir bis heute nicht erklären. Er auch nicht. Der Pauli hat das Wirtshaus übernommen, ebenso wie den Namen. Im Keller ist die Gaststube jedenfalls nicht – und ins Lager schaut besser keiner seiner Gäste rein. Es reicht völlig, wenn ich da nicht so genau reinschaue.
Kurz gesagt, ich will den Stammtisch nicht gefährden. Wo sollten wir denn hin? Zum Reischl? Zum Franzl? Oder zur Linde? Die eigentlich Kastanie heißen müsste, wenn es danach geht, was für ein Baum vorm Haus wächst.
Verstehe einer die Welt …
Wirtshäuser gibt es gerade genug in meinem Verwaltungsbezirk, das Geschäft geht nicht aus. Im Gegenteil, wir kommen nicht hinterher, und das nutzen diese Hundlinge natürlich aus. Die Hygienemoral ist am Boden! Wie so vieles, aber das würde den Rahmen sprengen, sich da jetzt drüber auszulassen, was noch alles darniederliegt bei uns.
Heute ist auf jeden Fall der Chinese dran. Der bei uns am Ort. Unangekündigt, versteht sich. Nicht, dass ich was gegen Chinesen habe. Überhaupt nicht. Gegen Asiaten generell habe ich nichts. Auch nichts gegen Inder. Oder Afrikaner. Also, im Allgemeinen. Ich bin sehr tolerant gegenüber allen Volksgruppen. Außer es geht um die Paragrafen drei bis acht LMHV.
Und der Chinese, also der bei uns am Ort, das ist auch so ein Hundling. Weshalb ich öfter dort vorbeischaue. Dabei hat der eh schon kaum mehr Haare auf dem Kopf. Manchmal mache ich mir den Spaß und fahr auf seinen Parkplatz. Nur so, um zu sehen, wie ihm die Augen rausquellen.
Heute ist es allerdings ernst. Wegen des anonymen Anrufs, der gestern in der Dienststelle einging und umgehend an mich weitergeleitet wurde. Das Los, wenn man im Außendienst ist. Im Büro kann man so einen Anruf leichter ignorieren. Es klingelt, ein Blick aufs Display. Du hast alle Zeit, das Für und Wider abzuwägen. Aber draußen, im Auto, in der Hektik, da gehst du aus einem Reflex heraus ans Handy – und zack, schon haben sie dich am Wickel.
Nicht, dass es ihm nicht geschmeckt hätte, hat der Anrufer gemeint, aber irgendwas sei komisch gewesen. Da soll unsereins was mit anfangen können, mit so unkonkreten Aussagen. Irgendwas komisch. Die schwarze Soße oder so.
Schwarze Soße?
Soja?, habe ich nachgefragt.
Nein, hat er gemeint, Soja war’s nicht, das kennt er von daheim.
Anonym war der Anrufer jetzt auch nicht wirklich. Man kennt sich halt im Ort. Zumindest kenne ich viele und Leute mit eindringlichen Stimmen im Besonderen. Und genau diejenigen sollten nicht versuchen, ihre Stimme zu verstellen, und schon gar nicht probieren, Hochdeutsch zu reden. Das funktioniert sowieso nie und hört sich noch schlimmer an, als wie wenn die im Fernsehen sich bemühen, gezwungen Bayerisch zu sprechen.
Soja! Grad als ob dem Grundmüller Sigi seine Frau daheim mit Soja kochen würde! Es ist ja schon verwunderlich, dass die überhaupt zum Chinesen gehen.
Ich steige also aus. Am späten Vormittag ist der Parkplatz vor dem Peking noch leer. Mittagstisch ist erst ab elf. Durchs Fliegengitter vor dem Küchenfenster sehe ich schon, wie sie drinnen hektisch werden. Und das ist ja nicht unbegründet. Nicht nur, weil der vermeintlich unbekannte Anrufer irgendwas komisch fand und der Rumäne sich nach dem Biesln nicht die Hände wäscht. Ja, beim Chinesen kocht tatsächlich ein Rumäne. Das wissen die wenigsten. Noch weniger wissen, dass er es mit dem Händewaschen nicht so genau nimmt, wenn er vom Klo kommt. Das weiß eigentlich nur ich, weil ich mal einen Abstrich gemacht habe. So was erzähle ich im Normalfall nicht weiter und belasse es bei einer Ermahnung. Fraglich, ob’s was hilft.
Nicht, dass ich den Rumänen etwas vorzuwerfen hätte. Ich habe nämlich auch nichts gegen Europäer. Osteuropäer eingeschlossen. Außerdem sind bei mir keinerlei Aversionen gegen rumänische Kochkünste vorhanden.
Wobei – Kunst? Die machen viel mit Maisbrei und so Eingewickeltes. Schafhack in Kraut. Eintöpfe. Ob das die asiatische Küche nicht ein klein wenig verfälscht? Rein objektiv betrachtet. So was beschäftigt mich halt, auch wenn ich nicht zum Sternevergeben komme.
Was das Peking im Speziellen angeht, habe ich gehört, dass der Hofer Erwin letzte Woche dort was Sanitäres gemacht hat. Angeblich gab es eine Verstopfung, und die Rohre verlaufen unterm Reislager, was praktischerweise einen Ablauf hat, wenn man es mal ausspritzen möchte. Nur – wenn es in die andere Richtung geht und was von unten hochdrückt, ist das wiederum nicht so geschickt. Für den Reis und auch geruchsmäßig. Und dass der Erwin nicht immer alles so hundertprozentig dichtkriegt, das ist jetzt auch kein Geheimnis.
Wie ich mein Equipment aus dem Kofferraum hole, sehe ich den Herrn Luang im Eingang auftauchen. Rechts und links stehen da zwei chinesische Löwen. In Gold und Rot lackiert. Diese Torwächter sind freilich aus Plastik. Die Chinesen sind ja ganz groß, wenn’s darum geht, was in Plastik zu machen. Allerdings würde von uns auch keiner erwarten, dass die Löwen aus Stein und mit Blattgold verziert wären. Auf jeden Fall haben die Viecher ein komisches Grinsen, und das passt zum Herrn Luang. Der lächelt vergleichbar verkniffen und wiegt dabei leicht seinen Kopf. Nicht so übertrieben, wie es die Inder machen, aber auffällig ist es allemal. Kulturell geschult, wie ich bin, weiß ich natürlich, dass sein Lächeln nichts zu bedeuten hat. Das ist eher wie ein Krampf im Gesicht. Mehr nicht. Wenn mein Opa, Gott hab ihn selig, zu seinen Lebzeiten zu tief ins Glas geschaut hat, bekam er des Öfteren eine Maulsperre. So zumindest hat es die Oma immer genannt. Maulsperre. Ich habe das spaßeshalber gegoogelt, und fachlich korrekt heißt es Kiefersperre. So würde es hier in der Gegend keiner nennen, versteht sich. Jedenfalls muss ich immer an Maulsperre denken, wenn der Herr Luang mir entgegenlächelt. Das macht er eben, weil er aus dem Land des Lächelns kommt und dem gerecht werden muss, selbst wenn der Mann von der Lebensmittelüberwachung vor der Tür steht.
Wo ich nicht lange stehen bleibe, sondern am Wirt vorbei mit Schwung die Gaststube betrete. Selbstredend lehne ich den Pflaumenschnaps ab, den er jedem Gast nach der Bestellung aufdrängt, und der schon auf der Anrichte bereitsteht. Ich marschiere gleich durch in die Küche. Herr Luang hört auf zu lächeln, lässt den Pflaumenschnaps, wo er ist, und trottet hinterher.
Ich habe persönlich nichts gegen den Mann, es ist alles von Amts wegen, nur um das noch mal zurechtzurücken.
Der Rumäne tut überrascht und nestelt an seiner Schürze herum. Die ist nahezu reinweiß, womit klar wird, dass er sie eben frisch angezogen hat. Wenn ich jetzt in irgendeiner Ecke die alte finde, die er bis vor zehn Sekunden noch umgebunden hatte, dann wird es eng fürs Peking. Aber ich schaue nur oberflächlich herum, habe keine Lust, mich zu bücken und unter die Regale zu leuchten. Schon gar nicht unter den Ofen oder die Spüle. Später vielleicht, wenn sie mir blöd kommen, dann hole ich meinen Teleskopstock mit Spiegel aus der Tasche.
»Ich hätt gerne eine Probe von der schwarzen Soße!«, sage ich, weil ich nicht weiß, wie man auf Rumänisch einen guten Tag wünscht.
Der Koch tauscht einen Blick mit seinem Chef. Der lächelt kopfwackelnd zurück, woraufhin der Rumäne von einem der Töpfe auf dem Gasherd den Deckel hebt. Ich muss nächstes Mal besser aufpassen, ob es bei Herrn Luangs Lächeln und Wackeln unterschiedliche Nuancen gibt.
Mit stoischer Miene halte ich meinen Zinken über den Topf und atme langsam ein. Sie riecht nicht sonderlich lecker, die schwarze Soße. Stinkt jetzt aber auch nicht direkt. Der fettige Glanz auf der Oberfläche erinnert an das Altöl, das aus dem alten Hanomag meines Vaters rausläuft, wenn der alle heilige Zeiten mal einen Ölwechsel macht.
»Muss ich was wissen?«, frage ich und greife nach einem Kochlöffel.
»Alles gut!«, behauptet der Rumäne.
Langsam rühre ich um. Klumpen treiben an die Oberfläche. »Sind das Speckkäfer?«
»Schwarze Bohnen«, verbessert der Küchenchef.
Mit der Pipette ziehe ich mir eine Probe und fülle sie ordentlich in ein dafür vorgesehenes Döschen mit Schraubverschluss ab. Dann sauber beschriften, vor den Augen des Kochs und des Chinesen. Zwei Zeugen sind immer besser als einer. Das Ganze wird zudem fotografiert, schriftlich dokumentiert und muss zu guter Letzt gegengezeichnet werden. Alles nach Vorschrift und damit hinterher keiner mit einem Anwalt kommen kann, der dann behauptet, die schwarze Soße stamme gar nicht aus dem Peking, sondern vom Imbiss hinter der Tankstelle.
Noch während ich die Probe sachgerecht in meinem Untersuchungskoffer verstaue, fällt mir auf, dass die Küchenhilfe – optisch eine Asiatin, allerdings mit stark ostdeutschem Dialekt behaftet – verdächtig festgefroren vor dem Eingang zur Kühlung steht. Und zwar schon, seit ich die Küche betreten habe.
»Ist da was kaputt?«, frage ich und deute in ihre Richtung. Poröse Dichtungen bei Kühlaggregaten sind das Haupteinfallstor für Schädlinge, muss man wissen.
»Oha, nix kaputt, Hell Fellingel«, antwortet Herr Luang.
Ich weiß bis heute nicht, ob das mit dem »l« statt »r« wirklich ethnologisch verwurzelt oder nur so eine Masche von ihm ist.
»Ja, und warum wäscht die dann nicht den Salat, sondern drückt sich dort vor der Kühlung herum, als müsste sie die Kronjuwelen bewachen?«
Herr Luang wedelt hinter meinem Rücken mit der Hand und meint tatsächlich, ich würde das nicht mitkriegen. Seine Küchenhilfe schaut jetzt noch verwirrter drein, bleibt aber an Ort und Stelle.
»Also, jetzt muss ich da einen Blick reinwerfen!«
Eigentlich war ich ja mit der schwarzen Soße noch gar nicht fertig. Sicher gibt es im Lager noch mehr davon, weil ich dem Rumänen nicht abnehme, dass der diese kulinarische Preziose jeden Tag frisch zubereitet. Da steht bestimmt irgendwo ein Eimer davon rum, aus dem er nach Bedarf was rausschöpft und aufkocht. Aber jetzt bin ich zu neugierig darauf, was die da in der Kühlung haben. Auffälliger kann man sich ja kaum verhalten. Ich ziehe also meinen Kopf zwischen die Schultern und stiefle schnurstracks auf die sächselnde Asiatin zu.
Dass die schmächtige Gestalt aus Sachsen stammt, das weiß ich übrigens seit dem letztjährigen Volksfest. Da war sie am Nebentisch gehockt. Im Dirndl. Man stelle sich das mal vor, im Dirndl! Wo sie doch nichts hat, womit sie das ausfüllen könnte. Also rein gar nichts! Auf jeden Fall hat sie sich vom Wollner Franz mindestens drei Mass spendieren lassen, geschunkelt, was das Zeug hielt, und jedes Lied, das die Blaskapelle gespielt hat, in breitem Sächsisch mitgesungen. Was die drei Mass anbelangte, war das rausgeschmissenes Geld für den Wollner. Den habe ich nämlich zwei Stunden später, als ich aus dem Toilettenwagen gekommen bin, allein nach Hause torkeln sehen. Na ja, vielleicht hat er freiwillig verzichtet, wegen des Dialekts.
Die Küchenhilfe, jetzt ohne Dirndl, dafür mit Papierhäubchen und Kochkittel – ebenfalls auffällig frisch, wenn auch mit leichtem Grauschleier –, tritt erschrocken zur Seite, weil ich so auf sie losrausche.
Ich drücke den Hebel nach unten. Herr Luang samt Rumäne hängen mir im Nacken. Trotzdem, sich gegen die Stahltüre zu schmeißen, um zu verhindern, dass ich sie aufziehe, trauen sie sich dann doch nicht. Kalter Nebel wabert mir aus der Kühlung entgegen. Temperaturmäßig schaut alles gut aus. Auch die Dichtung, nagelneu. Aber ich sehe natürlich sofort, warum der Chinese nicht wollte, dass ich einen Blick reinwerfe. Da hängt was von der Decke, was dort nicht hingehört. Zumindest nicht in die Kühlung eines deutschen Chinarestaurants.
»Wem gehört der Hund?«, frage ich so trocken wie die Kälte, die mich umfängt.
AKTENZEICHEN XY
»Ist nicht fül Gäste, ist fül Familie, kommt zu Besuch aus Wuwei, nächste Woch’«, stammelt der Chinese, überraschend verständlich dafür, dass die Panik auf seinen Stimmbändern reitet. Ich gehe näher ran, weil ich es nicht glauben kann. Aufgehängt wie eine Sauhälfte, den Fleischerhaken durchs Hinterbein getrieben, wie man es halt so macht, baumelt der nackte Hund in der Kälte. Tiefgefroren. Das Fell sauber abgezogen, der Kadaver ausgeweidet. Fachmännisch geschlachtet, da kann man nichts beanstanden. Aber eindeutig ein Hund. Mittlere Größe, Schulterhöhe geschätzt etwa ein halber Meter, Gewicht rund dreißig Kilo, wenig Fettanteil, ordentlich Muskelfleisch, was auf eine gesunde Ernährung schließen lässt. Kein Straßenköter jedenfalls, den man einfach geschwind so aberntet. Mal abgesehen davon, dass es die bei uns in Bayern gar nicht gibt, die herrenlosen Streuner. Dafür haben wir eine zu große Jägerdichte, und die schießen bekanntlich auf alles, was vier Beine und keinen Mensch dranhängen hat. Wobei, selbst das stört in manchem Fall nicht, und Nordic Walker … mei, da würde ich aufpassen und immer helle Kleidung tragen.
»Wem gehört der Hund, wo haben Sie den her?« Ich werde etwas lauter. Eigentlich müsste ich den Laden jetzt sofort zusperren, aber das behalte ich mir fürs Erste noch vor. Erfahrungsgemäß verliere ich damit sonst augenblicklich jede Form von Kooperation. Dann schalten sie auf stur, und ein sturer Wirt ist schlimmer wie jedes Maultier.
»Wal kaputt«, erklärt Herr Luang. »Schon tot, übelfahl’n.«
»Überfallen?«
»Überfahren«, korrigiert der Rumäne und brummt dann, an seinen Chef gewandt: »Ich hab gesagt, gibt Problem.«
»Da hat er aber so was von mitgedacht, Ihr Chefkoch«, bestätige ich. »Wer hat den Hund überfahren?«
»Cousin Tian«, kommt es zögerlich.
»Oha, wie praktisch, wo doch das Familienfest mit der Verwandtschaft aus Wauwau ansteht.«
»Wuwei«, korrigiert mich Herr Luang. »Hund wal schon tot«, erinnert er mich und zeigt auf den Brustkorb. Die Rippen sind dort tatsächlich eingedellt. »Flisch, aba tot!«
»Tot hin oder her, das gehört gemeldet. Wo kämen wir denn da hin, wenn man alles gleich mitnimmt, was man überfährt, um es dann der Familie vorzusetzen?«
»Spart Abdecker«, wirft der Rumäne ein.
Jetzt bringen die zwei mich aber auf die Palme. »Der Hund kommt weg! Nein, er bleibt hier!«, korrigiere ich mich, weil ich mir in dem Moment vorstelle, wie der Kadaver langsam in meinem Kofferraum auftaut und das Stinken anfängt. Heute komme ich nämlich nicht mehr in die Dienststelle, und mein Gefrierfach zu Hause ist zu klein. Das gäbe nur eine Riesensauerei bei den Temperaturen. »Ich lass ihn abholen«, verkünde ich. »Bis dahin geht mir keiner in die Kühlkammer!«
»Mit was soll ich dann kochen?«, fragt der Rumäne.
»Jedenfalls nicht mit dem Hund!«
Herr Luang sagt gar nichts mehr und schaut mich nur entsetzt an. Ich will schon aus der Kühlkammer raus, weil ich langsam Frostbeulen ansetze, da fällt mir noch was ein.
»Wo ist das Halsband?«
Der Rumäne verweist mit einem Kopfnicken auf seinen Chef, und ich ertappe mich dabei, wie ich kontrolliere, ob der Herr Luang es sich umgelegt hat.
Im Tross gehen wir quer durch die Küche zu einem Büfett, bei dem der Chinese eine Schublade aufzieht. Er muss nicht groß drin rumkramen, sondern holt gleich eine breite Gliederkette heraus. Ich will gar nicht wissen, welche Souvenirs der Herr Luang sonst noch aufbewahrt von dem, was dem Cousin Tian so alles vor den Kühler gerät. Fast demütig reicht er mir das Hundehalsband. Die Marke hängt auch noch dran. BEAVER ist da eingraviert und eine Nummer. 270865-4.
Beaver!
Können die Leute ihren Hunden keine gescheiten Namen mehr geben? Hasso oder Rex? Von mir aus auch Arco.
»Das nehme ich mit!«, sage ich. Keine Einwände. »Und jetzt will ich noch wissen, wann und wo der Cousin Tian den Hund überfahren hat?«
»Dienstag, spät. Nix weit, zweihundelt Metel. Hund ganz flisch tot«, erklärt Herr Luang und deutet in die Richtung, in der seiner Meinung nach die Bayerwaldstraße rauf nach Oberfrauenwald und Waldkirchen verläuft. Wir haben hier in der Gegend verdammt viel Wald, egal wo man hinschaut, denke ich und wiederhole die Aussage des Chinesen. »Zweihundert Meter.« Nicht sonderlich weit. Ich könnte zu Fuß die Straße abgehen und nach dem Tatort Ausschau halten. Falls es nach Dienstag überhaupt noch Spuren gibt, zumal wir bereits Freitag haben und es dazwischen mindestens einmal gewittermäßig geregnet hat.
Ich zeige auf die Tür zur Kühlung. Warnend. Versichere mich, dass meine Anweisung verstanden wurde, und verlasse die Küche. In der Wirtsstube sitzen die ersten Gäste. »Heute gibt es nur Reis und Gemüse«, erkläre ich im Vorbeimarschieren und ernte fragende Blicke. Herr Luang, der mir an den Fersen hängt, wedelt mit den Händen und lächelt. Ich bin mir nicht sicher, ob er seine Kundschaft damit beruhigen kann. Nachher vielleicht, mit einer zweiten Runde Pflaumenschnaps.
Draußen auf dem Parkplatz steht die Sächsin und raucht. Ich sehe ihr sofort an, dass die Zigarette nur ein Vorwand ist. Sie hat sogar den Betonkübel, der als Aschenbecher dient, ein Stück verrutscht, sodass ihr Standort vom Küchenfenster des Peking nicht erkennbar ist. Mich juckt es an der Stelle, dort, wo es mich immer juckt, wenn etwas zum Himmel stinkt. Dort, zwischen den Schulterblättern, wo ich so schlecht hinkomme, was es besonders unangenehm macht. Das ist psychosomatisch, und es mag jetzt vielleicht arg abgedreht und in der Tendenz metaphysisch klingen, aber es kündigt Unheil an. Weshalb ich überhaupt erst darauf aufmerksam geworden bin. Auf diese – nennen wir es beim Namen – Gabe!
Ich bin nicht abergläubisch. Nicht einmal meine Oma hat mich da anstecken können, obwohl die an alles geglaubt hat, was man auf esoterischer Ebene so glauben kann. An die Bauernregeln hinten auf dem Abreißkalender von der BayWa, an das Horoskop im Goldenen Blatt und an die Prophezeiungen vom Mühlhiasl und vom Nostradamus. Wahrscheinlich hätte sie auch an den Maya-Code geglaubt, wenn sie jemals davon gehört hätte. Sie hatte nie Zweifel, selbst wenn sich was nicht erfüllt hat. Ich hingegen betrachte diese unangenehme Form der Erleuchtung unter einem anderen Aspekt. So wie Peter Parker seinen Spinnensinn hab ich das Unheil-Jucken, und da gibt es nichts dran zu deuteln, auch wenn ich das natürlich niemandem erzähle. Da halte ich es wie meine Vigilanten-Vorbilder aus der Comicwelt.
Jucken tut es mich schon seit der Kindheit, ohne dass ich sagen kann, wann genau es anfing. Was letztlich in Erinnerung blieb, waren vielmehr die dramatischen Vorfälle, die sich auf diese Weise ankündigten. Zum Beispiel im Winter 1976, als der Löffelmacher Pepi gemeint hat, er müsste mit seinem Schlitten das Stalldach runterrodeln, und dabei direkt in der Jauchegrube gelandet ist. Die trotz des strengen, anhaltenden Frostes nicht genug zugefroren war, dass die Eisdecke seinen Aufschlag ausgehalten hätte. Da hat es sakrisch gejuckt, bevor er losgeschlittert ist, und so lang, bis sie ihn endlich rausgezogen hatten. Solcherart Geschichten gibt es einige, und gerade jetzt juckt es fast ebenso heftig wie damals, als der Pepi seine gewagte Schlittenpartie angetreten hatte. Es juckt, und ich reagiere darauf. Gespielt teilnahmslos geselle ich mich zu der Sächsin. Sie bietet mir eine Zigarette an, und ich schüttle den Kopf, woraufhin sie bemüht ist, den Rauch von mir wegzublasen.
»Isch kenn den Hund.«
»Ah wa’?«
»Wissen Se, als där Dian den Hund gebrocht hat, hat där noch Fell gehabt.«
Ich versuche, nicht überrascht zu wirken, und denke an die drei Mass, die der Wollner Franz hat springen lassen. »Und so mit Fell, da haben Sie den Hund wiedererkannt?«
»Nu, isch wees nisch, obs därselbe war, abr de Frau Boschinga, die hat och so een, so schwarz mit unten weiß.«
»Und die Frau …?«
»Boschinga!«
»… die wohnt wo?«
»Sonneneck!«, sagt sie und deutet mir die Richtung. Ich verstehe und weiß nun auch, wen sie meint. Besagte Straße ist ja gleich oberhalb vom Kellerwirt. Wenn ich eine kleine Runde drehe, könnte ich im Anschluss dort was zu Mittag essen. Also nachdem ich mich bei der Frau Poschinger danach erkundigt habe, ob sie einen schwarzen Hund mit unten weiß vermisst.
Warum ich das mache, was ich mache?
Weil ich völlig talentfrei bin. Im herkömmlichen Sinne zumindest. Handwerklich habe ich zwei linke Daumen. Keinen Sinn für Ästhetik, hat die Höllmüllerin mir mal vorgeworfen. Zahlen? Keine Chance. Naturwissenschaftlich bin ich nicht zurechnungsfähig, das bisschen Chemie, das ich für den Job brauche, mal ausgenommen. Und Singen? Eine Katastrophe. Was ich gut kann, ist rumschnüffeln. Und ein Gespür haben. Da bin ich nicht schlecht drin. Deshalb wollte ich ja zur Polizei. Nicht so wie der Lechner natürlich. Mich an den Straßenrand stellen und die Autofahrer mit Radarstrahlen beschießen oder ins Röhrchen blasen lassen, das wäre jetzt gar nichts für mich. Die Schiaghaferl konnte ich in der Schule schon nicht leiden, und was anderes sehe ich in dieser Tätigkeit nicht. Der ist zu schnell gefahren und besoffen obendrein, das sag ich der Frau Lehrerin, dann gibt sie mir bestimmt einen Stern, oder ich werde für den Rest des Jahres vom Tafeldienst befreit. So in der Art halt!
Freilich, die Kripo hätte mich durchaus interessiert. Schon allein, weil ich da meine Gabe gezielt hätte einsetzen können. Gehobener Dienst. Den Leuten auf den Zahn fühlen. Kriminalisieren. Gerechtigkeit üben …
Da bin ich einfach geprägt, weil ich mit dem Papa früher immer Aktenzeichen XY schauen musste. Es gab ja damals auch nichts anderes samstagabends, wenn man nicht auf Volksmusik oder Quizshows abgefahren ist, die von untersetzten, pseudolustigen Moderatoren in steifen Anzügen präsentiert wurden. Also: Aktenzeichen. Ein Pflichtprogramm bei uns daheim. Echte Verbrechen, laienhaft nachgestellt, aber trotzdem erschreckend für ein Kind in meinem Alter. Was hab ich mir oft in die Hose geschissen – nur sprichwörtlich, versteht sich –, wenn Eduard Zimmermann eine Liveschaltung zu Peter Nidetzky nach Wien oder zu Konrad Toenz nach Zürich angekündigt hat. Aus heutiger Sicht pädagogisch völlig verwerflich, aber darüber hat man sich nicht nur bei uns auf dem Hof vor dreißig Jahren keinerlei Gedanken gemacht. Die Mama nicht und der Papa erst recht nicht. Der fand auch eine gescheite Bockfotze erzieherisch wertvoll und hat mich damit häufiger schwer beeindruckt. Pädagogik war damals schlichtweg noch nicht erfunden. Genau wie Grüne Politiker im Landtag. Aktenzeichen XY ungelöst konnte mich somit nachhaltig prägen, und seit jener Zeit wollte ich unbedingt zur Kripo.
Das daraus nichts geworden ist, lag in erster Linie am Knie. Am rechten. Das lässt manchmal aus. Ausgeprägte Chondropathia patellae, Knorpelschaden an der Kniescheibe. Leider angeboren. Das ist was ganz Seltenes. Mein persönliches Kryptonit.
Der Dr. Kremmling, mein Kinderarzt von damals, hat da sogar eine Abhandlung drüber geschrieben. Ohne dass ich je Tantiemen dafür gesehen habe. Das schmiere ich manchmal dem Papa aufs Brot: dass er sich da hat übern Tisch ziehen lassen, mit dem besonderen Knie von seinem Sprössling. Das stinkt ihm heute noch, zumal er Ärzte nicht ausstehen kann und Krankenhäuser scheut wie der Teufel das Weihwasser.
Also das Knie. Es ist jetzt nicht so schlimm. Wer es nicht weiß, dem fällt es nicht auf. Das liegt auch an dem Schongang, den ich mir angewöhnt habe. Da hatte ich immerhin vierzig Jahre Zeit dazu, selbst wenn es auf Dauer und mit fortschreitendem Alter schlecht fürs Kreuz ist. Aber wie gesagt. Es geht schon – oder noch –, und es schwächelt nur hie und da. Gelegentlich haspel ich halt deswegen. Wenn ich nicht gerade vom Kellerwirt komme, mit drei, vier Bier intus, kann ich mich auch ganz elegant wieder abfangen. Privat kein Thema, aber für den Polizeidienst. Das ginge natürlich nicht, haben die vom Eignungsprüfungskomitee damals in Landshut gemeint. Stellen Sie sich vor, Sie verfolgen einen Flüchtigen, und dann lässt Ihr Knie aus.
Mein Vorschlag, dass ich dem Flüchtigen stattdessen ja hinterherschießen könnte, kam nicht so gut an. Trotzdem wurde ich zum Schießstand geschickt. Und das war dann fatal. Ich habe alles getroffen, bis auf die Zielscheibe. Dass da alle Anwesenden lebend rausgekommen sind, grenzt heute noch an ein Wunder.
Ja, das Knie und das Zielwasser. Ich merke, wie der alte Gram wieder in mir hochsteigt, während ich die Bayerwaldstraße entlangschlendere und nach Spuren Ausschau halte. Wie schon vermutet, fällt mir an der Stelle, die mir die Mai Ling beschrieben hat, nichts auf. Der Regen hat saubere Arbeit geleistet. Schwül ist es deswegen wie die Sau. Überhaupt ist es hundsmäßig warm für Anfang Juni. Wenn man bedenkt, dass bis vor vier Wochen noch Schnee am Hochficht lag! Ich schau rauf zum Geiersberg. Auch dort droben: alles grün. Der Gedanke an Schnee hilft leider nicht gegen die Schwitzerei. Ich hätte das Auto nehmen oder zumindest was Kurzärmliges anziehen sollen.
Vor der Einmündung zum Sonneneck sind die Haselnussstauden sehr hoch und ziemlich dicht, sie hängen weit über Leitplanke und Gehsteig. Ich muss schon fast auf die Fahrbahn ausweichen. Wenn man da ein bisserl zu schnell dran ist, kann es schon sein, dass man einen Hund übersieht, der aus der abzweigenden Straße geschossen kommt. Was nicht entschuldigt, dass man ihn einfach in den Kofferraum packt und ihm später das Fell über die Ohren zieht.
Durch die Blätter schimmert das Ziegeldach vom Kellerwirt. Ein kühles Bier wäre jetzt schon eine gute Alternative, um der Hitze Herr zu werden, überlege ich, und beeile mich, einen schnellen Abschluss meiner Mission zu finden.
Die Poschinger-Villa ist das letzte Haus in der Sackgasse und hat den besten Blick, runter bis zum Freudensee. Den ich von meinem Standpunkt vor dem Gartentor freilich nicht sehe, weil die Thujenhecke so hoch ist, dass selbst der Dirk Nowitzki nicht drüberschauen könnte. Warnung vor dem Hund steht über der Klingel, die in die Granitsäule eingelassen ist. Besser, ich hätte erst den Lechner angerufen, ob die Frau Poschinger ihr Viecherl als vermisst gemeldet hat. Weil, was wenn der Hund in der Kühlung jetzt gar nicht der Poschingerin ihrer ist? Falls der jetzt gleich anschlägt, wenn ich läute, gehe ich stiften. Mit einem Schulterzucken drücke ich den Messingknopf. Während ich auf das Surren warte, lege ich die Hand aufs Gartentor – das einfach aufgeht. Es war gar nicht richtig ins Schloss gezogen, was so betrachtet einer Einladung gleichkommt.
Der Rasen ist frisch geschnitten. Genau wie die Rabatten. Insgesamt alles sehr gepflegt. Bestimmt von einem Gärtner. Der Poschinger Franz hat natürlich auch keine billigen Waschbetonplatten verlegen lassen. Über dunklen Granit marschiere ich zum Haus. Granit hat der Poschinger gerade genug gehabt. Insgesamt vier, fünf Brüche, soweit ich mich erinnere. Bis ihn vor drei Jahren ein Herzinfarkt weggeputzt hat, obwohl er gar nicht so schlecht beieinander war. Ich meine, ich bin ihm sogar mal beim Joggen begegnet. Also, er ist gejoggt, ich war mit dem Traktor im Wald.
Kann sein, dass er sich schlicht übernommen hat, der Poschinger. Mit all dem Sport. So jung war er ja nicht mehr. Vielleicht frage ich mal die Höllmüllerin, ob es wirklich ein Herzinfarkt war. Manchmal erzählen die Leute ja auch bloß irgendeinen Schmarrn.
An der Haustür probiere ich gedankenversunken erneut die Klingel aus. Die Helga hat das schon schlau gemacht. Hat jetzt eine saubere Villa, einen Haufen Geld auf der hohen Kante und ihre Ruhe. Nur keinen Hund mehr, wie mir scheint. Denn trotz der Warnung am Gartentor wird nicht gekläfft, und es schießt auch keiner ums Eck, um mich ins Bein zu zwicken. Wofür ich recht dankbar bin.
Nachdem ich eine gute Minute gewartet habe, beschließe ich, eine Runde ums Haus zu machen, nur um alle Eventualitäten geprüft zu haben. Nachher flackt die Poschingerin hinten im Garten und sonnt sich. Hoffentlich nicht oben ohne, überlege ich unbehaglich, gehe aber trotzdem weiter. Bei der Doppelgarage spähe ich durchs Fenster. Ich entdecke den M-Klasse Mercedes, mit dem der Franz immer zum Joggen gefahren ist. Und das 911er Cabrio, das die Helga sich nach der Beerdigung geleistet hat. In gedecktem Silbergrau, wie es sich für eine trauernde Witwe gehört.
Mit dem Auto ist sie jedenfalls nicht unterwegs. Dass sie zu Fuß bis in die Stadt läuft, glaube ich jetzt auch nicht, und der Hund zum Gassigehen ist nicht mehr vorhanden. Das steht zumindest zu vermuten, und ich vermute es immer mehr. In seinem jetzigen Zustand könnte sie ihn allenfalls hinter sich herziehen. Solange er nicht auftaut, rutscht er bestimmt prima über den Asphalt. Ich versuche das Bild aus meinem Kopf zu kriegen und schlendere in den hinteren Garten. Für einen Swimmingpool hätte die Poschingerin weiß Gott genug Platz, und der Ausblick über den See ist noch besser, als ich ihn mir vorgestellt habe. Der gemauerte Grill zu Beginn der Terrasse hat allerdings ein bisschen Rost angesetzt. Wahrscheinlich hat den nach dem Ableben vom Franz keiner mehr benutzt. Daneben, in dem Kübel mit Gartenabfällen liegt ein Strauß roter Rosen, den man jetzt rein von der Frischequalität her noch nicht hätte wegschmeißen müssen. Ansonsten ist die Terrasse leer. Die Teakholzliegestühle stehen zusammengerückt in der Ecke unter grünen Abdeckplanen. Auch die Auflagen auf den Rattansesseln fehlen. Mittlerweile kommt mir die Sache mehr als spanisch vor. Ich schirme die Sicht gegen die Sonne ab und drücke meine Nase gegen die Fensterscheibe der Terrassentür. Das Wohnzimmer ist ordentlich aufgeräumt. Zu ordentlich aus meiner Sicht, aber ich kann mir halt auch keine Putzfrau leisten.
Im Fenster spiegelt sich was. Eine dunkle Reflexion. Ich schrecke zusammen. Ich dreh mich um und spüre gleich mein Knie. Selbst schuld, wenn ich mich so ruckartig bewege. Aber das Adrenalin löscht den Schmerz im Gelenk schnell wieder. Mir war, als wäre einer hinter mir vorbeigerannt, wie ich ins Wohnzimmer geglotzt habe. Der Flieder ist hoch und dicht, genau wie die Ribiselsträucher. Ideal, wenn man nicht gesehen werden will.
»Ist da wer?« Also, wenn da wer wär, der hierhergehört, dann bräuchte diejenige Person sich ja nicht zu verstecken. Unverhofft fühle ich mich ein wenig unwohl. »Hallo!«
Ich merke, dass mein Puls rast, aber ehe ich mich’s verseh, marschieren meine Beine los, in die Tiefe des Gartens hinein. So vorsichtig, als würde ich Ostereier suchen, steuere ich direkt auf den ersten Strauch zu. Das Vogelgezwitscher, das ich bis vor wenigen Sekunden noch unterschwellig wahrgenommen habe, ist verstummt. Noch fünf Meter …
Ich hätte jetzt gerne was in der Hand. Irgendwas Großes.
Noch vier …
Lauf weg, du Depp!, schreit mein Verstand.
Drei …
Eigentlich bin ich schon starr vor Schreck, bevor er hinter dem Gebüsch hervorspringt.
Rechts ist die Hecke, links eine Zeile stachliger Himbeerstauden, also wählt er das vermeintlich leichtere Hindernis und kommt auf mich zugestürmt. Passend dazu trägt er auch eine Sturmhaube. Und einen speckigen Parka, der mir bei der Hitze unangebracht vorkommt und um die dürre Gestalt weht wie die schwarze Kutte von Gevatter Tod höchstpersönlich. Mit was sich das Gehirn so beschäftigt, wenn es überfordert ist, denke ich noch, dann rammt er mir auch schon seine Schulter in den Magen.
Es hebt mich ansatzlos aus. Schmerzen spüre ich erst, als ich am Boden liege und in den weißblauen Himmel schaue.
Der Fluss der Zeit erfährt eine gewisse Verzögerung. Zwischen Aufprall und Landung hat es mich gefühlt dreimal überschlagen, was schon physikalisch gar nicht möglich ist. Aber es kommt mir halt so vor. Im Kopf und auch in meinem Kreuz. Mit zusammengebissenen Zähnen wälze ich mich herum und schaue dem grindigen Krüppel hinterher, wie er auf seinen Steckerlhaxen aus dem Garten flüchtet.
BEAVER
Ich habe ihn schon erkannt, den Sauhund, den elendigen. Trotz Sturmhaube. Weit kommt der mir nicht, weshalb ich eine Verfolgung erst mal verschieben kann. Schwer schnaubend schleppe ich mich auf die Terrasse zurück, ziehe mir einen von den Lounge-Stühlen heran und stoße dabei gegen einen Hundenapf, in dem zwei Schnecken sich an den Resten gütlich tun. Den hat der Beaver nicht grad sauber ausgeschleckt.
Ohne Auflage ist der Sessel brutal hart, aber ich bleibe trotzdem sitzen und halte mir den Magen. Im Sitzen tut es nicht ganz so weh, außerdem denkt es sich besser. Wobei ich nicht lang spekulieren muss. Eigentlich nur so lang, bis ich wieder genug Luft zum Telefonieren habe. Der Lechner, die alte Schwungscheibe, geht wie immer nicht ans Handy. Wenn da wirklich mal ein Notfall ist, man wäre restlos verloren. Ich wähle die Nummer vom Revier. Allerdings ungern. Dieser Widerwille findet auch sofort Bestätigung, weil wie befürchtet, meldet sich der Schnittlauch. Polizeimeister Kronawitter ist kein Freund von mir. Und auch sonst von keinem in der Gegend.
»Den Lechner bitte!«
»Wer ist da?«
»Gib mir den Lechner!«, verlange ich, ohne mich zu erkennen zu geben. Ich meine, der Mann ist Polizist, der wird ja von selber rauskriegen, wer da anruft, wenn es ihn so brennend interessiert.
»Polizeihauptmeister Lechner ist im Einsatz«, erklärt er unterkühlt. Gleich ist es mir weniger heiß, obwohl der Gärtner von der Poschingerin auch den Ampelsonnenschirm sauber zusammengeschnürt hat.
»Ist er wieder auf Geschwindigkeitsmessung?«
»Dazu kann ich keine Auskunft geben.«
Ich muss mich beherrschen, um nicht auszusprechen, was ich denke. »Ist sonst noch einer da? Die Silke vielleicht?« Ich merke schon, dass er immer grantiger wird, weil ich selbst seine Kollegin ihm vorziehen würde, obwohl die erst Anwärterin ist.
»Sofern Sie nichts zu melden haben, machen Sie jetzt bitte die Leitung frei!«, zischt er.
Bringe ich beim Kronawitter den unbefugten Eindringling zur Sprache, rückt der wahrscheinlich mit dem SEK an. Das kann ich jetzt aber absolut nicht gebrauchen, sonst ist der Tag dahin. Auf jeden Fall die Mittagspause. Nein, ich muss das subtiler angehen. »Sehr wohl hab ich was zu melden«, erkläre ich.
»Und was?«
»Akuter Verdacht auf Nichtanwesenheit«, antworte ich.
»Glauben Sie, ich weiß nicht, dass Sie es sind, Herr Fellinger?«
»Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich es nicht bin, Herr Kronawitter.«
»Ich lege jetzt auf«, kündigt er an. Ich stelle mir vor, wie rot sein Gesicht mittlerweile ist. Ungesund rot, vor allem seine Wangen. Die glühen gerne auf, schon bei marginaler Verärgerung.
»Das könnte sich aber schlecht auf Ihre Polizeikarriere auswirken, wenn Sie meinen Anruf nicht ernst nehmen.«
»Zefix, ich hab doch gefragt, ob Sie was zum melden haben!«
»Sie kommen jetzt her, wir müssen was überprüfen. Danach wird sich rausstellen, ob es was zu vermelden gibt oder nicht.«
»Wie? Wo soll ich hin?« Er scheint einigermaßen um Fassung zu ringen. »Sie können mich doch nicht einfach so … anfordern, wie wenn Sie ein Taxi bestellen würden.«
»Dann bestelle ich halt eine Pizza. Meinetwegen Calabrese«, sage ich und nenne ihm die Adresse.
Auch wenn es schwerfällt, wieder aufzustehen, gehe ich einmal komplett ums Haus. Soweit ich mich entsinne, hat er nichts bei sich getragen. Bargeld in großen Scheinen lässt sich allerdings prima in den Taschen von so einem Parka verstauen. Einbruchsspuren sind jedoch nirgendwo zu entdecken. Dann brauch ich zumindest bezüglich dieses schmerzhaften Aufeinanderprallens nichts zu Protokoll zu geben. Auf Höhe der Nieren zwickt noch die Bandscheibe, sonst habe ich den Angriff gut verkraftet.
Nach knapp zehn Minuten höre ich einen Wagen vorfahren und trotte Richtung Straße. Ich erwarte den Schnittlauch am Gartentor.
»Was machen Sie bei der Frau Poschinger auf dem Grundstück?«
»Mich sorgen«, sage ich und bitte ihn herein. Der Kronawitter rückt seine Mütze gerade und setzt vorsichtig seinen Fuß auf die teure Granitplatte.
»Wieso?«
»Sie macht nicht auf.«
»Ich würde auch nicht jedem x-Beliebigen die Haustüre aufmachen. Was wollen Sie überhaupt von der Frau Poschinger?«
Den x-Beliebigen überhöre ich mal großzügig. »Ich habe ihren Hund gefunden.«
»Hund?« Der Kronawitter dreht sich einmal um seine Achse.
»Ich habe ihn nicht dabei«, kläre ich ihn auf. Er schaut mich mit einer Begriffsstutzigkeit an, die ich sonst nur von illegal beschäftigten nordafrikanischen Tellerwäschern kenne, die in vermeintlichen Gourmetküchen bis zu den Knöcheln in Essensresten waten und vom Mindestlohn träumen.
»Wie kommen Sie eigentlich drauf, dass die Frau Poschinger ihren Hund vermisst?«
Eine entscheidende Frage, die für mich eine Antwort birgt, von der der Polizeimeister natürlich keine Ahnung haben kann. Abgesehen davon, dass der Kronawitter sowieso nicht von viel eine Ahnung hat.
»Der Beaver ist demnach nicht als vermisst gemeldet?«, folgere ich.
»Der wer?«
»Der Beaver!«
»Ich dachte, es geht um einen Hund. Was reden Sie denn jetzt von einem Biber?«
Mein Blick entgleitet mir zum Freudensee, und ich denke, dass es der Biber dort unten einfach wunderschön haben muss, weil er sich niemals in seinem beschaulichen Biberleben mit einem solchen Brezelsoizer abzugeben braucht.
»Der Hund heißt Beaver«, erkläre ich eindringlich und mit der pädagogischen Nachsicht, die ich üblicherweise bei Köchen im ersten Lehrjahr anschlage.
»Ja, und wo ist jetzt der … der Beaver?«
»An einem sicheren Ort«, gebe ich dem Kronawitter zu verstehen. Um weitere Erklärungen zu umgehen, komme ich jetzt auf den Punkt. »Vielleicht überprüfen wir einfach mal, ob die Frau Poschinger tot in ihrer Wohnung liegt?«
Entgeistert schaut er mich an, und ich merke, das war zu rabiat. »Oder verletzt und hilflos«, lenke ich ein.
»Ich rufe besser Verstärkung.«
»Dann wird es vermutlich zu spät sein.«
Er glotzt mich an. Nach ein paar Sekunden des gegenseitigen Belauerns tippe ich auf meine Armbanduhr. Woraufhin der Kronawitter nickt und sich zögernd Richtung Hauseingang bewegt.