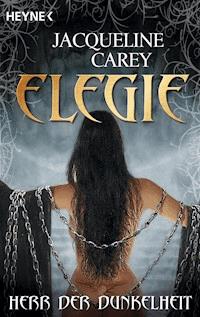9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Elegie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Die neue faszinierende Saga der Erfolgsautorin der Kushiel-Romane
Noch immer regiert mit Satoris Fluchbringer das Böse in der Welt. Während sich die Völker Urulats einer alten Prophezeiung nach vereinen, um den dunklen Gott zu stürzen, gelingt es der Elfenprinzessin Cerelinde, die auf Satoris’ Burg gefangen gehalten wird, in diesem die Erinnerung an das Gefühl der Liebe hervorzurufen. Doch damit besiegelt sie das Schicksal aller Völker…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 669
Ähnliche
DAS BUCH
Seit sich der dunkle Gott Satoris vor mehr als tausend Jahren gegen seinen Bruder Haomane erhoben hat, tobt ein entsetzlicher Krieg zwischen den göttlichen Brüdern, der die Welt Urulat zu zerstören droht. Einer der wenigen, die treu an Satoris’ Seite stehen, ist der finstere Lord Tanaros, der einst mit dem Mord an seiner untreuen Ehefrau schwere Schuld auf sich geladen hat und seither Satoris als Heerführer dient. Doch nun haben sich alle Völker Urulats vereint, um eine uralte Prophezeiung zu erfüllen und den Gott der Finsternis zu stürzen. Satoris gelingt es jedoch, den Schlüssel zur Erfüllung der Prophezeiung - die Elfenprinzessin Cerelinde - zu entführen und auf seiner Burg Finsterflucht gefangen zu halten. Während Satoris’ Anhänger darauf drängen, die Prinzessin zu töten, entdeckt Satoris in Cerelinde das längst vergessene Licht der Liebe. und auch Tanaros’ von Wut und Bitterkeit erkaltetes Herz wird durch Cerelinde berührt und er erkennt, dass er noch immer das Herz eines Sterblichen in sich trägt. Doch diese Liebe könnte Satoris’ Untergang sein…
ELEGIEErster Roman: Herr der DunkelheitZweiter Roman: Fluch der Götter
Die KUSHIEL-SagaErstes Buch: Kushiel – Das ZeichenZweites Buch: Kushiel – Der VerratDrittes Buch: Kushiel – Die Erlösung
DIE AUTORINJacqueline Carey, 1964 geboren, hat Englische Literatur und Psychologie studiert. Mit »Kushiel – Das Zeichen«, ihrem Debütroman, sorgte sie sofort nach Erscheinen international für Furore und wurde mehrfach preisgekrönt. Die Autorin lebt in West Michigan und schreibt an der Fortsetzung ihrer großen Kushiel-Saga.
Mehr zu Jaqueline Carey unter: www.jaquelinecarey.com
Inhaltsverzeichnis
Titel der amerikanischen Originalausgabe GODSLAYER. VOLUME TWO OF THE SUNDERING
DRAMATIS PERSONAE
Die Sieben Schöpfer
Haomane der Gedankenfürst
Arahila die Schöne
Satoris der Säende
Neheris von den fallenden Wassern
Meronin der Tiefgründige
Yrinna von den Früchten
Oronin der Frohe Jäger
Die Kämpfenden von Finsterflucht
Tanaros Schwarzschwert – Heerführer, einer der Drei
Uschahin – Traumspinner, einer der Drei
Vorax – Gierschlund, einer der Drei
Hyrgolf – Marschall der Fjel
Carfax – stakkianischer Hauptmann
Skragdal – Kommandant der Fjel
Speros – Mittländer, ein Neuankömmling
Meara – Irrlingsfrau, Dienerin Cerelindes
Haomanes Verbündete
Malthus der Gesandte – Haomanes Unterhändler
Ingolin der Weise – Fürst der Riverlorn
Cerelinde – Hohe Frau der Ellylon
Aracus Altorus – Erbe des Königreiches im Westen
Blaise Caveros – Aracus’ stellvertretender Kommandant, Mitglied von Malthus’ Truppe
Fianna – die Bogenschützin von Arduan, Mitglied von Malthus’ Truppe
Peldras – ein Ellyl, Mitglied von Malthus’ Truppe
Lorenlasse von Valmaré – Anführer der Schar der Riverlorn
Dani – ein Yarru, der Träger
Thulu – ein Yarru, Danis Onkel und Führer
Andere
Lilias – die Zauberin des Ostens
Calandor – Drache, einer der Ältesten
Calanthrag – die Älteste der Drachen
Graufrau – Anführerin der Wehre
Nun erweckt Gewissen die Verzweiflung, Die geschlafen – erwecket bittere Erinnerung An das, was er gewesen, was nun er ist, was Schlimmres er noch werden muss.
John Milton, Das verlorene Paradies
EINS
Alle Linien laufen in einem Schnittpunkt zusammen.
Im letzten großen Zeitalter der Gespaltenen Welt von Urulat, das einst Uru-Alat hieß, nach dem Weltengott, der sie gebar, liefen sie in Finsterflucht zusammen.
Es begann mit einem roten Stern, der im Westen aufgestiegen war; mit Dergails Soumanië, einem polierten Stein, der einst ein Splitter der Souma gewesen war, jenem mächtigen Juwel, das auf der abgespaltenen Insel Torath geruht hatte, dem Auge in der Stirn von Uru-Alat, der Quelle, aus welcher die Schöpfer ihre Macht erhielten.
Der Schöpfer Satoris sah in dem Aufgehen des Sterns eine Warnung, eine Botschaft von seiner Schwester, die ihn einstmals geliebt hatte – von Arahila der Schönen, deren Kinder das Geschlecht der Menschen bildeten. Seine Feinde sahen darin eine Kriegserklärung.
Was auch immer der Wahrheit entsprechen mochte, es folgte darauf ein Krieg.
Haomane, der Erstgeborene der Schöpfer, tat vor langer Zeit eine Prophezeiung kund.
»Wenn das Unbekannte einst bekannt ist, die verlorene Waffe gefunden, das Feuermark erloschen und der Gottestöter befreit, wenn eine Tochter des Elterrion einen Sohn des Altorus ehelicht, wenn der Speer des Lichts zurückkehrt und der Helm der Schatten zerschlagen wird, dann sollen die Fjeltrolle fallen und die Wehre geschlagen werden, noch ehe sie sich erheben. Der Weltenspalter wird nicht mehr sein, die Souma wird wieder strahlen, die Gespaltene Welt wird wieder eins, und Haomanes Kinder werden überleben.«
Es begann mit dem Aufstieg von Dergails Soumanië. Cerelinde, die Hohe Frau der Ellylon, eine Tochter aus Elterrions Linie, gelobte Aracus Altorus ihre Treue. Dies war der erste Schritt zur Erfüllung der Prophezeiung Haomanes; Arahilas Kinder und jene von Haomane vereinigten sich; ihre Linien flossen unentwirrbar ineinander. Doch im Tal von Lindanen wurde ihre Hochzeit gestört.
Es kam zu einem großen Blutvergießen.
Es war eine Falle gewesen; eine Falle, die fehlschlug. Zuerst hatte es den Anschein, als füge sich alles zusammen. Getrieben von Rache verlor die Graufrau der Wehre ihr Leben bei einem Angriff, und das Halbblut Uschahin Traumspinner entfesselte Wahnsinn und Täuschung. Unter deren Schutz entführte Tanaros Schwarzschwert die Hohe Frau Cerelinde und brachte sie nach Finsterflucht.
Haomanes Verbündete wurden in die Irre geführt. Sie folgten einem Gerücht der Drachen, stellten unter dem Kommando von Aracus Altorus eine Streitmacht auf und führten einen Angriff gegen Beschtanag und Lilias, die Zauberin des Ostens. Und hier misslang die Falle. Die Bahnen wurden geschlossen, die Streitmacht von Finsterflucht wurde zurückgeschlagen, ihre Anführer wurden zerstreut. In Beschtanag drängten Haomanes Verbündete auf das Schlachtfeld.
Dort obsiegten sie.
Doch dies war nicht von ihnen erwartet worden.
Sie kamen – sie alle.
Sie kamen zu Fuß, zu Pferd und auf Segelschiffen, denn die Bahnen des Marasoumië waren zerstört worden. Fürst Satoris hatte dies in seinem Zorn getan. Der Drache von Beschtanag lebte nicht mehr; er war durch den Pfeil des Feuers gemordet worden, durch die verlorene und wiedergefundene Waffe. Ihres Soumanië beraubt, war die Zauberin des Ostens nur mehr eine gewöhnliche Frau, sterblich und machtlos. Die Wehre hatten einen bitteren Handel mit Aracus Altorus abgeschlossen und sich seinen Bedingungen gebeugt; sie waren besiegt, noch bevor sie sich erhoben hatten. Aracus nahte; sein Herz war von rechtschaffenem Zorn erfüllt, da er wusste, dass er hintergangen worden war.
Malthus, der Weise Gesandte, der in den Bahnen gefangen gewesen war, war sogar dem Gottestöter entkommen und verschwunden … doch liefen geflüsterte Gerüchte über eine neue Gestalt um: über den Galäinridder, den Leuchtenden Reiter, dessen Worte Angst in den Herzen der Menschen erzeugten und sie dazu verführten, ihren uralten Eid gegenüber Fürst Satoris zu brechen.
Doch Haomanes Verbündete hatten noch nicht gewonnen.
Am westlichen Rande der Unbekannten Wüste schlug Tanaros Schwarzschwert, der Heerführer der Streitkräfte von Finsterflucht, sein Lager an einem Bache auf. Dort stillte er den Durst seines versengten Fleisches, bereitete sich darauf vor, die Reste seiner Truppen zu sammeln. Obwohl er unsterblich war, hätte er doch in der Wüste sterben können. Nur durch die Dankbarkeit eines Raben hatte er überlebt.
Wenn er träumte, dann träumte er von der Hohen Frau Cerelinde.
Auf dem Rücken eines blutbraunen Pferdes ritt Uschahin Traumspinner die Pfade zwischen Wachen und Träumen entlang, stürzte sich in die Mittlande und hinterließ eine Spur aus Albträumen. Ein Schwarm von Raben bahnte ihm den Weg, und zu jeder Seite trabte ein reiterloses Pferd neben ihm her – eines in geisterhaftem Grau, das andere so schwarz wie Kohle.
Wenn er geträumt hätte, was er nicht tat, dann hätte er vom Rat der Drachen geträumt.
Vorax der Gierschlund erwartete ihn in Finsterflucht, murrend über seinen Vorräten.
Die Unsterblichen Drei würden bald wieder vereint sein.
Haomanes Prophezeiung musste sich noch erfüllen.
In der mächtigen Feste von Finsterflucht, in der die Hohe Frau Cerelinde gefangen war und gegen die ansteigende Flut der Zweifel kämpfte, brannte noch immer das Feuermark. In ihm hing der Dolch Gottestöter, rubinrot, ein Splitter der Souma. Einst hatte er Satoris verwundet; es war eine Wunde, die nimmermehr heilen würde. Allein der Gottestöter konnte das Leben eines Schöpfers beenden – das Leben des Fürsten Satoris und das Leben der anderen Schöpfer. Und solange das Feuermark brannte, vermochte keine Menschenhand den Dolch zu berühren. Niemand außer einem Schöpfer würde dies wagen.
Nur das Wasser des Lebens, geschöpft aus dem Brunnen der Welt, besaß die Macht, das Feuermark zu löschen. Das Wasser war geschöpft, doch sein Träger war verschwunden.
Dani von den Yarru, der durch Malthus den Gesandten in einer verzweifelten Anstrengung aus den Bahnen geschleudert worden war, wanderte in den kalten Landen von Nordegg tief im Gebiet der Fjeltrolle umher und hatte nur seinen Onkel als Führer. Zusammen gedachten sie, den Flüssen, dem Lebensblut von Urulat, bis nach Finsterflucht zu folgen.
Und auch sie wurden gejagt …
Die Fjel, angeführt von dem Tungskulder Skragdal, waren ihnen auf der Spur. Ihre Treue zu Fürst Satoris war über jeden Zweifel erhaben. Haomanes Prophezeiung versprach ihnen nichts als den Tod. Sie würden ihre Suche niemals aufgeben, wohin sie auch immer führen mochte. Sie würden obsiegen oder untergehen.
Alle Linien laufen in einem Schnittpunkt zusammen.
Neherinach war ein grünes, flaches Tal, das sich in die Hänge des Berges schmiegte. Hier und da durchbrachen kleine Felsen den Boden; an anderer Stelle erhob sich ein halbes Dutzend kleiner Hügel, die mit blühendem Efeu überzogen waren. Ein kleiner, aus einer Quelle gespeister Bach wand sich durch die Mitte des Tals, schlängelte sich westwärts und versickerte im Boden. Niedrige Berge mit täuschend sanften Flanken betteten es ein. Stechginsterbüsche boten Nahrung für Damwild und Unterschlupf für Hasen, die in den Schatten kleiner Felsvorsprünge hockten.
Es war ein friedvoller und zugleich schrecklicher Ort.
An seinem Rande warteten die Späher der Kaldjager und beobachteten mit ihren gelben Augen das langsame Vorankommen der anderen. Skragdal, ihr Anführer, wusste, was die Kaldjager fühlten. Hier hatte es seinen Ausgang genommen.
Sie sammelten sich still auf dem Felde von Neherinach. Das grüne Gras fühlte sich weich unter den Füßen an. Wasser glitzerte unter der hellen Sonne. Vögel regten sich in den Bäumen; Insekten sprangen von den Grashalmen in Sicherheit.
»Kommt«, sagte Skragdal leise.
Gemeinsam überquerten sie das Feld. Das Gras knickte unter ihren Schritten und richtete sich wieder auf, sobald sie vorübergegangen waren. Es roch frisch und süß. Skragdal spürte, wie die Krallen seiner Füße in die reiche und zerbröckelnde Erdkrume drangen. Uralte Wut erfüllte ihn. Blut hatte vor langer Zeit diesen Boden getränkt. Tausende und Abertausende von Fjel waren an diesem Ort gestorben, wo sie ohne Waffen gegen die gewaltigen Streitkräfte der Menschen und der Ellylon gekämpft hatten. Ohne Pardon waren sie für das Verbrechen angegriffen worden, dem verwundeten Schöpfer Unterschlupf gewährt zu haben, der sie das Ausmaß ihres eigenen Wertes gelehrt hatte. Die efeubedeckten Hügel, die das Feld sprenkelten, kennzeichneten die Grabhügel der Fjel, einen für jeden der sechs Stämme.
Am Ende hatten sie doch gewonnen – durch Verrat und Heimtücke, wie es in den Liedern der Verbündeten Haomanes hieß. Es stimmte, sie hatten Fallen gestellt, doch was bedeutete Verrat einem Volk, das in keiner Weise den Angriff herausgefordert hatte? Es war ein bitterer Sieg gewesen.
In der Nähe des Ufers, wo der Boden so weich war, dass sich Abdrücke in ihm erhielten, fanden sie alte Hufspuren. Skragdal zog die Stirn kraus. Nur Menschen und Ellylon ritten auf Pferden, und die Vorstellung, dass die eine oder andere Gruppe Neherinach entweiht hatte, gefiel ihm gar nicht.
»Ein Reiter«, sagte Thorun.
»Ja.«
»Der Galäinridder des Grafen?«
»Vielleicht.«
Unter der Führung der Kaldjager folgten sie den Spuren bis zu deren Ursprung. An der nördlichen Spitze von Neherinach lag verborgen in einer Höhlung ein Knotenpunkt des Marasoumië. Nun war hier ein größerer Krater in die Erde gesprengt worden. Felssplitter waren ringsum verstreut. Was immer hier herausgekommen war, es hatte gewaltige Kraft eingesetzt. Die innere Oberfläche des Granits war glatt und glänzend, als ob der Fels geschmolzen wäre. Es gab frische Kratzer im Gestein, und in der verkohlten Erde waren noch die Reste von Hufspuren sichtbar.
»Das ist nicht gut«, sagte Thorun.
»Nein.« Skragdal betrachtete das Loch und dachte daran, wie Osrics Männer in den Tunneln geschwatzt und gelärmt hatten; und er dachte an Osric im Wohnturm von Gerflod, wie er sein totes Grinsen gegen die Decke gerichtet hatte. Das zerklüftete Loch klaffte wie eine Wunde im grünen Tal von Neherinach und entblößte die aschenen Überreste des Knotenpunkts tief unter ihnen. Graf Coenreds letzte Worte hallten durch seine Erinnerung, und sein Fell kräuselte sich vor Unbehagen. Du bist tot, und du weißt es noch nicht einmal!
Er dachte daran, ihren Kurs zu ändern und die Kaldjager auf die Spur des Galäinridder zu setzen, doch Heerführer Tanaros hatte ihnen wieder und wieder eingeschärft, wie wichtig es war, Befehlen zu gehorchen. Es war wichtig, Befehlen zu gehorchen, auch wenn sie von Fürst Vorax kamen. Aber es war schon zu spät. Der Wohnturm von Gerflod lag eine Tagesreise hinter ihnen, und der Reiter hatte einige Tage Vorsprung. Nicht einmal die Gulnagel könnten ihn jetzt noch einholen.
Aber sie könnten Finsterflucht warnen.
»Rhilmar«, sagte er entschlossen. »Und Morstag. Ihr geht zurück. Falls Heerführer Tanaros schon wieder da ist, berichtet ihr ihm von dem, was wir hier gesehen haben. Sagt ihm, was in Gerflod passiert ist. Wenn er nicht da ist, dann sagt ihr es Fürst Vorax. Und wenn er euch nicht anhören will, dann sagt ihr es Marschall Hyrgolf. Nein, sagt es ihm auf alle Fälle. Er muss es wissen. Diese Sache ist sehr wichtig für die Fjel.«
»In Ordnung, Anführer.« Rhilmar, der kleinere der beiden, zitterte im hellen Sonnenlicht. An diesem Ort des grünen Grases, der glitzernden Bächlein und der alten Knochen hatte ihn die Angst gepackt; ihr Gestank drang aus seinen Poren und verpestete die Luft. »Nur … nur wir beide?«
Einer der Kaldjager schnaubte verächtlich. Skragdal beachtete ihn nicht. »Haomanes Verbündete haben sich nicht davor gefürchtet, nur zwei auszusenden, und es sind bloß kleine Leute«, sagte er zu Rhilmar. »Beeilt euch und meidet die Festungen der Menschen.« Dann wandte er sich an die Kaldjager. »Blågen, wo ist die nächste Fjel-Höhle?«
Der Kaldjager deutete in Richtung Osten. »Eine halbe Meile entfernt.« Seine gelben Augen glühten. »Gehen wir auf die Jagd?«
»Ja.« Skragdal nickte. »Wir folgen unseren Befehlen. Wir werden die Nachricht unter den Stämmen verbreiten, bis es keinen sicheren Ort und kein Versteck mehr gibt. Wer immer – oder was immer – dieser Galäinridder ist, er hat gut daran getan, das Fjel-Gebiet zu meiden und sich außerhalb unserer Reichweite zu begeben.« Er stand neben der entweihten Erde und bleckte seine Augenzähne in einem grimmigen Lächeln. »Gnade dem kleinen Volk, das er zurückgelassen hat.«
Sie lagerten einen ganzen Tag unter den Kiefern und genossen die Gegenwart von Wasser und Schatten. Rote Eichhörnchen spielten in den Zweigen und bildeten eine leichte Beute für die Gulnagel. Als Speros dem Lauf des Baches gefolgt war, hatte er eine Stelle mit wilden Zwiebeln entdeckt. Tanaros’ zerbeulter Helm, der schon als Schaufel und Spaten gedient hatte, diente nun als behelfsmäßiger Kochtopf für einen herzhaften Eintopf.
Nach Tanaros’ Berechnungen mussten sie sich südöstlich von Finsterflucht befinden. Vor ihnen lagen die fruchtbaren Gebiete der Mittlande und die ausgedehnte Ebene von Curonan. Es war durchaus möglich, dass sie am Rande der Mittlande einen Eingang zu den Tunneln fanden, doch vor ihnen lag noch eine weite Wegstrecke. In der Wüste wäre es eine einfache Reise gewesen, doch für die Fjel stellte sie eine beträchtliche Schwierigkeit dar. Zwei Menschen konnten sich im Feindesland leicht unsichtbar machen.
Nicht aber drei große Gulnagel.
»Wir müssen bei Nacht reisen«, sagte Tanaros wehmütig. »Wenigstens sind wir daran gewöhnt.« Er warf Speros einen Blick zu. »Weißt du noch, wie man Pferde stiehlt?«
Der Mittländer wirkte unsicher. »Ist das ein Scherz, Herr?«
Tanaros schüttelte den Kopf. »Nein.«
In der ersten Nacht kamen sie an einem Gehöft vorbei und schlichen sich so nahe heran, dass sie die Umrisse einer Stallung ausmachen konnten, doch in einer Entfernung von hundert Schritten erfüllte plötzlich Hundegebell die Nacht. Als im Gehöft eine Lampe angezündet wurde und sich Gestalten hinter den Fenstern bewegten, ordnete Tanaros einen hastigen, schmählichen Rückzug an. Sie rannten über die Felder, während ihnen die Gulnagel in leichtem Trab folgten.
Erst als sie einen ordentlichen Abstand zwischen sich und das Gehöft gebracht hatten, befahl er stehen zu bleiben. Speros beugte sich vornüber, stützte die Hände auf die Oberschenkel und rang nach Luft. »Warum haben … wir sie nicht … einfach getötet? Bestimmt … hätten diese Bauern keine große … Schwierigkeit für uns dargestellt.«
Tanaros hob eine Braue. »Damit ihre Leichen entdeckt werden? Wir müssen noch viele Meilen wandern, bis wir in Sicherheit sind, und die ganzen Mittlande sind auf der Hut. Du bist doch derjenige, der in der Freiwilligen-Miliz gedient hat, Speros von Haimhault. Willst du, dass sie hinter uns herjagt?«
»Stimmt.« Speros richtete sich auf. »Also ziehen wir auf Schusters Rappen weiter, Heerführer.«
Schweigend gingen sie einige Stunden dahin. Nach der Wüste war das beinahe ein Vergnügen, fand Tanaros. Ihre Wasserschläuche waren gut gefüllt, und die Felder stellten gute Jagdgründe für die Gulnagel dar. Die Luft war mild und feucht, und die Sterne über ihnen spendeten so viel Licht, dass die gefurchte Straße gut zu erkennen war. In einer solchen Nacht konnte man sich vorstellen, für immer und ewig zu wandern. Er dachte an das Gehöft, an dem sie vorbeigekommen waren, und lächelte in sich hinein. Auch wenn er einen guten Grund dafür gehabt hatte, das Leben der Bewohner zu schonen, so war dies doch ein teures Vergnügen gewesen. Selten wurde er vor eine solche Wahl gestellt. Er fragte sich, was für eine Geschichte die Bauern am Morgen erzählen würden. Sie würden eine schlaflose Nacht in ihrem Hause verbringen, wenn sie die Wahrheit wüssten. Vermutlich hatte der Geruch der Gulnagel die Hunde aufgestört. Das nächste Mal würde er Speros allein losschicken. Er fragte sich, ob der Rabe Bring, der vorausgeflogen war, in der Lage wäre, ein mögliches Opfer für einen Pferdediebstahl zu erspähen.
»Es ist schon komisch, nicht wahr?«, bemerkte Speros. »So etwas hätte ich mir nie vorstellen können.«
»Was?«
»Das.« Der Mittländer deutete auf die leere Straße und die stillen Felder. »Uns, hier. Wir ziehen wie gewöhnliche Bettler übers Land. Ich hätte geglaubt … ich weiß nicht, Heerführer.« Er zuckte die Achseln. »Ich hätte geglaubt, dass mehr Magie darin liegt.«
»Nein.« Tanaros schüttelte den Kopf. »Es liegt verdammt wenig Magie im Krieg, Speros.«
»Aber Ihr seid … einer der Drei, Herr!«, wandte Speros ein. »Tanaros Schwarzschwert, Tanaros …« Seine Stimme verwehte.
»Königsmörder«, sagte Tanaros gleichmütig. »Ja. Ein gewöhnlicher Mann, ungewöhnlich geworden nur durch die Gnade des Fürsten Satoris.« Er berührte den Griff seines Schwertes. »Diese Klinge kann nicht von Sterblichen zerbrochen werden, Speros, aber ich wirke keine Macht außer der, die in der Reichweite meiner Waffe liegt. Enttäuscht dich das?«
»Nein.« Während er ging, richtete Speros den Blick auf seine Stiefel und schlurfte mit seinen geborstenen Absätzen durch die Furchen der Straße. »Es enttäuscht mich nicht.« Er grinste. Das glimmende Sternenlicht enthüllte eine Lücke zwischen seinen Zähnen. »Es schenkt mir Hoffnung. Schließlich, Heerführer, könnte auch ich an Eurer Stelle sein!«
Als Tanaros den Mund öffnete und etwas darauf erwidern wollte, hob einer der Gulnagel die Hand und grunzte. Die anderen erstarrten. Tanaros befahl ihnen mit einer knappen Geste zu schweigen und lauschte angestrengt. Er hoffte, dass es nicht die Bauern aus dem Gehöft waren. Bestimmt hatten sie nichts gesehen. Es war nur die Warnung der Hunde gewesen, die ihren Schlaf unterbrochen hatte. Vermutlich hatten sie einen müden Blick über die Felder geworfen, die Hunde ausgeschimpft und sich wieder zu Bett begeben. Aber was war es dann? Die Fjel hatten schärfere Ohren als die Menschen, doch alle drei machten ein verwirrtes Gesicht. Speros hingegen zeigte eisiges Grauen.
Tanaros strengte all seine Sinne an. Zuerst hörte er nichts, dann vernahm er aus der Ferne ein Trommeln wie Donner. Hufgetrappel? Es klang so, doch dann wieder nicht. Es waren zu viele, zu schnell – und noch ein anderes Geräusch, wie ein rauschender, pulsierender Sturm, wie der Klang von tausend gleichzeitig schlagenden Schwingen. Er erkannte, dass es wie der Rabenspiegel klang.
»Bring?«, rief Tanaros.
»Krock!«
Das Gewebe der Nacht schien unter ihrem Ansturm zu zerreißen, als sie aus den Traumpfaden in die wache Welt eindrangen. Ja, es waren Raben, ein ganzer Schwarm. Dort, am Kopf, befand sich Bring, mit Augen wie Obsidiankiesel. Und hinter ihnen, mit scharrenden Vorderhufen und geblähten Nüstern …
Pferde.
Sie traten aus der Dunkelheit wie aus einer Tür, und das Sternenlicht schimmerte auf ihrem glatten Fell. Überall um sie herum ließen sich die Raben auf den Feldern nieder – außer Bring, der sich auf Tanaros’ Schulter hockte. Der Tritt der eisernen Pferdehufe hallte hart und deutlich von der Straße wider; die herbeipreschenden Tiere waren groß. Es waren drei: eines so grau wie ein Geist, ein anderes schwarz wie Pech, und in der Mitte ein Kastanienbrauner mit einer Farbe wie jüngst vergossenes Blut.
Auf seinem Rücken saß eine bleiche, verkrümmte Gestalt mit mondsilbernem Haar; ein Gesicht voll zerstörter Schönheit lächelte verschlagen, und eine Hand wurde zum Gruße erhoben.
»Ausgezeichnet, Vetter«, sagte Uschahin Traumspinner. »Ein kleiner Vogel hat mir verraten, dass du ein Pferd brauchst.«
»Traumspinner!« Tanaros lachte laut auf. »Das ist allerdings ausgezeichnet. « Er schlug mit der Hand auf Speros’ Schulter. »Ich widerrufe meine Worte, Junge. Verzeih mir, dass ich voreilig war. Anscheinend steckt in dieser Nacht mehr Magie, als ich für möglich gehalten habe.«
Die Farbe wich aus Speros’ sonnenversengter Haut. Wortlos starrte er vor sich hin.
»Ich bin auf den Schwingen eines Albtraums geritten, Vetter, und ich fürchte, er hat die Gedanken deines Schützlings berührt.« Uschahin klang belustigt. »Was plagt dich, Mittländer? Hast du einen Blick auf deine eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten erhascht, auf den Neid, dem deine Art so oft zum Opfer fällt? Hast du vielleicht einen Stein gesehen, um den sich eine knabenhafte Hand schließt? Der Zufall hätte es so einrichten können, dass du einer von ihnen bist.« Seine verschiedenfarbigen Augen glitzerten; Schatten sammelten sich unter seiner zerfurchten Stirn. »Hast du Angst, meinem Blick zu begegnen, Mittländer?«
»Vetter …«, begann Tanaros.
»Nein.« Mit großer Willensanstrengung hob Speros das Kinn und hielt dem glühenden Blick des Halbbluts stand. Er ballte eine Hand zur Faust und presste sie gegen sein Herz, dann öffnete er sie wieder und gewährte so den uralten Gruß. Auf seinem vom Sternenlicht beschienenen Gesicht zeigten sich Ernsthaftigkeit und Trotz. »Nein, Fürst Traumspinner. Ich habe keine Angst.«
Uschahin schenkte ihm ein schiefes Lächeln. »Das ist eine Lüge, aber ich will sie um der Dinge willen hinnehmen, die du erlebt hast.« Er deutete mit dem Kopf links neben sich. »Nimm den Grauen, Mittländer. Tanaros, wenn du meinen Spuren folgst, wird dich dieses Tier hinter mir her auf dem Weg tragen, den die Raben bahnen.« Er deutete auf das schwarze Pferd. »Du bist schon einmal auf einem solchen geritten. Hier ist ein weiteres. Können deine Gulnagel Schritt halten?«
»Jawohl«, murmelte Tanaros. Seine Zustimmung wurde vom Grinsen der Fjel begleitet. Er näherte sich dem schwarzen Pferd und fuhr ihm mit der Hand über den gewölbten Hals. Die schwarze Mähne ergoss sich wie Wasser über seine Finger. Das Tier drehte den Kopf, bleckte die scharfen Zähne, und eine unnatürliche Klugheit schimmerte in seinem Auge. Tanaros packte die Mähne knapp über dem Widerrist und schwang sich auf den Rücken des Tieres. Muskeln hoben und senkten sich unter seinen Schenkeln. Bring krächzte unzufrieden auf und flog davon. Mit dem Druck seiner Knie wendete Tanaros den Schwarzen. Er dachte an seinen eigenen Hengst, seinen treuen Rappen, der in den Bahnen des Marasoumië verloren gegangen war, und fragte sich, was wohl aus ihm geworden war. »Das hier sind Pferde, die in Finsterflucht gezüchtet wurden und dort aufgewachsen sind, Vetter. Wo bist du auf sie gestoßen?«
»Am südlichen Rande des Deltas.«
Tanaros hielt inne und sagte schließlich: »Meine Stakkianer. Die Fährtensucher?«
»Ich fürchte, so ist es.« In Uschahins Miene lag ein beunruhigendes Mitleid. »Sie haben ein … angemessenes Ende gefunden, Vetter. Ich werde dir später darüber berichten, aber wir müssen fort sein, bevor Haomanes Dämmerung den Himmel berührt, ansonsten kann ich den Durchgang nicht offen halten. Die Nacht ist kurz, und es sind noch … andere Dinge zu bedenken. Kannst du reiten?«
»Ja.« Tanaros drückte die Schenkel gegen den Rumpf des Rappen. Spürte dessen Bereitschaft, loszulaufen und die im Zwielicht liegende Straße abermals unter den Hufen dahinfliegen zu sehen. Er warf Speros einen raschen Blick zu. Der Mittländer saß bereits auf seinem Pferd und hatte die Augen vor Erregung weit aufgerissen. Tanaros schaute kurz hinüber zu den Gulnagel und sah, wie sie sich bereit machten. Ihre Muskeln spannten sich an den kräftigen Lenden. »Wir sollten uns beeilen.«
»Anführer?« Einer von ihnen hielt Tanaros’ Helm hoch. »Wollt Ihr ihn haben?«
»Nein.« Bei dem Gedanken an Wasserlöcher, knapp unter der Erdoberfläche liegende Gräber und Eichhörncheneintopf schüttelte Tanaros den Kopf. »Behalt ihn. Er hat seinen Zweck mehr als erfüllt. Sollen ihn doch die Mittländer finden und sich wundern. Ich brauche ihn nicht mehr.«
»In Ordnung.« Der Fjel legte ihn sanft an den Rand der Straße.
Tanaros holte tief Luft und berührte das Schwert an seiner Seite. Sein gebrandmarktes Herz raste, reagierte auf diese Berührung, auf diese Erinnerung an das Feuer des Gottestöters und das Blut des Fürsten. Mit starkem Verlangen dachte er an die Mauern von Finsterflucht. Er versuchte zu vergessen, dass sie dort war. Eine leise Stimme flüsterte einen Namen mitten in seinen Gedanken, senkte eine Ranke in sein Herz, so zart und zerbrechlich wie das Erschauern einer Mortexigus-Blume. Unter großen Anstrengungen zerdrückte er sie. »Wir sind bereit, Vetter.«
»Gut«, sagte Uschahin nur. Er hob die Hand, und eine Wolke aus Raben stob wirbelnd von den Feldern auf, sammelte und fügte sich. Der blutbraune Hengst regte sich unter seinem Gewicht; er zitterte und tänzelte. Die Straße, die äußerlich der Straße glich, auf der sie standen, und doch wiederum ganz anders war als diese, lockte mit ihrem silbernen Pfad. »Dann wollen wir losreiten.«
Heim!
Das blutfarbene Tier sprang los, und die Raben drängten voran. Hinter ihnen rannten der Graue und der Schwarze. Die Welt geriet ins Taumeln und die Sterne verschwammen – alle außer einem, dem blutroten Stern, der am westlichen Horizont stand. Nun ritten die drei Männer dahin, und zwei von ihnen gehörten zu den Dreien. Das Schlagen der Rabenflügel verschmolz mit dem Donnern der Hufe und dem flinken, gleichmäßigen Tappen der Krallen an den Füßen der Gulnagel.
Und irgendwo im Norden drang ein einsamer Reiter in die Unbekannte Wüste ein.
In den Gehöften und Dörfern warfen sich die Mittländer im Schlafe herum und wurden von Albträumen gepeinigt. Die Farbe ihrer Träume veränderte sich. Wo sie zuvor nur ein einziges Pferd, so weiß wie die Gischt, gesehen hatten, sahen sie nun deren drei – Rauch und Pech und Blut.
Wo sie eine verehrungswürdige Gestalt gesehen hatten – einen Menschen oder so etwas wie einen Menschen – mit einem Juwel auf der Brust, das so klar wie Wasser war, erblickten sie nun ein schattenhaftes, abgewandtes Gesicht, einen rauen Stein, um den sich eine Kinderfaust geschlossen hatte, und berstende Knochen sowie spritzendes Blut.
Voran und weiter voran ritten sie.
Lilias war seekrank.
Sie lehnte sich über die Reling des Zwergenschiffes Yrinnas Lohn und spie ihr Essen in die wogenden Wellen. Als ihr Magen gereinigt und leer war, befanden sich ihre Eingeweide noch immer in Aufruhr. Es gab keine Ruhe auf diesen schwankenden Decks; es war ein immerwährendes Auf und Ab. Die Wellen stiegen hoch, fielen, stiegen und fielen und erinnerten sie unablässig daran, dass die Welt, die sie gekannt hatte, untergegangen war. Lilias übergab sich wieder und würgte Galle hoch, bis ihr Hals vor trockener, bitterer Hitze brannte. Es war kein Wunder, dass sie nicht hörte, wie sich der Ellyl hinter ihr näherte.
»Bitte richtet Euch auf, Zauberin.« Eine kühle Hand legte sich besänftigend auf ihre Stirn, und in dieser Berührung lag Trost und süßes Wohlgefühl. »Es sind nur Meronins Wellen, welche diejenigen belästigen, die an den festen Boden von Urulat gewöhnt sind.«
»Geh fort!« Lilias richtete sich auf und schob ihn beiseite. »Lass mich allein.«
»Vergebt mir.« Anmutig machte der Ellyl einen Schritt nach hinten und hob die schmalen Hände. Es war Peldras, einer aus Malthus’ Truppe. Jener mit dem verdammten Schatten der Trauer und des Mitleids in seinem Blick. »Ich wollte Euch nur Trost spenden.«
Lilias lachte. Es klang so hart wie der Schrei der Möwen. Ihr Mund fühlte sich versengt und faulig an. Sie schob sich einige Strähnen des dunklen, von der Galle besudelten Haares aus dem Gesicht. »Trost, ja? Kannst du das Geschehene ungeschehen machen, Ellyl? Kannst du Calandor ins Leben zurückrufen?«
»Ihr wisst, dass so etwas unmöglich ist.« Der Ellyl wich nicht vor ihr zurück, und das Mitleid in seinem Blick wurde nur noch tiefer. »Zauberin, ich bedaure all das Sterben beim Beschtanag. Ja, vermutlich sogar das des Ältesten. Es bereitet mir Kummer, zu spät gekommen zu sein. Glaubt mir, wenn ich es hätte verhindern können, dann hätte ich es getan, das versichere ich Euch. Ich habe es versucht.«
»So, so.« Lilias zuckte die Achseln und warf einen Blick über das Deck, dorthin, wo Aracus Altorus gerade den Kopf senkte und dem Zwergenkapitän zuhörte, der mit seinem kleinen Körper und den knorrigen, wurzelgleichen Beinen breit auf dem Deck stand und ein Bild des Behagens bot. Sie wusste nicht genau, wie es gekommen war, dass Yrinnas Kinder im Hafen von Eurus bereitgestanden hatten, um Haomanes Verbündete über das Wasser zu bringen. »Aber du hast versagt.«
»Ja.« Peldras neigte das Haupt. Blondes, glitzerndes Haar fiel wie ein Vorhang über seine ernste Stirn. »Hohe Zauberin«, sagte er sanft, »ich glaube nicht, dass Euer Herz so schwarz ist, wie es gemalt wird. Ich möchte gern mit Euch über jemanden reden, dem ich begegnet bin. Es handelt sich um Carfax von Stakkia, der den Willen des Weltenspalters ausgeführt hat und am Ende zu einem Gefährten der Wahrheit wurde …«
»Nein.« Lilias biss die Zähne zusammen und schluckte schwer, als sie sich an ihm vorbeizwängte. »Ich will es nicht hören, Ellyl. Ich brauche dein verfluchtes Mitleid nicht. Verstehst du das?«
Er machte einen weiteren Schritt zurück; ohne Zweifel wollte er ihrem fauligen Atem ausweichen. Früher hatten sogar die Riverlorn in ihrer Gegenwart Ehrfurcht empfunden. Doch jetzt war nichts mehr an ihr außer Galle und Verwesung. Diese Fäule, diese Sterblichkeit fraß sie von innen her auf. Der Gestank belästigte sogar ihre eigene Nase. »Vergebt mir, Zauberin«, keuchte er und streckte noch immer seine bleiche, vollkommene Hand aus. »Ich wollte Euch nicht beleidigen, sondern nur Trost spenden, denn selbst die Geringsten unter uns haben ihn verdient. Arahilas Gnade …«
»… ist nicht das, was ich suche«, beendete Lilias barsch den Satz. »Was weiß Arahila die Schöne schon über Drachen?«
Es war etwas Besonderes, einen Ellyl nach Worten suchen zu sehen. Dieses Bild nahm sie mit sich, während sie auf die Kabine zutaumelte, in der man ihr einen Platz gewährt hatte. Haomanes Kinder, die Abkömmlinge des Gedankenfürsten. Oh, sie hatten so große Freude daran, sich selbst für weiser als alle anderen Rassen und als alle Geringeren Schöpfer zu halten.
In der engen Kabine war es heiß und stickig, doch wenigstens war hier das Sonnenlicht ausgeschlossen, das blendend von den Wellen zurückgeworfen wurde und tanzende Flecken in Lilias’ Augen erzeugte. Hier war es gnädigerweise dunkel. Lilias kauerte sich in eine der Zwergenkojen und schlang die Arme immer enger um ihren schmerzenden Bauch, bis sie nur noch ein kleines Bündel Elend war.
Einige segensreiche Augenblicke ließ man sie allein.
Dann wurde die Tür geöffnet, und schräg einfallendes Sonnenlicht drang durch ihre geschlossenen Lider.
»Zauberin.« Es war eine weibliche Stimme, die sich der Gemeinsamen Sprache bediente, allerdings einen unbeholfenen arduanischen Akzent aufwies. Der kühle Rand eines Steingutbechers berührte ihre Lippen und befeuchtete sie mit Wasser. »Blaise sagt, Ihr müsst trinken.«
»Geh weg.« Ohne die Augen zu öffnen, schlug Lilias nach der helfenden Hand, doch jemand packte ihre eigene Hand und hielt sie in starkem, sehnigem Griff. Sie schlug die Augen auf und begegnete dem angeekelten Blick der Bogenschützin. »Lass los.«
»Das würde ich ja gern«, sagte Fianna langsam und bedächtig, »aber ich habe einen Treueeid geschworen, und der König des Westens will, dass Ihr am Leben bleibt. Es ist außerdem der Wille unserer zwergischen Gastgeber, dass kein Mann mit jemandem von unserem Geschlecht in einem Raum allein ist. Also müsst Ihr mit mir vorliebnehmen. Trinkt.«
Sie neigte den Becher.
Kühles, einfaches Wasser tröpfelte in Lilias’ Mund. Sie wollte sich verweigern, wollte auf diesen Eindringling, der ihr das Leben erhalten sollte, eindreschen. Doch der harte Blick der Bogenschützin und der feste Griff um Lilias’ Handgelenk warnten sie. Also nahm sie missmutig einen Schluck nach dem anderen. Das kalte Wasser benetzte angenehm die ausgedörrte Haut von Mund und Kehle und blubberte in ihrem Bauch. Aber sie behielt es bei sich.
»Gut.« Fianna ging in die Hocke. »Gut.«
»Du solltest dir eigentlich meinen Tod wünschen«, keuchte Lilias. »Aracus ist ein Narr.«
»Ihr kennt seine Beweggründe. Und was mich angeht, ja, ich wünsche ihn mir.« Die Stimme der Bogenschützin war ausdruckslos, und auf ihrem Gesicht lag kein bedrückendes Mitleid, sondern nur Hass und starkes Misstrauen. »Habt Ihr etwas anderes von mir erwartet?«
»Nein.« Lilias richtete sich auf, bis ihr Rücken die Kabinenwand berührte. »Nein, das habe ich nicht.«
»Dann verstehen wir einander.« Sie füllte den Becher erneut. »Trinkt.«
Lilias nahm ihn und bemühte sich dabei, die Finger der Bogenschützin nicht zu berühren. Das waren die Hände, die den Pfeil des Feuers auf den Bogen gelegt hatten; das waren die Finger, welche die Sehne von Oronins Bogen gespannt hatten. Lilias wollte sie nie wieder auf ihrer Haut spüren. »Allerdings, das tun wir.« Sie nippte an dem Wasser und beobachtete Fiannas Gesicht. »Sag mir, weiß Blaise Caveros, dass du in ihn verliebt bist?«
Langsam röteten sich die Wangen der Bogenschützin ein wenig, halb aus Verärgerung, halb wegen dieser Erniedrigung. »Es steht Euch nicht zu, seinen Namen auszusprechen!«, fuhr sie Lilias an und sprang auf die Beine.
Lilias zuckte die Schultern und nahm noch einen Schluck. »Soll ich es ihm sagen?«
Einen Augenblick lang glaubte sie, die andere Frau würde sie schlagen. Fianna stand gebeugt in der niedrigen Kabine, ballte die Hände zu Fäusten und lockerte sie wieder. Schließlich siegte ihre Disziplin, und sie schüttelte nur den Kopf. »Ich bedaure Euch«, sagte sie mit leiser Stimme. »Das sollte ich zwar nicht tun, aber ich tue es. Ihr habt vergessen, wie es ist, eine sterbliche Frau zu sein.« Sie betrachtete Lilias eingehend. »Falls Ihr es überhaupt je gewusst habt. Es ist eine Schande, denn das ist alles, was Euch geblieben ist, und alles, was Ihr je haben werdet.«
»Nicht ganz.« Lilias schenkte ihr ein bitteres Lächeln. »Ich habe noch meine Erinnerungen.«
»Ich wünsche Euch viel Freude damit!«
Mit diesen Worten schlug die Bogenschützin die Tür heftig hinter sich zu. Lilias seufzte und spürte, wie sich ihr verkrümmter Körper entspannte. Wenigstens hatte diese Konfrontation dazu beigetragen, sie von ihrem Elend abzulenken. Sie würde diese Seereise wohl doch überleben. Das war Aracus’ Wille? Nun, dann sollte er seinen Willen haben. Es war nicht weniger als das, was der Sohn des Altorus verlangte. »Ich wünsche dir viel Freude damit«, flüsterte Lilias.
Sie trank den Rest des Wassers, drehte sich auf die Seite und schlief ein.
Als sie erwachte, war es stockfinster und erstickend heiß in der Kabine. Das Geräusch von tiefem und ruhigem Atmen drang aus einer anderen Koje. War das die Bogenschützin? Das war durchaus möglich, da die Zwerge es den Männern und Frauen verboten, ein Quartier miteinander zu teilen.
Bei diesem Gedanken krampfte sich ihr Magen zusammen. Mit leisen Bewegungen kletterte Lilias aus der Koje und begab sich zur Tür. Sie war nicht verriegelt und ließ sich ohne Schwierigkeiten öffnen. Lilias trat hinaus auf Deck und schloss die Tür behutsam hinter sich.
Hier fuhr ihr die Meeresbrise kühl und belebend über das Gesicht; sie schmeckte nach Salz. Lilias holte tief Luft und füllte ihre Lunge. Gnädigerweise beruhigte sich ihr Magen an der frischen Luft. Hier unter der Kuppel der Nacht war es beinahe angenehm. Die Sterne leuchteten strahlender als in den Bergen, und der zunehmende Mond legte einen hellen Pfad auf die dunklen Wellen. Hier und da hingen Laternen an der Takelage des Schiffes und verbreiteten einen irrlichternden Glanz. Zwergenhafte Gestalten arbeiteten still in ihrem Schein, kümmerten sich um dies und das und beachteten Lilias’ Gegenwart nicht.
Es war ein Segen, zum ersten Mal seit Beschtanag keinen Wächter zu haben. Lilias ging zum Bug des Schiffes und fand dabei heraus, dass das Schaukeln ihr kein so großes Unbehagen mehr bereitete. Zu ihrem Ärger musste sie feststellen, dass sie nicht allein hier war. Eine große Gestalt stand am Bug und blickte hinaus auf das Wasser. Sie drehte den Kopf, als Lilias näher kam, und das Mondlicht glänzte auf der goldenen Kopfbinde, die um die Stirn lief.
Sie hielt inne. »Fürst Altorus. Ich wollte Euch nicht stören.«
»Lilias.« Er winkte sie herbei. »Kommt her. Habt Ihr je Meronins Kinder gesehen?«
Sie schüttelte den Kopf. Es war das erste Mal, dass er sie so angeredet hatte, und es war seltsam, ihren Namen aus seinem Mund zu hören. »Nein, Herr. Bis zum heutigen Morgen hatte ich noch nicht einmal das Meer gesehen.«
»Wirklich?« Aracus wirkte verblüfft. »Ich habe geglaubt … ach, das ist unwichtig. Kommt und seht. Kommt, ich beiße nicht.« Er streckte die Hand aus, als sie sich zögerlich neben ihn stellte. »Seht, dort.«
Im Wasser unter dem Bug des Schiffes sah Lilias sie: ein ganzer Schwarm anmutiger Gestalten, die mit freudigen Sprüngen aus dem Meer schossen und wieder hineintauchten. Ihre glatte Haut leuchtete silbern im Sternenlicht, und in ihren großen, dunklen Augen lag eine funkelnde Weisheit, die in merkwürdigem Widerspruch zu dem fröhlichen Lächeln auf ihren schmalen Gesichtern stand.
»Oh!«, rief Lilias aus, als eine von ihnen eine leuchtende Wasserfontäne ausstieß. »Oh!«
»Sie sind wunderlich, nicht wahr?« Nachdenklich lehnte er sich gegen die Reling. »Manchmal scheint mir das eine angenehme Weise zu sein, das Leben zu verbringen. Der ganze Hader der Welt lässt sie unberührt. Auch wenn sie wohl niemals zu den Geringeren Schöpfern gezählt werden mögen, hat Meronin vermutlich klug gehandelt, indem er seine Kinder in dieser Gestalt geschaffen hat. Auf alle Fälle sind sie glücklicher als wir.«
»›Und Meronin der Tiefgründige behielt seine Gedanken für sich‹«, zitierte Lilias.
Aracus warf ihr einen kurzen Blick zu. »Ihr kennt die Überlieferungen. «
»Überrascht Euch das so sehr?« Sie beobachtete die anmutigen Kinder Meronins, wie sie überschwängliche Sprünge in den Wellen vollführten. »Ich habe zwar nie zuvor das Meer gesehen, aber ich habe tausend Jahre auf meinem Berg gelebt, Aracus Altorus, und die Weisheit der Drachen ist genauso tief wie die Meronins.«
»Vielleicht«, sagte er. »Aber sie ist falsch.«
Lilias sah ihn an. »Wisst Ihr, Herr, dass die Drachen Meronins Kinder zu den Geringeren Schöpfern zählen? Sie sagen, ihre Zeit sei noch nicht gekommen und werde noch viele Zeitalter auf sich warten lassen. Doch sie sagen, Meronin habe gut für sie vorgesorgt. Wem nützte es am meisten, als die Welt gespalten wurde?«
Er sah sie finster an. »Ihr wisst genau, dass das der Weltenspalter selbst war.«
»War er das?« Sie zuckte die Schultern. »Haomane der Erstgeborene behauptet das, aber Fürst Satoris hat wie ein Flüchtling auf Urulats Boden gelebt und war dabei von zehntausend Feinden umgeben. Währenddessen haben Meronins Wasser die Gespaltene Welt bedeckt, und seine Kinder vermehrten sich in Frieden.« Lilias deutete mit dem Kopf auf die springenden Gestalten. »Meronin der Tiefgründige ist klug und wartet ab. Vielleicht wird er eines Tages den Gedankenfürsten höchstpersönlich herausfordern.«
»Was Ihr sagt, ist Blasphemie!«, rief Aracus entsetzt.
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf. »Das ist die Wahrheit, so wie ich sie kenne. Die Wahrheit, die nicht in den Büchern der Gelehrten oder in der Prophezeiung der Schöpfer zu finden ist. Was immer ich sein mag, ich bin nicht Haomanes Untertanin, sondern Calandors Gefährtin. Ihr habt von den Überlieferungen gesprochen. Ich kenne eine ganze Menge.«
»Und vieles, das Ihr nicht teilen wollt.« Seine Stimme wurde grob. »Warum nicht?«
Lilias zitterte und schlang die Arme um sich. »Ihr redet von dem Soumanië? Das ist eine andere Sache, und Ihr wisst, warum.«
Er sah sie fest an. »Begreift Ihr, dass es um das Leben einer Frau geht?«
»Ja.« Sie hielt seinem Blick stand. »Würdet Ihr mir glauben, wenn ich Euch sagte, dass Satoris sie nicht töten wird?«
Er hob die Brauen. »Ihr könnt doch nicht wirklich behaupten, so etwas zu glauben.«
Sie seufzte. »Doch, das kann ich. Vor langer, langer Zeit hat Satoris der Drittgeborene häufig dem Rat der Drachen gelauscht, und er hat auch mit ihnen geredet. Ich weiß einiges über seine Natur. Obwohl sie stark verzerrt ist, befindet sich doch noch Anstand in ihr – und auch Stolz. Der Stolz eines Schöpfers. Er wird sie nicht kurzerhand töten.«
»Nein.« Aracus dachte nach und schüttelte schließlich den Kopf. »Nein!« Unter dem matten, glutlosen Stein des Soumanië wirkte sein Gesicht starr. »Seht Ihr das?« Mit dem Finger deutete er geradewegs auf den roten Stern, der hoch über ihnen im Nachthimmel hing. »Das ist eine Kriegserklärung, Zauberin. Ich habe die unschuldigen Toten im Tal von Lindanen gesehen. Ich war Zeuge, wie meine Verlobte hinterhältig in Gefangenschaft geriet, und ich bin ihr in eine Falle gefolgt, die uns alle hätte vernichten können, wenn da nicht Haomanes Gnade gewesen wäre. Wenn der Weltenspalter Euch etwas von Gnade erzählt hat, dann hat er Eure Gedanken nur mit seinen Lügen umgarnt.«
»Nein«, erwiderte Lilias sanft. »Ihr habt Satoris den Krieg erklärt, Fürst Aracus, als Ihr gelobt habt, die Hohe Frau der Ellylon zu heiraten. Der rote Stern ist nur der Widerhall dieser Tat. Ich spreche ihn nicht von seinen Taten frei, genauso wenig wie ich einen Freispruch für meine eigenen Taten fordere. Aber … was habt Ihr denn von ihm erwartet?«
»Es ist Haomanes Prophezeiung.« Seine Hände schlossen sich um die Reling, bis die Knöchel weiß hervorstachen. Er schaute hinaus auf das Wasser und sah mit einer Mischung aus unbewusstem Neid und erneuertem Unbehagen Meronins Kindern bei ihren Vergnügungen zu. »Ich habe nicht um dieses Schicksal gebeten.«
»Ich weiß.« Lilias beobachtete ihn. »Dennoch habt Ihr es angenommen. « Das Mondlicht warf schwache Schatten in die Falten, die Sorge und Müdigkeit in sein Gesicht gegraben hatten. Er war jung, ja, aber er war ein Mensch und daher sterblich. Wie würde es für ihn sein, wenn seine Geliebte die Zeiten überdauerte, während sein eigenes Fleisch welkte und verweste? Lilias hatte während ihrer eigenen Zeit der Alterslosigkeit Dutzende von hübschen Gehilfen ersetzen müssen und verspürte nun den seltsamen Drang, seine zerfurchte Stirn zu glätten.
»Welche Wahl hatte ich denn?« Er sah sie mit weit aufgerissenen Augen an, in denen eine verlockende Mischung aus Verlangen und Vertrauen lag. »Ehrlich, was blieb mir denn anderes übrig?«
Alle Dinge müsssen so sein, wie sie sind, kleine Schwessster. Alle Dinge.
»Ich weiß nicht, Herr«, flüsterte Lilias, während Tränen ihren Blick verschwimmen ließen. Sie hob die Hand, berührte seine Wange, legte die Handfläche sanft dagegen und spürte die Wärme seiner Haut sowie die leichte Rauheit der rotgoldenen Bartstoppeln. Der Soumanië auf seiner Stirn pulsierte aufgrund ihrer Nähe in einem kurzen, sehnenden Leuchten. Ihr Herz schmerzte bei diesem Anblick. »Sagt mir, liebt Ihr sie?«
»Ja.« Seine Finger schlossen sich um ihr Handgelenk. »Das tue ich.«
Es gab tausend Dinge, die er hätte sagen können: wie Cerelindes Schönheit sogar die Sterne beschämte, oder wie er angesichts ihres Mutes seine eigene Unzulänglichkeit verfluchte. Dass er das Opfer erkannte, das sie für die Riverlorn gebracht hatte, und wie schrecklich die Auswirkungen dieses Opfers sein würden. Aracus Altorus sagte nichts von alldem, doch das alles lag in seinen einfachen, offenen Worten und in seinem eindringlichen, fordernden Blick. Er war ein Krieger; ja, das war er.
Einer, der die Hohe Frau der Ellylon liebte.
»Also gut.« Lilias ließ es zu, dass er ihre Hand beiseiteschob und damit die Berührung sanft beendete. »Ihr hattet keine andere Wahl, nicht wahr?«
Er sah sie fest an. »Ihr beunruhigt mich, Zauberin.«
»Gut.« Sie lächelte durch ihre Tränen hindurch. »Ihr solltet beunruhigt sein, Altorus.« Sie wand ihre Hand aus seinem Griff und machte einen unsicheren Schritt weg von ihm. »Ich danke Euch, dass Ihr Euer Bild von den Kindern Meronins mit mir geteilt habt. Egal ob es der Wahrheit entspricht oder nicht, es war ein angenehmer Traum.«
Die Zwerge sahen ihr unbeteiligt nach, und auch Aracus folgte ihr mit den Blicken, bis sie die Tür zu ihrer Kabine hinter sich zuzog und wieder in die erstickende Finsternis eintauchte. Noch immer schnarchte die Bogenschützin in der zweiten Koje.
Als Lilias die Tür geschlossen hatte, weinte sie.
ZWEI
Tagelang hatte ihr Weg sie westwärts durch das ausgedörrte Nordegg geführt, wobei sie einem unterirdischen Zufluss des Gischtflusses gefolgt waren.
Thulu führte sie. Immer wieder bohrte er seinen Grabstock in die Erde und lauschte auf das Lebensblut, das tief unter der Oberfläche durch Urulats Adern floss. Dani zog die Führerschaft seines Onkels nicht in Zweifel. Alle Kinder der Yarru-yami waren darin ausgebildet, den tiefen Adern von Urulat zu folgen, doch diese Fähigkeit konnte durch Alter und Übung verbessert werden, und genau deshalb war Danis Onkel von den Yarru-Ältesten viele Jahre hindurch unterwiesen worden.
Obwohl es eine mühevolle Aufgabe war, so waren die Yarru doch wenigstens geeignet für sie. Dani und sein Onkel nippten sparsam an ihren Wasserschläuchen; ihre Körper waren daran gewöhnt, so viel wie möglich aus jedem einzelnen kostbaren Tropfen herauszuholen. Wo gewöhnliche Leute bereits zusammengebrochen wären, verspürten die Yarru lediglich einen Anflug von Unbehagen.
Sie hielten sich in den Senken, in ausgetrockneten Wasserläufen und Tälern. Fern von den sprudelnden Bächen gab es kaum mehr Anzeichen für Leben, wenn man von den hohen Fichten absah, welche die Berghänge sprenkelten. Das war ein Segen, denn es bedeutete, dass sie keine Anzeichen von Fjeltrollen bemerkten. Hier und da entdeckte Onkel Thulu eine kleine Quelle, wie ein unerwartetes Geschenk von Neheris, ein plätscherndes Rinnsal, das eine schmale Kluft zwischen den Felsen bildete.
Wo es Quellen gab, gab es auch kleine Wildtiere: Hasen und Fasane. Mit Yarru-Schleudern, die Thulu aus Lederstreifen hergestellt hatte, gingen sie abwechselnd auf die Jagd, um ihren Kochtopf zu füllen. Hier war es schwieriger als in der offenen Wüste, einen sauberen Schuss zu landen, doch Dani stellte zu seinem großen Vergnügen fest, dass ihm seine scharfen Augen als Schütze sehr nützlich waren.
Nach der Kletterei in den Bergen war das hier fast eine angenehme Reise. Ihre von der Wüste abgehärteten Füße gewöhnten sich an das raue Terrain. Die Nächte waren zwar kühl, aber keineswegs so frostig wie in höheren Lagen. Nach einigem Für und Wider hielten sie es für ungefährlich, ein munteres Feuer zu entzünden, das die schlimmste Kälte vertrieb; gegen den Rest schützten sie sich mit ihren Wollumhängen und kauerten sich zusammen, wodurch sie ihre Körperwärme besser ausnutzten.
Am Morgen des siebten Tages hörten sie ein fernes Grollen. Onkel Thulu stützte sich auf seinen frisch angespitzten Grabstock und wandte sich grinsend an Dani. »Das ist er, Junge. Das ist unser Fluss!«
Der Pfad verlief quälend lange im Zickzack, und es bedurfte der mühsamen Reise eines ganzen Nachmittags, bis sie endlich die Quelle des Grollens erreichten. Sie standen auf einem Felsvorsprung und betrachteten das, was da unter ihnen lag.
Dani starrte ehrfürchtig in die Tiefe.
Der Gischtfluss brach aus einer Bergflanke hervor und stürzte sich in einer mächtigen Kaskade in das aufgewühlte Flussbett. In geringer Entfernung war der Lärm ohrenbetäubend. Der schaumgekrönte und von Buschwerk gesäumte Fluss warf sich gegen die Felsbrocken, die es wagten, seinen Lauf zu hemmen. Am Rand des diesseitigen Ufers kämpften die kahlen Äste einer halb umgestürzten Fichte verzweifelt gegen die Strömung.
»Dem sollen wir folgen?«, fragte Dani mit offenem Mund.
»Jawohl, mein Junge!« Onkel Thulu blähte die Nüstern und sog tief die Luft ein. Er schrie seine Antwort heraus: »Kannst du die Ausdünstungen nicht riechen? Auf die eine oder andere Weise wird er uns nach Finsterflucht führen!«
Dani öffnete den Mund und wollte etwas darauf sagen, doch dann schaute er an seinem Onkel vorbei und hielt inne. Vierzig Ellen weiter den Fluss hinunter hockte eine geduckte Gestalt auf einem Sims und beobachtete sie.
Auf den ersten Blick sah sie aus wie ein weit vorgeschobener, unerschütterlicher Felsblock von der Farbe matten Granits, doch dann deutete sie mit einem stämmigen Arm auf die beiden. Der fassartige Brustkorb schwoll immer stärker an, nahm an Umfang ungeheuerlich zu, und der Mund öffnete sich und enthüllte einen höhlenartigen Schlund.
Das Brüllen des Tordenstem-Fjel erschütterte die Schlucht.
Danis Blut gefror.
Es war ein wortloses Brüllen, und es hallte von den Wänden der Schlucht wider und erstickte sogar den Lärm des Wassers, so unmöglich das auch zu sein schien. Dani hielt sich die schmerzenden Ohren mit beiden Händen zu; sein Inneres erbebte wie ein angeschlagener Gong. Seine Zähne und Knochen zitterten unter dem misstönenden Heulen.
»Ein Fjeltroll!«, rief er unnötigerweise.
Abermals ertönte das Brüllen, und Danis Eingeweide zuckten darunter zusammen. Doch es kam noch schlimmer, oh, noch viel schlimmer! Auf dem Hügelkamm darüber tauchten weitere Köpfe auf, deren Umrisse sich gegen den Himmel abzeichneten. Es waren nichtmenschliche Köpfe, missgestaltet und scheußlich, mindestens ein Dutzend. Der Wachtposten wiederholte sein ohrenbetäubendes Geheul, und die Fjeltrolle stiegen mit schrecklicher Schnelligkeit herab, wobei sie sich mit ihren Krallen in den schmalen Rissen der Hügelflanken festhielten.
»Dani!« Er sah, wie der Mund seines Onkels seinen Namen formte, während er auf das Ufer des schäumenden Flusses deutete. »Da hinunter!« Ohne zu zögern sprang Thulu hinunter und schlitterte durch eine Spalte im Felsen.
»Lass mich nicht allein!« Dani kämpfte gegen die aufsteigende Panik an und taumelte hinter seinem Onkel her. Es war schwer, einen klaren Gedanken zu fassen, während die Eingeweide in Aufruhr waren, und er spürte kaum mehr seine Fingerspitzen. Das betäubende Brüllen ertönte erneut. Dani warf einen raschen Blick hinter sich und sah, dass die Fjel näher kamen. Sie trugen nichts über ihrer rauen Haut, hatten die ledrigen Lippen gebleckt und entblößten lange Fangzähne. Kleine gelbe Augen glitzerten erbarmungslos unter den stark gewölbten Stirnen. »Uru-Alat«, flüsterte er und erstarrte.
»Lauf weiter!«, schrie Onkel Thulu. Auf dem Grund der Schlucht hatte er sich einen Weg zu der halb umgestürzten Fichte gebahnt, zerrte an den obersten Zweigen und brach sie ab. »Dani, komm!«
Während er weiter halb dahinglitt, halb fiel, schlug ihm das Wasser des Lebens in der kleinen Tonflasche gegen die Brust. Der tosende Gischtfluss kochte wie ein Herdkessel; er knurrte und tobte in seinem engen Bett und spie Fontänen hoch in die Luft. Dani stolperte über Felsen, die glitschig von der Gischt waren, und fiel seinem Onkel in die ausgebreiteten Arme.
»Nimm die hier.« Thulu warf einen raschen Blick die Schlucht hoch und drückte dabei seinem Neffen einen Stoß Fichtenzweige in die Arme. »Nein, so. Guter Junge.«
»Sind das …?« Dani biss die Zähne zusammen, damit sie nicht mehr so klapperten.
»Ja. Schnell.« So gelassen, als würde er Thukka-Ranken in der Wüste flechten, knüpfte Thulu ein langes Stück Kaninchenfell zwischen die Zweige und verknotete es fest und stramm. »Wir müssen es durch den Fluss versuchen, Dani. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht.« Er sah Dani tief in die Augen. »Was immer passieren mag, klammere dich an die Zweige. Sie halten dich über Wasser.«
Dani nickte verständig.
»Guter Junge.« Mit einer einzigen, schnellen Bewegung bückte sich Thulu, packte seinen Grabstock und drückte sich an Dani vorbei. »Geh jetzt!«
Die Fjeltrolle hatten sie erreicht.
Der Pfad nach unten war schmal, und sogar die trittsicheren Fjel konnten nur jeweils zu zweit nebeneinander angreifen. Onkel Thulu kämpfte wie ein in die Enge getriebener Tiger und schwang seinen Stab so schnell, dass er nur noch verschwommen zu sehen war. Die unbewaffneten Fjel zischten wütend und schwangen ihre abscheulichen Krallen, aber es gelang ihnen nicht, in Thulus Reichweite zu kommen. Der größte unter ihnen bellte einen kehligen Befehl, und zwei Paare trennten sich und kletterten die Schlucht hoch, damit sie den älteren Yarru von der linken Flanke her angreifen konnten. Dani hielt sich an seinem behelfsmäßigen Floß fest und schaute entsetzt zu. Derjenige, der den Befehl gegeben hatte, grinste, und bösartige Klugheit leuchtete in seinen Augen.
»Worauf wartest du noch?«, rief Thulu über die Schulter. »Geh, Dani! Geh!«
»Nein.« Tief in ihm stieg eine unerwartete Welle der Wut auf. Dani ließ das Bündel aus Fichtenzweigen fallen und griff nach seiner Schleuder. »Nicht ohne dich!«
Thulu kämpfte um sein Leben und konnte darauf nur mit einem Grunzen antworten.
Es war reine Raserei, die Danis Kopf klar machte und das Blut in seinen Ohren zum Singen brachte. Obwohl die Angst noch da war, schien sie doch fern und unwichtig zu sein. Er griff in seine Tasche, zog daraus einen glatten Stein hervor und legte ihn in die Schleuder. Er spannte sie und zielte sorgfältig auf den nächsten Fjeltroll, der sich von links näherte. Bei Uru-Alat, waren sie hässlich! Der Fjel zog eine Grimasse, deutete mit einer schmutzigen Kralle auf die Flasche vor Danis Brust und sagte etwas in seiner groben Sprache. Dani schleuderte den Stein.
Er hatte gut gezielt. Der Fjeltroll schlug die Hand gegen sein rechtes Auge, brüllte auf und geriet ins Taumeln. Dani packte eine Handvoll Steine und schoss ein wahres Sperrfeuer ab, wodurch er die Fjel einige Schritte zurücktrieb. Die anderen ordneten sich neu und beobachteten ihn. »Lasst uns in Ruhe!«, schrie er sie an.
Es war nur eine kurze Atempause. Die unverletzten Fjel senkten die Köpfe und grinsten nur, als Danis Steingeschosse von ihrer groben Haut und ihren festen Stirnknochen abprallten. Sehr bald würden sie ihn erreicht haben.
Rechts von ihm geschah etwas, das er eher hörte als sah. Thulu stieß zuerst einen scharfen Schmerzensschrei und dann ein angestrengtes Grunzen aus, und etwas schlug schwer zu Boden. Die Stimme eines Fjel dröhnte vor Schmerz. Ein Arm umfasste heftig Danis Hüfte und riss ihn aus dem Gleichgewicht. »Jetzt, Junge!«
Und dann fiel er.
Der Fluss traf ihn wie eine mächtige Faust. Er war wie ein lebendes Wesen, wie ein böses, das ihm das Leben bei jeder Biegung zu nehmen trachtete und den Funken des Feuers auslöschen wollte, der seinen Herzschlag in Gang hielt und seine Lunge zum Luftholen trieb. Wasser füllte ihm Augen und Ohren, Nase und Mund; es war mehr Wasser, als er in seinem ganzen bisherigen Leben gesehen hatte. Dani schlug mit den Armen aus, und der Fluss rollte ihn wie ein Stück Treibgut hin und her und riss ihn in die Tiefe.
Wenn sein Onkel nicht gewesen wäre, wäre er sicherlich ertrunken. Es war Thulus starker Arm um seine Hüfte, der ihn wieder hochzog, bis sein Kopf die Wasseroberfläche durchbrach und er nach Luft rang. Mit dem anderen Arm hielt sich Onkel Thulu an dem Fichtenfloß fest; er hatte die Finger um die Lederriemen gekrallt. »Halt dich gut fest!«, schrie er über das Tosen des Wassers hinweg. »Halt dich an den Zweigen fest!«
Und das tat Dani.
Es reichte kaum, damit sie beide den Kopf über Wasser halten konnten. Der Fluss wirbelte sie herum, und Dani sah am Ufer die Fjel, die miteinander stritten. Einer lag reglos am Boden. Onkel Thulus Grabstock steckte in seiner Brust. Der Wächter auf dem Sims über der Schlucht heulte vor Wut und zog sich rasch zurück, bis er außer Sichtweite war.
Der größte Fjel, der den anderen Befehle erteilt hatte, nahm die Verfolgung auf.
»Uru-Alat!« Dani hielt sich an dem Floß fest und beobachtete, wie der Fjel taumelnd und springend den schmalen Pfad entlanglief, wobei er alle vier Gliedmaßen benutzte. Ihm sank das Herz. Das Geschöpf hatte den Mund aufgerissen und keuchte schwer, doch es war schneller als die Strömung. »Können sie schwimmen?«
»Ich weiß es nicht.« Sein Onkel zog eine Grimasse. Dani warf ihm einen raschen Blick zu und erkannte Blut in der Gischt, die seine untergetauchte Brust umwirbelte.
»Du bist verletzt!«
»Nur ein Kratzer.« Thulu deutete mit dem Kinn auf eine Biegung des Flusses. »Da kommt er. Tritt nach ihm, Dani! Ich glaube nicht, dass er schwimmen kann. Wenn wir weit nach links paddeln, treibt uns die Strömung vielleicht an ihm vorbei.«
Dort, wo die Biegung eine seichte Stelle vor dem Ufer geschaffen hatte und der Fluss ein klein wenig langsamer wurde, watete der Fjel ins Wasser und versuchte mit beharrlicher Verbissenheit, seine Opfer abzufangen. Das Wasser teilte sich und umtoste seine Hüfte und die mächtigen Muskeln seiner Schenkel. Jedes andere Wesen hätte die Kraft des Wassers umgeworfen.
Nicht aber den Fjel.
Schritt für Schritt drang er weiter vor.
Dani trat wie rasend aus und spürte, wie sich der Kurs des Floßes änderte. Sein Onkel grunzte und drosch mit einem Arm auf das Wasser ein. Die roten Schlieren in der Gischt, die ihn umgab, breiteten sich aus.
Nun stand der Fjel tief im Wasser, hob den tropfenden Arm und streckte die krallenbewehrte Hand aus. Er wollte einen Zweig des Floßes ergreifen und es auf diese Weise aufhalten. Das Wesen musste das Kinn heben, damit sein Mund nicht mit Wasser vollief. Es war so nahe, dass Dani nur wenige Zoll von ihm entfernt die geschlitzten gelben Augen sah.
Es sagte etwas in der Fjelsprache.
»Geh weg!« Dani trat nach ihm aus.
Der Fjel grinste und sagte noch etwas, während er mit der anderen Hand nach der Tonflasche griff, die um Danis Hals hing. Die krallenbewehrte Hand schloss sich um die Flasche …
… und sank unter den Wasserspiegel, als ob sie einen Felsbrocken umfasst hielte, der sie hinunterzog. Der Fjel sank; sein Kopf verschwand im Wasser. Sein Griff, mit dem er sich am Floß hielt, lockerte sich, und der Strom holte sich den Fjel. Dani würgte und spürte, wie sich der Riemen um seinen Hals immer enger zog und ihm die Haut verbrannte, doch dieses Gefühl verschwand sofort, als der Fjel losließ.
Das Floß drehte sich langsam, während es die Biegung umrundete, und seine Passagiere hielten sich mit aller Kraft an ihm fest. Hinter ihnen durchbrach eine Säule aus Luftblasen die Oberfläche. Der große Fjel tauchte tropfend auf und starrte hinter ihnen her.
Zu spät.
Sie hatten die Biegung umrundet.
Dani kämpfte darum, sich über Wasser zu halten, und sah zu dem Fjel zurück, bis dieser außer Sichtweite geriet. Er fragte sich, was das Wesen gesagt hatte. Dann stürzte der Fluss in die Tiefe und verwandelte sich abermals in einen weißen Strudel. Dani gehorchte den verzweifelten, gebrüllten Befehlen seines Onkels und klammerte sich an das Floß. Er dachte nur noch an das Wasser und daran, wie er am Leben bleiben konnte, bis der tobende Strom sie hart gegen einen Felsen schleuderte.
Etwas brach mit einem kaum hörbaren Laut, und Dani verspürte einen stechenden Schmerz in der Schulter und einen dumpfen Schlag gegen den Kopf. Während die Welt vor seinen Augen schwarz wurde, befreite er die eine Hand und tastete nach der Tonflasche um seinen Hals. Sie war nicht zerbrochen.
Das war sein letzter bewusster Gedanke.
Das Gebrüll des Tordenstem-Fjel hallte durch den Schlund der Verderbten Schlucht. Es scheuchte die Raben zu einer kreisenden schwarzen Wolke auf, brachte die verhüllten Fäden in der Weberkluft zum Zittern und hieß die Reiter in Finsterflucht willkommen.
Speros warf einen raschen Blick zu den Gestalten, die auf den Höhen kauerten, und erinnerte sich nur allzu deutlich an den unfreundlichen Empfang, den sie ihm bereitet hatten. Er fuhr sich mit der Zunge über die Zähne und tastete nach der Stelle, an der ein Zahn fehlte.
»Die letzte Gelegenheit, Mittländer.« Neben ihm zügelte Heerführer Tanaros sein Pferd; in seinen dunklen Augen lag ein undeutbarer Ausdruck. »Ich meine es ernst. Kehre jetzt um und reite fort, ohne zurückzuschauen. Du kannst das Pferd behalten.«
Taschenbuchausgabe 4/2011
Copyright © 2005 by Jacqueline Carey Copyright © 2009 der Übersetzung von Michael Siefener by LYX, verlegt durch EGMONT Verlagsgesellschaft mbH, Köln Copyright © 2011 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Rainer Michael Rahn Karte: © Elisa Mitchell Umschlagillustration: Luis Royo Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
eISBN 978-3-641-08076-1
www.heyne-magische-bestseller.de
www.randomhouse.de
Leseprobe