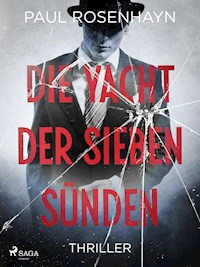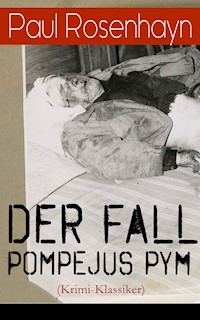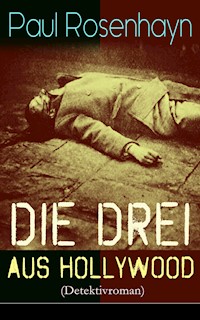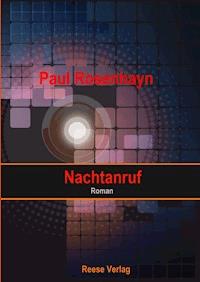Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Baker Street Bibliothek
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Kurz nach der Ankunft in Berlin beginnen für den amerikanischen Privatdetektiv Joe Jenkins elf Abenteuer, die ihn im Laufe der lose verknüpften Geschichten auch nach Paris, London, Stockholm und Hamburg führen. Ein verschollener Geheimvertrag, ein toter Offizier, der seine Frau in den Wahnsinn treibt, ein Mord in der Berliner Theaterszene, rätselhafte Flugzeugabstürze - Joe Jenkins widmet sich elf unheimlichen und angeblich unlösbaren Fällen und bedient sich dabei gerne der deduktiven Methode seines englischen Kollegen Sherlock Holmes. Joe Jenkins machte den Autor über Nacht berühmt. Abgesehen von zahlreichen Kurzgeschichten und Romanen eroberte der Privatdetektiv in insgesamt zwölf Filmen zwischen 1917 und 1919 die Leinwände des Kaiserreichs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elf Abenteuer des Joe Jenkins
Ein Kriminalroman aus dem Jahre 1893
Originaltext von 1915
von Paul Rosenhayn
Inhalt
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
Zum Autor
Das grüne Licht (Berlin)
Wenn die Toten wiederkehren (Berlin)
Proszeniumsloge Nr. 1 (Berlin)
Der Geldbrief (Paris)
Ein Ruf in der Nacht (Paris)
Das Haus im Schatten (Paris)
Das Logenbillett (London)
Rauch im Westwind! (Stockholm)
Der Similischmuck (Berlin)
Die Amati (Berlin)
Die Visitenkarte (Hamburg)
Impressum
Zur Baker Street Bibliothek
Vorbemerkung
Kurz nach der Ankunft in Berlin beginnen für den amerikanischen Privatdetektiv, Joe Jenkins, elf Abenteuer, die ihn im Laufe der lose verknüpften Geschichten auch nach Paris, London, Stockholm und Hamburg führen.
Ein verschollener Geheimvertrag, ein toter Offizier, der seine Frau in den Wahnsinn treibt, ein Mord in der Berliner Theaterszene, rätselhafte Flugzeugabstürze – Joe Jenkins widmet sich 11 unheimlichen Fällen, die „andere als unlösbar beiseite legen“ und bedient sich dabei gerne der deduktiven Methode seines englischen Kollegen (und literarischen Vorbildes), Sherlock Holmes.
Die Elf Abenteuer des Joe Jenkins (1915) machten Paul Rosenhayn (1877-1929) über Nacht berühmt und seine Detektivfigur zu einem frühen „multimedialen“ Star, der nicht nur in zahlreichen Kurzgeschichten und Romanen des spätwilhelminischen Bestseller-Autors auftritt, sondern in zwölf Joe-Jenkins-Filmen, zwischen 1917 und 1919, auch die Leinwände des Kaiserreichs eroberte.
Paul Rosenhayns Bücher haben eine Wiederentdeckung verdient. Mit Elf Abenteuer des Joe Jenkins liegt nun erstmals seit 1927 Rosenhayns Debüt wieder in gedruckter Buchform vor.
Der Text folgt in Orthographie, Grammatik und Satz weitgehend der Originalausgabe von 1915. Offensichtliche Fehler wurden berichtigt, einige Formulierungen behutsam korrigiert.
Gestatten, Paul Rosenhayn.
Eine kurze Vorstellung
Kennen Sie Paul Rosenhayn? Ich kannte ihn nicht. Dabei war Rosenhayn um 1916 einer der „meistgedruckten Novellisten Deutschlands“1 und eine feste Größe im spätwilhelminischen Filmbetrieb. Er las Auszüge seiner Bestseller-Romane im Rundfunk und verhalf als gefragter Drehbuchautor neben dem berühmten Sherlock Holmes und den heute weitgehend vergessenen Serienhelden Engelbert Fox, Tom Shark und Harry Higgs auch seiner eigenen Detektivfigur, Joe Jenkins, auf die Leinwände des Kaiserreiches. Rosenhayn war eine Schlüsselfigur des Detektivfilm-Booms der Kriegsjahre und ein Star der deutschen Unterhaltungsliteratur der 1910er und 1920er Jahre. Im Sommer 1929 wurde das von ihm und Alfred Schirokauer verfaßte Stück Karriere unter dem Titel Careers als früher Tonfilm in Hollywood produziert. Ein Sprung nach Amerika schien möglich, doch Rosenhayns Tod mit nur 52 Jahren im Spätsommer desselben Jahres ließ seine eigene Karriere abrupt enden.
Im Verhältnis zu seinem Werk (ca. 40 verfilmte Drehbücher und ca. 30 Romane und Sammlungen von Kurzgeschichten) sind die biographischen Daten zu Paul Rosenhayn sehr dürftig. 1877 in Hamburg geboren, wächst er zunächst in Großbritannien auf, besucht aber später ein deutsches Gymnasium. Er beginnt ein Jura-Studium, bricht ;es ab und reist mehrere Jahre durch Amerika, Europa und Asien. Er arbeitet als Journalist, beginnt zu schreiben und strandet, wie so viele Künstler und Literaten seiner Generation, in Berlin.
In Berlin beginnt auch das erste von elf Abenteuern des amerikanischen Detektivs, Joe Jenkins. Die Elf Abenteuer des Joe Jenkins erschienen 1915 im Leipziger Josef Singer Verlag und machten Paul Rosenhayn über Nacht berühmt. Es folgten weitere Kurzgeschichten und eine Reihe von Romanen um den Amerikaner, der in den Metropolen Europas zu Hause ist und der sich bei der Lösung seiner Fälle gerne der deduktiven Methode seines englischen Kollegen (und literarischen Vorbildes), Sherlock Holmes, bedient. Tatsächlich wird Joe Jenkins bald als deutscher Sherlock Holmes gehandelt und erobert in zwölf Filmen, für die Rosenhayn die Drehbücher schrieb, zwischen 1917 und 1919 auch das Kinopublikum im Sturm. Jenkins drittes Abenteuer aus der vorliegenden Sammlung, Proszeniumsloge Nr. gehört zu den wenigen Kurzgeschichten, die Rosenhayn direkt als Drehbuch adaptierte. Unter dem Titel Der gelbe Ulster wurde sie im Rahmen der Harry Higgs Serie 1916 verfilmt.2
Es mag heute überraschen, daß Rosenhayns „Amerikaner“ im als eher xenophob geltenden wilhelminischen Deutschland zur Zeit des ersten Weltkrieges derart populär war. Immerhin betreibt der weltmännisch auftretende Jenkins eine Art Großstadt-Hopping und löst seine Fälle (im Falle des vorliegenden Buches) in Berlin, Hamburg, London, Paris und Stockholm ohne dabei Rücksicht auf Fronten, Grenzen oder bestehende Ressentiments zu nehmen.
Rosenhayn fesselt seine Leser durch ausgefallene Plots, Bezüge auf das aktuelle Zeitgeschehen und ist immer auf Augenhöhe mit den rasanten Entwicklungen in Wissenschaft und Technik, die nicht selten zur Lösung der Fälle beitragen.
Dies alles sind sicherlich Gründe für den nicht eben selbstverständlichen Erfolg des deutschen Sherlock Holmes im Ausland. Die Fälle des Joe Jenkins erschienen auch in Großbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten von Amerika.
Vom einstmaligen Ruhm des Autors ist praktisch nichts geblieben. Rosenhayns filmisches Werk ist wahrscheinlich für immer verloren3 und sieht man von zwei ZDF-Fernsehproduktionen aus den 60er Jahren ab, bei denen es sich um Adaptionen von Kurzgeschichten aus seinem Werk Salto Mortale (1919) handelt, kann der Autor als vergessen gelten.
Zu Unrecht! Paul Rosenhayns Bücher sind Meilensteine der deutschen Trivialliteratur und haben eine Wiederentdeckung verdient. Mit Elf Abenteuer des Joe Jenkins liegt nun erstmals seit 1927 Rosenhayns Debüt wieder in gedruckter Buchform vor.
1. Julius Urgiss: Paul Rosenhayn. Filmschriftsteller. In: Der Kinematograph, Nr. 488, 1916.
2. Sebastian Hesse: Kamera-Auge und Spürnase. Der Detektiv im frühen deutschen Kino. Frankfurt a.M., 2003, S. 188.
3. Ebd., S. 186.
Das grüne Licht (Berlin)
Der Fremde, der mit dem Abendzuge von Kopenhagen angekommen war, trat in das Vestibül des vornehmen Hotels Unter den Linden. Der Hoteldirektor ließ einen prüfenden Blick über das glattrasierte hagere Gesicht und die hochgewachsene Gestalt des Angekommenen gleiten und konstatierte bei sich: Ein Amerikaner!
Als er aufsah, blickte er in zwei kühle graublaue Augen, und eine ruhige Stimme sagte mit leicht amerikanischem Akzent: „Ich bin Mr. Sanderson aus New York. Sind meine Zimmer reserviert?“
„Jawohl, Mr. Sanderson“, mischte sich diensteifrig der Portier ein. „Nummer 45 und 46. Ihr Telegramm aus Kopenhagen haben wir gestern abend erhalten.“ Sanderson nickte.
„Übrigens ist auch ein Brief für Sie da. Ich bitte sehr.“
Damit überreichte er dem Amerikaner ein längliches Kuvert, das dieser betrachtete und in die Tasche steckte.
„Ich möchte gleich auf mein Zimmer gehen.“
„Sehr wohl, Mr. Sanderson. Ich werde die Ehre haben, Sie persönlich hinaufzugeleiten.“ Der Direktor schritt dem Amerikaner voran, öffnete die Tür zum Lift und ließ ihn einsteigen. Gleich darauf entschwand der Fahrstuhl in die obere Etage.
In einem der Klubsessel, die die Halle flankierten, hatte ein älterer Herr im Smoking gesessen, der das unverkennbare Gehaben des ehemaligen Offiziers zur Schau trug. Er hatte eifrig in einer großen Zeitung gelesen. Als Mr. Sanderson seinen Namen nannte, hatte der alte Herr einen schnellen Blick auf den Ankömmling geworfen. Darauf hatte er unmerklich das Zeitungsblatt zur Seite geneigt und den Angekommenen mit den Blicken verfolgt, bis ihn der Fahrstuhl entführte. Dann war er aufgestanden, war langsam zur Treppe geschritten, die neben dem Lift emporführte, und war in den ersten Stock hinaufgegangen. Als er oben anlangte, begegnete er dem Direktor, der ins Parterre zurückkehrte. Der alte Herr nickte jenem mit einer leichten Kopfbewegung zu und schlenderte gemächlich den Korridor hinunter, den Blick auf die Nummern der Zimmer geheftet, die in endloser Reihe an ihm vorüberglitten. Bei Nummer 45 machte er halt, sah sich einen Augenblick um und klopfte an.
„Come in.“
Der alte Herr öffnete die Tür und stand im nächsten Augenblick vor Mr. Sanderson, dem Amerikaner.
„Mr. Sanderson aus New York?“
„Ja.“
„Sehr wohl. Ich möchte Ihnen melden, dass Herr Wendland in einer Viertelstunde hier sein wird.“
„Ich danke Ihnen, Inspektor. Etwas Weiteres?“
„Ja. Das Hotel ist umstellt. Ich selbst sitze unten in der Halle. Im zweiten Klubsessel vom Lift. Ich habe Befehl, Ihnen zur Verfügung zu stehen, falls Sie meiner bedürfen.“
„Ich danke Ihnen, Inspektor.“ Damit ging der Besucher hinaus.
Der Amerikaner hatte sich warmes Wasser bringen lassen und eben seinen Handkoffer ausgepackt, als das Zimmertelephon klingelte. „Ein Herr Wendland ist hier“, meldete der Portier. „Er habe einen Brief erhalten, ein Mr. Sanderson wünsche ihn zu sprechen. Ist es richtig?“
„All right, Portier, lassen Sie ihn heraufkommen.“
Man hörte das feine Summen des Fahrstuhls, ein kurzes Türenschlagen, und in der nächsten Minute klopfte der Zimmerkellner an die Tür Nummer 45 und ließ den Fremden eintreten. Der wohlbeleibte breitschultrige Herr mochte Mitte der Vierziger sein. In seinen Gesichtszügen machte sich eine gewisse Erregung bemerkbar; in den Augen lag unverkennbare Gereiztheit. „Ich kenne Sie nicht, Mr. Sanderson“, begann er, ohne sich vorzustellen. „Ich weiß eigentlich selbst nicht recht, was mich dazu bewogen hat, dem Rufe eines Unbekannten so ganz einfach Folge zu leisten. Ich bekomme da heute mittag einen Brief, darin steht, ich solle heute abend um acht Uhr hier im Hotel bei Herrn Sanderson vorsprechen. Ob dieser Brief von Ihnen ober von einem Dritten herrührt, weiß ich nicht. Jedenfalls verstehe ich nicht, wie man so einfach über mich verfügen kann, und ich muss Sie bitten, mir dies zu erklären, Mr. Sanderson. Was wünschen Sie von mir? Wer sind Sie? Und schließlich – woher kennen Sie meinen Namen?“
Mr. Sanderson verzog keine Miene. Er sah sein erregtes Gegenüber mit einem freundlichen Lächeln an und fragte, indem er höflich auf einen Sessel wies:
„Wollen Sie nicht Platz nehmen?“
Halb widerwillig ließ sich der Besucher in den Sessel nieder und blickte dem Amerikaner erwartungsvoll ins Gesicht.
„Sie betreiben“, so begann dieser mit ruhiger Stimme, „ein Pensionat in der Viktoriastraße?“
„Ja“, antwortete der Gefragte mit unwirschem Gesicht.
„Sehr gut. Vor einiger Zeit hat bei Ihnen ein Herr gewohnt …“
„Bei mir haben sehr viele Herren gewohnt“, unterbrach ihn der Pensionsbesitzer unhöflich.
„Ich spreche von einem bestimmten Herrn. Von dem Militärattaché Sanno.“
Der Pensionatsbesitzer, der grade wieder zu einer groben Erwiderung ausholte, sah den Amerikaner mit offenem Munde an. In der nächsten Sekunde wollte er aufspringen, als ihm Mr. Sanderson die Hand auf die Schulter legte und ruhig sagte: „Bleiben Sie nur sitzen, Herr Wendland. Ich möchte Sie noch einiges Weitere fragen.“
Der Aufgeforderte sah den Amerikaner mit einem Blick an, in dem ein Gemisch von Furcht und Staunen lag. Dann sagte er schließlich mit unsicherer Stimme: „Ich weiß nicht, wer Sie sind, Mr. Sanderson. Und ich weiß nicht, was Sie wollen. Aber – da Sie den Namen des Militärattachés Sanno erwähnen, so sehe ich, daß Sie etwas über Dinge wissen, die in meine eigensten Privatverhältnisse eingreifen. Wie das möglich ist – das verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, wohin diese Unterredung führen wird. Bevor ich Ihnen daher eine weitere Antwort gebe, bitte ich Sie, mir zu erklären, was Sie mit diesem Verhör – denn es ist nichts weiter als ein Verhör – beabsichtigen. Anders sage ich nicht ein Wort weiter. Wer sind Sie, Mr. Sanderson?“
Der Amerikaner sah den Besucher mit einem ruhigen Blick aus seinen kühlen grauen Augen an und sagte langsam: „Was ich will, das werden Sie im Laufe dieser Unterredung erfahren. Sie fragen weiter, wer ich bin. Die Frage beweist mir eins: Sie zweifeln daran, daß ich Mr. Sanderson heiße. Ihr Zweifel ist nicht unberechtigt. Ich will Ihnen meinen wirklichen Namen nennen; vielleicht, daß er Ihnen bekannt erscheint.“
Herr Wendland stieß ein leises Lachen aus. „Ich wüßte nicht“, entgegnete er schroff, woher ich Sie kennen sollte. Ich habe keinerlei Beziehungen zu Amerika. Und wenn Sie nicht gerade Woodrow Wilson oder Thomas Edison heißen, so kann ich Ihnen vorher versichern, daß mir Ihr Name wahrscheinlich nicht bekannt vorkommen wird.“
Der Amerikaner lächelte unmerklich und sagte mit ruhiger Stimme: „Mein Name ist Joe Jenkins.“
Der Pensionatsbesitzer fuhr empor, starrte den Amerikaner halb ungläubig an und wiederholte, fast mechanisch: „Mr. Joe Jenkins? Der berühmte Detektiv?“
„Ganz richtig“, bestätigte „Mr. Sanderson“ lächelnd. „Es freut mich, daß Sie doch noch mehr Leute in Amerika kennen als unseren Präsidenten und unseren Elektriker. Und da ich diese Unterhaltung nicht zum Vergnügen mit Ihnen führe, so möchte ich Sie bitten, wieder Platz zu nehmen.“
Der Pensionatsbesitzer sank wie willenlos in seinen Sessel zurück. „Ich weiß zwar nicht“, so begann er zögernd, „mit welchem Recht … Aber immerhin … wenn ich Ihnen in irgendeiner Weise dienlich sein kann … bitte fragen Sie.“
„Ich danke Ihnen. Ich werde Sie einiges fragen und ich bitte um kurze, knappe und unzweideutige Antwort.“ Mr. Jenkins lehnte sich in seinen Sessel zurück, der so stand, daß der darin Sitzende sich im tiefsten Schatten befand, während das Gesicht seines Gegenübers hell vom Licht der Bronzekrone bestrahlt wurde. Er legte die Beine übereinander und begann:
„Also, bei Ihnen hat bis vor einiger Zeit der Gesandtschaftsattaché Herr Sanno gewohnt. Er steht in den Diensten eines neutralen europäischen Staates. Der Name dieses Staates tut nichts zur Sache. Ist er Ihnen bekannt?“
„Ja, Mr. Jenkins.“
„Um so besser. Herr Sanno hatte für seine Regierung ein wichtiges Dokument auszuarbeiten. Ein Exposé, zu dem ihm der Gesandte die Direktiven persönlich erteilt hatte. Auch das wissen Sie wohl?“
„Ja.“
„Dieses Schriftstück sollte Herr Sanno eigentlich in der Gesandtschaft ausarbeiten. Anscheinend aus Bequemlichkeit hat er es mit in seine Wohnung genommen, um die Arbeit – ich wiederhole, entgegen seiner Instruktion – zu Hause, d. h. also in Ihrem Pensionat, auszuführen. Stimmt das?“
„Jawohl.“
„Die Arbeit war ziemlich lang und wohl recht schwierig. Sei es infolge der allnächtlichen Arbeit, sei es aus anderen Gründen – am Tage, an dem das Dokument fertig war, ist Herr Sanno schwer erkrankt. So schwer, daß er sofort in ein Sanatorium geschafft werden mußte.“ – „Jawohl, Mr. Jenkins.“
„In der letzten Minute war er so hinfällig und auch wohl nicht mehr ganz im Besitze seiner geistigen Frische, daß er Ihnen kurzerhand das Schriftstück übergeben hat. Mit der Weisung, es bis zu seiner Rückkehr aufzubewahren und zu keinem Menschen darüber zu sprechen?“
„Ja, Mr. Jenkins.“
„Wie war das Schriftstück verpackt?“
„Das Dokument mochte 80 bis 90 Seiten stark sein“, antwortete Herr Wendland. „Es lag in einem großen versiegelten Kuvert in einer Aktentasche. Diese Aktentasche hat mir Her Sanno übergeben.“
„Wo haben Sie sie untergebracht?“
„Ich habe sie in meinen Geldschrank gelegt.“
„Sehr schön. Und nun muß ich Sie etwas fragen, was scheinbar von dieser Sache abweicht, in Wirklichkeit aber eng damit zusammenhängt … Ist in letzter Zeit in Ihrem Hause irgend etwas passiert? Etwas, das ungewöhnlich war und das Ihnen aus diesem Grunde aufgefallen ist? Um es Ihnen gleich zu sagen: ich weiß, daß etwas passiert ist. Ich bitte Sie, mir die Ereignisse der Reihe nach, also chronologisch, zu erzählen, so, wie sie sich nacheinander zugetragen haben. Vergessen Sie nichts, lassen Sie nichts aus. Und damit Sie die Wichtigkeit Ihres Berichtes von vornherein richtig ermessen können, so bemerke ich Ihnen eins: Es handelt sich um Ihre persönliche Freiheit. Vielleicht um Ihr Leben.“
Der Besucher war den Worten des Detektivs mit atemloser Spannung gefolgt. Mehr und mehr hatten sich seine Blicke umdüstert; seine Augen senkten sich langsam zu Boden, endlich stand er auf, ging ein paarmal im Zimmer auf und ab, murmelte etwas vor sich hin und hielt auf einmal mitten in seiner Wanderung inne.
„Mr. Jenkins“, begann er, „ich begreife nicht, woher Sie von diesen Dingen auch nur ein Sterbenswörtchen wissen können, denn ich habe zu niemandem über meine Erlebnisse auch nur andeutungsweise gesprochen. Aber – Sie haben recht. Es ist etwas vorgekommen. Dinge, die mir unverständlich sind, ja, die mir von Tag zu Tag rätselhafter werden. Dabei muß ich Ihnen gestehen: einen Zusammenhang mit dem Dokument haben die Ereignisse nach meiner Überzeugung nicht. Denn das Dokument liegt wohlverwahrt in meinem Geldschrank, und ich habe es noch vor einer Stunde in der Hand gehabt … Ich komme schon zur Sache“, unterbrach er sich, als er die abwehrende Handbewegung des Amerikaners sah. „Sie gestatten wohl, daß ich wieder Platz nehme.“
„Es war vor zehn Tagen“, so begann Herr Wendland, nachdem er sich wieder in seinen Sessel niedergelassen hatte, „als mir Herr Sanno das Dokument in der Aktentasche übergab. Ich habe die Aktentasche in meinen Geldschrank gelegt, den Geldschrank verschlossen und den Schlüssel in die Tasche gesteckt. Das war an einem Montag. Am Abend desselben Tages hatte ich eine Vereinssitzung – ich bin Mitglied des Vereins der Hoteliers – und die Sitzung hat sich ziemlich ausgedehnt. Denn meine Kollegen können meist erst sehr spät erscheinen, und dadurch ziehen sich die Sitzungen oft bis in den Morgen hinein. Es mag also halb vier Uhr morgens gewesen sein, als ich nach Hause kam. Wie Sie wissen, Mr. Jenkins, wohne ich in der Viktoriastraße, in einem vornehmen, stillen Villenviertel. Als ich um die Ecke meiner Straße biege, fällt mein Blick auf mein Haus, das drüben in tiefem Schatten liegt, und plötzlich bemerke ich etwas, was mich mit Staunen, ich kann wohl sagen, mit Furcht erfüllt. Aus dem Erkerfenster meines Arbeitszimmers dringt heller Lichtschein. Was konnte das zu bedeuten haben? Sollte meine Frau krank geworden sein? Aber es kam noch etwas anderes hinzu: das war ja gar kein eigentliches Licht, was dort strahlte, jedenfalls nicht das schöne, sonnenscheinähnliche Licht der Lampen in meinem Arbeitszimmer; das war ein geisterhaftes und dabei eigentümlich durchdringendes Licht von smaragdgrüner Farbe! Ich kenne doch natürlich meine Lampen: eine solche Lampe habe ich in meinem Zimmer nicht.“
„Vielleicht eine Schreibtischlampe mit einem grünen Schirm?“, warf Mr. Jenkins ein.
„Nein. Eine solche Lampe besitze ich nicht … Ich stand wie gebannt und starrte auf diesen seltsamen, grünlichen Schimmer, der in dieser totenstillen Straße und in der nachtdunklen Häuserreihe einen geradezu unheimlichen Eindruck machte. Ich bin nicht abergläubisch, Mr. Jenkins, aber in dieser Stunde hatte ich das bestimmte Gefühl, daß dieses grüne Licht der Vorbote eines drohenden Unheils sei, eine Ankündigung – vielleicht eine Warnung aus einer anderen Welt. Schließlich raffte ich mich auf und stürzte die Treppen hinauf. Mein erster Weg geht ins Arbeitszimmer. Ich trete ein und fahre zurück: Das Zimmer ist dunkel und leer. Ich suche alles ab: nichts ist zu sehen.“
„Untersuchten Sie den Geldschrank?“, fragte Mr. Jenkins.
„Natürlich, sofort. Alles war unversehrt, und das Dokument lag an der alten Stelle in der Aktentasche. Darauf gehe ich zu meiner Frau ins Schlafzimmer – sie hat ihr eigenes Zimmer – sie liegt in tiefem Schlaf. Mein hastiger Tritt weckt sie. Ich erzähle ihr mit einigen fliegenden Worten, was ich beobachtet, frage, ob sie nichts gesehen oder gehört habe? Nichts!
Meine Frau hatte nicht das geringste bemerkt. Sie betonte mit Recht, wenn irgend jemand die Wohnung betreten haben würde, so hätte sie es vor allen Dingen bemerken müssen. Schließlich meinte meine Frau lächelnd, ich müsse wohl ein Gläschen über den Durst getrunken haben. Ich verteidigte meine Beobachtung, um schließlich, Zweifel im Herzen, schlafen zu gehen. Am andern Morgen war ich schon geneigt, meine Beobachtungen meiner erhitzten Phantasie zuzuschreiben – vielleicht auch den zwei Flaschen Wein, die ich im Laufe der Nacht getrunken hatte – als mich am nächsten Mittag ein Freund antelephoniert und mich fragt, was eigentlich in der letzten Nacht bei mir vorgegangen sei. Er sei um zwei Uhr durch die Viktoriastraße gegangen und habe einen grünen Lichtschein in meinem Arbeitszimmer bemerkt … Jetzt wußte ich, daß ich mich nicht geirrt hatte, Mr. Jenkins.“
„Erzählten Sie Ihrer Frau von der Beobachtung Ihres Freundes?“ fragt der Detektiv.
„Ja. Meine Frau schüttelte skeptisch den Kopf und meinte schließlich, mein Freund sei wahrscheinlich ebenso angeheitert gewesen wie ich. – Nun, ich bin überzeugt, wir haben uns nicht geirrt. Ich nicht und mein Freund nicht. Auch ist es unwahrscheinlich, daß zwei Menschen unabhängig voneinander und zu verschiedenen Zeiten genau die gleiche Halluzination gehabt haben sollten.
Das Erlebnis hat mich nachdenklich gemacht. Ich untersuchte am nächsten Tage aufmerksam die ganze Wohnung – vergeblich. Ich fand nichts Verdächtiges. Dann kamen geschäftliche Dinge dazwischen. Ich habe in der nächsten Nacht noch ein bißchen aufgepaßt, aber nichts hat sich gerührt. Bis sich in der Nacht darauf etwas Neues ereignete.
Ich sagte Ihnen schon, Mr. Jenkins, daß wir, meine Frau und ich, getrennte Schlafzimmer haben. Das hängt damit zusammen, daß ich etwas herzleidend bin und daher besser schlafe, wenn ich allein bin. Meine Frau hat ein Vorderzimmer; ich schlafe in einem Raum, der nach hinten auf die Gärten hinausblickt. Es mochte um halb drei Uhr in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag sein, als ich davon erwachte, daß in meinem Hause eine Tür ging. Gleich darauf höre ich leise schleichende Schritte auf dem Korridor. In Friedenszeiten würde ich mich um ein derartiges Vorkommnis nicht viel kümmern, Mr. Jenkins; einer meiner Pensionäre konnte die späte Störung verursachen – vielleicht, daß er einen galanten Besuch entließ, oder etwas Ähnliches.
Jetzt, im Kriege, steht mein Haus leer, denn alle meine Pensionäre, größtenteils Ausländer, sind abgereist. Ich gehe leise an meine Zimmertür und öffne sie; in diesem Moment wird die Etagentür von außen geschlossen. Kein Zweifel – jemand verließ das Haus.
Und da tappten auch schon knarrende Schritte die Treppe hinunter. Ich stürzte an die Haustür; der Schlüssel steckt von außen im Schloß – ohne Zweifel mit Absicht, um mich am schnellen Verlassen des Hauses zu hindern.
Ich eile nach vorn und reiße das Fenster auf; leise wird unten die Tür geöffnet und jemand verläßt das Haus. Mit meinen Blicken durchbohre ich die Finsternis, und nach einigen Sekunden kann ich die Gegenstände unterscheiden. Zu meinem Erstaunen ist es eine Dame, die aus dem Hause tritt. Und mit grenzenloser Bestürzung erkenne ich in der Dame meine Frau. – Meine Frau! Was bedeutete das? Ich konnte es noch immer nicht glauben. Darum eilte ich zu ihrem Zimmer hinüber: es war verschlossen. Nach einiger Zeit gelingt es mir, die Tür zu öffnen – Das Bett war leer. Ich versuchte nun, meiner Frau nachzueilen; von vornherein ein ziemlich aussichtsloses Beginnen bei ihrem großen Vorsprung. Mit einigem Zeitverlust gelang es mir, das Haus zu verlassen, ich stürzte in der Richtung davon, in der meine Frau verschwunden war. Aber nichts war von ihr zu sehen. Nur in der Ferne hörte ich das Rattern eines Automobils, das sich schnell entfernte.
Nun ging ich nachdenklich und niedergeschlagen wieder nach Hause und grübelte und zermarterte mir den Kopf über das Unerhörte, das ich gesehen und gehört hatte. Was lag diesen unbegreiflichen Dingen zugrunde? Ich dachte und dachte und konnte nicht einschlafen.
„Eine Frage“, unterbrach Jenkins den Erzähler. „Drängte sich Ihnen ein Gefühl der … der Eifersucht auf?“
Herr Wendland lächelte traurig und sagte leise: „Nein, Mr. Jenkins. Meine Frau ist 43 Jahre alt – 43 Jahre! Und sie ist mir immer eine treue und aufopfernde Kameradin gewesen, der jede Falschheit fernlag. Eine Untreue war das letzte, woran ich dachte.
Als ich am anderen Morgen um neun Uhr am Kaffeetisch erschien, saß meine Frau schon wie immer an ihrem Platz und begrüßte mich mit einem Lächeln. Ich beobachtete sie heimlich von der Seite. Da sah ich, daß ihr Gesicht bleich und eingefallen war. Und in ihren Augen lag der Ausdruck eines furchtbaren Kummers. Ich habe gewartet, Mr. Jenkins, und habe gehofft, meine Frau würde reden. Aber sie schwieg beharrlich und starrte in den scheinbar unbewachten Augenblicken vor sich hin, immer mit dem gleichen Ausdruck des grenzenlosen Jammers in den Zügen. Gewiß, ich hätte sie einfach fragen können. Ein paarmal war ich drauf und dran, es zu tun. Aber immer wieder, wenn ich in das blasse Gesicht und in diese trostlosen, verzweifelten Augen blickte, dann ist mir das Wort in der Kehle erstorben. Und schließlich – wollte sie nicht reden, nicht die Wahrheit reden – dann würde sie mir auch auf meine Fragen nicht mit der Wahrheit geantwortet haben.
Aber – mein Mißtrauen war erwacht. Es traf sich zufällig, daß ein Klub, dem ich angehöre, am letzten Sonnabend seinen Ball abhielt. Ich habe zwei Jahre hintereinander diesen Ball in Gesellschaft meiner Frau besucht und wir haben uns jedesmal gut unterhalten. Nichts war daher natürlicher, als daß ich sie auch diesmal wieder aufforderte, mit mir hinzugehen. Sie lehnte ab. Sie fühle sich nicht wohl. Als ich darauf die Absicht aussprach, ebenfalls nicht hinzugehen, drängte sie mich, es doch zu tun. „Geh‘ nur“, sagte sie, und es kam mir vor, als ob ein Ausdruck der Unruhe in ihre Augen trat, „ich wäre untröstlich, wenn du dir meinetwegen das Vergnügen versagen würdest. Amüsiere dich gut.“ Abends legte sie mir selbst meinen Frack zurecht. Und ich ging.
Ich fuhr auch tatsächlich zum Ball, um auf alle Fälle dort gewesen zu sein, verließ ihn aber schon um ein Uhr wieder, während ich zu Hause meine Rückkehr auf drei Uhr in der Nacht angesagt hatte.
Um ein Uhr nahm ich mir ein Automobil und fuhr in die Viktoriastraße. An der Ecke stieg ich aus.
Das Haus lag in tiefem Schatten. Ich ging ein paarmal daran vorüber, schwang mich über das Gitter eines der Vorgärten und drückte mich gegen die Mauer der Villa, die meinem Hause gegenüberliegt.
Die Straße war menschleer. Am Himmel ballten sich schwarze Wolken, und kein Stern war zu sehen. In der Ferne hallte von Zeit zu Zeit der einsame Schritt eines nächtlichen Wandrers. Sonst war alles totenstill. Ich beobachtete unausgesetzt die Fenster meines Hauses, die in schweigendem Dunkel dalagen. Plötzlich hatte ich das Gefühl, als ob an den Fenstern meines Arbeitszimmers eine Veränderung vor sich gegangen sei. Einen Augenblick dachte ich vergeblich darüber nach, worin diese Veränderung wohl bestehe, dann wurde es mir in der nächsten Sekunde klar – die Vorhänge! Irgend jemand hatte soeben die Vorhänge zugezogen! Und als ich noch mit fiebernden Augen auf meine Fenster starrte – da – da – da flammte es plötzlich auf …“
„Das grüne Licht?“, fragte der Detektiv ruhig.
„Das grüne Licht. Ich stand wie gelähmt, Mr. Jenkins. Meine Augen irrten an der Front entlang und suchten vergeblich nach einer Lösung des Rätsels. Dann starrte ich wieder wie hypnotisiert auf die grüne Lichtflut, die da zu mir herniederdrang. Das Licht war nicht von gleicher Intensität. Manchmal schwoll es an, und ich glaubte, einen leise singenden Ton zu hören. Dann verminderte sich plötzlich die Leuchtkraft der Strahlen, und der Schein wurde ganz schwach und fahl, als ob in dem Zimmer eine winzige Nachtlampe brannte.
Um die Ecke kam in langsamer Fahrt eine Automobildroschke. Die hellen Azetylenscheinwerfer erleuchteten im Vorüberfahren die beiden Häuserreihen mit einem blitzschnellen Reflex, und als sie an meinem Hause vorüberfuhr, fiel ein blendendheller, zitternder Lichtkegel über die Fenster meiner Wohnung. Und da stieß ich einen Schrei aus. Aus einem der Vorderfenster schaute der Kopf meiner Frau, die Blicke mit dem Ausdruck des Grauens auf die grünlich schimmernden Erkerfenster gerichtet. Auf das grüne Licht!“
„Wissen Sie genau, daß es der Kopf Ihrer Frau war?“
„Ganz genau, Mr. Jenkins. Und nie habe ich ein entsetzteres Gesicht gesehen, als das meiner Frau in diesem Augenblick. Einen Moment war ich dem Zusammensinken nahe, dann beschloß ich, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich schüttelte meine Gedanken ab, stürzte zum Hause hinüber, schloß auf und ging leise die Treppen hinauf. Dann eilte ich mit ein paar Sätzen in mein Arbeitszimmer. Ich stieß es auf und faßte mich an den Kopf: Das Zimmer war dunkel und leer. War das der beginnende Wahnsinn?
Ich ging zu meiner Frau hinüber. Sie lag im Bett und schlief fest. Anscheinend. „Hast du nicht eben das grüne Licht gesehen?“, schrie ich und rüttelte sie am Arm. Sie schien aus tiefem Schlaf zu erwachen, lächelte und sagte schlaftrunken: „Was hast du mit dem grünen Licht? Ich weiß nichts von einem grünen Licht!“
„Und da wußte ich, daß sie mich belog.“ Der Erzähler hatte geendet und starrte gedankenverloren vor sich hin.
„Wann war das?“ fragte der Detektiv.
„Vorgestern abend.“
„Hat sich inzwischen noch etwas ereignet?“
„Nein, Mr. Jenkins.“
„Haben Sie sich“, begann der Detektiv nach einer Pause, „irgendeine Meinung darüber gebildet, was das grüne Licht zu bedeuten hat? Und haben Sie versucht, einen Grund für das Verhalten Ihrer Frau zu finden?“
„Ich habe nachgegrübelt, bis ich überhaupt nicht mehr fähig war, irgendeinen Gedanken zu fassen. Ich finde keine Erklärung. Keinen Anhalt. Nichts.“
„Nun“, sagte Mr. Jenkins nach einer Weile und stand auf, „ich denke, einiges kann ich Ihnen immerhin zur Erklärung sagen.“
Der Pensionatsbesitzer warf einen erstaunten Blick auf Mr. Jenkins und schüttelte ungläubig den Kopf.
„Ich wüßte nicht, Mr. Jenkins“, sagte er endlich, „wie Sie zu einer Erklärung dieser Dinge kommen sollten, kennen Sie doch weder mich noch meine Frau.“
„Nein“, erwiderte der Detektiv. „Sie und Ihre Frau kenne ich nicht, aber ich glaube, etwas anderes zu kennen, worauf es hier ankommt: das Dokument.“
„Das Dokument?“, wiederholte der Pensionatsbesitzer verständnislos.
„Sie verstehen offenbar noch immer nicht, um was es sich hier handelt, Herr Wendland“, fuhr Joe Jenkins fort. „Wissen Sie im übrigen, was dieses Dokument enthielt?“
„Nein.“
„Es stellt einen geheimen Vertrag dar, geschlossen zwischen zwei europäischen Staaten: eben dem, dessen militärischer Attaché Herr Sanno ist, und einem anderen. Und nun hören Sie, was ich Ihnen sage, Herr Wendland: Dieser Vertrag ist vor drei Tagen einer feindlichen Regierung für eine halbe Million Frank angeboten worden. Dem Angebot lag eine Abschrift der ersten drei Seiten des Vertrages bei.“
Der Pensionatsbesitzer stieß einen dumpfen Schrei des Entsetzens aus, griff mit den Armen in die Luft und fiel kraftlos in einen Sessel. Erst nach einiger Zeit kam er wieder zu sich. Er öffnete mit sichtlicher Mühe die Lider und sah den Detektiv mit glasigen Augen an. „Sind Sie der Meinung“, fuhr dieser ruhig fort, „daß sich der Vertrag noch in Ihrem Besitze befindet?“
„Kein Zweifel“, antwortete der Gefragte mit matter Stimme. „Ich habe das Dokument noch heute gesehen. Bevor ich fortging.“
„Geht Ihre Frau heute aus?“
„Nein.“
„Wann pflegt sie schlafen zu gehen?“
„Um halb zwölf.“
„Ich möchte das Dokument sehen.“
Der Pensionsbesitzer zögerte einen Augenblick.
„Nehmen Sie es mir nicht übel, Mr. Jenkins. Ich weiß nicht recht, ob ich berechtigt bin, Ihnen das Schriftstück zu zeigen.“
Mr. Jenkins blickte einen Augenblick zu Boden und sagte dann leise: „Herr Wendland, ich sehe, Sie haben die Situation noch immer nicht richtig erfaßt. In dem Briefe, den ich hier in der Tasche trage, steckt ein Verhaftungsbefehl. Wissen Sie, gegen wen er lautet? … Gegen Sie und Ihre Frau. Auf Ihnen beiden ruht der Verdacht, den Vertrag entwendet und dem fremden Staate angeboten zu haben. Es kostet mich ein Wort, und Sie sind verhaftet. Das Hotel ist umstellt. Wünschen Sie also, daß ich den Haftbefehl benutze – oder wollen Sie mit mir den Täter ermitteln?“
Der Pensionatsbesitzer rang eine Weile mühsam nach Atem. Schließlich sagte er mit sichtlicher Mühe: „Wenn die Sache so steht, Mr. Jenkins – dann muß ich natürlich tun, was Sie von mir verlangen. Was soll ich also tun?“
„Ihre Frau geht um halb zwölf schlafen. Sie werden solange bei mir bleiben und in der Zeit bis dahin mit mir unten im Restaurant eine Kleinigkeit essen. Dann werden wir zusammen in Ihre Wohnung fahren.“
Es mochte gegen halb zwei Uhr nachts sein, als Herr Wendland und sein Begleiter durch die stillen Straßen des Tiergartens schritten. Fern verklang dumpf das brandende Großstadtleben. Hier, kaum 200 Meter von der Peripherie, war es still und menschenleer. Ab und zu hallte die gedämpfte Hupe eines fernen Automobils herüber. Und je näher die beiden ihrem Ziele kamen, desto leiser und spärlicher klangen die Töne des Lebens zu ihnen herüber.
Die beiden Herren schritten langsam dahin. Beide in tiefen Gedanken. Die Häuser dieses vornehmen Stadtviertels lagen schon in tiefem Schweigen. Über den Straßen hing ein regenschwerer Himmel, und seufzender Nachtwind strich durch die alten Eschen.
„Hier ist die Viktoriastraße“, sagte Wendland und zog seinen Begleiter auf die andere Seite. Im nächsten Augenblick deutete der Pensionatsbesitzer mit der zitternden Hand auf ein Haus, das aus der dunklen Häuserreihe grell hervorstach. Der Detektiv folgte der Richtung des ausgestreckten Armes und zog die Brauen zusammen: die zwei Eckfenster des gegenüberliegenden Hauses erstrahlten in smaragdgrünem Lichte. „Das grüne Licht“, sagte der Pensionatsinhaber mit zitternder Stimme.
„Haben Sie den Schlüssel bereit?“, fragte Joe Jenkins. „Dann kommen Sie schnell.“ Damit stürzten die beiden ins Haus und eilten die Stufen empor.
Wendland schloß die Haustür auf und stürzte voran, ins Arbeitszimmer. Er stieß die Tür auf und sah sich mit einem unbeschreiblichen Gesichtsausdruck um: das Zimmer lag in tiefem Dunkel.
Mr. Joe Jenkins trat langsam ein, den Strahl einer Taschenlampe auf den Teppich gerichtet. „Bitte, schalten Sie das Licht ein.“ Wendland tat es, und das Zimmer erstrahlte in mildem, gelbem Glühlicht.
„Hat dieses Zimmer einen zweiten Ausgang?“
„Ja, in unser Wohnzimmer.“
„Führen Sie mich hinein.“ Auch dies Zimmer war leer.
„Wohin führt diese Tür?“
„Ins Schlafzimmer meiner Frau.“
„Versuchen Sie zu erfahren, ob sie schon schläft.“