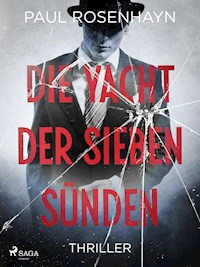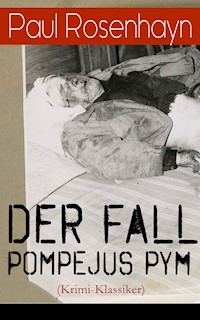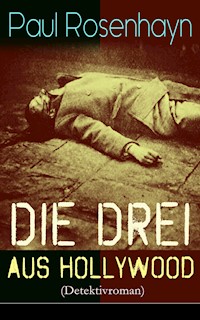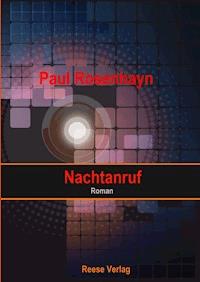Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Die Dinge, von denen ich hier sprechen will, gehören einem Gebiet an, das heiß umstritten ist. Ich will gestehen, daß ich selbst zu den Streitenden gehöre. Und zwar wie ich hinzufügen will: zu denen auf der andern Seite. Zu den Verneinern. Dies vorausgeschickt, bitte ich um Gehör und gleichzeitig, ich möchte sagen, um einen gewissen Kredit. Eben weil ich mich eingehend, zweifelnd, forschend und voller Skepsis mit den seltsamen Erlebnissen beschäftigt habe, die rechts und links von mir einwandfreien Leuten widerfahren sind, eben darum, auf diesem Wege, sind mir Geschehnisse untergekommen – oder doch in meiner nächsten Nähe vor sich gegangen – die mit einem einfachen ›Unsinn‹ nicht abzutun sind." Paul Rosenhayns kurzweilige Sammlung unerklärlicher Begebenheiten befasst sich mit den Dingen, die an den Grenzen des Menschenverständlichen liegen, und geht paranormalen Phänomenen auf den Grund: Das Zweite Gesicht, Seelentausch, Geistererscheinungen und andere gespenstisch wirkende Phänomene werden auf unterhaltsame und mitunter recht verstörende Weise präsentiert, so dass der Leser unweigerlich an all dem zu zweifeln beginnt, was er bisher für allein "real", "möglich" und "wirklich" gehalten hat. Ein äußerst spannendes "Tatsachen"-Buch!Paul Rosenhayn (1877–1929) war ein deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor. Am 11. Dezember 1877 in Hamburg als Sohn eines Handelskapitäns geboren, wuchs Rosenhayn zunächst in England auf, wo er auch zur Schule ging, bis er auf ein deutsches Gymnasium wechselte. Er studierte zunächst einige Semester Jura, entschied sich dann jedoch für eine journalistische Laufbahn. Er reiste ausgiebig durch Europa und Amerika, lebte mehrere Jahre in Indien und schrieb während dieser Zeit für verschiedene englische und deutsche Zeitungen. Nach Beginn des Ersten Weltkriegs ließ er sich in Deutschland nieder und begann, Kriminalgeschichten zu verfassen. Sich vage am Vorbild Sherlock Holmes orientierend, schuf er den ähnlich scharfsinnigen, aber wesentlich tatkräftigeren Detektiv Joe Jenkins. Rosenhayns zweites Standbein wurde die aufstrebende Filmindustrie. Er schrieb insgesamt etwa 40 verfilmte Drehbücher, wobei er den Krimi bevorzugte. Dank seiner Zweisprachigkeit konnte Rosenhayn seine Werke auch im Ausland anbieten. Der Weg über den Atlantik und eine Zukunft in Hollywood schienen nahe, als Paul Rosenhayn am 11. September 1929 im Alter von nur 52 Jahren in Berlin starb. In den Jahren der Nazidiktatur geriet Rosenhayns allzu kosmopolitisches Werk in Vergessenheit. Erst jetzt wird das Werk dieses vielseitigen, engagierten und fruchtbaren Autors, der viele Jahre zu den Größen der deutschen Unterhaltungsliteratur und des Unterhaltungsfilm gehörte, im E-Book-Format wiederentdeckt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Rosenhayn
Spaziergänge ins Jenseits
Saga
Spaziergänge ins Jenseits
Copyright © 1925, 2017 Paul Rosenhayn Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711592618
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
I
Die Dinge, von denen ich hier sprechen will, gehören einem Gebiet an, das heiss umstritten ist. Ich will gestehen, dass ich selbst zu den Streitenden gehöre. Und zwar wie ich hinzufügen will: zu denen auf der andern Seite. Zu den Verneinern. Dies vorausgeschickt, bitte ich um Gehör und gleichzeitig, ich möchte sagen, um einen gewissen Kredit. Eben weil ich mich eingehend, zweifelnd, forschend und voller Skepsis mit den seltsamen Erlebnissen beschäftigt habe, die rechts und links von mir einwandfreien Leuten widerfahren sind, eben darum, auf diesem Wege, sind mir Geschehnisse untergekommen — oder doch in meiner nächsten Nähe vor sich gegangen — die mit einem einfachen „Unsinn“ nicht abzutun sind.
Die Aufsätze, die hier folgen, sollen einige der prominentesten und unerklärlichsten Erlebnisse auf diesem Gebiete wiedergeben.
Meine Rolle — ich wiederhole es — ist eine lediglich berichtende. Die Dinge, die ich mitteilen werde, lassen sich, wie ich glaube, verstandesmässig, also mit den uns bekannten Gesetzen der Physik, nicht erklären. Ebensowenig aber würde ich behaupten, dass aus diesem Grunde übernatürliche Deutungen, die also etwa auf dem Gebiete des Geisterglaubens liegen würden, sich zwangsläufig ergäben.
Es möge vielmehr dem Leser überlassen bleiben, sich eine Meinung zu bilden — ein Urteil, eine Deutung zu finden. Das Thema ist ein so ungeheuer grosses, ein so bis zu den letzten Quellen der Menschheitsgeschichte reichendes, dass sich vielleicht eines Tages Perspektiven ergeben, die zu dritten, vierten und fünften Lösungsmöglichkeiten führen. Denn, dies möge nur angedeutet sein, auch die Begriffe natürlich und übernatürlich, physisch und metaphysisch sind letzten Endes dem Alltagsbedarf der Menschheit entnommen; sie sind verkleinernd statt umfassend. Und es wäre sehr wohl denkbar, dass die Schablone des Handwerkers für die Ansprüche der lebendigen Welt nicht reicht.
Ein mir befreundeter Berliner Fabrikant, Herr E., den Neugier und Neigung in okkultistische Kreise geführt haben, wohnte lange Zeit in einem westlichen Berliner Vorort. Er war oberflächlich bekannt mit einem Ehepaar, das die Nachbarvilla bewohnte. Der Mann starb; seine Witwe ging auf Reisen, und erst nach Jahren sah Herr E. sie wieder. Sie hatte sich inzwischen, die Länge der Zeit liess das als selbstverständlich erscheinen, über den Verlust des Gatten einigermassen getröstet. Die Rede kam auf okkulte Dinge. Es stellte sich heraus, dass die Dame allem Übersinnlichen völlig ablehnend gegenüberstand. Auch Herr E. erklärte, dass er durchaus Skeptiker sei; lediglich aus dem menschlich begreiflichen Interesse für das Unerklärliche beschäftige er sich hin und wieder mit metaphysischen Dingen — immer bestrebt, sie auf bekannte Gesetze zurückzuführen und ihnen den Nimbus des Geheimnisvollen zu entziehen.
Die Dame antwortete mit ablehnendem Lächeln. Sie habe indessen eine Freundin, die sich für derartige Dinge interessiere. Und schliesslich wurde verabredet, dass Herr E. die Dame in ihrer Villa in Begleitung eines Mediums einmal besuchen werde. Das Nähere sollte telephonisch vereinbart werden, damit auch die Freundin der zu besuchenden Dame eingeladen werden könne. Die Dame selbst war, wie erwähnt, betont ungläubig. Ja, sie stand okkulten Fragen offenbar mit einer gewissen Feindseligkeit gegenüber.
Es dauerte fast ein halbes Jahr, bis der beabsichtigte Besuch zustande kam.
Frau J. — eben jene Dame, die Herr E. in das Haus seiner Nachbarin einführte — hatte mehrfach überraschende Proben medialer Veranlagung gegeben. Einige davon sollen in späteren Aufsätzen folgen. Auf der Fahrt nach dem Villenvorort sagte sie ganz plötzlich:
„Was ist das für eine Dame, die dort draussen zu Besuch ist?“
(Herr E. hatte ihr von dem Dabeisein jener zweiten Dame nichts gesagt.)
Herr E. erwiderte, dass er die Dame nicht kenne und nie gesehen habe. „Nun,“ sagte Frau J., „sie hat braunes Haar, ein wenig angegraut. Sie trägt ein graues Kleid. Was sind das für Menschen, die in ihrem Hause ein- und ausgehen? Es sind auffallend viele; und ich glaube, es sind auffallend junge Leute.“
Herr E. konnte wiederum nur erwidern, dass er keine Ahnung habe. „Sehen Sie sie denn vor sich?“
„Gewiss“, antwortete Frau J. „Und ich sehe auch den Raum, in dem sie sitzt. Es ist ein sehr grosses Speisezimmer mit zwölf Lederstühlen. Sie sitzt in einer Ecke, in der ein Tisch und zwei Sessel stehen. Über ihr hängt eine Blumenampel.“
Hier konnte Herr E. zu seiner Befriedigung einen Irrtum feststellen: das Speisezimmer besass keine solche Ecke, wie die Dame sie beschrieb, und auch von einer Blumenampel konnte keine Rede sein.
Bei ihrem Eintreten in das Haus präsentierte ihnen die Gastgeberin ihre Besucherin: eine Dame mit braunem Haar, das leicht angegraut war; sie trug ein graues Kleid.
„Wissen Sie, dass mir Frau J. schon von Ihnen erzählt hat?“ sagte Herr E. „Sie hat mir sowohl Ihr Haar als auch Ihr Kleid beschrieben. Aber im übrigen hat sie sich geirrt,“ wandte er sich an die Besitzerin des Hauses, „sie spricht von einer Ecke in Ihrem Speisezimmer mit Sesseln und Blumen. Ich kenne doch das Zimmer und weiss, dass es dort ganz anders ...“
Die Gastgeberin schüttelte den Kopf und stiess die Tür zum Speisezimmer auf. „Wir haben das Arrangement geändert“, sagte sie, auf die Ecke deutend.
Die Ecke sah genau so aus, wie Frau J. sie unterwegs beschrieben hatte: zwei Sessel, ein Tisch, eine Blumenampel.
„Frau J. behauptet übrigens, in Ihrem Hause gingen auffallend viel junge Leute ein und aus, gnädige Frau.“
Die Dame lächelte erstaunt. „Allerdings. Ich habe eine Musikschule.“
Während man den Tee nahm, benutzte Frau J. einen günstigen Moment, um Herrn E. zuzuflüstern: „Was ist in diesem Hause vorgegangen?“
Herr E. zuckte die Achseln. „Warum?“
„Ich fühle, dass jemand hinter mir steht.“
Die Gastgeberin wurde aufmerksam und mischte sich ins Gespräch.
„Ich höre, dass jemand unausgesetzt ‚Anka’ ruft.“
Die Worte hatten eine seltsame Wirkung. Die Dame des Hauses wurde blass. „Anka ... mein Gott ... so nannte mich mein Mann. Ich heisse in Wirklichkeit Elisabeth.“
Frau J. nickte. „Und sagen Sie mir, was ist das ...“
„Was haben Sie nur?“
„Nein. Nichts.“
Man drang in sie, und sie sagte endlich mit einem scheuen Blick auf die Hausfrau: „Was ist das für ein weisser grosser Kragen, den Ihr Herr Gemahl getragen hat?“
Die Wirtin starrte sie fassungslos an. Aber sie gab keine Antwort.
Nach einiger Zeit äusserte Frau J. den Wunsch, die anderen Räume der Villa zu sehen. Herr E. blieb aus irgendeinem gleichgültigen Grunde unten im Vibliothekzimmer.
Es mochten zehn Minuten vergangen sein, als er plötzlich einen lauten Aufschrei hörte. Er stürzte hinaus. Ein zweiter Schrei kam durch das Haus. Dann sah er Frau J. mit allen Zeichen des Entsetzens die Treppe herunterkommen und unten fassungslos zusammenbrechen. Man brachte sie mit ziemlicher Mühe wieder zu sich.
„Wie konnten Sie mich in dieses Haus führen?“ keuchte sie. „Ich habe ihn gesehen. Dort oben in dem kleinen Zimmer sitzt er, mit einem weissen Taschentuch erdrosselt!“
Dabei machte sie würgende und krampfhafte Bewegungen mit dem Hals. „Mein Gott! Wie das schmerzl! Und dieser entsetzliche Gasgeruch ...!“
Die Herrin des Hauses stierte wortlos vor sich hin — alles war auf den Schrei zusammengelaufen.
An ihrer Stelle nahm ihre Freundin das Wort. „Ja — sie sagt die Wahrheit. Er hat sich erdrosselt und gleichzeitig den Gashahn geöffnet. Aber niemand ausser uns beiden und dem Arzt hat es je erfahren.“
II
Das Erlebnis, das ich hier beschreibe, ist in verschiedener Hinsicht bemerkenswert. Es betrifft Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und deren Namen weitesten Kreisen bekannt sind. Der ungewöhnliche Vorfall ist ferner besonders gelagert durch den Umstand, dass er das erste Erlebnis eines Hellsehers bildet, dessen Name inzwischen weit über Deutschlands Grenzen bekannt geworden ist, ja dass er das eigentliche auslösende Moment darstellt, das jenen Hellseher auf seine „mediale Begabung“ aufmerksam gemacht hat. Ob das hier geschilderte Erlebnis eine rationalistische Deutung zulässt, oder ob es auf anderem als okkultem Wege nicht erklärbar ist — diese Frage zu beantworten möchte ich dem Leser überlassen. Ich folge hier minutiös den Aufzeichnungen des Mediums und enthalte mich nicht nur jedes schmückenden Beiworts, sondern vor allem jeden Kommentars.
In der Nacht vom 25. auf den 26. November des Jahres 1915 lag ein verwundeter deutscher Soldat in einem Münchener Sanatorium. Das Haus, eine Villa in vornehmer Gegend, war für Lazarettzwecke zur Verfügung gestellt worden; es war mithin in Wahrheit ein Privathaus, das vorübergehend seine Bestimmung gewechselt hatte. Ich erwähne dies mit Absicht zweimal, weil es von einer gewissen Bedeutung ist.
Der Soldat, der schon fast völlig hergestellt und jedenfalls gänzlich fieberfrei war, lag wachend im Bett; von irgendwoher aus der Nacht schlug es ein Uhr. Er drehte sich gelangweilt und ein wenig verdriesslich im Bett herum, als er plötzlich von der Tür zur Rechten — dem Bett gegenüber — ein leises Geräusch vernahm. Wahrscheinlich, so sagte er sich, die Trockentäfelung: die Faserrichtung passt vermutlich nicht zu dem Rahmen, der sie umgibt. Trotz dieser naheliegenden Deutung vermag er nicht seine Aufmerksamkeit von jener Tür abzuwenden. Er weiss genau, dass solche Nachtgeräusche nichts Seltenes sind: das Material zieht sich unter der Einwirkung der Kälte zusammen.
Plötzlich sieht er zu seinem Erstaunen, dass sich im Rahmen der Tür (die Tür war geschlossen und verschlossen) ein schwacher Lichtschein zeigt. Während er seine Augen auf die befremdliche Erscheinung richtet, sucht er vergeblich nach einer Erklärung. Dass es nicht der Schein der Lampe ist, ist ihm ohne weiteres klar. Die Helle ist eine viel schwächere und eine völlig andere: ein phosphoreszierender, grünlicher Schimmer.
Während er sich den Kopf zerbricht, tritt durch die geschlossene Tür eine Gestalt.
Man wird hier den Einwand erheben können, dass dies alles ein Traum gewesen sei. Obwohl mein Gewährsmann diese Version als ausgeschlossen bezeichnet, will ich mit der Möglichkeit rechnen, dass er in der Tat geträumt hat. Bloss, leider, wird dadurch das Rätsel nicht kleiner. Warum, das wird man ohne weiteres erkennen, wenn man diesen kleinen Artikel bis zu Ende verfolgt hat.
Die Erscheinung — mein Gewährsmann nennt sie das Phantom — tritt auf das Bett zu. Er streckt den rechten Arm aus, eine dem Soldaten geläufige Abwehrgeste — und ruft:
„Halt!“
Zu seiner eigenen Überraschung bleibt die Erscheinung stehen und blickt ihm unverwandt ins Gesicht. Er hat Musse, sie eingehend zu betrachten. Es ist ein älterer Mann von mittelgrosser Figur, ein wenig korpulent. Das Gesicht ist rund und ziemlich gross, die Stirn gewölbt. Plötzlich zieht sie sich kraus; es entstehen unregelmässige Falten. Die Nase ist mittelgross, das Kinn länglich abgerundet. Der Mund ist eher klein als gross, die Wangen sind rund, die Lippen voll. Spärliches blondes Haar hängt ihm um die Stirn; der Schnurrbart ist klein und gestutzt. Auffällig sind die spärlichen, wenig ausdrucksvollen Augenbrauen. Die hellen Augen sind nicht sehr tiefliegend. Er trägt einen Klemmer, der lose zu sitzen scheint. Seine Schritte sind kurz und schnell. Die Hände sind mittelgross und fleischig, der Daumen klein. Die Erscheinung trägt einen Jackettanzug, in der Hand einen weichen Filzhut. Der Mann mag 48 bis 51 Jahre alt sein.
Der im Bett Liegende hatte sich, fast ohne es zu wollen, jede dieser Einzelheiten eingeprägt. Denn er fühlte, wie ihm das Blut durch den Körper zu jagen begann, und in der gesteigerten Intensität seiner Gehirnfunktionen mochte er mehr ahnen als begreifen, dass jede Einzelheit von Wichtigkeit sein konnte.
Der Blick, mit dem ihn die Erscheinung unverwandt anstarrte, wurde ihm schliesslich unerträglich, und er entschloss sich, den fremden Mann, der durch die verschlossene Tür hindurch eingetreten war, anzureden:
„Wer sind Sie?“
Der andere schweigt.
„Wo kommen Sie her?“
Die Erscheinung schüttelt den Kopf.
„Kann ich Ihnen helfen?“
Die Erscheinung öffnet den Mund. Die Stimme klingt hohl, so als ob sie aus weiter Ferne käme: „Wo kommen Sie her?“
„Ich soll hier gesund werden“, antwortet der Soldat. „Deshalb liege ich im Bett und versuche zu schlafen.“
Die Erscheinung schüttelt den Kopf. „Sie haben hier nichts zu suchen. Sie sind nicht mein Sohn.“
„Das ist schon richtig. Aber man hat mich hier placiert, und Sie haben kein Recht, mich hinauszuweisen.“
Das Phantom sieht ihn an und versucht, sich dem Bett zu nähern; wie der Patient zu seinem Erstaunen bemerkt, gelingt es ihm nicht. Dadurch ermutigt, sagt er:
„Sehen Sie wohl: Sie können es nicht.“
Während der Patient die Erscheinung wieder, mehr neugierig als furchtsam, mustert, erinnert er sich, ihr bereits einmal begegnet zu sein. Am Tage seiner Einlieferung am Freitag, dem 19. November, mittags um 12 Uhr, hat er diesen Mann durchs Zimmer gehen sehen.
Ein Gedanke kommt ihm. „Ist dies Ihr Haus? fragt er.
„Ja“, antwortet jener. „Aber alles ist anders. Ich finde mich nicht mehr zurecht.“
Der Patient hat ein würgendes Gefühl im Hals, während sich ihm die folgende Frage auf die Lippen drängt. Aber er vermag nicht sie zu unterdrücken. So nimmt er allen Mut zusammen und fragt:
„Wissen Sie, dass Sie tot sind?“
Die Erscheinung antwortet:
„Nein.“
Eine Pause entsteht, während sich in ihm das Gefühl der Furcht verstärkt. Endlich fragt der Soldat:
„Was kann ich für Sie tun? Wollen Sie wiederkommen und mehr von mir hören?“
Der andere blickt ihn an und nickt leise und traurig:
„Es hat keinen Zweck. Mir kann niemand helfen.“
„Warum“, fragt der Patient, „sind Sie denn heute gekommen? Wollten Sie nur das Haus besuchen, oder haben Sie mich persönlich aufgesucht?“
Zu seiner Überraschung antwortet der andere:
„Ich suche Sie.“
„Und warum?“ fragt der Soldat atemlos.
„Ich finde keinen Menschen ausser Ihnen hier im Hause, der mich versteht.“
„Wie haben Sie mich denn gefunden? Das Zimmer ist doch dunkel.“
Der andere schüttelt den Kopf. „Hier ist Licht.“
(Hierzu muss bemerkt werden, dass von Spiritisten behauptet wird, Medien strahlten ein Licht aus, das „Phantome“ anziehe.)
„Nein“, sagte der Soldat abermals. „Hier ist es dunkel.“
„Dann weiss ich es nicht“, sagte der andere. Darauf wendet sich die Erscheinung ohne Gruss um. Sie legt die Hand auf den Türdrücker, lässt darauf den Arm sinken und geht durch das Holz der Tür hindurch aus dem Zimmer.
Jetzt macht der Soldat eine neue Entdeckung: um den Kopf und die Schultern des Verschwindenden hängen Seetang und Meeresalgen; Wasser scheint von ihm niederzutriefen.
Der Soldat springt aus dem Bett, reisst die Tür auf und blickt dem Dahinschreitenden nach. Er kann eben sehen, dass das Phantom in derselben Weise — durch die geschlossene Tür hindurch — ein zweites Zimmer durchschreitet.
Am andern Morgen fragt der revidierende Arzt nach dem Befinden des Patienten; er scheint ihm unausgeschlafen. Der Soldat, der sich jetzt, im nüchternen Licht des Tages ein wenig geniert, kann sich dennoch nicht enthalten, das Erlebnis zu berichten. Der Arzt lächelt zunächst; dann, als er zur Beschreibung der Erscheinung kommt, wird er stutzig. Schwestern erscheinen; sie lassen sich, sichtlich nachdenklich und verwirrt, das Erlebnis ebenfalls berichten. Darauf kündigt man ihm den Besuch des Chefarztes an. Der Patient wird unruhig; er fürchtet eine Art von psychiatrischer Prüfung, denn er selbst muss sich jetzt bei nüchterner Überlegung sagen, dass diese ganze Geschichte sehr stark nach den Phantastereien eines Irrsinnigen aussieht.
Der Chefarzt erscheint. Aber er ist die Aufmerksamkeit in Person, und zum Schluss bittet er den Patienten, ihm die genaue Beschreibung des Mannes, der ihm in dieser Nacht erschienen ist, schriftlich zu geben.
Und nun ergibt sich folgendes: ein paar Tage später kommt der Antwortbrief der Besitzerin dieses Hauses. Sie erklärt, dass sie aus der Beschreibung des Erschienenen unzweideutig und ohne jede Irrtumsmöglichkeit ihren verstorbenen Mann erkenne, den Besitzer dieses Hauses ...