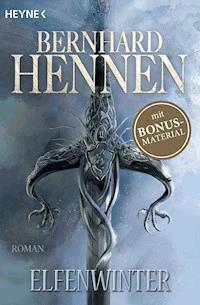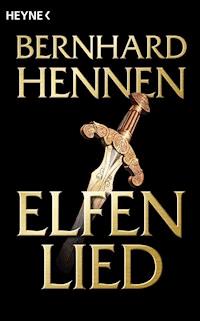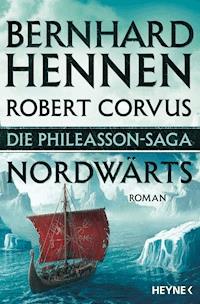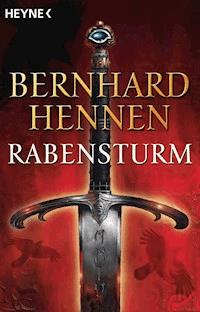11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Elfen-Saga
- Sprache: Deutsch
Das Schicksal der Elfen erfüllt sich
Nach Jahrhunderten hat Elfenkönigin Emerelle ihren Thron verloren. Unerkannt reist sie durch das Land, an ihrer Seite Ollowain, der wiedergeborene Held, der ihr in den Drachenkriegen das Leben rettete. Da erreicht sie eine erschütternde Nachricht: Albenmark droht unter der Herrschaft der Trolle unterzugehen. Emerelle muss sich entscheiden: Kämpft sie für ihre Liebe oder für ihren Thron …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1368
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
BERNHARD HENNENS GROSSE ELFEN-SAGA:
Die Elfen Elfenwinter Elfenlicht Elfenkönigin Elfenlied Elfenritter – Die Ordensburg Elfenritter – Die Albenmark Elfenritter – Das Fjordland
Inhaltsverzeichnis
Für die Rose im Winter
Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derjenigen, die die Welt nicht angeschaut haben.
ALEXANDER VON HUMBOLDT
PROLOG
ELFENKÖNIGIN
Wahrscheinlich bin ich der einzige Elf, der beinahe von einem Schneehasen getötet worden wäre. Und die einzige Entschuldigung, die ich vorbringen kann, ist, dass ich dreizehn war und auf meinen ersten Kuss hoffte … ich, Alvias, einst Hofmeister der Königin Emerelle.
Ich sitze hoch über den Dächern von Vahan Calyd und schärfe meinen Dolch. In zwei Stunden wird das Fest der Lichter beginnen. Das Fest, auf dem Albenmark seinen Herrscher wählt. Ich werde dort sein. Und ich werde dem Herrscher den Dolch in die Brust stoßen. Dies ist mein letzter Dienst für die Königin.
Doch kommen wir auf den Schneehasen zurück … Ich hatte immer das Gefühl, dass er wusste, was er tat. Er wollte mich in den Tod treiben! Es war eine jener Winternächte, in denen geisterhaftes, grünes Licht in wogenden Bahnen über den Sternenhimmel zieht. Eine Nacht voller Verheißung und Magie. Ich war allein mit Nailyn. Sie war siebzehn und damit eine Welt von mir entfernt. Ich wusste, dass etliche junge Jäger ihr schöne Augen machten. Aber sie hatte mich erwählt in dieser Nacht, und ich war unendlich glücklich. Wir ritten über ein weites Schneefeld in den Bergen Carandamons. Die Jagdgesellschaft hatten wir weit hinter uns gelassen. Nailyn machte mir Mut. Auf jeden meiner Vorschläge war sie eingegangen. Sie wollte mit mir allein sein. Ihr langes, blondes Haar floss wie ein goldener Umhang über ihre bestickte Jagdweste. Sie trug ein Seidenhemd, so dünn, dass ihre Arme durchschimmerten. Wie alle Normirga vermochte sie sich durch ein einziges Wort der Macht vor dem eisigen Biss des Winters zu schützen. Sie hätte nackt durch den Schnee gehen können, ohne zu frieren.
Ihre Hose und Stiefel waren so eng wie eine zweite Haut. Sie wusste, wie man Blicke fing! Ich hingegen war in allem unerfahren. Ich wusste mich nicht einmal richtig vor der Kälte zu schützen. Irgendetwas machte ich falsch, wenn ich das Wort der Macht flüsterte. Entweder war mir zu heiß, oder die Kälte fraß sich unvermindert in meine Glieder. Nur bei Nailyn schien ich alles richtig gemacht zu haben. Sie übersah mein Ungeschick. Und ich, ich starrte sie immerzu nur an.
So wäre ich fast aus dem Sattel gestürzt, als mein Hengst Sternenauge einen Schneehasen aufscheuchte. Der Hase hatte sich flach in eine Mulde geduckt und bis zum letzten Augenblick gewartet, bis er das Weite suchte. Meinen Hengst erschreckte er so sehr, dass er stieg und mich fast abgeworfen hätte. Nailyn lachte. Dann sagte sie jene verhängnisvollen Worte, die mein ganzes Leben verändern sollten. »Fang mir den Hasen. Ich will ihn auf dem Arm halten. Dein Lohn soll ein Kuss sein!«
Mein Hengst war schneller als der Hase, und ohne aufschneiden zu wollen, ich war viel geschickter. Das Einzige, was er besser konnte als wir beide, war Haken zu schlagen. Und er kannte die verschneite Ebene besser. Er wusste, was sich unter dem Schnee verbarg. Ich jagte tief aus dem Sattel gebeugt dahin. Nie hatte ich mich so großartig gefühlt. Zweimal bekam ich ihn fast zu packen. Meine Fingerspitzen berührten ihn schon, da öffnete sich der Abgrund. Eine Felsspalte, unter dem Schnee verborgen. Es ging alles so schnell. Gerade jauchzte ich noch vor übermütiger Freude und dann … Dann kam der Schmerz. Durchdringend. Sternenauge lag neben mir. Der Glanz seiner Augen, der ihm den Namen gegeben hatte, verblasste. Sein Körper erbebte. Ein letztes Aufbäumen des geschundenen Fleischs. Seiner Kehle entrang sich ein Laut, den Worte nicht beschreiben können. Vielleicht weil ich mich nicht durch Worte von meiner Schuld befreien darf. Auch jetzt, nach all den Jahrhunderten, klingt er mir immer noch im Ohr, wenn ich an diese Nacht zurückdenke. So voller Qual war er.
Überall um mich herum waren scharfkantige Felsen. Und der Schnee, der mit uns hinabgestürzt war. Ich konnte mich nicht bewegen; all meine Glieder schmerzten. Mein linkes Bein war verdreht. Ich wagte nur einen Blick. Dann schaufelte ich Schnee auf das Bein, um es nicht mehr zu sehen … den Knochen, der durch die zerrissene Hose ragte, und all das Blut.
Hoch über mir, umwoben vom grünen Licht der Winternacht, erschien das Antlitz, das ich so sehr verehrte. Nailyn wirkte blass. Sie zu sehen, gab mir die Kraft, meine Tränen zurückzuhalten. Sie würde mich retten.
»Alvias?«
»Ich lebe«, stieß ich hervor.
»Ich hole Hilfe!« Mit diesen Worten war sie verschwunden. Keine Frage, ob ich verletzt war. Kein Versuch, zu mir hinabzusteigen, um mir zu helfen. Ich hörte ihre Schritte im Schnee und konnte meine Tränen nicht länger beherrschen. Natürlich war der Schmerz in meinem Bein unvergleichlich schlimmer, aber die Wunde, die sie meinem Herzen zufügte, habe ich bis heute nicht vergessen.
Ich weiß nicht, wie lange ich in der Spalte lag. Ich sah zu, wie mein Blut den Schnee rot färbte. Dann und wann warf ich neuen Schnee darauf, doch das Weiß blieb nicht lange unbefleckt. Keinen vernünftigen Gedanken konnte ich fassen. Ich hatte einen Gürtel. Ich hätte mein Bein abbinden sollen. Stattdessen sah ich zu, wie meine Tränen, wenn sie auf den Fels fielen, langsam zu Eisperlen erstarrten.
Melodramatisch, wie nur Dreizehnjährige es können, malte ich mir meinen Tod aus. Wer alles um mich weinen würde. Wer mich vermissen würde … Und dann kam sie. Die andere. Ihr Gesicht erschien über der Spalte, als sei es aus dem Himmel gewachsen. Ich hatte keinen Laut gehört. Sie war plötzlich da. Einen Herzschlag blickte sie mich an. Dann sprang sie zu mir herab, ohne sich von den scharfkantigen Felsen schrecken zu lassen.
»Ich bringe dich hier heraus.« Sie sagte das so selbstbewusst, wie nur Fürsten und Könige sprechen. Damals wusste ich nicht, wer sie war.
Ich staunte sie an, vom Blutverlust benommen. Sie trug ein Jagdkostüm aus grauem Leder mit weißem Pelzbesatz und Silberstickereien. Ihr dunkelblondes Haar fiel in Wellen auf ihre Schultern. Ihre Lippen waren vom dunklen Rot reifer Himbeeren. Die Augen hellbraun und voller Mitgefühl. Sie hatte ein schmales Gesicht und ein Lächeln, das einem das Herz schneller schlagen ließ. Behutsam schob sie den Schnee zur Seite, den ich auf mein Bein gehäuft hatte. Ich sah zu, wie sie das Grauen freilegte. Mein zersplittertes Schienbein, das aus dem Fleisch ragte.
»Es wird jetzt wehtun.«
Sie tat nichts, um mir Mut zu machen oder mich abzulenken. Und »wehtun« drückt nicht annähernd das Gefühl aus, das mich durchfuhr, als sie den gebrochenen Knochen durch das zerfetzte Fleisch drückte. Ich schrie wie nie wieder in meinem Leben. Und versuchte, mich ihrem Griff zu entwinden. Aber sie war unglaublich stark, obwohl sie von zierlicher Gestalt war und kaum größer als ich.
In ihren Augen standen Tränen. Als ich das sah, verstummte ich. Sie teilte meinen Schmerz, so viel wusste ich auch damals schon über die Kunst der Heilzauber. Wärme floss durch mein Bein und all meine Glieder. Mir wurde schwindelig.
Als ich erwachte, hatte sie mich aus der Spalte geholt. Ich habe nie erfahren, wie ihr das gelungen war. Sie setzte mich auf ihre Stute und führte das Pferd am Zügel den Bergen entgegen. Und in mir wuchs die Furcht vor meinen Eltern. Sie blieb bei mir, bis zuletzt. Sie lobte meinen Mut und meine männliche Härte. Ja, das waren ihre Worte! Und so hatte sie mich zum zweiten Mal an einem Tag gerettet.
Erst als sie fort war, erfuhr ich, wer mich aus der Gletscherspalte geholt hatte. Emerelle, die Königin Albenmarks.
Sieben Jahre später sah ich sie das nächste Mal, an einem Ort, der unterschiedlicher nicht hätte sein können. Und ich gestehe, sie war mir in all den Jahren nicht aus dem Sinn gegangen, und ich kam um ihretwillen. Es war zum Fest der Lichter in Vahan Calyd, jenem verwunschenen Ort an der Mangrovenküste des Waldmeers, der nur alle achtundzwanzig Jahre aus seinem ewigen Schlaf erwacht. Vahan Calyd ist eine Stadt, in der alle danach trachten, sich von ihrer prunkvollsten Seite zu zeigen, denn hier entscheiden die Fürsten Albenmarks, wer die Krone für die nächsten achtundzwanzig Jahre tragen wird. Alle großen Elfensippen haben hier Palasttürme erbaut, überladen mit Friesen und Statuenschmuck. Und auch all die anderen Völker Albenmarks wollen dahinter nicht zurückstehen, so unterschiedlich ihre Auffassungen von Pracht auch sind. So findet man an manchen Fassaden Seidenkokons, groß wie Äpfel, in denen sich Blütenfeennester verbergen. Die Lamassu behaupten jedes Jahr aufs Neue, einen Palast aus Wind erschaffen zu haben, doch außer ihnen vermag ihn niemand zu sehen. Von außen eher bescheiden und doch von Geheimnissen umrankt, ist der Turm der Mondbleichen Blüten, den die Apsaras über einer Meeresgrotte errichtet haben. Der Palast der tausend Banner hingegen entsteht zu jedem Fest neu. Minotauren errichten ihn aus bunten Stoffbahnen und rammen Hunderte, mit vergoldeten Schnitzereien geschmückte Zeltpfosten in die Erde, von denen ihre Banner wehen.
Alles hier war fremd für mich, der ich aus einem Land kam, das vom Weiß des Schnees beherrscht wird. Hier wurde mein Auge bei jedem Herzschlag von neuen, nie gesehenen Farben bestürmt. Alle Sinne wurden belagert! Die Völkerscharen Albenmarks versammeln sich zum Feste, und sie brachten ihre Düfte mit, von Fladenbroten, über einer Glut aus Pferdeäpfeln gebacken, bis hin zu frisch gekochten Krabben, Reisbrei, Thymian, Safran und roten Pfeffer. Dazu der Duft verfaulender Mangos aus den Gärten und der Odem des Dschungels, der die Stadt einschloss. Und inmitten von all dem: Emerelle. Stets ist sie es, die zur Königin gewählt wird. Und nie verläuft die Wahl ohne verborgene Kämpfe. So oft habe ich dem Fest der Lichter inzwischen beigewohnt. Und nicht einmal verging der Tag danach ohne Leichenfunde. Stumme Zeugen der Intrigen um den Thron. Zu meinen Pflichten gehörte es später, sie beerdigen zu lassen und alle Fragen zu ersticken.
Doch davon, was kommen sollte, ahnte ich nichts auf meinem ersten Fest der Lichter. Ich gehörte zu den Gästen in Emerelles Palast. Und ich sah zu, als sie in einem Pavillon, hoch im Geäst des alten Lotosblütenbaums, ihr Schmetterlingsgewand anlegte. Ein Kleid der schillernden Farben aus unzähligen lebenden Schmetterlingen, die sich auf der Herrscherin niederließen. Dann ließ sich Emerelle auf einer Sänfte, die von fünfzig Kentauren getragen wurde, zum Hafen bringen, wo inmitten eines Meeres aus Schiffsmasten jene Prunkbarkasse lag, auf der die Königswahl stattfand. Majestätisch und von Jubel bestürmt, stand sie über den Massen auf ihrer Sänfte. Sie wurde mit Blumen beworfen und kostbarem Geschmeide. Und man hob Kinder zu ihr empor, damit sie ihnen über die Köpfe streichen konnte, denn es bringt Glück, von Emerelle berührt zu werden.
An jenem Tag entschied ich, künftig meiner Retterin zu dienen. Und über die Jahre stieg ich auf zu ihrem Hofmeister. Ich war bei ihr in Tagen von Ruhm und Leid. War an ihrer Seite, als sie an der Spitze ihrer Ritter die Höhlenfestung Mordstein erstürmte, reiste in ferne Städte als ihr Gesandter und wurde tief in die Intrigen der Krönungsfeste verstrickt.
Manche nennen sie die Königin der tausend Gesichter. Sie konnte die strahlende, gütige Herrscherin sein. Sie war Kriegerin und Zauberin. Sie war die höchste Richterin. Und sie war einsam. Seit sie die Krone nahm, hatte sie sich keinen Gefährten mehr erwählt. Die Sorge um Albenmark bestimmte ihr Leben. Sie opferte sich im Kampf um unser aller Zukunft. Wenn sie nachts allein im Thronsaal über die Silberschale gebeugt stand, die ihr die Zukunft zu zeigen vermochte, dann zeichnete Schrecken ihr Gesicht. Ich weiß nicht, was sie dort sah. Aber sie kämpfte dagegen an, an jedem Tag ihrer Herrschaft.
Sie haben ihr Werk zerstört, die Trolle! Vor siebenundzwanzig Jahren und sechs Monden kehrten sie zurück. Sie waren in die Welt der Menschen verbannt gewesen, doch fanden sie einen Weg zurück. Sie überfielen Vahan Calyd während des Festes der Lichter. Und sie begannen damit, all das Schöne auf der Welt zu zerstören. Emerelle musste flüchten, aber sie stemmte sich gegen die Heerscharen ihrer Feinde. Manchmal nur von Ollowain, ihrem Schwertmeister, beschützt. Als sie auch ihn verlor, begann der Niedergang. Ich weiß nicht, was genau die Trolle ihm angetan haben. Er war bei ihnen an dem Tag, an dem Emerelles Herrschaft endete. Er schien nicht bei Sinnen zu sein! Es heißt, sie hätten Ollowains Verstand getötet, aber seinen Körper erhalten. Sie haben ihn gezwungen, auf der Shalyn Falah, der weißen Brücke, zum Duell gegen Emerelle anzutreten. Das war der Tag, an dem ihr das Herz brach. Sie legte Schwert und Krone nieder, statt gegen den Mann zu kämpfen, dem schon lange heimlich ihr Herz gehört hatte. So wurde der Troll Gilmarak zum Herrscher über Albenmark.
Die Seele eines Elfen ist unsterblich, bis sie letztlich ins Mondlicht geht. Wenn wir wiedergeboren werden, dann ist unsere Seele alt, aber die Erinnerung an unsere früheren Leben ist verloren. So sind wir frei.
Emerelle hat Ollowain mit sich genommen, als sie verschwand. Ich habe sie gesucht. Und ich weiß, dass auch Meuchler sie gesucht haben, denn die Trolle fürchten sie noch immer. Sie ist verloren. Ich ahne, ihre Feinde haben sie vor mir gefunden. Heute feiert Vahan Calyd das Fest der Lichter. Ihr Fest!
Mein Dolch ist geschärft. Ich bin ein Fürst. Sie haben mich ausgewählt, an der Königswahl teilzunehmen. Mich! Welch ein Hohn. Aber ich werde dort sein. Nur so kann ich Gilmarak nahe genug kommen, um Emerelle zu rächen.
FAST ZWÖLF JAHRE ZUVOR
AM HORIZONT
»Was siehst du am Horizont?«
Die Königin hatte wieder diesen entrückten Blick. Eine Ewigkeit war vergangen, seit er für sie gestorben war, auch wenn für ihn erst wenige Wochen verstrichen zu sein schienen. Falrach hatte eine ganz andere Emerelle gekannt. Neben ihm stand eine Fremde. Er durfte sie nicht einmal bei ihrem Namen nennen, dem letzten Wort, das in seinem vergangenen Leben über seine Lippen gekommen war. Sie gab sich als Nandalee aus. Dies war der Name ihrer Mutter gewesen.
»Die Zukunft.« Emerelles Antwort kam spät. Falrach hatte nicht mehr damit gerechnet, dass sie noch etwas sagen würde.
Er blickte über die verschneiten Hügel. Es war windstill und so kalt, dass seine Haut an dem silbernen Knauf seines Schwertes festkleben würde, sollte er es unvorsichtigerweise mit bloßer Hand berühren.
Hinter den Hügeln am Horizont stand Rauch wie die Wolken eines heraufziehenden Unwetters am Nachthimmel. Der Glanz der Sterne, der vom frisch gefallenen Schnee in den Nachthimmel zurückgeworfen wurde, wob ein magisches Licht. Die Rauchwolke störte die Harmonie dieses Zaubers. Dicht und bedrückend hing sie tief am Himmel und schimmerte rotorange, in der Farbe frisch vergossenen Drachenblutes. Es war der Widerschein der Essen von Feylanviek.
Makarios stapfte unruhig mit den Hufen. Sie hatten den Viehtrieb des Kentaurenfürsten begleitet. Ihr Lohn waren zwei alte Pferde gewesen. Falrach mochte sie nicht, aber Emerelle hatte es geschätzt, nicht länger zu Fuß gehen zu müssen.
»Ihr solltet der Stadt nicht näher kommen«, warnte der Kentaur. »Das Leben eines Elfen ist dort keinen Büffelfurz wert.«
»Warum?« Sie kannte die Geschichten über Feylanviek. Und Makarios wusste das.
Kentauren waren nicht dafür berühmt, ihre Gefühle zu beherrschen. Allerdings hatten die meisten von ihnen großen Respekt vor Elfen. An Makarios Schläfe schwoll eine Ader so sehr an, dass man das Blut darin pochen sehen konnte. »Du weißt um den Fürsten Shandral, edle Dame. Und du weißt, wie sehr die Kobolde in der Stadt unter seinen Grausamkeiten gelitten haben. Ein Elf sollte dort nicht hingehen.«
»Eben weil sie so sehr gelitten haben, muss ich gehen.«
Der Kentaur schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn. »Ich glaub es nicht! Wie deutlich muss ich es noch sagen, Nandalee. Die werden mit deinem kleinen Elfenarsch Dinge anstellen, die du dir nicht einmal im Entferntesten …«
Falrach trat vor den Kentauren. Er konnte nicht zulassen, dass dieser so mit der Königin sprach. Auch wenn der Kentaur keine Ahnung hatte, wer wirklich vor ihm stand. »Das genügt.« Er sagte das leise, und seine Augen fingen den Blick des Kentauren.
Makarios’ Unterlippe zitterte vor Wut. Eiskristalle funkelten in seinem struppigen blonden Bart. Lange maßen sie einander mit Blicken. Endlich seufzte der Steppenfürst. »Elfen tun immer, was sie für richtig halten, nicht wahr? Selbst jetzt noch, nach all dem, was geschehen ist.« Seine Wut war verraucht. Er klang enttäuscht. Sie würden ihn nach dieser Nacht wahrscheinlich nie mehr wiedersehen, dachte Falrach.
»Du irrst dich, Makarios. Elfen wissen, was richtig ist.«
Falrach zuckte innerlich zusammen, als die Königin sprach. Früher war sie taktvoller gewesen.
Der Kentaur schnaubte wie ein zorniger Bulle. »Das habe ich gesehen. Ich war am Mordstein, als deinesgleichen Feuer vom Himmel regnen ließen. Ihr habt die Schlacht gewonnen, aber ihr habt die Trolle nicht besiegt. Wie konnte das geschehen? War das der Plan? Mein Bruder ist damals gestorben. War das der Plan?« Die letzten Worte hatte er förmlich hinausgeschrien.
»Frag Ollowain. Er war der Heerführer an jenem Tag.«
Der Kentaur ballte die Fäuste. »Der Schwertmeister war der anständigste Elf, der jemals gelebt hat. Du wirst seinen Namen nicht in den Schmutz ziehen, du …«
»Du hast Ollowain gekannt?« Der Tonfall, in dem Emerelle fragte, versetzte Falrach einen Stich. In ihrer Stimme schwang mehr mit als nur allgemeines Interesse an einem geschätzten Freund.
»Nicht gekannt …« Die Frage brachte Makarios offensichtlich durcheinander. »Aber ich habe ihn gesehen, von Ferne. Als er das Heer vor Feylanviek gesammelt hat. In meinem Volk gibt es viele Lieder über ihn.« Er bedachte sie beide mit einem vernichtenden Blick. »Und Kentauren singen nicht oft über Elfen.«
»Und doch kamt ihr, als die Königin Emerelle euch zu den Waffen gerufen hat.«
Er lachte bitter auf. »Natürlich! Schließlich mussten die Trolle auf ihrem Weg zur Elfenkönigin zuerst durch unser Land.« Seine Schultern sanken herab. Plötzlich sah er um Jahre gealtert aus. »Wir hätten davonlaufen sollen. Meine Brüder und Freunde sind auf den Schlachtfeldern des Grasmeers zum Rabenfraß geworden. Der Grabhügel meiner Ahnen ist geschändet. Man hat ihn zum Schlachthaus gemacht. Die über Jahrhunderte wohl verwahrten Leichname der Fürsten meines Volkes füllten Trollmägen. Die Lutin, mit denen uns Kentauren ein Pakt verband, so alt wie die Steppe … diese Lutin haben uns verkauft. Haben den Zauber, der meine Ahnen vor dem fauligen Atem der Zeit bewahrte, missbraucht, um die Grabhügel mit Büffelfleisch zu füllen. Sie haben unsere heiligsten Stätten heimlich zu den Vorratslagern des Trollfeldzugs gemacht. Sie …« Er ballte in hilfloser Wut die Fäuste.
»Und doch treibst du Handel mit den Trollen«, stellte Emerelle unerbittlich fest.
»Was soll ich tun?«, fauchte der Kentaur. »Die Meinen brauchen Salz. Und Eisen für Waffen, mit denen wir die Trolle eines Tages vertreiben werden.«
»Wirst du, nach all dem, was du verloren hast, kommen, wenn die Elfen noch einmal zum Kampf rufen?«
»Um die Trolle zu vertreiben? Lieber heute als morgen. Aber die Elfen sind besiegt. Eure Königin hat einfach aufgegeben. Alle im Stich gelassen, die an sie geglaubt haben. Ohne sie sind die Elfen zu uneins. Sie sind verrückt. So wie du. Du solltest nicht nach Feylanviek gehen. Dort spielt man deinesgleichen übel mit. Du solltest dein Schicksal nicht unnötig herausfordern, Nandalee.«
Die Worte waren Falrach aus dem Herzen gesprochen, aber er wusste, dass Emerelle sie einfach abtun würde. Sie wollte sich der Gefahr ausliefern, warum auch immer. Für den Kampf, in dem er einst gestorben war, hatte es einen guten Grund gegeben. Aber das hier … Wem wollte sie etwas beweisen? Sie blickte wieder zum Horizont. Dorthin, wo die Feuer Feylanvieks die Wolkenränder in die Farbe von Drachenblut tauchten.
»Unsere Wege trennen sich hier«, sagte Makarios, der es augenscheinlich müde geworden war, Emerelle von ihrer Entscheidung abbringen zu wollen. »Ich wünsche euch beiden Glück. Ihr werdet es gewiss brauchen. Wenn ihr Ärger bekommt, erwartet nichts von mir. Ich werde sagen, dass ich euch nicht kenne.«
»Ich weiß, du brauchst Salz.«
Der Kentaur schnitt eine Grimasse, als habe man ihm einen Dolch zwischen die Rippen gestoßen. Er sah zu Emerelle zurück, doch diese würdigte ihn keines Blickes. »Du solltest nicht mit ihr gehen«, flüsterte er Falrach zu. »Sie ist unerbittlich. Solche Frauen ziehen Unheil an.«
»Ich kann nicht anders«, entgegnete er dem Kentauren. »Ich …«
»Ja, ich sehe schon, dass es kein Eid ist, der dich an sie bindet. Es ist schlimmer. Gib acht auf dich. Die dümmsten Dinge, die wir Männer tun, sind jene Dinge, die wir aus Liebe zu einer Frau tun. Wenn du alt wirst …« Er runzelte die Stirn. »Nein, du wirst es nie verstehen. Denn du wirst nicht alt werden, wenn du ihr folgst. Diese Elfe ist dein Tod. Komm mit mir!«
EIN PFERDETRITT
Obwohl die Straßen Feylanvieks so belebt waren, dass man nur langsam vorankam, war kein einziger Elf zu sehen. Emerelle drehte sich im Sattel und blickte zu der Schmiede, die auf einer steinernen Brücke mitten im Fluss lag. Sie hatte von diesem Ort gehört. Hier hatte Shandral seine grausamen Exzesse an den Kindern Albenmarks betrieben. Sie hätte ihm Einhalt gebieten müssen. Vielleicht wäre dann alles ganz anders gekommen.
Die große Schmiede war niedergebrannt, das Dach eingestürzt. Ein paar rußgeschwärzte Steine waren alles, was von den Wänden übrig geblieben war. Ein Großteil des hölzernen Räderwerks, das die pferdekopfgroßen Schmiedehämmer betrieben hatte, schien auf wundersame Weise die Feuersbrunst überstanden zu haben. Auch eines der drei großen Wasserräder, die unter den Brückenbögen in die Fluten eines Seitenarms des Mika eintauchten, war augenscheinlich noch intakt.
Neben einem der mächtigen Ambosse stand ein Troll und beobachtete sie misstrauisch. Trotz der großen Kälte trug er nur einen Lendenschurz. Er stützte sich auf einen mannshohen Streitkolben, der mit schwarz glänzenden Obsidiansplittern besetzt war. Vulkanglas aus der Snaiwamark. Obwohl sie mächtige Krieger waren, mieden die Trolle jegliches Metall. All ihre Rüstungen und Waffen waren allein aus Holz, Stein und Leder gefertigt. Wulstige Narben zogen sich von der Stirn bis zu den Wangen hinab. Einen merkwürdigen Geschmack für Ästhetik hatten die Trolle. Das waren keine Kampfverletzungen, sondern Schmuck. So auszusehen, ehrte einen Kämpfer.
Die Königin ließ den Blick über die Häuser am Ufer schweifen. Dort standen Fachwerkbauten aus Lehm, Weidengeflecht und mit üppigen Schnitzereien verzierte Balken. Grellbunte hölzerne Schilder hingen an rostigen Eisenarmen und priesen die Güter der Handwerkssippen, die sich entlang des Flussarms niedergelassen hatten. Robbenfellmäntel, Bernsteinschnitzereien, Silberschmuck und dickwandige Tontöpfe in jeder Größe, die vollmundig als härter denn ein Trollschädel gepriesen wurden. Dabei war jedes der Häuser in einer anderen Farbe gehalten. Gelb-, Rot- und Türkistöne waren vorherrschend. Aber man sah auch Lindgrün und vereinzelt ein Knochenweiß. Sie alle hatten gemein, dass Schmutzschlieren über die Wände liefen und den üppigen Farben den Glanz nahmen. Erker wucherten wie geometrische Geschwüre aus den windschiefen Wänden.
Keines der Häuser war in einem einheitlichen Baustil gehalten. Selten sah man zwei gleich große Fenster, und auch die Etagen hatten sehr unterschiedliche Höhen. Scheunengroße Eingangstüren lagen unter winzigen Balkonen mit Geländern aus vergoldetem Schmiedewerk. Alle Giebel schnitten in spitzen Winkeln in den rauchverhangenen Himmel. So boten sie dem Schnee nur wenig Halt, der in den langen Wintermonden so reichlich fiel, dass viele der kleineren Häuser eine zweite Haustür im Dachgiebel besaßen.
Falrach ritt mit ausdrucksloser Miene an ihrer Seite. Seit gestern Abend hatte er keine Fragen mehr über den Sinn dieses Ausflugs gestellt. Er hielt ihn für eine Laune und für äußerst gefährlich. Sie wusste, dass er so dachte, obwohl er für sie Partei ergriffen hatte. Seine Liebe machte ihn bedingungslos loyal. Es war seltsam, Ollowain vor Augen zu haben und mit Falrach zu sprechen. Der Schwertmeister hätte ihr sehr deutlich gesagt, was er davon hielt, zu zweit in eine mutmaßlich feindlich gesonnene Stadt zu reiten. Aber auch er wäre bei jeder Torheit an ihrer Seite geblieben. In manchen Dingen waren sich die beiden sehr ähnlich, auch wenn sie grundverschiedene Beweggründe für ihr Handeln hatten. Ollowain hatte sie nicht geliebt. Er vermochte den Verlust Lyndwyns nicht zu verwinden. Sie war eine begabte Magierin gewesen, doch von zweifelhafter Vertrauenswürdigkeit wie alle Elfenadligen aus dem Fürstenhaus von Arkadien. Lyndwyn war bei den Kämpfen um die Felsenburg Phylangan gefallen.
Emerelle zog an den Zügeln. Ihr Grauer verharrte. So viele Tote hatte es gegeben! Und doch hatten die Trolle zuletzt den Thron Albenmarks gewonnen. Alle Kämpfe waren vergebens gewesen. So schien es zumindest …
Sie blickte hinab auf den zugefrorenen Kanal. Das Eis hielt die Frachtkähne gefangen. Bunt bemalte Boote mit Augen, die hoch im Rumpf über das Wasser wachten. Farbe blätterte an manchen Stellen ab und legte tiefere Schichten frei. Blau, das auf Rot gemalt war. Schmutziges Weiß über Flaschengrün.
Alles, was einmal Ollowain gewesen war, war abgeblättert. Die Seele Falrachs, jenes Mannes, den sie einst geliebt hatte, war wieder freigelegt. Wie war es für ihn zurückzukehren? In seinem Empfinden war wohl nur ein Augenblick vergangen, seit der sengende Drachenatem sein Leben ausgelöscht hatte. Für sie hingegen unzählige Jahrhunderte. Wie viele Schichten neuer Farbe lagen über der Emerelle, die er einmal gekannt hatte? Gab es einen Weg zurück zu ihr? Schimmerte noch etwas hindurch, so wie bei den alten Booten, die der Fluss in eisigem Griff gefangen hielt?
Sie hatte ihren Thron verloren. Sie war heimatlos. Eine fahrende Ritterin, so wie damals, als sie Falrach zum ersten Mal begegnet war. Doch damals hatte sie eine Aufgabe gehabt. Ein Ziel, für das sie alles geopfert hätte. In den Wochen, die verstrichen waren, seit ihr Thron verloren war, hatte sie sich einfach treiben lassen. Emerelle wusste nicht, welches neue Ziel sie ihrem Leben geben sollte. Sie lächelte melancholisch. Immerhin wusste sie, was sie nicht wollte. Nie wieder würde sie in den Thronsaal Burg Elfenlichts zurückkehren. Nie wieder die Last der Krone tragen!
Sie sah hinab auf das Eis. An manchen Stellen hatten sich scharf gezackte Schollen übereinandergeschoben und türmten sich zu flachen Tafelbergen. Ruß und allerlei Unrat sprenkelte das Weiß. In der Mitte, wo die Strömung des Kanals am stärksten war, schien das Eis nur dünn zu sein. Man konnte das dunkle Wasser hindurchschimmern sehen.
Verstohlen blickte die Königin zu ihrem Begleiter. Ollowain hatte sich Lyndwyn gegenüber nach ihrem Tod wohl bis ans Ende aller Zeiten schuldig gefühlt. Hatte er sie wirklich geliebt? Oder war es allein diese Schuld, die ihn an Lyndwyn gebunden hatte? Sie würde es nie mehr erfahren.
Emerelle wusste nicht, was genau mit ihrem Schwertmeister nach der Schlacht am Mordstein geschehen war, aber die Persönlichkeit Ollowains hatte sich vollständig aufgelöst. Wahrscheinlich war er das Opfer eines heimtückischen Zaubers geworden, während er der Sklave der Lutin gewesen war. Er war wie ein Stück Pergament, das gründlich mit einer feinen Klinge abgeschabt worden war. Die Geschichte seines jahrhundertelangen Lebens war vollständig ausgelöscht. Zurück blieb allein ein leeres Blatt.
So hatte Falrach von Ollowains Leib Besitz ergreifen können. Er war eine frühere Inkarnation der Seele des Schwertmeisters, der wohl berühmteste Feldherr der Elfen. Ein genialer Taktiker, ein Spieler und Frauenheld, ein wahrer Blender. Ihre erste Liebe.
Falrach hatte im Drachenkrieg sein Leben gegeben, um sie zu retten. Jahrhundertelang hatte sie um ihn geweint. Jede Inkarnation seiner Seele hatte sie aufgespürt. Lange hatte sie geglaubt, ihre Trauer und ihr Schmerz würden niemals enden. Wohl verborgen hinter der Maske der kühlen Herrscherin aber waren sie stets nahe gewesen. Doch mit der Zeit waren diese Gefühle zu eitlem Beharren geworden.
Zeit, die Granitgebirge zu flachen Ebenen schleifte. Zeit war die Herrin von allem. Selbst die Liebe und ihr selbstsüchtiger Schmerz unterwarfen sich ihr. Sie hatte Falrach nicht vergessen, doch ohne es zu wollen, hatte sie sich in Ollowain verliebt. Ihren Schwertmeister, den selbstlosen Ritter, der seine Ideale nie den Kompromissen unterworfen hatte, die die komplexe Dialektik der Herrschaft ihr aufzwang. Als sie einander zum letzten Mal begegnet waren, hatten sie heftig gestritten. Er hatte sie in eine ausweglose Lage gebracht. Sie hatte ihn in die Bibliothek von Iskendria geschickt, um nach verschollenem Wissen zu forschen. Dabei begleitete ihn die Lutin Ganda. Eben diese Lutin war es, die ein Buch stahl, das einst von Meliander verfasst worden war. Der kluge, zärtliche Meliander. Noch ein Opfer der Zeit, dachte Emerelle traurig. Ihr Bruder war um so vieles empfindsamer gewesen als sie. Er hatte sich einst selbst entleibt, um seinen Weltschmerz zu beenden. Melancholie löschte sein Leben, das nach Jahrhunderten zählte.
Wer die Bibliothek von Iskendria betrat, wurde darüber unterrichtet, dass das schwerste aller Verbrechen am dortigen Ort darin bestand, einen Text zu stehlen oder zu vernichten. Ein Verbrechen, das stets mit der Todesstrafe gesühnt wurde. Emerelle war sich ganz sicher, dass Ollowain nicht das Buch Melianders gestohlen hatte. Gewiss war es die Lutin Ganda gewesen. Aber der Schwertmeister hatte alle Schuld auf sich genommen und darauf bestanden, dass Ganda unschuldig sei.
Was zählte eine Königin, die sich über die Gesetze stellte? Was zählten Gesetze, wenn sie nicht für jeden gleich waren?
Sie hatte es nicht fertiggebracht, ein ehrenvolles Leben mit einer Hinrichtung im Hof ihrer Burg zu beenden. Zugleich war sie zornig darüber gewesen, dass Ollowain offensichtlich darauf vertraut hatte, sein Rang und ihre Liebe würden ihn vor der Strafe schützen. Sie hatte ihn in die Schlacht gegen die Trolle geschickt und befohlen, nicht lebend zurückzukehren. Und er hatte gehorcht, wie immer. Sie würde wohl niemals erfahren, was genau danach geschehen war. Ollowain gab es nicht mehr. Der Bote, der ihren Befehl widerrufen sollte, hatte ihn nicht mehr erreicht. Niemand würde je wieder Ollowain erreichen, dachte sie bitter.
»Nandalee.«
Es dauerte zwei Herzschläge, bis Emerelle begriff, dass sie gemeint war.
»Ich denke, die sind unseretwegen hier«, sagte Falrach leise.
Die Königin folgte seinem Blick. Drei Trolle und eine ganze Schar Kobolde mit roten Mützen kam die Straße entlang auf sie zu. Ihr Anführer, ein Kerl in hohen Schaftstiefeln, deutete mit seinem Säbel, der kaum so groß wie ein Brotmesser war, in ihre Richtung. »Nehmt die Feinde des Volkes fest.«
Die Trolle gehorchten dem Befehl, doch die Kobolde, die mit Spießen und Heugabeln mehr schlecht als recht bewaffnet waren, zögerten.
»Jetzt ist der Zeitpunkt, auf Makarios’ Rat zu hören.« Falrach zog sein Pferd um den Zügel.
»Ich bleibe«, sagte Emerelle entschieden. Sie wollte wissen, was geschehen würde. Deshalb war sie hierher gekommen. »Wir haben nichts Unrechtes getan.«
»Manchmal reicht das nicht. Komm!«
Die Königin strich ihrem Grauen über den Hals. Der Hengst stampfte unruhig mit den unbeschlagenen Hufen. Die Trolle machten ihm Angst. Sie waren nur noch wenige Schritt weit entfernt.
Falrach griff nach ihren Zügeln. »Sei nicht so verdammt halsstarrig.«
Ein Stück hinter ihnen wurde ein Heuwagen quer über die Straße geschoben. Jetzt war jeder Fluchtweg versperrt. Falrach hörte das Knirschen der eisenbeschlagenen Karrenräder auf dem Pflaster. Er drehte sich um und fluchte. Mit Elfenpferden hätten sie hinab auf das schmutzige Eis des Kanals springen können. Aber die struppigen, kleinen Steppenpferde der Kentauren würden durch die Eiskruste brechen und elendig im Kanal ersaufen. Es gab keinen Ausweg mehr.
Ein Troll packte in die Mähne ihres Hengstes. Der Graue stieß ein schrilles Wiehern aus. Er versuchte zu steigen, doch gegen den eisernen Griff des Trollkriegers kam er nicht an. Obwohl Emerelle im Sattel saß, überragte sie der Troll um mehr als Haupteslänge. Der Krieger sah sie misstrauisch an. »Leg deine Hand ans Schwert, und ich mach dich tot«, stieß er hervor und schien dabei ganz selbstverständlich davon auszugehen, dass sie ihn verstand.
Der Hengst keilte aus. Ein Huf traf den Troll am Knie. Er grunzte und schlug dem Grauen den Ellenbogen gegen den Kopf. Der plötzliche Schlag riss den Hengst zu Boden. Emerelle war mit einem Satz aus dem Sattel. Sie landete sicher auf den Füßen. Fast hätte sie nach ihrem Schwert gegriffen, einfach aus Gewohnheit. Auch wenn sie seit langem nicht mehr in die Schlacht gezogen war, hatte sie doch regelmäßig ihre Fechtübungen absolviert.
Ihr Hengst schlug schwer auf das Pflaster. Blutiger Schaum troff aus seinem Maul. Emerelle zwang sich, ruhig zu bleiben.
»Ihr beide seid verhaftet!«, rief eine schnarrende Stimme. Hinter dem Troll stand der Kobold in den Stulpenstiefeln. Er deutete mit dem Säbel auf ihre Brust. Jetzt erst bemerkte Emerelle, dass ihm die rechte Hand fehlte.
»Warum willst du uns festnehmen?«, fragte sie, um Gelassenheit bemüht.
»Weil du eine der Trollwachen angegriffen hast.«
»Ich glaube, das war mein Pferd«, sagte sie in der Sprache der Trolle. »Wirst du es in den Kerker werfen?«
Der große Krieger verzog das vernarbte Gesicht zu einem Grinsen.
»Du machst dich lustig über mich? Über Dalmag Paschendrab, den Vogt von Feylanviek und Hüter der Gerechtigkeit? «, ereiferte sich der Kobold. Er stand jetzt dicht vor ihr; er reichte ihr kaum bis zum Knie. »Du bist als Reiterin für dein Pferd verantwortlich. Dir wird dein spöttisches Gerede noch leidtun, Elfe.« Der Kobold deutete auf Falrach. »Den Kerl nehmt ihr auch mit. Er ist ebenfalls angeklagt.«
»Was hat er getan? Dich mit einem Blick verletzt?«
Der Kobold schob seinen Säbel in die Schärpe. Er stützte seine verbliebene Hand in die Hüfte und bemühte sich augenscheinlich, würdevoll auszusehen.
»Nein, er trägt die Hauptschuld am Angriff auf den Troll. Ich gehe davon aus, dass der Fürst ihn zum Tode verurteilen wird.«
Für einen Augenblick verschlug es Emerelle die Sprache. »Das ist kein Recht«, stieß sie schließlich hervor.
»Jetzt beleidigst du auch noch unsere Gesetze. Mach nur so weiter, du redest dich um Kopf und Kragen.«
»Er hat doch gar nichts getan.«
»Eben«, sagte der Kobold mit selbstzufriedenem Nicken. »Das ist Teil seines Verbrechens. So wie du auf dein Pferd hättest achtgeben müssen, hätte dein Mann auf dich achtgeben müssen, Weib. Er hätte wissen müssen, was für eine schlechte Reiterin du bist. Es wäre seine Aufgabe gewesen, dir zu verbieten, zu Pferd nach Feylanviek zu kommen. Stell dir vor, es wäre durchgegangen und hätte ein paar spielende Kinder auf der Straße totgetrampelt.«
»Ich bin nicht sein Weib!«
»Oh!« Dalmag rollte mit den Augen. »Dann pflegt ihr also liederlichen Umgang miteinander, ohne euch ein Eheversprechen gegeben zu haben.« Er stieß einen keckernden Laut aus. »Elfen! Völlig sittenlos und verkommen! Das ändert natürlich nichts daran, dass er verpflichtet gewesen wäre, auf dich aufzupassen.«
Emerelle hatte Mühe, ernst zu bleiben. Dieser Kobold sollte das Recht in Feylanviek verkörpern? Das konnte nicht sein! Es musste hier einen Trollfürsten geben. »Wie lösen wir unseren Streit? Werde ich vor ein Gericht gestellt?«
»Natürlich! Hier hat sich viel geändert, seit Shandral geflohen ist.« Er hob den Armstumpf. »Er hat behauptet, mein Bruder habe ihn bestohlen. Jeder in meiner Sippe hat dafür die rechte Hand verloren. Sogar Neugeborene! Er hat unsere Hände in seinem Haus ausgestellt. Mit vielen anderen. Sieh dich um in dieser Stadt und wundere dich, wie viele meinesgleichen mit nur einer Hand leben! Vor ein Gericht wurde keiner von ihnen gebracht. Du wirst es also viel besser haben als wir, Elfe.«
Sie war hier, um genau das zu erleben, was gerade mit ihr geschah. Als Königin war sie so sehr in die Sorge um die Zukunft Albenmarks verstrickt gewesen, dass sie die Gegenwart vernachlässigt hatte. Grausamkeiten wie die Taten Shandrals hätten niemals geschehen dürfen. Das würde sich von nun an wieder ändern. Als fahrende Ritterin würde sie sich gegen die Tyrannei stellen, so wie sie es einst getan hatte. Im Großen war sie gescheitert. Nun konnte sie sich einer Aufgabe stellen, der sie gewachsen war.
»Gerne werde ich mich der Gerechtigkeit deines Herrn überantworten. Ich vertraue tief darauf, dass ihr aus der Vergangenheit gelernt habt.« Sie hörte Falrach hinter sich scharf einatmen. Doch ihr Gefährte erhob keinen Widerspruch.
Dalmag wirkte enttäuscht, dass sie nicht versuchte, sich zu widersetzen. »Wir schieben es nicht lange hinaus«, sagte er schließlich. »Ich bringe dich zum Rudelführer Gharub. Er wird das Urteil fällen.«
Emerelle blickte auf den Grauen hinab. Der Troll hatte ihren Hengst bewusstlos geschlagen. Aber er würde wieder zu sich kommen. »Was wird aus meinem Pferd?«
»Ja, das Pferd …« Der Kobold kratzte sich hinter dem linken Ohr. »Dies ist eine der wenigen gepflasterten Straßen. Und der Schnee ist fortgeräumt, damit hier Karren fahren können. Dein Pferd stört den Fluss der Waren. Und Feylanviek ist eine Stadt des Handels. Da du vor Gericht kommst und dich um dieses Ärgernis nicht kümmern kannst, werde ich meinen Freund beauftragen, das Problem zu lösen.« Er stieß dem Troll mit dem Ellenbogen gegen das Bein. »Hörst du, Madra. Du wirst dieses verdammte Pferd hier wegschaffen. Es gehört dir. Ich erwarte aber, dass es umgehend von der Straße verschwindet.«
»Egal wohin?«, fragte der Troll.
»Egal«, entgegnete Dalmag und wandte sich wieder Emerelle zu. »Du wirst selbstverständlich für die Kosten aufkommen, die dadurch entstehen, dass ein Teil der Wachen dieser Stadt damit beschäftigt ist, sich um den Ärger zu kümmern, den du verursacht hast.«
»Das kostet nix«, sagte der Troll und kniete neben dem Pferd nieder. Er packte den Kopf des Tieres mit beiden Händen und riss ihn in einem Ruck herum. Ein scharfes Knacken ertönte. Er ließ den Kadaver auf das Pflaster zurücksinken und zog ein in seinen mächtigen Pranken geradezu zerbrechlich wirkendes Steinmesser hervor.
Emerelle wandte den Blick ab, aber sie konnte nicht verhindern, dass ihr der Blutgeruch in die Nase stieg.
Der Troll rief seine Kameraden herbei, während Falrachs Pferd ängstlich schnaubte.
»Halt deinen Gaul still«, herrschte ihn der Kobold an, der ungerührt zusah, wie seine Wachen sich als Metzger versuchten. Die lange Zunge glitt ihm über die schmalen Lippen. Er fand offenbar Gefallen an diesem blutigen Schauspiel. Emerelle fragte sich, wie er wohl gewesen war, bevor er seine Hand verloren hatte.
Bald lagen nur noch die Röhrbeine, der Kopf und ein Haufen Eingeweide auf der Straße. Dutzende Schaulustige hatten sich um sie versammelt. So ausgemergelt, wie die meisten von ihnen aussahen, war sich Emerelle sicher, dass sie nur darauf warteten, dass die Trolle etwas übrig ließen.
»Wir hätten das Blut auffangen sollen«, murrte einer der Trollkrieger. »Das hätte eine schöne Wurst gegeben.«
Der Kobold stieß ein kurzes, schnarrendes Lachen aus. »Dann weicht mir jetzt nicht von der Seite. Vielleicht gibt es ja bald noch eine andere Gelegenheit, Blutwurst zu machen.« Bei diesen Worten bedachte er Emerelle mit einem boshaften Blick. »Glaubst du ans Mondlicht, Elfenschlampe? Du würdest meine Wachen maßlos enttäuschen, wenn du einfach nur verblasst.«
GOSSENKIND
Adrien schob die Dachschindeln auseinander und bemühte sich, so wenig Lärm wie möglich zu machen. Er lag ausgestreckt im Schnee. Feuchtigkeit drang durch seine Kleider, aber er achtete kaum darauf. Zu groß war sein Hunger. Es gab hier keinen Hund, darauf hatte er als Erstes geachtet, als er das Haus ausgewählt hatte. Allerdings konnte man ihn vom Haus auf der anderen Seite des Hofes sehr gut sehen, falls jemand zufällig aus dem Fenster blickte. Die Gefahr war jedoch nicht sehr groß. Die Läden waren alle geschlossen, die Riegel vorgelegt. Zum einen wegen der Winterkälte, vor allem aber wegen des Widergängers, der die Stadt seit Tagen in Schrecken versetzte. Nach Einbruch der Dämmerung wagte sich nur noch auf die Straße, wer keine andere Wahl hatte oder kein anderes Zuhause.
Warme, rauchgesättigte Luft schlug Adrien entgegen. Und das Aroma der Eselswürste. Ihm lief das Wasser im Munde zusammen. Er schob sich ein Stück vor. Ein Schneeklumpen fiel hinab in die Dunkelheit und schlug mit sattem Klatschen auf den Boden.
Adrien hielt den Atem an. War dort unten jemand? Der Fleischhauer war noch nicht gegangen, das wusste er. Genauso wie er wusste, dass der bullige Kerl immer abgelenkt war, wenn ihn das Blumenmädchen vom Heumarkt besuchte. So leicht hätte er es auch gerne! Sie trug jedes Mal eine kleine Räucherwurst in ihrem Korb, wenn sie ging. Und die hatte sie nicht gegen geflochtene Strohblumen getauscht.
Er seufzte. Er hatte ihr oft schöne Augen gemacht, aber sie beachtete ihn nicht einmal. Und er konnte es ihr nicht verdenken. Was hatte er schon zu bieten, außer vielleicht genau diesen schönen Augen. Ganz gewiss keine Würste, die man nach Hause tragen konnte. Manchmal stellte er ihr im Verborgenen nach. Deshalb wusste er, dass sie hierherkam. Und oft galten seine letzten Gedanken ihr, bevor der Schlaf ihn übermannte. Sie war so schön. Und er wusste nicht einmal ihren Namen … Er hatte nicht gewagt, danach zu fragen. Es würde ihr gewiss zu Ohren kommen. Er sollte sie sich aus dem Kopf schlagen! Jetzt galt es, dafür zu sorgen, dass er wieder einen vollen Bauch bekam. Von Träumen konnte man nicht leben!
Vorsichtig erweiterte Adrien das Loch zwischen den Schindeln. Sie waren nicht sonderlich fest gefügt. Brüchige, gebrannte Pfannen. Bedeckt mit eisverkrustetem Moos und nassem, pappigem Schnee. Als das Loch groß genug war, dass er bequem mit dem Arm hinablangen konnte, tastete er ins Dunkel. Bald bekam er einen der Dachsparren zu packen. Seine Finger glitten an dem Holz entlang, das vom alten Ruß ganz ölig war, bis er eine der Lederschnüre ertastete.
Adrien malte sich aus, was seinen Augen verborgen blieb. Die Räuchergerüste, die schräg unter der Decke der Dachkammer standen, behängt mit langen Reihen von Würsten. Vor ein paar Monden war er schon einmal hier gewesen. Er nahm nie viel. Natürlich machte er sich nichts vor. Wenn zwei Würste in einer Reihe fehlten, dann blieb das nicht verborgen. Aber es war bescheiden genug, dass der Zorn über den Dieb schnell verrauchte.
Der Junge stellte sich vor, wie der Fleischhauer unter ihm im Dunkel stand, eines der großen Messer in den massigen Händen. Der Kerl war nicht zartbesaitet. Das sah man sofort.
Adrien verfluchte sich für seine Einbildungskraft. Manchmal war sie ein Segen, nämlich dann, wenn er sich ausmalte, dass die paar Abfälle, die er mit geschlossenen Augen herunterschlang, köstliche Spezereien von eine Festtafel waren. Weitaus häufiger war diese Gabe jedoch ein Fluch. Zu gut konnte er sich vorstellen, was bei seinen Diebereien alles missglücken mochte. Immerzu dachte er an alle möglichen Ungeschicke und Strafen, die ihm drohten.
Mit den Fingerspitzen machte er sich an der Lederschnur zu schaffen. Endlich bekam er das herabhängende Ende zu packen. Das Ende mit dem eisernen Haken, von dem die Wurst hing. Vorsichtig zog er sie durch das Loch im Dach. Sie roch köstlich. Er ließ den Haken an der Lederschnur zurückfallen. Eine noch … War er maßlos? Nein, eine noch! Er wollte Nantour verlassen. Er war zu lange schon in der Stadt. Fast ein Jahr. Das konnte nicht gutgehen. Er musste fort! Am besten in eine noch größere Stadt, wo er in der Masse der gesichtslosen Gossenkinder verschwinden konnte.
Adrien streckte sich. Wieder tastete er ins Dunkel. Eine Wurst noch. Dort unten in der Räucherkammer hingen bestimmt hundert Würste. Was waren da schon zwei. Er ertastete das Gerüst. Die erbeutete Wurst hatte er unter sein Hemd geschoben. Sie drückte gegen seine Brust. Heute Nacht würde er nicht hungern. Zum ersten Mal seit vielen Wochen.
Er erhaschte eine weitere Lederschnur. Mit dem Fingernagel des Mittelfingers zog er sie zu sich heran. Unendlich langsam.
Wieder rutschte Schnee durch die Lücke im Dach und fiel mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden der Räucherkammer. Adrien fluchte stumm. Hörte er da nicht Schritte im Haus? Er sollte nicht bleiben. Er gab es auf, nach der zweiten Wurst zu angeln. Vorsichtig schob er die beiden losen Dachschindeln zusammen. Wenn keine Lücke zu sehen war, dann würde der Fleischhauer vielleicht ein wenig länger brauchen, bis er begriff, was geschehen war. Das bedeutete ein wenig mehr Zeit, um zu entwischen.
Er ließ sich auf das Dach des Erkers rutschen und sprang von dort auf einen niedrigen Anbau. Noch ein Sprung und er war im Hof. Sein Herz raste. Es gab nur zwei Wege, die vom Hof fortführten. Den Torbogen, der neben dem Fleischerladen auf die Straße zum Heumarkt führte. Und den schmalen Durchgang zwischen den Weberhäuschen auf der anderen Seite. Durch den Torbogen würde der Fleischhauer kommen.
Adrien hastete geduckt über den Hof. Er mied es, in Pfützen zu treten. Der nasse Schnee griff schmatzend nach seinen nackten Füßen. Er spürte die Kälte kaum. Das würde erst später kommen. Noch im Laufen biss er in die Wurst. Was er im Bauch hatte, dass konnte ihm keiner mehr nehmen.
Als er den Durchgang zwischen den Weberhäusern erreichte, hielt er inne. War der Fleischhauer jetzt in seiner Räucherkammer? Vielleicht blieb sein Diebstahl noch die ganze Nacht unentdeckt. Vielleicht hatte das Blumenmädchen ihm gerade ins Ohr geflüstert, was für ein wunderbarer Liebhaber er war?
Auf jeden Fall sollte er nicht auf die Straße hinter den Weberhäusern hinauslaufen. Wer rannte, erregte Aufmerksamkeit. Und die Straßen waren leer. Adrien dachte an die Geschichten über den Widergänger und biss erneut von der Wurst ab. Köstlich! Der Fleischhauer verstand sein Handwerk! Was er wohl alles unter das Fleisch mischte?
Adrien trat in den Durchgang. Es stank nach Pisse. Bestimmt wurden hier jeden Morgen die Nachttöpfe der Webersippschaft entleert. Der Junge hielt den Atem an und watete durch den Matsch. Diesen Weg nahm gewiss nur, wem sein Schuhwerk egal war oder wer sich keines leisten konnte.
Er trat hinaus auf den langen, geraden Seilersteig. Keine Menschenseele war zu sehen. Durch einige Fensterläden fiel gelbes Licht. Im Mondschein leuchteten die Kreidezeichen auf den freigeschaufelten Simsen und Türschwellen. Zeichen, die den Widergänger fernhalten sollten.
Wo sollte er die Nacht verbringen? Bei der Armenstube ließ er sich besser nicht blicken. Die würden an seinem Atem riechen, was er gegessen hatte. Und sie wüssten, dass diese Wurst kein Geschenk war.
»Diebesgut mundet gut«, erklang eine Stimme unmittelbar neben ihm.
Vor Schreck fiel ihm die Wurst aus der Hand. Ein Schatten löste sich aus der Türnische des Weberhauses, eine dunkel gewandete Gestalt mit langem Wanderstock.
Adrien bückte sich hastig nach der Wurst und wischte sie an seinem Hosenbein ab. Sollte er loslaufen? Das Gesicht des Fremden war im Schatten seiner Kapuze verborgen. Er trug ein dunkelblaues Gewand wie ein Wanderpriester. Bestimmt könnte er ihm entwischen!
»Ich muss weiter«, sagte er und wollte gehen, doch der Fremde hielt ihm den Wanderstab quer vor die Brust.
»Dies ist die letzte Nacht, in der du hungern musst, wenn du es so willst.«
Adrien legte die Hand auf den Stab. Ihm stand jetzt
Redaktion: Angela Kuepper Originalausgabe 11/2009
Copyright © 2009 by Bernhard Hennen Copyright © 2009 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH Karten und Illustratiionen: Andreas Hancock Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN 978-3-641-06494-5
www.heyne-magische-bestseller.de
www.randomhouse.de
Leseprobe