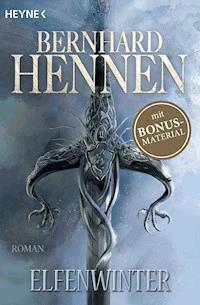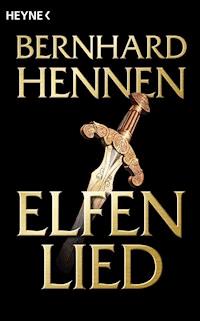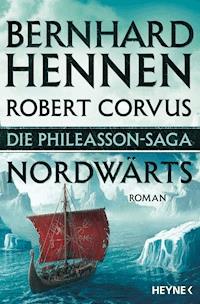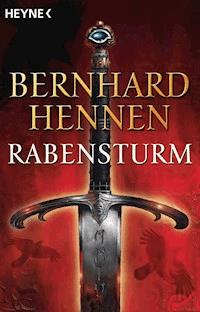11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Elfen-Saga
- Sprache: Deutsch
Verborgen vor den Augen der Menschen, geschützt durch magische Pforten, liegt das Reich der Elfen: Albenmark. Doch ihre Welt ist bedroht, denn ein gefährlicher Feind schickt sich an, das Volk der Elfen für immer zu vernichten. Die Elfenkönigin Emerelle schickt Farodin und Nuramon — die kühnsten Krieger Albenmarks und Rivalen um die Gunst der Zauberin Noroelle — aus, um Albenmark zu retten. Vor ihnen liegt eine gefährliche Reise durch verschiedene Zeiten und Welten, an deren Ende sich das Schicksal eines ganzen Volkes entscheiden wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1456
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Bernhard Hennen
KINDER DER NACHT
Eine Geschichte aus der Welt der Elfen
jetzt exklusiv als E-Book
BERNHARD HENNEN
&JAMES SULLIVAN
DIE
ELFEN
Roman
Mit den Bonusgeschichten»Nuramon der Wanderer« und »Farodin«
Wilhelm Heyne Verlag
München
Neuausgabe 10/2014
Copyright © 2004/2011 by Bernhard Hennen und James Sullivan
Copyright © 2014 dieser Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Isabelle Hirtz, Inkcraft, Augsburg
Umschlagillustration: Melanie Miklitza, Inkcraft, Wedel
Karten: Andreas Hancock
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-06501-0
www.heyne-fantastisch.de
@HeyneFantasySF
twitter.com/HeyneFantasySF
Durch den Wald im Mondenscheine
Sah ich jüngst die Elfen reiten;
Ihre Hörner hört’ ich klingen,
Ihre Glöckchen hört’ ich läuten.
Ihre weißen Rösslein trugen
Güldnes Hirschgeweih und flogen
Rasch dahin; wie wilde Schwäne
Kam es durch die Luft gezogen.
Lächelnd nickte mir die Kön’gin,
Lächelnd im Vorüberreiten.
Galt das meiner neuen Liebe,
Oder soll es Tod bedeuten.
HEINRICH HEINE
DER MANNEBER
Inmitten der tief verschneiten Lichtung lag der Kadaver eines Elchbullen. Das zerschundene Fleisch dampfte noch. Mandred und seinen drei Gefährten war klar, was das bedeutete: Sie mussten den Jäger aufgeschreckt haben. Der Kadaver war mit blutigen Striemen bedeckt, der schwere Schädel des Elchs aufgebrochen. Mandred kannte kein Tier, das jagte, um dann nur das Hirn seiner Beute zu fressen. Ein dumpfes Geräusch ließ ihn herumfahren. In wirbelnden Kaskaden fiel Schnee von den Ästen einer hohen Kiefer am Rand der Lichtung. Die Luft war erfüllt mit feinen Eiskristallen. Misstrauisch spähte Mandred ins Unterholz. Jetzt war der Wald wieder still. Weit über den Baumwipfeln zog das grüne Feenlicht tanzend über den Himmel. Das war keine Nacht, um in die Wälder zu gehen!
»Bloß ein Ast, der unter der Last des Schnees gebrochen ist«, sagte der blonde Gudleif und klopfte sich den Schnee von seinem schweren Umhang. »Jetzt schau nicht drein wie ein tollwütiger Hund. Du wirst schon sehen, am Ende folgen wir doch nur einem Rudel Wölfe.«
Sorge hatte sich in die Herzen der vier Männer geschlichen. Jeder dachte an die Worte des alten Mannes, der sie vor einer todbringenden Bestie aus den Bergen gewarnt hatte. Waren sie doch mehr als Hirngespinste, gesprochen im Fieberwahn? Mandred war der Jarl von Firnstayn, jenes kleinen Dorfes, das hinter dem Wald am Fjord lag. Es war seine Pflicht, jede Gefahr abzuwenden, die dem Dorf drohen mochte. Die Worte des Alten waren so eindringlich gewesen, er hatte ihnen nachgehen müssen. Und doch …
In Wintern wie diesem, die früh begannen, die zu viel Kälte brachten und in denen das grüne Feenlicht am Himmel tanzte, kamen die Albenkinder in die Welt der Menschen. Mandred wusste das, und seine Gefährten wussten es auch.
Asmund hatte einen Pfeil auf den Bogen gelegt und blinzelte nervös. Der schlaksige, rothaarige Mann machte nie viele Worte. Er war vor zwei Jahren nach Firnstayn gekommen. Man erzählte sich, er sei im Süden ein berühmter Viehdieb gewesen und König Horsa Starkschild habe ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Mandred scherte sich nicht darum. Asmund war ein guter Jäger, der viel Fleisch ins Dorf brachte. Das zählte mehr als irgendwelche Gerüchte.
Gudleif und Ragnar kannte Mandred von Kindesbeinen an. Sie beide waren Fischer. Gudleif war ein stämmiger Kerl mit Bärenkräften; stets gut gelaunt, zählte er viele Freunde, auch wenn er als etwas einfältig galt. Ragnar war klein und dunkelhaarig, er unterschied sich von den großen, meist blonden Bewohnern des Fjordlands. Manchmal wurde er dafür verspottet, und hinter vorgehaltener Hand nannten sie ihn ein Koboldkind. Das war närrischer Unsinn. Ragnar war ein Mann mit dem Herzen auf dem rechten Fleck. Einer, auf den man sich unbedingt verlassen konnte!
Wehmütig dachte Mandred an Freya, seine Frau. Sie saß jetzt gewiss an der Feuergrube und lauschte hinaus in die Nacht. Er hatte ein Signalhorn mitgenommen. Ein Hornstoß bedeutete Gefahr; blies er hingegen zweimal ins Horn, so wusste jeder im Dorf, dass keine Gefahr hier draußen lauerte und die Jäger sich auf dem Heimweg befanden.
Asmund hatte den Bogen gesenkt und legte warnend einen Finger an die Lippen. Er hob den Kopf wie ein Jagdhund, der Witterung aufgenommen hatte. Jetzt roch Mandred es auch. Ein seltsamer Geruch zog über die Lichtung. Er erinnerte an den Gestank fauler Eier.
»Vielleicht ist es ja ein Troll«, flüsterte Gudleif. »Es heißt, in harten Wintern kommen sie aus den Bergen herab. Ein Troll könnte einen Elch mit einem Fausthieb niederstrecken.«
Asmund blickte Gudleif finster an und bedeutete ihm mit einer Geste zu schweigen. Das Holz der Bäume knarrte leise in der Kälte. Mandred beschlich das Gefühl, beobachtet zu werden. Etwas war hier. Ganz nah.
Plötzlich stob das Geäst eines Haselstrauchs auseinander, und zwei weiße Schemen stürmten mit lautem Flügelschlag über die Lichtung hinweg. Mandred riss unwillkürlich den Speer hoch, dann atmete er erleichtert aus. Es waren nur zwei Schneehühner gewesen!
Aber was hatte sie aufgescheucht? Ragnar zielte mit dem Bogen auf den Haselstrauch. Der Jarl senkte die Waffe. Er spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Lauerte das Ungeheuer dort im Gebüsch? Lautlos verharrten sie.
Eine Ewigkeit schien zu vergehen, doch nichts rührte sich. Die vier hatten einen weiten Halbkreis um das Dickicht gebildet. Die Spannung war kaum mehr zu ertragen. Mandred spürte, wie ihm kalter Schweiß den Rücken hinabrann und sich am Gürtel sammelte. Der Weg zurück zum Dorf war weit. Wenn seine Kleidung durchgeschwitzt war und ihn nicht länger gegen die Kälte schützte, wären sie gezwungen, irgendwo ein Lager aufzuschlagen und Feuer zu machen.
Der dicke Gudleif kniete nieder und steckte den Speer in den Boden. Sodann grub er die Hände in den frischen Schnee und formte mit leisem Knirschen einen Ball. Gudleif blickte zu Mandred, und der Jarl nickte. In weitem Bogen flog der Schneeball ins Gebüsch. Nichts rührte sich.
Mandred atmete erleichtert aus. Ihre Angst hatte die Schatten der Nacht lebendig werden lassen. Sie selbst waren es gewesen, die die Schneehühner aufgescheucht hatten!
Gudleif grinste erleichtert. »Da ist nichts. Das Mistvieh, das den Elch gerissen hat, ist längst über alle Berge.«
»Ein schöner Jagdtrupp sind wir«, spottete nun auch Ragnar. »Demnächst laufen wir noch vor einem Hasenfurz davon.«
Gudleif stand auf und nahm seinen Speer. »Jetzt spieß ich die Schatten auf!« Lachend stocherte er im Geäst des Buschwerks herum.
Plötzlich wurde er mit einem Ruck nach vorn gerissen. Mandred sah eine große, krallenbewehrte Hand den Speerschaft umklammern. Gudleif stieß einen schrillen Schrei aus, der abrupt in kehliges Blubbern überging. Der stämmige Mann taumelte zurück, beide Hände auf die Kehle gepresst. Blut spritzte zwischen seinen Fingern hindurch und rann über sein Wolfsfellwams.
Aus dem Gebüsch trat eine riesige Gestalt, halb Mann, halb Eber. Durch das Gewicht des massigen Eberkopfs stand die Kreatur tief vorgebeugt, und dennoch ragte sie mehr als zwei Schritt auf. Der Leib der Bestie war der eines kräftigen Hünen; dicke, knotige Muskelstränge zogen sich über Schultern und Arme. Die Hände endeten in dunklen Krallen. Die Beine waren unterhalb der Knie unnatürlich dünn und dicht mit grauschwarzen Borsten besetzt. Anstelle von Füßen hatte die Kreatur gespaltene Hufe.
Der Manneber stieß ein tiefes, kehliges Grunzen aus. Dolchlange Hauer ragten aus seinen Kiefern. Die Augen schienen Mandred verschlingen zu wollen.
Asmund riss den Bogen hoch. Ein Pfeil schnellte von der Sehne. Er traf die Bestie seitlich am Kopf und hinterließ eine feine rote Schramme. Mandred packte seinen Speer fester.
Gudleif aber brach in die Knie, verharrte einen Herzschlag lang schwankend und kippte dann zur Seite. Seine verkrampften Hände lösten sich. Noch immer quoll Blut aus seiner Kehle, und seine stämmigen Beine zuckten hilflos.
Blinde Wut packte Mandred. Er stürmte vor und rammte den Speer in die Brust des Mannebers. Ihm kam es so vor, als wäre er auf einen Fels aufgelaufen. Das Speerblatt glitt seitlich von der Kreatur ab, ohne Schaden anzurichten. Eine Krallenhand schnellte vor und zersplitterte den Schaft der Waffe.
Ragnar griff das Ungeheuer von der Seite her an, um es von Mandred abzulenken. Doch auch sein Speer vermochte nichts auszurichten.
Mandred ließ sich in den Schnee fallen und zog eine Axt aus dem Gürtel. Es war eine gute Waffe mit schmaler, scharfer Klinge. Der Jarl hieb mit aller Kraft nach den Fesseln des Mannebers. Das Ungeheuer grunzte. Dann senkte es den wuchtigen Kopf und rammte den Krieger. Ein Hauer traf Mandred an der Innenseite des Oberschenkels, zerfetzte die Muskeln und zersplitterte das silbergefasste Signalhorn, das an Mandreds Gürtel gehangen hatte. Mit einem Ruck riss der Manneber den Kopf in den Nacken, sodass Mandred in den Haselstrauch geschleudert wurde.
Halb betäubt vor Schmerz, drückte er mit einer Hand die Wunde zu, während er mit der anderen einen Streifen Stoff von seinem Umhang riss. Schnell presste er die Wolle in die klaffende Wunde und nahm dann den Gürtel ab, um das Bein notdürftig abzuschnüren.
Gellende Schreie klangen von der Lichtung. Mandred brach einen Ast vom Strauch und schob ihn durch den Gürtel. Dann drehte er das Lederband enger, bis es so stramm wie ein Fassband um seinen Oberschenkel lag. Der Schmerz ließ ihn fast ohnmächtig werden.
Die Schreie auf der Lichtung waren verstummt. Vorsichtig bog Mandred die Äste des Gebüschs auseinander. Seine Kameraden lagen leblos im Schnee. Der Manneber stand über Ragnar gebeugt und rammte ihm wieder und wieder die Hauer in die Brust. Mandreds Axt lag dicht neben der Bestie. Alles in ihm drängte danach, das Ungeheuer tollkühn anzuspringen, ganz gleich, ob er bewaffnet war oder nicht. Es war ehrlos, sich aus einem Kampf davonzuschleichen! Aber es war dumm, einen aussichtslosen Kampf zu führen. Er war der Jarl, er trug die Verantwortung für das Dorf. Deshalb musste er jene warnen, die noch am Leben waren!
Doch er konnte nicht einfach nach Firnstayn zurückkehren. Seine Spur würde das Ungeheuer direkt zum Dorf führen. Er musste einen anderen Weg finden.
Zoll um Zoll kroch Mandred rückwärts aus dem Gebüsch. Jedes Mal, wenn ein Ast knackte, blieb ihm fast das Herz stehen. Doch die Bestie scherte sich nicht um ihn. Sie kauerte auf der Lichtung und hielt ihr schauriges Mahl.
Als er aus dem Gebüsch herausgekrochen war, wagte es Mandred, sich halb aufzurichten. Ein stechender Schmerz fuhr durch sein Bein. Er tastete über die Wollfetzen. Eiskrusten bildeten sich darauf. Wie lange würde er in der Kälte durchhalten?
Der Jarl humpelte das kurze Stück Weg bis zum Waldrand. Er blickte zur Steilklippe, deren dunkles Haupt hoch über den Fjord ragte. Dort oben gab es einen uralten Steinkreis. Und ganz in der Nähe war der Holzstoß für das Signalfeuer aufgeschichtet. Wenn er das Feuer entfachen könnte, wäre das Dorf gewarnt. Doch es waren mehr als zwei Meilen Weg bis dort oben.
Mandred hielt sich am Waldrand, doch er kam nur langsam durch den frischen Schnee voran. Beklommen betrachtete er das weite Schneefeld vor sich, das in sanfter Steigung an der Rückseite der Klippe hinaufführte. Dort gab es kaum Deckung, und die breite Spur, die er durch den Schnee ziehen würde, wäre nicht zu übersehen.
Erschöpft lehnte er sich an den Stamm einer alten Linde und sammelte Kräfte. Hätte er den Worten des alten Mannes nur Glauben geschenkt! Sie hatten ihn eines Morgens vor der hölzernen Palisade gefunden, die das Dorf schützte. Die Kälte hatte dem armen Kerl schon fast das Leben aus den Knochen gestohlen. In seinen Fieberträumen hatte er von einem Eber erzählt, der aufrecht ging. Von einem Ungeheuer, das aus den Bergen weit im Norden gekommen war, um Tod und Verderben über die Dörfer des Fjordlandes zu bringen. Ein Menschenfresser! Hätte der Alte von Trollen gesprochen, die aus den Tiefen der Berge kamen, von bösartigen Kobolden, die ihre wollenen Mützen im Blute Erschlagener färbten, oder von der Elfenjagd mit ihren weißen Wölfen, Mandred hätte ihm geglaubt. Aber ein Eber, der aufrecht ging und Menschen fraß … Niemand hatte je zuvor von einem solchen Geschöpf gehört! Schnell hatten sie das Gerede des Alten als wirre Fieberträume abgetan.
Dann war die Mittwinternacht gekommen. Der Fremde hatte Mandred an sein Sterbebett gerufen. Er hatte keinen Frieden finden können, bis Mandred ihm schließlich geschworen hatte, nach der Fährte des Ungeheuers zu suchen und die anderen Dörfer am Fjord zu warnen. Mandred hatte dem Alten da noch immer nicht geglaubt, doch er war ein Mann von Ehre, der einen Eid nicht auf die leichte Schulter nahm. Deshalb war er hinausgegangen …
Wären sie nur vorsichtiger gewesen!
Mandred atmete tief aus, dann humpelte er hinaus auf das weite Schneefeld. Sein linkes Bein war ganz taub. Wenigstens ein Gutes hatte die Kälte, er spürte jetzt keine Schmerzen mehr in der Wunde. Doch das taube Bein erschwerte ihm das Gehen. Immer wieder strauchelte er. Halb kriechend, halb gehend kämpfte er sich vorwärts. Von dem Manneber war noch nichts zu hören. Ob er sein grausiges Mahl wohl schon beendet hatte?
Endlich erreichte er ein breites Geröllfeld. Ein Steinschlag war hier im letzten Herbst niedergegangen. Der tückische Untergrund lag nun unter einer dicken Schneedecke verborgen. Mandreds Atem ging stoßweise. Dichte weiße Dunstwolken standen ihm vor dem Mund und schlugen sich als Raureif auf seinem Bart nieder. Verdammte Kälte!
Der Jarl dachte an den letzten Sommer zurück. Manchmal war er mit Freya hierher gekommen. Sie hatten im Gras gelegen und den Sternenhimmel betrachtet. Er hatte vor ihr mit seinen Jagdabenteuern geprahlt und damit, wie er König Horsa Starkschild auf seinem Kriegszug an die Küsten von Fargon begleitet hatte. Freya hatte ihm geduldig zugehört und ihn manchmal ein wenig aufgezogen, wenn er seine Heldentaten zu sehr ausgeschmückt hatte. Ihre Zunge konnte so scharf sein wie ein Messer! Aber sie küsste wie … Nein, nicht daran denken! Er schluckte hart. Bald würde er Vater werden. Aber sein Kind würde er niemals sehen. Ob es wohl ein Junge wurde?
Mandred lehnte sich an einen großen Felsbrocken, um zu verschnaufen. Den halben Weg hinauf hatte er geschafft. Sein Blick schweifte zurück zum Waldrand. Die Dunkelheit des Waldes vermochte das grüne Feenlicht nicht zu durchdringen, doch hier auf dem Berghang sah man alles so deutlich wie in einer wolkenlosen Vollmondnacht.
Nächte wie diese hatte er immer gemocht, obwohl das unheimliche Himmelslicht den meisten Menschen in den Nordlanden Angst machte. Es sah aus, als würden riesige Bahnen Tuch, gewoben aus funkelndem Sternenschein, über den Himmel gezogen.
Manche sagten, die Elfen verbärgen sich in diesem Licht, wenn sie nachts zur Jagd über den frostklaren Himmel ritten. Mandred lächelte. Freya hätte an diesem Gedanken Gefallen gefunden. Sie liebte es, an Winterabenden an der Feuergrube zu sitzen und Geschichten zu lauschen; Geschichten von den Trollen aus den fernen Bergen und von den Elfen, deren Herzen so kalt wie Wintersterne waren.
Eine Bewegung am Waldrand schreckte Mandred aus seinen Gedanken. Der Manneber! Die Bestie hatte also seine Verfolgung aufgenommen. Gut so. Mit jedem Schritt die Klippe hinauf lockte er sie fort vom Dorf. Er musste nur durchhalten … Sollte sie ihm ruhig die Brust aufreißen, um sein Herz zu fressen, wenn er es nur schaffte, das Signalfeuer zu entzünden!
Mandred stieß sich von dem Felsbrocken ab und strauchelte. Seine Füße! Sie … sie waren noch da, aber er spürte sie nicht mehr. Er hätte nicht stehen bleiben dürfen! War er denn närrisch … Jedes Kind wusste, dass eine Rast bei dieser Kälte den Tod bedeuten konnte.
Mandred sah verzweifelt auf seine Füße hinab. Erfroren und ohne jedes Gefühl, würden sie ihn nicht mehr warnen, wenn Geröll unter ihnen wegrutschte. Sie waren Verräter an ihm geworden, waren zum Feind übergelaufen, der verhindern wollte, dass er das Warnfeuer entzündete.
Der Jarl lachte auf. Doch es lag kein Frohsinn in dem Gelächter. Seine Füße waren übergelaufen. Welch ein Unsinn! Er wurde langsam verrückt. Die Füße waren einfach nur totes Fleisch, so, wie schon bald der ganze Mann totes Fleisch sein würde. Wütend trat er gegen den großen Felsbrocken. Nichts! Als wären die Füße nicht da. Er konnte aber noch gehen! Das war nur eine Frage des Willens. Doch er musste sehr genau aufpassen, wohin er trat.
Voller Sorge blickte er zurück. Der Manneber war auf das Schneefeld hinausgetreten. Er schien keine Eile zu haben. Wusste er, dass es nur diesen einen Weg zur Klippe hinauf gab? Mandred konnte ihm jetzt nicht mehr entkommen. Doch das hatte er ja auch nicht vorgehabt. Wenn er nur das Feuer entzünden könnte, dann wäre alles andere egal!
Ein Geräusch ließ ihn aufschrecken. Die Bestie stieß ein tiefes Knurren aus. Mandred hatte das Gefühl, dass ihm der Manneber geradewegs in die Augen sah. Natürlich war das auf diese Entfernung unmöglich, und doch … Etwas streifte sein Herz wie ein kalter Luftzug.
Der Jarl beschleunigte seine Schritte. Er musste seinen Vorsprung halten! Um das Feuer zu entfachen, würde er ein wenig Zeit brauchen. Sein Atem ging pfeifend. Wenn er ausatmete, war da ein leises Klirren, wie von Eiszapfen, die in hohen Tannenwipfeln aneinander schlugen, nur zarter. Der Kuss der Eisfee! Ein Märchen, das man den Kindern erzählte, fiel ihm ein. Es hieß, die Eisfee sei unsichtbar und wandere in Nächten, in denen es so kalt war, dass selbst das Licht der Sterne gefror, durch das Fjordland. Näherte sie sich, dann verschwand der dampfende Atem, und ein leises Klirren lag in der Luft. Kam sie so nahe, dass ihre Lippen das Antlitz eines Wanderers berührten, dann brachte ihr Kuss den Tod. War das der Grund, warum der Manneber sich nicht näher heranwagte?
Wieder blickte Mandred zurück. Der Bestie schien es keine Mühe zu bereiten, sich durch den tiefen Schnee zu bewegen. Eigentlich hätte sie ihn viel schneller einholen müssen. Warum spielte sie mit ihm wie eine Katze mit der Maus?
Mandred rutschte aus; sein Kopf schlug schwer gegen einen Felsbrocken, doch er fühlte keinen Schmerz. Mit den Fäustlingen fuhr er sich über die Stirn. Dunkles Blut troff von dem Leder. Ihm war schwindelig. Das hätte nicht passieren dürfen! Gehetzt blickte er zurück. Der Manneber war stehen geblieben, hatte den Kopf weit in den Nacken gelehnt und blickte zu ihm auf.
Mandred schaffte es nicht mehr auf die Beine. Was war er nur für ein Narr. Zurückzublicken und dabei weiterzugehen!
Mit aller Kraft versuchte er hochzukommen. Aber die halb erfrorenen Beine verweigerten ihm den Dienst. Er hätte einen großen Felsbrocken gebraucht, um sich emporzuziehen. Jetzt musste er kriechen. So eine Demütigung! Er, Mandred Torgridson, der berühmteste Kämpfer am Fjord, kroch vor seinem Feind davon! Sieben Männer hatte Mandred allein auf dem Kriegszug König Horsas im Zweikampf besiegt. Für jeden überwundenen Feind hatte er sich stolz einen Zopf geflochten. Und nun kroch er davon.
Dies war eine andere Art Kampf, ermahnte er sich. Gegen dieses Ungeheuer konnte man nicht mit Waffen ankommen. Er hatte doch gesehen, wie Asmunds Pfeil von ihm abgeprallt war und wie seine Axt keine Wunde geschlagen hatte. Nein, dieser Kampf hatte andere Gesetze. Er würde siegen, wenn er es schaffte, das Feuer zu entfachen.
Verzweifelt robbte Mandred auf den Ellenbogen voran. Langsam wich auch die Kraft aus seinen Armen. Aber der Gipfel war nicht mehr weit. Der Krieger blickte zu den stehenden Steinen auf; sie waren von hellen Schneemützen gekrönt, die sich gegen den grün schimmernden Himmel abzeichneten. Gleich hinter dem Steinkreis waren die Scheite für das Signalfeuer aufgeschichtet.
Die Augen zusammengekniffen, kroch er weiter. Seine Gedanken galten nur noch seiner Frau. Er musste sie retten! Seine Kraft durfte nicht versiegen! Weiter, immer weiter!
Blinzelnd öffnete er die Augen. Der Schnee war fort. Er lag auf blankem Felsen. Vor ihm erhob sich einer der Pfeiler des Steinkreises. Er zog sich an dem Stein hoch und kam schwankend zum Stehen. Weit würden ihn seine Beine nicht mehr tragen.
Der Gipfel war abgeflacht und so eben wie der Boden einer Holzschüssel. Gewöhnlich hätte er um den Steinkreis einen Bogen gemacht. Niemand trat zwischen die stehenden Steine! Das war keine Frage von Mut. Im Sommer hatte Mandred den Gipfel einmal einen ganzen Nachmittag lang beobachtet. Nicht einmal Vögel waren über den Steinkreis hinweggeflogen.
Ein schmaler Pfad verlief dicht am Rand der Klippe und erlaubte es, die unheimlichen Steine zu umgehen. Doch mit seinen gefühllosen Beinen war er nicht mehr trittsicher genug, um diesen Weg wagen zu können. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zwischen den Steinen hindurchzugehen.
So als erwartete er einen plötzlichen Hieb, zog Mandred den Kopf zwischen die Schultern, als er ins Innere des Kreises trat. Zehn Schritte, dann hätte er das andere Ende erreicht. Es war ein so lächerlich kurzes Stück Weg …
Ängstlich sah Mandred sich um. Kein Schnee lag hier auf dem Boden aus gewachsenem Fels. Im Innern des Kreises schien der Winter keinen Einzug halten zu wollen. Seltsame Muster aus geschwungenen Linien waren in den Stein geritzt.
Zum Fjord hin fiel das Hartungskliff fast senkrecht ab. Unten vom Dorf sah es so aus, als hätte man eine steinerne Krone auf das Haupt des Kliffs gesetzt. Mehr als drei Mannlängen ragten die Granitblöcke auf, die in weitem Kreis das Felsplateau umschlossen. Es hieß, sie hätten schon lange, bevor die Menschen ins Fjordland gekommen waren, hier gestanden. Auch sie waren mit Mustern aus verschlungenen Linien geschmückt. So fein war dieses Gespinst, dass kein Mensch es nachzuahmen vermochte. Und sah man es zu lange an, dann fühlte man sich trunken wie von schwerem, gewürztem Wintermet.
Vor Jahren war einmal ein wandernder Skalde nach Firnstayn gekommen, der behauptet hatte, die stehenden Steine wären alte Elfenkrieger, die von ihren Urahnen, den Alben, mit einem Fluch belegt worden wären. Sie wären verdammt zu endloser, einsamer Wacht, bis das Land selbst sie eines fernen Tages um Hilfe riefe und der Zauberbann gebrochen werde. Mandred hatte den Skalden damals verspottet. Jedes Kind wusste, dass die Elfen von zarter Gestalt und nicht größer als Menschen waren. Die Steine waren viel zu wuchtig, um Elfen zu sein.
Als er den Kreis durchmessen hatte, schlug Mandred eisiger Wind entgegen. Jetzt hatte er es so gut wie geschafft. Nichts würde … Der Holzstoß! Er hätte ihn von hier aus sehen müssen! Er war auf einem Sims windgeschützt dicht unter dem Klippenrand aufgeschichtet. Mandred ließ sich auf die Knie nieder und kroch vorwärts. Da war nichts!
Die Klippe ging hier fast zweihundert Schritt senkrecht in die Tiefe. Hatte es einen Steinschlag gegeben? War der Sims weggebrochen? Mandred hatte das Gefühl, dass seine Götter ihn verhöhnten. All seine Kräfte hatte er aufgeboten, um es bis hierher zu schaffen, und nun …
Verzweifelt blickte er über den Fjord hinweg. Weit unten, auf der anderen Seite des gefrorenen Meerarms, kauerte sein Dorf im Schnee. Firnstayn. Es bestand aus vier Langhäusern und einer Hand voll kleiner Hütten, umgeben von einer lächerlich schwachen Palisade. Der hölzerne Wall aus Fichtenstämmen sollte Wölfe fern halten und ein Hindernis für Plünderer sein. Den Manneber würde diese Palisade niemals aufhalten.
Vorsichtig wagte sich der Jarl ein Stück näher an den Abgrund und blickte hinab zum Fjord. Das Feenlicht am Himmel zauberte grüne Schatten in die tief verschneite Landschaft. Firnstayn hatte sich in den Winterschlaf zurückgezogen. Weder Mensch noch Tier waren auf den Wegen zu sehen. Durch die Rauchfänge unter den Dachfirsten stieg weißer Qualm auf, der von Windböen zerpflückt und hinaus über den Fjord gejagt wurde. Sicher saß Freya bei der Feuergrube und horchte auf das Hornsignal, das verkündete, dass sie von der Jagd zurückkehrten.
Wenn das Horn nur nicht zerbrochen wäre! Von hier oben hätte man seinen Ruf bis hinab ins Dorf gehört. Welch ein grausames Spiel trieben die Götter mit ihm und den Seinen! Sahen sie ihm nun zu und lachten?
Mandred hörte ein leises Klicken. Matt wandte er sich ab. Der Manneber stand auf der anderen Seite des Steinkreises. Langsam ging er den Kreis entlang. Wagte auch er es nicht, zwischen die stehenden Steine zu treten?
Mandred robbte vom Rand der Klippe fort. Sein Leben war verwirkt, das wusste er. Aber wenn er die Wahl hatte, dann wollte er lieber von der Kälte getötet werden, als zum Fraß für die Bestie zu werden.
Das Klicken der Hufe wurde schneller. Ein letzter Zug noch! Mandred hatte es geschafft. Er lag im Bannkreis der Steine.
Bleierne Müdigkeit griff nach seinen Gliedern. Mit jedem Atemzug schnitt der eisige Frost in seine Kehle. Erschöpft lehnte er sich gegen einen der Steine. Böiger Wind zerrte an seinen froststarren Kleidern. Der Gürtel um seinen Oberschenkel hatte sich gelockert. Blut sickerte durch die Wollfetzen.
Leise betete Mandred zu seinen Göttern. Zu Firn, dem Herrn des Winters, zu Norgrimm, dem Herrn der Schlachten, zu Naida der Wolkenreiterin, die über die dreiundzwanzig Winde gebot, und zu Luth, dem Webmeister, der aus den Schicksalsfäden der Menschen einen kostbaren Teppich für die Wände der goldenen Halle wob, in der die Götter mit den tapfersten der toten Krieger zechten.
Mandred fielen die Augen zu. Er würde schlafen … den langen Schlaf … Seinen Platz in der Halle der Helden hatte er verwirkt. Er hätte mit seinen Gefährten sterben sollen. Er war ein Feigling! Gudleif, Ragnar und Asmund, keiner von ihnen war fortgelaufen. Dass der Holzstoß die Klippe hinabgestürzt war, war die Strafe der Götter.
Du hast Recht, Mandred Torgridson. Wer feige ist, den schützen die Götter nicht mehr, erklang eine Stimme in seinem Kopf.
War das der Tod?, fragte sich Mandred. Nur eine Stimme?
Mehr als eine Stimme! Sieh mich an!
Der Jarl vermochte seine Augenlider kaum mehr zu öffnen. Warmer Atem schlug ihm ins Gesicht. Er sah in große Augen, so blau wie der Himmel an einem Spätsommertag, wenn Mond und Sonne zugleich am Firmament standen. Es waren die Augen des Mannebers! Die Bestie war neben ihm, gleich außerhalb des Steinkreises, in die Hocke gegangen. Geifer troff von ihrem blutverkrusteten Maul. An einem der langen Hauer hingen noch faserige Fleischfetzen.
Wer feige ist, den schützen die Götter nicht mehr, erklang wieder die fremde Stimme in Mandreds Kopf. Nun können die anderen dich holen.
Der Manneber richtete sich zu voller Größe auf. Seine Lefzen zuckten. Fast schien er zu lächeln. Dann wandte er sich ab. Er umrundete den Steinkreis und war bald ganz außer Sicht.
Mandred legte den Kopf in den Nacken. Noch immer tanzte das geisterhafte Feenlicht über den Himmel. Die anderen? Schon umfing ihn Dunkelheit. Waren ihm die Augenlider zugefallen, ohne dass er es gemerkt hatte? Schlafen … nur für kurze Zeit. Die Dunkelheit war verlockend. Sie verhieß Frieden.
MINNESPIEL
Noroelle saß im Schatten zweier Linden und ließ sich von Farodins Flötenspiel und Nuramons Gesang berühren. Fast schien es ihr, als schenkten ihr die beiden Werber mit ihren sanften Weisen die Sinne neu. Versonnen betrachtete sie das Spiel von Licht und Schatten im Blätterdach weit über ihr. Ihr Blick schweifte hinab zu der Quelle, die knapp außerhalb des Schattens lag. Sonnenlicht glitzerte auf dem Wasser. Sie beugte sich vor, ließ die Hand hineingleiten und spürte das Kribbeln des Zaubers, der darin wohnte.
Ihr Blick folgte dem Wasser, das sich in den kleinen See ergoss. Die Sonnenstrahlen drangen bis auf den Grund und ließen die bunten Edelsteine funkeln, die Noroelle einst dort mit Sorgfalt gebettet hatte. Sie nahmen den Zauber der Quelle in sich auf. Die Magie, die nicht gebunden wurde, strömte mit dem Wasser aus dem See in den Bach und wurde hinweggespült. Dort draußen nährten sich die Wiesen vom Zauber des Wassers. Und des Nachts verließen die kleinen Auenfeen ihre Blüten und trafen sich, um im Sternenlicht zu schwärmen und die Schönheit Albenmarks zu besingen.
Die Wiesen hatten ihre blühenden Frühlingskleider angelegt. Ein milder Wind trug den vielfältigen Duft der Gräser und Blumen zu Noroelle; unter den Bäumen vermischte er sich mit dem süßen Duft der Lindenblüten. Ein Rascheln schwebte über der Elfe, das sich mit dem Gesang der Vögel und dem Plätschern des Quellwassers verband und Farodins und Nuramons Klänge untermalte.
Während es Farodin gelang, mit seinem Flötenspiel einen feinen Klangteppich aus all den Schwingungen dieses Ortes zu weben, erhob Nuramon seine Stimme über diesen und ersann Worte, die Noroelle wie eine Albe erscheinen ließen. Liebevoll blickte sie zu Nuramon, der auf einem flachen Stein am Wasser saß, und wieder zu Farodin, der am Stamm der größeren der beiden Linden lehnte.
Farodins Gesicht war das eines Elfenfürsten aus den alten Liedern, deren edle Schönheit als Glanz der Alben gepriesen wurde. Die lindgrünen Augen waren der Kronschmuck dieses Gesichts, das weißblonde Haar der sanfte Rahmen. Er trug die Tracht der Minnesänger, und alles – das Hemd, die Hosen, der Mantel, das Halstuch – war aus feinster roter Feenseide gefertigt. Nur seine Schuhe waren aus weichem Gelgerok-Leder. Noroelle blickte auf seine Finger, die auf der Flöte tanzten. Sie hätte ihrem Spiel den ganzen Tag zuschauen können …
Während Farodin dem Ideal eines Elfenmannes entsprach, konnte man dies von Nuramon so nicht behaupten. Die Frauen am Hof spotteten offen über sein Aussehen, nur um dann hinter vorgehaltener Hand von seiner andersartigen Schönheit zu schwärmen. Nuramon hatte hellbraune Augen und mittelbraunes Haar, das sich ein wenig wild bis auf seine Schultern wellte. In seiner sandfarbenen Kleidung entsprach er zwar nicht dem Bild eines Minnesängers, bot aber dennoch einen angenehmen Anblick. Statt der Seide der Feen hatte er deren Wollstoffe gewählt, die weit weniger kostbar waren, aber so fest und weich, dass Noroelle beim Betrachten des Hemdes und des waldfarbenen Mantels am liebsten zu Nuramon gegangen wäre, um den Kopf an seine Brust zu legen. Selbst die halbhohen Stiefel, die aus erdfarbenem und besonders weichem Gelgerok-Leder waren, erweckten bei Noroelle den Wunsch, sie zu berühren. Der Ausdruck von Nuramons Gesicht war so wandelbar wie seine Stimme, die alle Formen des Gesangs beherrschte und jeder Gefühlsregung einen treffenden Klang verlieh. Seine braunen Augen aber sprachen von Sehnsucht und Melancholie.
Farodin und Nuramon waren unterschiedlich, doch jeder war auf seine Art beeindruckend. Beide hatten ihre eigene Vollkommenheit, so wie das Licht des Tages ebenso reizvoll war wie die Dunkelheit der Nacht, oder Sommer und Winter, Frühling und Herbst. Noroelle wollte nichts davon missen, und der Vergleich des Äußeren der beiden Männer brachte sie einer Entscheidung für einen von ihnen nicht näher.
Bei Hofe hatten manche ihr geraten, sie solle bei der Wahl ihres Gefährten das Familienhaus berücksichtigen. Doch war es denn etwa Farodins Verdienst, dass seine Urgroßmutter noch eine leibhaftige Albe gewesen war? Und war es etwa Nuramons Schuld, dass er aus einer Familie stammte, die durch viele Generationen von den Alben getrennt war? Noroelle wollte ihre Entscheidung nicht von ihren Vorfahren abhängig machen, sondern von ihnen selbst.
Farodin wusste, wie er um eine hohe Frau werben musste. Er kannte alle Regeln und Bräuche und handelte stets so angemessen und ehrenvoll, dass man ihn allseits bewundern musste. Noroelle war sehr davon angetan, dass er ihr Innerstes zu kennen schien, es zu berühren vermochte und stets so passende Worte fand, als könnte er in jedem Augenblick ihre Gedanken und ihre Gefühle wahrnehmen. Doch hier lag zugleich auch sein Makel. Farodin kannte sämtliche Lieder und alle alten Geschichten. Er wusste stets, welches süße Wort er sprechen musste, weil er sie alle zuvor gehört hatte. Welche waren aber seine Worte und welche die der alten Dichter? War diese Weise von ihm selbst, oder hatte er sie zuvor gehört? Noroelle musste lächeln; der scheinbare Makel haftete nicht Farodin an, sondern ihr. War dieser liebliche Ort nicht in allem so, wie es die alten Sänger geschildert hatten? Die Sonne, die Linde, der Schatten, die Quelle, der Zauber? Und boten die alten Sänger demnach nicht auch die passenden Lieder zu diesem lieblichen Ort? Konnte sie demzufolge Farodin einen Vorwurf machen, dass er nichts anderes tat als das, was in dieser Lage angemessen war? Nein, das durfte sie nicht. Farodin war in jeder Hinsicht vollkommen, und jede Frau in den Gefilden der Elfen wäre glücklich über sein Werben.
Dennoch fragte sie sich, wer Farodin eigentlich war. Er entzog sich ihr, wie die Quelle von Lyn sich den Blicken der Elfen durch strahlendes Licht entzog. Sie wünschte sich, er würde seinen Schein für eine Weile schmälern, sodass sie einen Blick auf die Quelle werfen konnte. Oft hatte sie versucht, ihn dazu zu bewegen, doch er hatte ihre Gesten nicht verstanden. So war ihr der Blick in sein Innerstes bislang verwehrt gewesen. Und manchmal fürchtete sie, dort könnte etwas Dunkles lauern, etwas, das Farodin um jeden Preis zu verbergen trachtete. Hin und wieder unternahm ihr Liebster lange Reisen, doch nie sprach er davon, wohin er ging und aus welchem Grunde. Und wenn er zurückkehrte, erschien er Noroelle bei aller Wiedersehensfreude noch verschlossener als zuvor.
Bei Nuramon hingegen wusste Noroelle genau, um wen es sich handelte. Schon oft hatte man ihr gesagt, Nuramon sei nicht der Richtige für sie, er sei ihrer Würde nicht angemessen. Er stammte nämlich nicht nur aus einer vielköpfigen Sippe, sondern auch aus einer Linie, der eine Schande anhaftete. Denn Nuramon trug die Seele eines Elfen in sich, der in all seinen Leben, in die er hineingeboren worden war, die Bestimmung seines Daseins nicht gefunden hatte und demnach nicht ins Mondlicht gegangen war. Wem dieser Weg versperrt blieb, der wurde in seiner Sippe wiedergeboren, bis sein Schicksal sich erfüllte. Und dabei war er nicht in der Lage, sich an die vorigen Leben zu erinnern.
Kein anderer war so oft wiedergeboren worden wie Nuramon; seit Jahrtausenden war er dem Wechselspiel von Leben, Tod und Wiedergeburt nun schon ausgesetzt. Mit der Seele hatte Nuramon auch seinen Namen geerbt. Die Königin hatte in ihm die Seele seines Großvaters erkannt und ihm dessen Namen gegeben. Die scheinbar nicht enden wollende Suche nach seiner Bestimmung hatte selbst in Nuramons eigener Familie für hochmütigen Spott gesorgt. Zumindest musste sich derzeit keiner um sein Neugeborenes sorgen; doch sobald Nuramon stürbe, würde seine Seele gleich einem Schatten über seiner Sippe liegen. Niemand wusste, wem der nächste Nuramon geboren würde.
Alles in allem konnte er wahrlich nicht auf seine Abstammung schauen und dabei hoffen, ihretwegen bewundert zu werden. Im Gegenteil, alle sagten, Nuramon werde den gleichen Weg gehen wie zuvor; er werde nach seiner Bestimmung suchen, darüber sterben und wiedergeboren werden. Noroelle war diese Sichtweise zuwider. Sie sah einen vortrefflichen Mann vor sich sitzen, und als Nuramon ein weiteres Lied auf ihre Schönheit sang, spürte Noroelle, dass jedes Wort, das er sprach, seiner tief empfundenen Liebe zu ihr entsprang. Was die Wiege ihm verwehrt hatte, das hatte er sich selbst erworben. Nur eins wagte er nicht: ihr zu nahe zu kommen. Noch nie hatte er sie berührt, noch nie hatte er es gewagt, so wie Farodin, ihre Hand zu fassen und diese gar zu küssen. Und wann immer sie versuchte, ihm eine harmlose Zärtlichkeit zukommen zu lassen, wies er sie mit süßen, berauschenden Worten zurück.
Von welcher Seite sie ihre beiden Werber auch betrachtete, sie konnte im Augenblick zu keiner Entscheidung finden. Wenn Farodin ihr sein Innerstes offenbarte, dann würde sie ihn wählen. Wenn Nuramon seine Hände nach ihr ausstreckte und ihre Hand fasste, dann würde sie ihm den Vorrang geben. Die Entscheidung lag nicht bei ihr.
Es waren erst zwanzig Jahre vergangen, da dieses Werben begonnen hatte. Es mochten noch einmal zwanzig Jahre vergehen, bis sie eine Entscheidung von ihr erwarteten. Und wenn sie keine Entscheidung traf, dann würde derjenige, der die größere Beständigkeit zeigte, ihre Gunst gewinnen. Sollten sie sich auch darin ebenbürtig sein, so mochte die Werbung auf immer anhalten – eine Vorstellung, die Noroelle zum Schmunzeln brachte.
Farodin stimmte ein neues Stück an und spielte so innig, dass Noroelle die Augen schloss. Sie kannte das Lied, sie hatte es einst bei Hofe gehört. Doch mit jedem Ton, den Farodin erklingen ließ, übertraf er, was sie damals vernommen hatte.
Nuramons Stimme verblasste dagegen ein wenig, bis Farodin wiederum ein neues Lied begann. »O schau nur, holdes Albenkind!«, sang Nuramon nun. Noroelle öffnete die Augen, sie war von dem plötzlichen Wechsel in seiner Stimme überrascht.
»Dort auf dem Wasser ein Gesicht.« Er schaute auf das Wasser, aber sie konnte seinem Blick nicht folgen, so gebannt war sie von seiner Stimme.
»O Noroelle, geh hin geschwind / Vom Schatten aus hinein ins Licht.« Noroelle stand auf und folgte den Worten; sie ging einige Schritte von der Quelle fort und kniete sich an das Ufer des Sees, um ins Wasser zu blicken. Doch da war nichts.
Nuramon sang weiter. »Die blauen Augen sind ein See.« Noroelle sah blaue Augen; es waren ihre eigenen, die Nuramon gern mit einem See verglich.
»Dein Nachthaar weht im Frühlingswind.« Sie sah ihr Haar, wie es sanft über ihren Hals streifte, und musste lächeln.
»Du lächelst dort wie eine Fee. O schau nur, holdes Albenkind!« Sie betrachtete sich ganz genau und lauschte, wie Nuramon in den verschiedenen Sprachen der Albenkinder von ihrer Schönheit sang. In den Feensprachen klang einfach alles schön, aber er konnte selbst mit der Zunge der Kobolde sprechen und ihr dabei schmeicheln.
Während sie ihm zuhörte, hatte sie nicht länger sich selbst vor Augen, sondern eine andere Frau, viel schöner als sie sich je empfunden hatte, so erhaben wie die Königin und mit einer Anmut versehen, wie man sie den Alben nachsagte. Auch wenn sie sich selbst nicht in diesem Licht sah, wusste sie, dass Nuramons Worte direkt von Herzen kamen.
Als ihre Liebsten verstummten, wandte sie den Blick unsicher vom Wasser ab und schaute zu Nuramon, dann zu Farodin. »Warum habt ihr aufgehört?«
Farodin schaute hinauf zum Blätterdach. »Die Vögel sind unruhig. Ihnen ist offenbar nicht länger zum Singen zumute.«
Noroelle wandte sich zu Nuramon. »War das wirklich mein Gesicht, das ich im Wasser sah? Oder war es deine Zauberei?«
Nuramon lächelte. »Ich habe nicht gezaubert, nur gesungen. Aber dass du es nicht zu unterscheiden wusstest, schmeichelt mir.«
Farodin erhob sich plötzlich, und auch Nuramon stand auf und blickte über den See und die Wiesen hinweg in die Ferne. Da ertönte ein tiefes Hornsignal über dem Land.
Nun erhob sich auch Noroelle. »Die Königin? Was mag geschehen sein?«, fragte sie.
Farodin war mit wenigen Schritten neben Noroelle und legte ihr die Hand auf die Schulter. »Mach dir keine Sorgen, Noroelle.«
Nuramon war herangekommen und flüsterte ihr ins Ohr: »Es ist gewiss nichts, was nicht von einer Schar Elfen gelöst werden kann.«
Noroelle seufzte. »Es war wohl zu schön, um den ganzen Tag anzuhalten.« Sie sah, wie die Vögel sich in die Luft erhoben und kurz darauf der Burg der Königin entgegenflogen, die jenseits der Wiesen und der Wälder auf einem Hügel lag. »Beim letzten Mal hat die Königin dich zur Elfenjagd berufen. Ich sorge mich um dich, Farodin.«
»Bin ich nicht jedes Mal zurückgekehrt? Und hat nicht Nuramon dir stets die Zeit versüßt?«
Noroelle löste sich von Farodin und wandte sich beiden zu. »Und wenn ihr nun gemeinsam fortmüsstet?«
»Man wird mir keine solche Pflicht anvertrauen«, wandte Nuramon ein. »Das war immer so, und so wird es auch immer sein.«
Farodin schwieg, Noroelle aber sagte: »Die Anerkennung, die man dir verwehrt, werde ich dir geben, Nuramon. Aber nun geht! Holt eure Pferde und reitet voraus! Ich werde nachkommen und euch heute Abend bei Hofe sehen.«
Farodin fasste Noroelles Hand, küsste diese und verabschiedete sich. Nuramons Abschied bestand in einem liebevollen Lächeln. Dann ging er zu Felbion, seinem Schimmel. Farodin saß bereits auf seinem Braunen. Noroelle winkte ihnen noch einmal zu.
Die Elfe beobachtete ihre beiden Liebsten, wie sie abseits der Feenblüten über die Wiese ritten, dem Wald und der jenseits davon liegenden Burg entgegen. Sie trank ein wenig Wasser aus der Quelle und machte sich dann auf den Weg. Barfüßig schritt sie über die Wiesen. Sie wollte zur Fauneneiche gehen. Unter ihr konnte sie so klare Gedanken fassen wie nirgends sonst. Die Eiche hielt ihrerseits Zwiesprache mit ihr und hatte sie in jungen Jahren viel Zauberei gelehrt.
Auf ihrem Weg dachte sie über Farodin und Nuramon nach.
ERWACHEN
Es ist erstaunlich warm, dachte Mandred, als er erwachte. Ganz in der Nähe erklang Vogelgezwitscher. In die Halle der Helden war er gewiss nicht eingegangen. Vögel gab es dort keine … Und überhaupt sollte der Honigduft von schwerem Met in der Luft hängen und der Geruch von harzigem Fichtenholz, das in der Feuergrube glühte!
Er hätte nur die Augen aufschlagen müssen, um zu wissen, wo er war. Aber Mandred zögerte es hinaus. Er lag auf etwas Weichem. Nichts schmerzte. Hände und Füße kribbelten leicht, aber das war nicht unangenehm. Er wollte gar nicht wissen, wo er war. Er wollte einfach nur den Augenblick genießen, in dem er sich so wohl fühlte. So war es also, wenn man tot war.
»Ich weiß, dass du wach bist.« Die Stimme klang, als ob es ihr schwer fiele, Worte zu formen.
Mandred schlug die Augen auf. Er lag unter einem Baum, dessen Äste sich wie eine weite Kuppel über ihn wölbten. Neben ihm kniete ein Fremder und tastete mit starken Händen seinen Körper ab. Die Äste reichten bis dicht über seinen Kopf; sein Gesicht blieb im Spiel von Licht und Schatten verborgen.
Mandred blinzelte, um deutlicher sehen zu können. Irgendetwas stimmte hier nicht. Die Schatten schienen um das fremde Gesicht zu wirbeln, so als wollten sie es voller Absicht verbergen.
»Wo bin ich?«
»In Sicherheit«, entgegnete der Fremde knapp.
Mandred wollte sich aufrichten. Da bemerkte er, dass seine Hände und Beine auf den Boden gebunden waren. Nur den Kopf konnte er anheben.
»Was hast du mit mir vor? Warum bin ich gefesselt?«
Kurz blitzten zwischen den Schatten zwei Augen auf. Sie hatten die Farbe hellen Bernsteins, wie man ihn manchmal nach schweren Stürmen weiter im Westen an den Ufern des Fjordes fand.
»Wenn Atta Aikhjarto dich geheilt hat, kannst du gehen. Ich lege längst nicht so viel Wert auf deine Gesellschaft, dass ich dich fesseln würde. Er war es, der darauf bestand, deine Wunden zu versorgen …« Der Fremde machte einen seltsam schnalzenden Laut. »Deine Sprache macht einem Knoten in die Zunge. Sie ist ohne jede … Schönheit.«
Mandred sah sich um. Außer dem Fremden, der auf so unheimliche Weise vom Zwielicht umgeben war, war hier niemand. Von den tiefer hängenden Ästen des mächtigen Baumes fielen Blätter wie an einem windstillen Herbsttag und sanken sanft schaukelnd zu Boden.
Der Krieger blickte zur Krone hinauf. Er lag unter einer Eiche. Ihr Laub strahlte in kräftigem Frühlingsgrün. Es roch nach guter, schwarzer Erde, aber auch nach Verwesung, nach fauligem Fleisch.
Ein goldener Lichtstrahl stach durch das Blätterdickicht hinab zu seiner linken Hand. Jetzt sah er, was ihn gefangen hielt: Es waren die Wurzeln der Eiche! Um sein Handgelenk hatte sich fingerdickes, knotiges Wurzelwerk geschlungen, und die Finger waren von hauchzartem, weißem Wurzelgeflecht überzogen. Von dort kam der faulige Geruch.
Der Krieger bäumte sich in seinen Fesseln auf, doch jeder Widerstand war sinnlos. Fesseln aus Eisenbändern hätten ihn nicht fester halten können als diese Wurzeln.
»Was geschieht mit mir?«
»Atta Aikhjarto hat angeboten, dich zu heilen. Du warst vom Tod gezeichnet, als du die Pforte durchschrittest. Er hat mir befohlen, dich hierher zu bringen.« Der Fremde deutete zu den weit ausladenden Ästen hinauf. »Er zahlt einen hohen Preis dafür, das Gift des Frostes aus deinem Körper zu ziehen und deinem Fleisch die Farbe von Rosenblättern zurückzugeben.«
»Bei Luth, wo bin ich hier?«
Der Fremde stieß ein meckerndes Geräusch aus, das entfernt an ein Lachen erinnerte. »Du bist da, wo deine Götter keine Macht mehr haben. Du musst sie verärgert haben, denn eigentlich behüten sie euch Menschenkinder davor, durch diese Pforten zu gelangen.«
»Die Pforten?«
»Der Steinkreis. Wir haben gehört, wie du zu deinen Göttern gebetet hast.« Wieder verfiel der Fremde in meckerndes Lachen. »Du bist jetzt in Albenmark, Mandred, bei den Albenkindern. Das ist ziemlich weit weg von deinen Göttern.«
Der Krieger erschrak. Wer die Pforten zu der jenseitigen Welt durchschritt, war ein Verfluchter! Er hatte genug Geschichten über Männer und Frauen gehört, die in das Reich der Albenkinder geholt wurden. Keine dieser Geschichten nahm ein gutes Ende. Und doch … Wenn man beherzt auftrat, konnte man sie zuweilen dazu bringen, einem einen Dienst zu erweisen. Ob sie von dem Manneber wussten?
»Warum hilft mir Atta Aik … Atta Ajek … die Eiche?«
Der Fremde schwieg eine Weile. Mandred wünschte, er hätte dessen Gesicht sehen können. Es musste wohl ein Zauber sein, der es so beharrlich vor seinen Blicken verbarg.
»Atta Aikhjarto muss dich für bedeutsam halten, Krieger. Bei manchen sehr alten Bäumen, so heißt es, reichen die Wurzeln so tief, dass sie in eurer Welt gründen, Mensch. Was immer Atta Aikhjarto um dich weiß, muss ihm so viel bedeuten, dass er einen großen Teil seiner Kraft für dich opfert. Er nimmt dein Gift in sich auf und gibt dir dafür von seinem Lebenssaft.« Der Fremde deutete auf die fallenden Blätter. »Er leidet statt deiner, Mensch. Und du hast fortan die Kraft einer Eiche in deinem Blut. Du wirst nicht mehr sein wie die anderen deiner Art, und du wirst …«
»Genug!«, unterbrach eine scharfe Stimme den Redefluss des Fremden. Die Äste des Baums teilten sich, und eine Gestalt, halb Mensch, halb Pferd, trat an Mandreds Lager.
Der Krieger schaute das Geschöpf fassungslos an. Nie zuvor hatte er von einer solchen Kreatur gehört. Dieses Mannpferd hatte den muskulösen Oberkörper eines Menschen, der aus dem Rumpf eines Pferdes wuchs! Sein Gesicht wurde von einem in Locken gedrehten schwarzen Bart eingerahmt. Das Haupthaar war kurz geschoren, und ein Goldreif ruhte auf seiner Stirn. Um die Schultern geschlungen trug er einen Köcher mit Pfeilen, und in der Linken hielt er einen kurzen Jagdbogen. Er hätte einen stattlichen Krieger abgegeben, wäre da nicht dieser rotbraune Pferdeleib gewesen.
Das Mannpferd verneigte sich knapp in Mandreds Richtung. »Man nennt mich Aigilaos. Die Herrin von Albenmark wünscht dich zu sehen, und man hat mir die Ehre übertragen, dich zum Königshof zu geleiten.« Er sprach mit tiefer, melodiöser Stimme, doch betonte er die Worte dabei auf seltsame Weise.
Mandred spürte, wie sich der eiserne Griff der Wurzeln lockerte und ihn schließlich ganz freigab. Doch er hatte nur Augen für das Mannpferd. Dieses seltsame Geschöpf erinnerte ihn an den Manneber. Auch er war halb Mensch, halb Tier gewesen. Wie mochte erst die Herrin dieses Mannpferdes aussehen?
Mandred tastete über seinen Oberschenkel. Die tiefe Wunde hatte sich geschlossen, ohne auch nur eine Narbe hinterlassen zu haben. Versuchshalber streckte er die Beine. Kein unangenehmes Kribbeln, keine Schmerzen mehr! Sie schienen völlig gesundet, so als wären sie niemals vom Frostbiss verstümmelt gewesen.
Vorsichtig stand er auf. Noch traute er der Kraft seiner Beine nicht. Durch die Sohlen seiner Stiefel fühlte er den weichen Waldboden. Das war Zauberei! Mächtige Zauberei, wie keine Hexe im Fjordland sie hätte wirken können. Beine und Füße waren tot gewesen. Jetzt war das Gefühl wieder in sie zurückgekehrt.
Der Krieger trat an den mächtigen Eichenstamm heran. Fünf Männer hätten den Baum mit ausgestreckten Armen nicht umfassen können. Er musste Jahrhunderte alt sein. Ehrfürchtig kniete Mandred vor der Eiche nieder und berührte mit der Stirn die zerklüftete Rinde. »Ich danke dir, Baum. Ich stehe mit meinem Leben in deiner Schuld.« Er räusperte sich verlegen. Wie bedankte man sich bei einem Baum? Einem Baum mit Zauberkräften, den der gesichtslose Fremde mit einer Ehrfurcht behandelte, als wäre er ein König. »Ich … Ich werde wiederkehren und dir zu Ehren ein Fest feiern. Ein Fest, wie wir es in den Fjordlanden begehen. Ich …« Er breitete die Arme aus. Es war jämmerlich, sich mit nichts als einem Versprechen bei seinem Lebensretter zu bedanken. Es sollte etwas Handfesteres sein …
Mandred riss einen Streifen Stoff von seiner Hose und knotete ihn um einen der tiefer hängenden Äste. »Wenn es je etwas gibt, was ich für dich tun kann, sende mir einen Boten, der mir diesen Stoffstreifen überbringt. Ich schwöre bei dem Blute, mit dem der Stoff durchtränkt ist, dass meine Axt von heute an zwischen dir und all deinen Feinden stehen wird.«
Ein Rascheln ließ Mandred aufblicken. Eine rotbraune Eichel fiel von der Krone des Baumes herab, streifte seine Schulter und landete im welken Laub.
»Nimm sie«, sagte der Fremde leise. »Atta Aikhjarto macht selten Geschenke. Er hat dein Gelöbnis angenommen. Hüte die Eichel gut. Sie mag ein großer Schatz sein.«
»Ein Schatz, von dem in jedem Jahr tausende Brüder an den Ästen Atta Aikhjartos wachsen«, spottete das Mannpferd. »Schätze, mit denen sich Heerscharen von Eichhörnchen und Mäusen den Bauch voll schlagen. Du bist wahrlich reich beschenkt, Menschensohn. Komm nun, du wirst unsere Herrin doch nicht warten lassen?«
Mandred musterte das Mannpferd misstrauisch und bückte sich nach der Eichel. Aigilaos war ihm nicht geheuer. »Ich fürchte, ich werde mit dir nicht Schritt halten können.«
Weiße Zähne blitzten zwischen dem dichten Bart. Aigilaos grinste breit. »Das wirst du auch nicht müssen, Menschensohn. Schwing dich auf meinen Rücken und halte dich gut am Lederband meines Köchers fest. Ich bin nicht weniger kräftig als ein Schlachtross deiner Welt, und ich wette meinen Schweif, dass ich jedes Pferd, dem du je begegnet bist, im Laufen schlagen würde. Dabei ist mein Tritt so leicht, dass sich kaum ein Grashalm unter meinen Hufen beugt. Ich bin Aigilaos, der Schnellste unter den Kentauren, und man rühmt mich …«
»… einer noch schnelleren Zunge«, spottete der Fremde. »Man sagt von den Kentauren, dass ihnen gern die Zunge durchgeht. Sie ist so schnell, dass sie manchmal sogar die Wirklichkeit überholt.«
»Und von dir, Xern, heißt es, dass du ein solcher Griesgram bist, dass es mit dir nur Bäume aushalten«, erwiderte Aigilaos lachend. »Und das vermutlich nur, weil sie nicht vor dir davonlaufen können.«
Die Blätter der großen Eiche rauschten, obwohl Mandred keinen Luftzug spürte. Welkes Laub fiel dicht wie Frühlingsschnee.
Der Kentaur blickte zu den mächtigen Ästen empor. Das Lächeln war von seinem Gesicht verschwunden. »Mit dir habe ich keinen Streit, Atta Aikhjarto.«
In der Ferne erklang ein Horn. Das Mannpferd wirkte plötzlich erleichtert. »Die Hörner von Albenmark rufen. Ich muss dich zum Hof der Königin bringen, Menschensohn.«
Xern nickte Mandred zu. Für einen Augenblick schwand der Zauber, der sein Antlitz den Blicken entzog. Er hatte ein schmales, hübsches Gesicht, wenn man davon absah, dass seinem dichten Haar ein mächtiges Hirschgeweih entsprang. Dem Krieger verschlug es den Atem. Erschrocken wich er zurück. Gab es hier denn nur Tiermänner?
Plötzlich fügten sich für Mandred alle Ereignisse zu einem deutlichen Bild zusammen. Der Manneber war von hier gekommen! Er hatte ihn bei der Jagd verschont. Es war kein Zufall gewesen, dass er als Einziger nicht unter den tödlichen Hauern der Bestie gestorben war. Die Verfolgung … War dies etwa Teil eines heimtückischen Plans? Sollte er in den Steinkreis getrieben werden? Vielleicht war er nur das Wild dieser Bestie gewesen und hatte genau das getan, was sie wollte. Er war in den Steinkreis getreten …
Das Mannpferd scharrte unruhig mit den Hufen. »Komm, Mandred!«
Mandred griff nach dem Gurt des Köchers und zog sich auf den Rücken des Kentauren. Er würde sich dem stellen, was ihn erwartete! Er war kein Feigling. Mochte diese geheimnisvolle Herrin tausend Hörner rufen lassen, er würde gewiss nicht das Knie vor ihr beugen. Nein, er würde ihr aufrecht und voller Stolz entgegentreten und ein Wergeld zur Sühne für das Unheil fordern, das ihr Manneber ins Fjordland getragen hatte.
Aigilaos zerteilte mit seinen kräftigen Armen den schützenden Vorhang aus Ästen und trat auf eine steinige Wiese hinaus. Mandred sah sich verwundert um. Hier herrschte Frühling, und der Himmel erschien ihm viel weiter als im Fjordland! Aber wie konnte dann eine reife Eichel vom Baum fallen?
Das Mannpferd verfiel in einen scharfen Galopp. Mandreds Hände klammerten sich fest um das Leder des Köchers. Aigilaos hatte nicht gelogen. Schnell wie der Wind eilte er über die Wiese, vorbei an einer mächtigen Turmruine. Dahinter erhob sich ein Hügel, der von einem Steinkreis gekrönt wurde.
Mandred war nie ein guter Reiter gewesen. Seine Beine verkrampften sich, so fest presste er sie gegen die Flanken des Mannpferdes. Aigilaos lachte. Er trieb ein Spiel mit ihm! Doch er würde ihn nicht bitten, langsamer zu werden, schwor sich Mandred stumm.
Sie durchquerten einen lichten Birkenhain. Die Luft war erfüllt von goldenen Samen. Alle Bäume waren gerade gewachsen. Ihre Stämme schimmerten wie Elfenbein. Nirgends hing die Rinde in Fetzen herunter, so wie bei den Bäumen, die er vom Fjordland kannte. Wilde Rosen rankten sich um vereinzelte Findlinge aus grauem Fels. Fast schien es, als herrschte in dem Hain eine seltsame, wilde Ordnung. Doch wer würde seine Zeit damit vertun, ein Stück Wald zu hegen, das keine Ernte einbrachte? Gewiss nicht ein Wesen wie Aigilaos!
Der Weg stieg stetig an und war bald nur wenig mehr als ein schmaler Wildpfad. Die Birken wurden von Buchen abgelöst, deren Blätterdach so dicht war, dass es kaum Licht hindurchließ. Wie graue Säulen erschienen Mandred die hohen, schlanken Stämme. Es war unheimlich still. Nur mehr der vom dicken Laubboden gedämpfte Hufschlag war zu vernehmen. Hin und wieder bemerkte Mandred hoch in den Kronen seltsame Nester, die wie große Säcke aus weißem Leintuch aussahen. In manchen der Nester leuchteten Lichter. Der Krieger fühlte sich beobachtet. Irgendetwas war dort oben und folgte ihnen mit neugierigen Blicken.
Aigilaos preschte noch immer mit halsbrecherischem Galopp voran. Eine Stunde oder vielleicht noch länger ritten sie durch den stillen Wald, bis sie schließlich auf einen breiten Weg stießen. Das Mannpferd schwitzte nicht einmal.
Der Wald wurde nun lichter. Breite Bänder aus grauem, moosbewachsenem Fels durchschnitten den dunklen Boden. Aigilaos wurde langsamer. Er sah sich aufmerksam um.
Mandred erblickte halb zwischen den Bäumen verborgen einen weiteren Steinkreis. Die stehenden Steine waren von Efeu umrankt. Ein gestürzter Baumriese lag quer im Kreis. Der Ort schien seit langem verlassen.
Der Krieger spürte, wie sich die feinen Härchen in seinem Nacken aufrichteten. Die Luft war hier ein wenig kühler. Er hatte das beklemmende Gefühl, dass knapp außerhalb seines Gesichtsfeldes etwas lauerte, das selbst dem Mannpferd unheimlich war. Warum hatte man diesen Steinkreis aufgegeben? Was mochte hier geschehen sein?
Der Weg führte sie hinauf zu einer Klippe, die einen atemberaubenden Blick auf das umliegende Land gewährte. Direkt vor ihnen lag eine weite Klamm, die aussah, als hätte hier einst Naida die Wolkenreiterin mit einem gewaltigen Blitzschlag den felsigen Boden gespalten. Ein schmaler, aus dem Stein geschlagener Weg führte hinab zu einer Brücke, die sich in kühnem Bogen über den Abgrund spannte.
Jenseits der Klamm stieg das Land in sanften Hügeln an, die zum Horizont hin in graue Berge übergingen. Über den jenseitigen Rand der Klippe ergoss sich eine Vielzahl kleiner Bäche schäumend in den Abgrund.
»Shalyn Falah, die weiße Brücke«, sagte Aigilaos ehrfurchtsvoll. »Es heißt, sie sei aus einem Fingerknöchelchen der Riesin Dalagira geschnitten. Wer sie überschreitet, betritt das Herzland von Albenmark. Es ist sehr lange her, dass ein Menschensohn diesen Ort zu sehen bekam.«
Das Mannpferd machte sich an den Abstieg in die Klamm. Der Boden aus glattem Fels war mit Gischtwasser benetzt. Vorsichtig tastete es sich abwärts und fluchte dabei herzhaft in einer Sprache, die Mandred nicht verstand.
Als sie einen breiten Felssims erreichten, bat Aigilaos Mandred abzusteigen. Vor ihnen lag die Brücke. Sie war nur zwei Schritt breit und zur Mitte des Weges hin leicht gewölbt, sodass das Sprühwasser sich nicht in Pfützen sammelte, sondern ablief. Es gab kein Geländer.
»Wahrlich ein wunderschönes Bauwerk«, murmelte Aigilaos missmutig. »Nur haben die Erbauer nicht daran gedacht, dass es vielleicht Geschöpfe mit beschlagenen Hufen geben könnte. Es ist besser für dich, wenn du auf eigenen Füßen die Brücke passierst, Mandred. Man erwartet dich auf der anderen Seite. Ich werde einen Umweg nehmen und wohl erst in der Nacht auf der Burg eintreffen. Dich aber erwartet die Herrin zur Stunde der Dämmerung.« Er lächelte schief. »Ich hoffe, du bist schwindelfrei, Krieger.«
Mandred hatte ein flaues Gefühl, als er die spiegelglatte Brücke betrachtete. Aber er würde diesem Mannpferd seine Angst nicht zeigen! »Natürlich bin ich schwindelfrei. Ich bin ein Krieger aus dem Fjordland. Ich kann klettern wie eine Ziege!«
»Zumindest bist du so haarig wie eine Ziege.« Aigilaos grinste frech. »Wir sehen uns am Hof der Herrin.« Der Kentaur wandte sich ab und erklomm zügig den steilen Pfad zum Rand der Klamm.
Mandred betrachtete die Brücke. In den Märchen vom Feenland mussten die sterblichen Helden meist eine Prüfung bestehen. War das hier seine Prüfung? Hatte das Mannpferd ihn hinters Licht geführt?