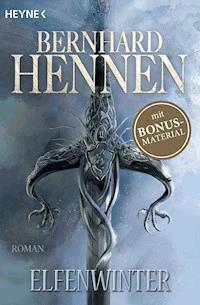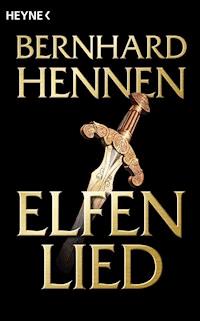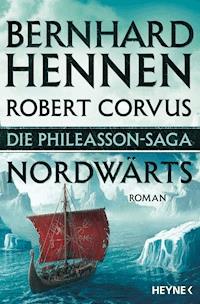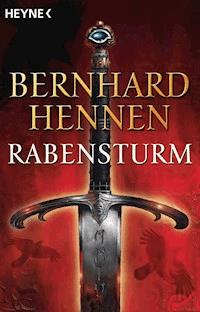5,99 €
5,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das große historische Epos von Bestsellerautor Bernhard Hennen
Mailand 1162: Nach fast einjähriger Belagerung erobern die Kreuzritter Kaiser Friedrichs I. die Stadt und erbeuten einen der kostbarsten Schätze der Christenheit: die Gebeine der Weisen aus dem Morgenland. Sie sollen Köln zu einem mächtigen Pilgerort machen. Erzbischof Rainald von Dassel wähnt sich am Ziel seiner Wünsche, da macht er eine ungeheuerliche Entdeckung. In einer dunklen Nacht werden vier Ritter ausgesandt, um einem Geheimnis nachzuspüren, das den Lauf der Welt für immer verändern könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 758
Veröffentlichungsjahr: 2010
4,5 (30 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Inschrift
PROLOG
XANTEN AM NIEDERRHEIN, DER ZWEITE JANUAR 1189
ROTHER
Kapitel 1
Copyright
DAS BUCH
Mailand im Jahr 1162. Endlich ist es soweit - nach scheinbar endloser Belagerung fällt die Hauptstadt der Lombardei in die Hände Friedrich Barbarossas. Und mit ihr auch der wertvollste Schatz der Christenheit: die Gebeine der Heiligen Drei Könige. Rainald von Dassel, Erzbischof von Köln und rechte Hand des Kaisers, wähnt sich am Ziel seiner Wünsche: Die heiligen Überreste der Weisen aus dem Morgenland sollen im Kölner Dom ihre letzte Ruhestätte finden. Zahllose Gläubige aus aller Herren Länder würden in die Stadt am Rhein kommen und sie zur bedeutendsten Pilgerstätte des Abendlandes machen. Doch dann entdeckt Rainald ein ungeheuerliches Geheimnis, das all seine Pläne zunichte zu machen droht: Bei einem der Könige handelt es sich um eine Fälschung! Der mächtige Erzbischof ist jedoch fest entschlossen, alle drei Könige nach Köln zu bringen und so werden in einer dunklen Nacht vier Ritter aus dem Gefolge Barbarossas ausgesandt, um den dritten König zu finden. Eine abenteuerliche Reise beginnt und führt sie über Konstantinopel bis ins heilige Land. Auf ihrem Weg begegnen sie geheimnisvollen Frauen, weisen Mönchen und tödlichen Gefahren, denn nicht nur Rainald von Dassel, sondern auch der Papst ist hinter der kostbaren Reliquie her. Denn wer sie findet, kann den Lauf der Welt für immer verändern …
DER AUTOR
Bernhard Hennen, 1966 geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Vorderasiatische Altertumskunde. Als Journalist bereiste er den Orient und Mittelamerika, bevor er sich ganz dem Schreiben phantastischer und historischer Romane widmete. Mit seinen Elfen-Romanen stürmte er alle Bestsellerlisten. Der Autor lebt mit seiner Familie in Krefeld.
Der Religion ist nur das Heilige wahr, der Philosophie nur das Wahre heilig.
Ludwig Feuerbach (1804-1872)
PROLOG
Das Richtschwert funkelte in der Frühlingssonne. Alles hielt den Atem an. Sie warteten auf ihn. Eine flüchtige Handbewegung, ein Nicken, würde über Leben oder Tod entscheiden. Der alte König genoss diesen Augenblick. Sein eigenes Leben würde nicht mehr lange währen. Ein paar Tage vielleicht noch … Er konnte spüren, wie nah der Tod ihm war. Und keine Macht der Welt vermochte ihn abzuwenden.
Der Alte nickte dem Henker zu. In blitzendem Bogen fuhr die Klinge nieder. Der Hieb war mit solcher Kraft geführt, dass der Hals glatt durchtrennt wurde und das Schwert knirschend auf den Marmorboden der Terrasse traf. Blut sprudelte über das blendende Weiß der Platten. Der König tat einen tiefen Seufzer. Gewöhnlich fühlte er sich belebt, wenn er einer Hinrichtung zusah. Doch diesmal war es anders … Seine Hände krampften sich um die Lehnen des Thronsessels.
»Bring mir den Kopf!«, befahl er mit müder Stimme. In den letzten Jahren war sein Augenlicht schwächer geworden, und er musste ganz sicher wissen, dass man den Richtigen getötet hatte. Er blickte zu seiner Schwester Salome, die der Hinrichtung ungerührt zugesehen hatte. Sie hatte ihn auf die Spur der Verschwörer gebracht. Doch nicht einmal ihr mochte er noch trauen! Er wusste, dass sein Thron von Verrätern und Aasgeiern umringt war, die es nicht abwarten konnten, dass er endlich den letzten Atemzug tat.
Der Henker hatte den Kopf bei den dichten, schwarzgelockten Haaren gepackt und trug ihn zu ihm hinüber. Ein treuer Mann, dieser Gallier mit den Haaren aus Gold. Einst hatte sein Henker in der Leibgarde Kleopatras gedient. Nach dem Tod der Herrscherin am Nil hatte Octavian ihm den Gallier und dessen vierhundert Kameraden als Lohn für treue Dienste geschenkt.
Der Alte lächelte bei seinen Gedanken an die Vergangenheit und blickte in die dunklen Augen des Toten. Warmes Blut tropfte aus dem Halsstumpf auf seinen Schoß. Der König tastete über die unrasierten Wangen. Die Haut des Toten war wärmer als seine gichtkrummen Finger. »Und ich hatte dich für den Klügsten aus meiner Brut gehalten, Antipater, mein Sohn.« Er lächelte bitter und dachte an den kleinen Jungen, der vor so langen Jahren auf seinen Schoß gekrochen war, um ihn frech am Bart zu zupfen. »Du Narr! Du wusstest doch, dass ich dir den Thron überlassen würde! Hättest du nicht die paar Tage noch warten können … Meine Wunderheiler haben dir doch sicherlich verraten, wie es um mich steht.« Der Alte machte eine ärgerliche Geste. »Weg mit dem Aas!« Es war nicht das erste Mal, dass der König der Hinrichtung eines seiner Söhne beigewohnt hatte. Doch diesmal empfand er keine Befriedigung. Zu nah war sein eigener Tod.
Er blickte über den Palastgarten unterhalb der Terrasse. Er war immer gern hier in Jericho gewesen. Dafür, dass der Frühling gerade erst begonnen hatte, war es bereits angenehm warm.
Der Alte presste sich die Rechte auf den Leib. Die Schmerzen waren zurückgekehrt. Es war, als hause eine Ratte in seinem Gedärm, die ihm bei lebendigem Leib die Eingeweide auffraß.
Salome stand auf und trat an seine Seite. »Kann ich etwas für dich tun, Bruder? Dir einen …«
»Setz dich«, fauchte er ungehalten. Diese Kriecherei widerte ihn so an! Sie warteten doch alle nur darauf, dass es endlich vorbei war! Geier! Sie sollten sich vorsehen! Ein Wort von ihm, und sie alle lägen vor ihm im Grab.
Stille! Sie ahnten wohl seine Gedanken. Recht so! Elende Brut. Ein Leben lang hatte er für dieses Königreich gekämpft. Es mit List und seinem eigenen Blute erschaffen und verteidigt. Und diesen Geiern würde es einfach in den Schoß fallen. Was würden sie damit anfangen? Was würde von seinem Lebenswerk in siebzig Jahren noch bestehen?
Der alte König sah zum strahlend blauen Himmel hinauf. Irgendwo in den Gärten jenseits der Terrasse erklang helles Frauenlachen. Sie hatten keinen Respekt mehr vor ihm. Nicht einmal in seinem eigenen Palast. Zu lachen, während er sich vor Qualen wand!! Und nicht nur hier lachten sie. Sein Siechtum wurde überall mit Freuden begrüßt. Er wusste das! Wütend ballte er die Fäuste und sah im Geiste, wie man in ganz Judäa feiern würde, wenn er endlich verreckt sein würde! Den edomitischen Sklaven Roms nannten sie ihn … Aber noch war dieser Sklave König! Und alle, die seinen Tod so sehr herbeisehnten, sollten noch einmal seine Macht zu spüren bekommen. Hatte er ihnen nicht den Tempel in Jerusalem geschenkt und den Hafen Caesarea? Hatte er nicht von seinem Golde Getreide in Ägypten gekauft und unter den Bedürftigen verschenken lassen, als Hungersnot herrschte? Hatte er nicht in schlechten Zeiten die Last der Abgaben gesenkt und das gierige Rom ferngehalten? Und hatten sie es ihm gedankt? Nein! Einen König wie ihn hatten sie nicht verdient.
Ein neuerlicher Krampf peinigte ihn. Verfluchter Schmerz! Nur Opium vermochte ihn zu lindern. Aber das wagte er nicht zu nehmen! Er musste bei klarem Verstand bleiben. Wieder überkamen ihn Zorn und Bitternis. Seine Güte hatten sie ihm mit Missgunst und Aufständen vergolten, die Judäer, Galiläer und Samariter. Nun sollten sie zu spüren bekommen, was es hieß, einen ungnädigen König zu haben.
»Dumnorix!«
»Ja, Herr!« Der Kommandant seiner gallischen Leibwache trat vor sein Lager. »Ich wünsche, dass aus jedem Dorf, nein, aus jeder Sippe in Judäa jemand verhaftet wird. Männer, Frauen, Kinder, wer immer euch als Erstes begegnet, wenn ihr ein Haus betretet, den nehmt ihr mit. Schafft sie alle hierher nach Jericho in das Hippodrom, und postiert auf den Besucherrängen Bogenschützen, auf dass keiner davonläuft.«
Der Offizier nickte knapp und verließ dann eiligen Schrittes die Terrasse. Gute Gallier! Sie dienten allein dem Gold. Bei ihnen konnte er sich ganz sicher sein, dass seine Befehle ausgeführt wurden.
Der König musterte die Gesichter seiner Frauen und Kinder, die um ihn herumstanden. Eine große Familie hatte er … Groß genug, um jederzeit auf einige von ihnen verzichten zu können. Sie wussten das! Alle wichen sie seinem Blick aus. Ihnen war klar, was diese Verhaftungen für seine Nachfolger bedeuten mochten. Es könnte einen neuen Aufstand geben. Vielleicht schritt auch der verdammte Augustus ein und nahm dies Unrecht zum Anlass, das Königreich endgültig unter römische Herrschaft zu stellen. Aber was scherte ihn das, wenn er im Grab lag. Sollten doch die Römer herrschen! Dann würden die Völker Israels ihm schon sehr bald nachtrauern. Die Römer würden ihnen keinen Tempel bauen. Und das bisschen Blut, das er vergossen hatte … Wenn sie die Römer so reizten wie ihn, dann würden wahre Ströme von Blut fließen.
»Bitte, Bruder«, flüsterte Salome. »Sei gnädig. Ruf die Gallier zurück. Beende deine Herrschaft mit einem Unrecht, und all dein Ruhm wird verblassen!«
Sie hat mehr Mut als meine verdammten Söhne. Ob sie wohl die Herrschaft an sich reißen würde? Hatte sie vielleicht falsches Zeugnis über Antipater abgelegt, damit sein ältester Sohn aus dem Weg war? »Noch bin ich der Herrscher!«, fuhr er sie an.
Wieder ertönte weit entfernt im Garten helles Gelächter. Seine Gallier sollten diese Weiber greifen und ihnen die Zungen herausreißen! Kein Respekt! Er rang mit dem Tod, und ganz Judäa frohlockte! Aber ihr Lachen würde ihnen noch vergehen. Er war der König! Und es lag in seiner Macht, sein Volk lachen oder weinen zu lassen! Und das sollten sie spüren! »An dem Tag, an dem ich sterbe, soll in jedem Haus in diesem Land geweint werden, so wie es sich gehört, wenn ein König stirbt! Deshalb sollen noch in der Stunde meines Todes alle hingerichtet werden, die ins Hippodrom geschafft wurden!« Er klatschte in die Hände. »Und nun macht euch davon, oder ich lasse auch euch in das Hippodrom schicken und vererbe mein Königreich dem Augustus! Hinweg mit euch allen!«
Endlich allein, genoss er den Anblick des Gartens. Überall blühten nun Blumen. Alles wuchs und gedieh. Nur er würde vergehen … Doch wenigstens sein Name würde bleiben. Niemals würde man Herodes, den König von Judäa, vergessen!
Dies alles geschah - genau genommen - vier Jahre, bevor der Stern über Bethlehem leuchtete … Herodes war vor allem der Mörder seiner eigenen Kinder. Die Bluttat, die ihm das Matthäus-Evangelium andichtete, hat er nicht begangen. Doch sind nicht jene ketzerische Narren, welche die Jahre an den Fingern abzählen und dann die Köpfe schütteln? Was zählt schon Genauigkeit, wenn es gilt, eine Geschichte zu erzählen, die den Lauf der Welt verändern soll. Wird die Wahrheit nur konsequent unterdrückt, so werden sich Lügen zur Wahrheit erheben. So dachte auch ein anderer Fürst zwölfhundert Jahre später …
XANTEN AM NIEDERRHEIN, DER ZWEITE JANUAR 1189
»… und als zur Mitternacht kam angeritten, der Teufel aus dem glüh’nden Höllenreich, da hat man sie vom Galgen abgeschnitten und warf die Schurken in den Mühlenteich.«
Mit einem dramatischen Akkord beendete Hartmann die Ballade und griff nach seinem Humpen. Das Bier war dünn und bitter, aber dafür kostete es ihn nichts. Ein Mittagsmahl für ein paar Lieder, das war stets ein gutes Geschäft.
Zufrieden betrachtete der junge Ritter seine Zuhörer: Handwerker und ein paar Bauern, die an diesem grauen Wintertag zum Zechen in die kleine Stadt gekommen waren. Kaum war das Lied verklungen, tuschelten sie miteinander und erzählten sich von Kälbern mit zwei Köpfen, unheimlichen Spuren im Schnee oder dem Hexenspuk an einem einsamen Wegkreuz auf den Feldern. So war es stets, wenn er ein Lied vom Teufel sang.
Mit dem letzten Stück Brot wischte Hartmann das Bratenfett aus seiner Holzschüssel und schob genüsslich kauend seine Laute in die lederne Hülle. Wenn er sich beeilte, würde er noch vor Einbruch der Nacht bis zum nächsten Dorf kommen. Einen ganzen Nachmittag in einer Schenke zu vertrödeln, konnte er sich nicht leisten. Er hatte sich geschworen, bis zum Dreikönigsfest in Cöln zu sein und dort das Kreuz zu nehmen, um sich alsbald dem Heerzug des Kaisers anzuschließen. An der Seite der edelsten Ritter des Reiches würde er reiten, um das Heilige Jerusalem zu befreien!
»Ihr junges Volk habt gut reden, wenn ihr vom Teufel singt und eure Späße über den Leibhaftigen macht«, ereiferte sich ein kahlköpfiger Bauer. »Aber wenn ihr vor ihm steht, dann rutscht auch euch das Herz in die Hose, und plötzlich seid ihr dann so maulfaul wie ein toter Fisch! Und du«, der Alte sah den jungen Ritter an, »auch du, der du so lang wie ein Baum bist, wirst dir wünschen, ein Mäuschen zu sein, das sich noch im kleinsten Loch verstecken kann, wenn du ihm wahrhaftig begegnest!«
Hartmann nahm seinen Umhang von einem Stuhl, der dicht vor dem offenen Kamin stand. »Wir sind doch hier unter guten Christenmenschen, Alter. Wollen wir hoffen, dass keiner zum Teufel fährt und eines Tages hören muss, ob deine Worte wahr sind.« Der junge Ritter lachte, doch keiner der anderen Gäste fiel in sein Lachen ein.
»Hier muss man nicht bis zur Hölle hinabsteigen, um einem Schergen des Gottseibeiuns zu begegnen«, murmelte der Glatzkopf finster. »Seit den Zeiten des Erzbischofs Rainald von Dassel haust ein Unhold, den die Hölle ausgespien hat, keine zwei Stunden von hier. Wenn du Mumm hast, dann spiel dort einmal auf. Solltest du aber Verstand haben, dann nimm die Straße nach Cöln und sieh zu, dass du deiner Wege kommst.«
Der Wind, der über den Rhein herüberwehte, und die tanzenden Schneeflocken hatten die Wegspur vor dem einsamen Reiter fast ausgelöscht. Seine lange und hagere Gestalt wurde durch die schwere Winterkleidung verborgen. Wie ein Stecken auf einem Pferd sähe er aus, so hatte man ihn oft verhöhnt, seine lange Nase mit einem Rabenschnabel verglichen und das dicke, strähnige Haar mit Rattenschwänzen. Aber mit den Jahren hatte er gelernt, sich zu wehren!
Hartmann sah über die Schulter zu den schwarzen Wolkengebirgen, die von Norden her über das Land krochen, das unter einem eisigen Leichentuch lag. Er hätte in Xanten, in Ad Sanctos bleiben sollen, dachte der junge Ritter reumütig. Bei den Heiligen, dieser Stadtname war ein Omen gewesen! Jetzt umzukehren hieße allerdings, dem Sturm entgegenzureiten. Das Städtchen lag schon mehr als zwei Meilen hinter ihm. Sollte er es wagen? Oder doch lieber nach dem Gehöft suchen? Weit konnte es ja nicht mehr sein.
Knirschend schoben sich Eisplatten auf dem Fluss übereinander. Seine Stute schnaubte unruhig. Er streichelte sie zwischen den Ohren. »Ruhig, Esseilte. Wir werden schon einen hübschen, warmen Stall für dich finden.«
Mit leichtem Schenkeldruck trieb er das Pferd voran. Es gab kein Zurück! Es blieb ihm nur noch wenig Zeit, das Ziel seiner Pilgerfahrt zu erreichen. In vier Tagen schon war das Dreikönigsfest, und er hatte noch fast hundert Meilen vor sich.
Hartmann nahm den Zügel in die Linke und rieb die steifgefrorene Rechte über seine wollene Hose, bis mit stechendem Schmerz Wärme und Leben in seine Finger zurückkehrten. Schon vor dem Weihnachtsfest hätte er seine Reise beginnen sollen, und zwar zu Fuß, wie es sich für einen ordentlichen Pilger gehörte! Als ahne sie seine Gedanken, schnaubte die Stute.
»Dir steht es nicht zu, mich zu maßregeln«, brummte der junge Ritter ärgerlich. »Wenn ich Esel mit mir selbst ins Gericht gehe, dann heißt das noch lange nicht, dass ich es den Pferden zugestehe.«
Esseilte warf den Kopf in den Nacken und wieherte. Hartmann zog die Zügel straff und hielt inne. Es roch nach Rauch. Der Wind war schärfer geworden und schnitt wie mit Messern durch seinen Umhang. Das Schneetreiben nahm ihm fast jede Sicht. Undeutlich erkannte er einen bewaldeten Hügel, der abseits des Weges direkt am Ufer des Rheins lag.
Hartmann verließ den Weg und blickte noch einmal zurück. Finsternis hatte den Horizont verschlungen. Bald würde der Sturm sie erreicht haben. Mühsam kämpfte sich die Stute den Hang hinauf. Über ihnen heulte der Wind in den Baumwipfeln.
Vage konnte er die Umrisse eines Turms erkennen. Auf der Kuppe des Hügels lag ein großes, befestigtes Gehöft. Doch das hohe Tor war versperrt.
Hartmann sprang aus dem Sattel, zog seinen Dolch und hämmerte mit dem Knauf gegen die verschlossene Mannpforte. »He!« Seine Stimme ging im Getöse des Sturms fast unter. »Hört mich denn keiner? Ich bin ein Reisender und fordere das Gastrecht!«
Er presste die Wange gegen das gefrorene Holz und spähte durch den Spalt zwischen den beiden Flügeltüren. Sollte es keine Torwache geben? Esseilte riss ihm die Zügel aus der Hand und wieherte.
Eine Windböe fuhr heulend durch die Dachsparren des Turms. Hartmann fluchte. Hätte er nur ein Horn! In diesem Sturm würde man ihn niemals hören. Wieder begann er mit dem Knauf der Waffe gegen das Tor zu hämmern.
Als seine Faust von den Schlägen schon ganz taub geworden war, gab er endlich auf. Kalter Schweiß rann ihm von der Stirn. Es musste einen anderen Weg geben! Er spähte durch den Spalt zwischen den beiden großen Torflügeln. Wenn sie nicht mit einem zu schweren Balken versperrt waren, könnte er den Riegel vielleicht mit seinem Schwert hochdrücken.
Die Stute schnaubte unruhig und scharrte mit den Hufen im Schnee. Hatte sich am Fenster des Turms etwas bewegt? Hartmann kniff die Augen zusammen und spähte hinauf. Dort war nichts zu sehen.
»Was für ein ungastliches Haus!«, fluchte er und zog sein Schwert. Konnte es denn sein, dass so früh am Abend schon alle schliefen? Die Sonne war doch kaum hinter dem Horizont verschwunden!
Gerade wollte er sein Schwert durch den Spalt zwischen den Torflügeln schieben, als im Hof ein blasses Licht erschien. Ein Knecht mit einer Laterne hastete zum Tor. Die Mannpforte öffnete sich.
Hartmann trat einen Schritt zurück. Sein Gegenüber hielt die Laterne so hoch, dass ihr Licht ihn blendete.
»Wer seid Ihr?«, fragte der Pförtner barsch.
»Ein Ritter und Dichter, Hartmann von Ouwe geheißen. Ich bitte um das Gastrecht und um einen Platz am Feuer für diese Nacht. Morgen schon werde ich weiterreisen und …« Nun, wo sich seine Augen an das Licht gewöhnt hatten, konnte Hartmann sein Gegenüber erkennen. Es war ein kleiner Mann mit faltigem Gesicht und tiefliegenden blassen Augen. Er schien ängstlich, so als fürchte er, einem Halsabschneider das Tor geöffnet zu haben.
»Bittet mich nicht, Euch diese Schwelle überschreiten zu lassen, Herr. Dies Haus ist verflucht, und alle, die …« Er schüttelte den Kopf. »Versucht es eine Meile flussaufwärts. Dort wird man Euch …«
»Bist du toll? Hörst du denn den Sturm nicht? Außerdem ist es finster. Ich würde nicht einmal den Weg von diesem Hügel hinunterfinden!«
»Gero!« Eine tiefe Stimme übertönte den heulenden Wind.
Der Knecht zuckte zusammen und drehte sich um.
Die Mannpforte schwang nun ganz auf. Hartmann musste sich ducken, um die niedrige Tür zu durchschreiten.
»Ich habe Euch gewarnt, Herr«, flüsterte der Knecht und blickte dabei ängstlich über die Schulter. »Viel gibt’s hier nicht zu beißen. Wir hatten eine schlechte Ernte dieses Jahr, und unser Herr …« Gero schüttelte den Kopf. »Das ist einer, den keiner freiwillig besuchen kommt.«
»Wie meinst du das?«
»Das werdet Ihr schon sehen, Herr.« Der Knecht griff nach Esseiltes Zügeln.
»Wie heißt dein Herr?«, fragte Hartmann ungeduldig.
»Ingerimm von Waldeck. Aber keiner hier glaubt, dass dies sein richtiger Name ist. Er hat … Aber was zerreiß ich mir das Maul. Geht nur in die Halle! Ihr habt ja Augen zu sehen.«
Als Gero keine Anstalten machte, noch irgendetwas zu sagen, nahm der junge Ritter seine Decke und die in Leder eingeschlagene Laute vom Sattel. Wie ein Blinder tastete er sich in dem immer stärker werdenden Schneetreiben über den Hof, bis er die Tür zum Langhaus fand. Er betrat eine winzige Kammer, in der eine flackernde Kerze brannte. Ein Vorhang aus dichter Wolle trennte die Türkammer vom Hauptraum. Hartmann klopfte sich den Schnee von den Kleidern und achtete darauf, nicht in den Fettnapf zu treten, der dicht bei der Schwelle stand. Entlang der Wände waren bis zur niedrigen Decke hinauf Holzscheite gestapelt. Der Geruch des abgelagerten Holzes mischte sich mit dem Rauch, der durch den Vorhang drang. Er hörte Stimmenraunen im Hauptraum.
Hartmann tastete nach dem Schabeisen und kratzte sich den festgebackenen Schnee von den Stiefeln. Er war ein wenig unruhig. Was hatte der Pförtner gemeint … Was erwartete ihn hier? Als er sich aufrichtete, stieß er mit der Laute gegen einen der Holzstapel. Ein dissonanter Ton drang durch das Lederfutter. Hartmann lächelte. Von solchem Geschwätz würde er sich nicht ins Bockshorn jagen lassen! Entschlossen zog er den Vorhang zur Seite und trat in den Hauptraum.
Eine junge Frau in einem grünen Kleid mit perlenbesticktem Gürtel kam ihm entgegen. »Willkommen auf Burg Waldeck, Fremder.« Wie zufällig ließ sie bei der Begrüßung ihren Umhang aus verfilztem Wolfsfell halb von den Schultern gleiten.
»Ich danke für die Gnade, in einer solchen Nacht ein Dach über dem Kopf haben zu dürfen.« Hartmann deutete eine Verbeugung an und musterte die Frau dabei aus den Augenwinkeln. Sie war nicht im landläufigen Sinne hübsch, doch hatte sie etwas an sich, das einem Mann auf den ersten Blick die Glut zwischen die Schenkel trieb. Sie trug das lange rote Haar offen. Ihre Augen waren grün und von buschigen Brauen überschattet. Die kleine Nase zierten halb verblasste Sommersprossen, und ihr Mund … Der junge Ritter räusperte sich nervös. »Ich danke dem Schicksal, das mich in das Haus einer solch gnädigen Herrin geführt hat.« Er setzte sein charmantestes Lächeln auf. »In Euren Augen lebt selbst in der kältesten Winternacht die Erinnerung an das wunderbare Grün der Frühlingswiesen weiter.«
Sie erwiderte sein Lächeln. »Ihr sprecht wie ein Dichter, doch ich bin keine Herrin. Ich bin lediglich die Kebse des Herrn von Waldeck, und jeder hier im Saale redet schlecht von mir, weil ich meinen Mann verlassen habe, als der Herr mir befahl, hierherzukommen, um für ihn die Beine breit zu machen.« Sie warf einen verächtlichen Blick zu den übrigen Bediensteten, die an der langen Tafel des Saals saßen und mit unverhohlener Neugier zu Hartmann herüberstarrten.
»Und Euer Herr?«, fragte der Ritter verwirrt.
»Er ist oben in seiner Turmkammer.« Sie deutete auf eine niedrige Tür nicht weit vom Ende der Tafel. »Die meiste Zeit schließt er sich dort oben ein, und wir alle sind ihm dankbar dafür. Er … Aber Ihr müsst ja völlig durchgefroren sein. Kommt zum Feuer! Nehmt im Stuhl des Herrn Platz. Er hat befohlen, Euch gut zu behandeln.«
Der Ritter nickte verlegen. Er hatte gehofft, sie hätte ihn um seinetwillen so freundlich aufgenommen.
»Man wird heute Abend vom Besten auftragen, was dieses Gut zu bieten hat, aber erhofft Euch nicht zu viel, Herr …«
Hartmann ließ sich zu dem hohen Lehnstuhl vor dem Kamin führen. Sein Blick wanderte durch den Saal, der von einem langen Tisch, flankiert von Holzbänken, beherrscht wurde. Zwei Frauen kneteten Teig, eine dritte rupfte ein Huhn. Neben ihr hockte ein Mann und setzte beschädigtes Zaumzeug instand. Ein anderer war mit einer Holzarbeit beschäftigt. Niemand außer der Rothaarigen hatte das Wort an ihn gerichtet, als er eingetreten war. Die Diener wagten nicht einmal, zu ihm aufzublicken. So kühl war er schon lange nicht mehr empfangen worden.
Der große Kamin am Ende der Halle zog schlecht. Ein Teil des Rauchs trieb in den Saal und sammelte sich unter den schwarzen Deckenbalken. Entlang der Wände reihten sich die Schlafstellen der Bediensteten. Sie sahen ein wenig aus wie Beichtstühle, nur dass sie nicht mit prächtigen Schnitzereien geschmückt waren. Dünne Holzwände trennten sie voneinander, und an den Vorderseiten hingen schwere Vorhänge herab.
Die Hitze des Feuers schmolz das Eis in Hartmanns Haar. Wasser tropfte auf sein Gesicht. Die junge Frau war neben ihm niedergekniet, rieb seine Schuhe mit Fett ein und streifte dann die Lederbänder um seine Wickelgamaschen aus Schafsfell ab. Hartmann war ein wenig verlegen. Seine Waden waren dürr wie Ziegenbeine, und wenn er erst einmal seinen schweren Umhang ablegte, dann würde man auch sehen, dass er nicht halb so stattlich war, wie er auf den ersten Blick wirken mochte. Er zögerte es ein wenig hinaus. Nestelte an der schweren Bronzefibel, die den Umhang schloss, herum. Er atmete noch einmal tief ein, dann stellte er sich dem Unausweichlichen. Mit lang einstudierter, galanter Geste warf er den Umhang ab. Er breitete ihn über die Stuhllehne zum Trocknen. Keine verstohlenen Blicke! Niemand belächelte seine Gestalt! Erleichtert wischte er sich das nasse lange Haar aus der Stirn und nahm im Lehnstuhl Platz. Es tat gut, vor dem Feuer zu sitzen und von kräftigen Frauenhänden die Waden massiert zu bekommen, bis die Wärme auch dorthin zurückkehrte. »Verzeiht, doch wäre es zu kühn, nach Eurem Namen zu fragen, Herrin?«
»Ich heiße Gudrun.« Sie lächelte kokett, bevor sie wieder den Blick senkte und ihm nun auch seine feuchten Schuhe auszog.
Hartmann sah in das Feuer. Das Schweigen in der Halle war bedrückend. Gudrun … Er dachte an die Gudrun-Saga. An das traurige Los der Heldin. Der Name passte zu seiner Gastgeberin!
Dicht beim Feuer saßen fünf Kinder und spielten stumm mit Puppen aus geflochtenem Stroh. Nicht einmal sie wagten es, zu ihm herüberzusehen. Was, zum Henker, mochte das für ein Hausherr sein, der unter seinem Gesinde solche Angst verbreitete?
Der junge Ritter öffnete die Lederhülle seiner Laute und strich spielerisch über die Saiten des Instruments. Mit kundiger Hand entriss er es dem stummen Schlaf. Und die düstere Halle schien wie von einem Zauber berührt.
Eines der Mädchen am Kamin blickte von seiner Puppe auf. Es hatte flachsfarbenes Haar. Hartmann lächelte ihm zu.
»Seid Ihr ein Spielmann, Herr?«, fragte Gudrun leise.
»Ich beherrsche die Kunst des Lautenspiels nicht gut genug, um mich einen fahrenden Sänger zu nennen.« Er winkte der Kleinen. Zögernd stand sie auf. Hartmann wusste, dass es am leichtesten war, Kinderherzen zu gewinnen, und wenn die Kinder ihm erst einmal zuhörten, dann würden auch die anderen bald dichter ans Feuer rücken. Wieder glitten seine Finger über die Saiten. Nun lächelte auch das Mädchen. Mit großen Augen musterte sie das Instrument.
»Hol deine Kameraden, kleine Prinzessin, und wir beraten, was für eine Geschichte ich euch vortrage.« Sie sah ihn mit ihren großen braunen Augen an und nickte dann schüchtern.
»Habt Ihr Kinder?«, fragte Gudrun. Sie saß vor ihm, hatte die Beine angezogen und mit den Armen umschlungen. Ihr Kinn stützte sie auf die Knie. Im Licht des Feuers schimmerten ihre Haare wie dunkles Kupfer.
Hartmann schüttelte den Kopf. »Ich habe keine Kinder. Aber sie sind stets meine aufmerksamsten Zuhörer. Die Geschichtenerzähler und die Kinder, sie sind durch ein unsichtbares Band miteinander verbunden.«
»So wie die Dichter und die Frauen?«
Der junge Ritter lachte leise. »Nein, Gudrun, dies ist ein anderes Band.« Er blickte tief in ihre grünen Augen. »Das weißt du, nicht wahr?«
Statt einer Antwort lächelte sie auf eine Weise, die Hartmann das Blut in die Wangen schießen ließ.
Jemand zupfte sacht an seinem Ärmel. Das kleine Mädchen war zurückgekommen und hatte seine Spielgefährten mitgebracht. Erwartungsvoll blickten fünf Augenpaare zu ihm auf.
»Nun, was für eine Geschichte wollt ihr hören?«
Ein Junge mit verkrusteter Nase schob das Mädchen mit dem Flachshaar vor. Es schaute verlegen zu Boden. »Von einer Prinzessin«, flüsterte es leise. Ein dunkelhaariges Mädchen nickte begeistert, während der Junge, der seine Kameradin vorgeschoben hatte, verzweifelt mit den Augen rollte.
»Und was will der junge Mann hören?«, fragte Hartmann freundlich.
»Von Rittern … und einer Schlacht …«, stotterte der Junge verlegen.
»Und von Drachen oder besser einem Ungeheuer und dem wilden Meer!«, mischte sich ein anderer ein, der Mut gefasst hatte zu sprechen.
Hartmann strich sich nachdenklich über das Kinn. »Das ist wahrlich keine leichte Aufgabe, die ihr mir hier stellt.«
»Belästigt unseren Gast nicht mit euren unmöglichen Wünschen«, warf Gudrun ein. »Ihr solltet euch zum …«
»Nicht«, unterbrach der Ritter die Kebse. »Ihr könnt sie nicht dafür tadeln, dass sie getan haben, wozu ich sie aufgefordert habe. Ich fürchte, ich muss nun die Suppe auslöffeln, die ich mir in meinem Hochmut eingebrockt habe.« Er lächelte und nickte den Kindern zu. So überraschend und ungewöhnlich waren ihre Wünsche nicht. Aber er würde sich hüten, den Zauber des Augenblicks zu zerstören, indem er dies Geheimnis mit ihnen teilte. »Kommt, setzt euch zu meinen Füßen.« Hartmann strich über die Saiten der Laute und entlockte ihr ein paar wohlklingende Akkorde.
»Ich werde euch eine Geschichte erzählen, die mir vor einigen Jahren ein Kaufmann aus dem hohen Norden mitgebracht hat. Er war ein Mann mit einem wilden schwarzen Bart und funkelnden Augen. Seine Reisen hatten ihn einmal auf ein Meer geführt, auf dem Berge aus Schnee und Eis schwammen, und wo es Fische gab, die größer als jedes Schiff waren. Dort hat er in einer Nacht, in der unheimliche Feenfeuer unter dem Himmelszelt tanzten, jene Geschichte gehört, die ich euch erzählen möchte. Es ist die Geschichte der Prinzessin Kudrun, die entführt wurde und die man zwang, niederste Dienste zu tun, bis ein Heer stolzer Ritter auszog, sie zu befreien.« Gudruns Augen leuchteten, während einer der Jungen ein langes Gesicht zog. »Ein richtiger Drache kommt in der Geschichte zwar nicht vor.« Hartmann schmunzelte. »Aber ich denke, ich kann es einrichten, dass den Helden auf ihrer Fahrt nach Norwegen noch eine gefährliche Seeschlange begegnet.«
Die Kinder tuschelten aufgeregt miteinander und stritten leise um den besten Platz zu seinen Füßen. »Ich wette, es ist ein Prinz unter den Helden«, raunte das Mädchen mit dem Flachshaar.
»Und ich wette, den wird die Seeschlange fressen. Prinzen sind langweilig, sie …« Ein grober Stoß mit dem Ellenbogen brachte den Jungen mit der Rotznase zum Verstummen. Dann sahen sie alle erwartungsvoll zu ihm auf. Und in ihrer aller Augen lag jener Glanz, der der kostbarste Lohn der Geschichtenerzähler ist, vorausgesetzt man ist nicht allzu hungrig.
Hartmann wollte gerade beginnen, als Türangeln ächzten und die Stimmung im Saal umschlug. Die Kinder duckten sich ängstlich. Auch Gudrun wirkte angespannt.
In der Tür, die zum Turm hinaufführte, war eine schattenhafte Gestalt erschienen. Ein Mann, mittelgroß, angetan mit einem Kapuzenmantel aus dunkelgrüner Wolle, dunkler Tunika und zerschlissenen braunen Hosen. Sein Gesicht war hinter einer grob gearbeiteten Maske aus speckigem Leder verborgen, mit ovalen Öffnungen für die Augen und einem runden Loch für den Mund. Das also war der Gutsherr, den der kahlköpfige Bauer in Ad Sanctos für einen Abgesandten Lucifers hielt.
Die Kinder zu Hartmanns Füßen rückten ein wenig dichter an ihn heran. Mit schwerem Schritt trat der Vermummte in den Saal. Jetzt bemerkte der Ritter, dass der unheimliche Gastgeber sogar Handschuhe trug. Kein Zoll seines Fleisches war unverhüllt. Ganz wie bei einem Aussätzigen.
»Bringt mir einen Stuhl ans Feuer«, befahl dieselbe dunkle Stimme, die der Ritter schon im Hof gehört hatte.
Eilig stand einer der Knechte auf und zog seinem Herrn einen schweren Lehnstuhl zum Kamin. Auch Hartmann sprang auf. Er wusste sehr wohl, auf wessen Stuhl er gesessen hatte. Doch der Vermummte bedeutete ihm mit einer Geste, wieder Platz zu nehmen. »Macht weiter, was immer Ihr gerade begonnen habt, doch rate ich Euch, mich nicht zu langweilen. Ich dulde keine Taugenichtse in meinem Haus.«
Hartmann räusperte sich. Warum nur hatte er sich dazu hinreißen lassen, ausgerechnet die Geschichte der Kudrun auszuwählen? Der Hausherr würde seine Gründe gewiss durchschauen. Wenn er wenigstens sein Gesicht sehen könnte, um in seinem Mienenspiel zu lesen! Ingerimm von Waldeck hatte eine angenehme Stimme, doch seine Erscheinung jagte einem mehr als einen Schauer über den Rücken.
Hartmann strich über die Laute, und der vertraute Klang des Instruments machte ihm Mut. »In den alten Geschichten heißt es, Kudrun sei die schönste Frau gewesen, die je unter Gottes Sonne lebte. Ihre Haut war wie Milch, ihr Haar hatte die Farbe von …«
Das Feuer im Kamin war längst herabgebrannt, als Hartmann die Laute zur Seite legte und seine müden Glieder streckte.
Er war zufrieden mit sich. Es hatte lange gedauert, bis das Gesinde näher an den Kamin gerückt war, um seiner Stimme zu lauschen. Nachdem er die Geschichte der Kudrun zu Ende erzählt hatte, waren Speisen aufgetragen worden. Frisch gebackenes Brot, eine fette Suppe, ja sogar zwei verschrumpelte Apfel aus dem letzten Herbst und ein wenig süßen Honig hatte man ihm gebracht. Zu trinken gab es ein starkes Bier. Diesem bitteren Gebräu war es zu verdanken gewesen, dass Ingerimms Diener es schließlich gewagt hatten, ihm zaghaft Fragen über die Welt jenseits dieses düstren Ritterguts zu stellen. Er hatte vom Reich erzählt, von den Herzögen und Erzbischöfen. Auch von Kaiser Friedrich, dem die Lombarden den Namen Barbarossa gegeben hatten. Bis zum Frühling wollte der Herrscher die tapfersten seiner Ritter um sich scharen und zu einem großen Kriegszug ins Heilige Land aufbrechen. Nichts Geringeres war sein Ziel, als Jerusalem wieder aus der Hand der Heiden zu befreien. Eine Tat, die ihn unbestritten zum ersten Herrscher der Christenheit machen würde!
Zuletzt hatte Hartmann gemeinsam mit dem Gesinde gesungen, bis die Knechte und Mägde sich schließlich zu ihren Schlafnischen zurückzogen. Die Kinder, die schon lange vor dem Kamin eingeschlafen waren, hatten leise gemurrt, als ihre Eltern sie aufhoben und aus ihren Träumen von Jungfern und edlen Recken rissen, um sie mit sich in die nach Stroh und Sommer duftende Dunkelheit zu nehmen.
Gudrun nickte Hartmann zu. Sie war die Letzte, die ging. In ihren Augen spiegelte sich blanke Furcht. Der Ritter hatte das vage Gefühl, dass sie sich auf ein geheimes Zeichen des Alten hin zurückzog. Nur Ingerimm saß ihm noch gegenüber. Von dem Augenblick an, in dem er das Kudrun-Lied angestimmt hatte, war dem Hausherrn kein Wort mehr über die Lippen gekommen.
»Ihr versteht es, Herzen zu fangen, Ritter«, sagte der Hausherr in die düstere Stille hinein. Wie ein Lob klangen seine Worte nicht.
Hartmann rutschte unruhig auf dem Stuhl zurück und starrte Ingerimm an. Nicht einmal die Farbe seiner Augen konnte man hinter der Ledermaske erkennen! Sollte er den Fehdehandschuh aufnehmen, den der Alte ihm hingeworfen hatte? Oder war es klüger, so zu tun, als habe er die kaum verhohlene Anspielung nicht verstanden? »Es freut mich, dass Euch meine bescheidene Kunst gefallen hat«, entgegnete er schließlich.
»Habe ich gesagt, dass sie mir gefallen hat? Kein Richter auf Gottes Erde würde mich verurteilen, wenn ich Euch von meinen Knechten packen ließe, um Euch eigenhändig den Kopf von den Schultern zu hacken.« Ingerimm sprach so gelassen, als unterhielte er sich mit Hartmann über die langweilige Predigt eines Pfaffen. »Meint Ihr, ich hätte nicht gemerkt, wie Ihr meiner Kebse den Hof macht? Ich mag ein Krüppel sein, doch bin ich weder blind noch taub!«
»Herr, Ihr irrt Euch, ich …«, stotterte Hartmann hilflos.
»Glaubt Ihr, ich sei ein Narr, der nicht mehr weiß, was er redet?« Ingerimm richtete sich halb in seinem Stuhl auf, doch seine Stimme klang immer noch ganz ruhig.
»Ich bin doch nur ein Pilger. Wenn ich Euch beleidigt haben sollte, Herr, dann tut …«
»Ein Pilger!« Der Maskierte hatte sich nun vollends aufgerichtet und brach in schallendes Gelächter aus. »Gesindel von Eurem Schlag kenne ich! Haltet mich nicht für dumm! Ich wette, jemand hat Euch erzählt, dass hier auf dem Rittergut ein Unhold haust, und weil es auf Eurem Weg lag, wolltet Ihr die Gelegenheit beim Schopfe packen und Euch dieses Ungeheuer einmal näher ansehen.« Er schnaubte wie ein zorniger Stier und beugte sich vor, so als wolle er Hartmann geradewegs in die Augen starren. Sein Atem stank nach Zwiebeln und säuerlichem Wein.
Hartmann schluckte. Konnte der Kerl etwa in seinen Gedanken lesen?
»Dabei seid Ihr es, der Gottes Heiligkeit lästern wird …« Überraschend ließ sich der Burgherr in seinen Stuhl zurücksinken. »Ihr seid doch auf dem Weg zum Dreikönigsfest in Cöln, oder?«
Hartmann nickte verwirrt.
»Dann seid Ihr auf dem besten Wege, Eure unsterbliche Seele zu besudeln und den Dienern des Antichristen zu huldigen.«
Der Alte war verrückt, daran konnte kein Zweifel bestehen. »Wie meint Ihr das, Herr?« Für einen Augenblick glaubte Hartmann, Ingerimms Augen hinter der Maske spöttisch funkeln zu sehen.
»Wollt Ihr das wirklich wissen, Ritter? Es gibt Weise, die behaupten, am glücklichsten sei der, dem Gott die Gnade schenkt, in seliger Unwissenheit zu leben. Ohne Zweifel gehört Ihr zu diesen Günstlingen des Herrn! Nach Cöln pilgern …« Der Alte lachte bitter. »Und dort das Kreuz nehmen! Ihr erinnert mich an einen jungen Ritter. Auch er war sich seines Glaubens so sicher.«
Hartmann richtete sich auf. »Auch wenn Ihr augenscheinlich nicht in guter Verfassung seid, Herr, kann ich nicht dulden, dass Ihr meine Ehre weiterhin mit solchen Reden beschmutzt. Ich werde Euer Haus verlassen und …«
»Und draußen erfrieren. Setzt Euch! Ihr wart es, der mit meiner Kebse getändelt und damit gegen das Gastrecht verstoßen hat. Und dafür werdet Ihr nun büßen.«
Hartmann spannte sich, bereit, zum Schwert zu greifen. Sein Gegenüber blieb jedoch unbeeindruckt.
»Ihr habt mich einen Lügner gescholten. Ich verurteile Euch hiermit dazu, mir eine Nacht lang zuzuhören. Ihr werdet erfahren, warum ein jeder Dreikönigspilger sich zum Spießgesellen gottloser Halunken macht.«
Hartmann starrte den Alten an. Ihn mit einer Geschichte bestrafen! Er hatte in seinem Leben schon viele Arten von Strafen erduldet, doch solch eine noch nie. Der Vermummte mochte ein Scherge des Teufels sein, ein gottloser Geselle, aber man konnte ihm nicht vorwerfen, langweilig zu sein.
Knirschend zerbrach ein glühendes Holzscheit, und Funken, hell wie Sterne am Winterhimmel, stiegen in den dunklen Schlot empor. »Seid Ihr bereit, Eure Strafe anzunehmen?«, fragte der Alte gefährlich leise.
Hartmann griff nach dem Becher mit dem dunklen Bier, den er neben sich auf den Boden gestellt hatte, und drehte ihn unschlüssig zwischen den Fingern. »Nun?«
Der junge Ritter zwang sich zu einem Lächeln. »Ich füge mich in mein Schicksal.«
Eine Stichflamme schoss aus einem der halb verglühten Holzscheite. Für einen Herzschlag lang konnte Hartmann überdeutlich die Augen hinter der Maske sehen. Kalte, lauernde Augen. Ein Schauder überlief den Spielmann. Hatte er sich am Ende gar auf ein Spiel mit dem Leibhaftigen selbst eingelassen?
Ingerimm atmete schwer. »So sei es! Ich versichere Euch, alles, was man über mich erzählt, ist wahr. Ja, ich bin in die Hölle gefahren und habe den Satan geschaut. Und deshalb trage ich meine Maske. Mein Antlitz ist das Antlitz des Teufels … auf eine gewisse Weise jedenfalls.« Der Hausherr schwieg einen Moment lang und starrte Hartmann an, als wolle er die Wirkung seiner Worte von dessen Gesicht ablesen.
»Wie Ihr vielleicht schon geahnt habt«, fuhr er schließlich fort, »ist es die Geschichte jenes jungen Ritters, an den Ihr mich erinnert. Obwohl … wenn man es genau nimmt, ist es eher die Geschichte von vier Rittern, deren Geschicke das Schicksal untrennbar miteinander verwoben hatte.« Ingerimm räusperte sich leise. Sein Blick war nun auf den Kamin gerichtet, so als läge die Vergangenheit, auf die er sich besinnen wollte, dicht hinter dem Schleier aus roter Glut …
ROTHER
»Es begab sich in jenem Jahr, in dem sich die lombardischen Städte gegen den Kaiser empörten, dass die Gesandten Friedrichs in aller Eile Mailand verließen, weil sie dort um ihr Leben fürchten mussten. Nur einer schaffte es nicht mehr zu entweichen, bevor der Pöbel die Tore besetzte. Es war jener, den die Lombarden später den Henker des Rotbart nennen würden und dem es bestimmt war, als Kanzler des Reiches auch über die Geschicke der italischen Untertanen zu gebieten, Rainald von Dassel, Erzbischof zu Cöln. An jenem Tag jedoch verbarg er sich, das Herz voller Furcht, bei einem der wenigen Getreuen, die dem Kaiser in Mailand noch verblieben waren. Erst am nächsten Morgen vermochte er, gekleidet wie ein Weib, den Häschern an den Stadttoren zu entgehen. Dies war der Tag, an dem im Erzbischof jener unnachgiebige, alles verschlingende Zorn gegen die Mailänder begründet wurde.
Es sollte nicht lange dauern, bis die Lombarden erfahren mussten, was es hieß, einen Günstling unseres Kaisers zum Feinde zu haben. Friedrich zog mit großer Heeresmacht gen Italien. Dort fand er seine Feinde wohlverschanzt, und als der Krieg keine Fortschritte machen wollte, bat er die Fürsten des Reiches, ihm zu Hilfe zu eilen. So rief denn nun der Erzbischof Rainald von Dassel sein Kriegsvolk zu den Waffen. Es war das Jahr des Herrn 1161 … Ein gutes Jahr, das im Moseltal einen starken Wein hervorbringen sollte und in Italien zwei Päpste, die einander spinnefeind waren. Es war zugleich das Jahr, in dem die Geschichte jener vier Ritter begann, von denen einer Euch im Wesen so glich, als wäret ihr beide vom Leibe einer Mutter geboren.«
1
Rother gab seiner Stute die Sporen und preschte den Weg zur Hügelkuppe hinauf. Jeder Schritt nach Süden brachte den Heerzug des Erzbischofs von Cöln weiter dem Frühling entgegen. Die mehr als eine Meile lange Kolonne aus Reitern und Tross war in den Hügeln hinter Rother verschwunden.
Er war jung und verschwendete keinen Gedanken daran, dass er mitten in Feindesland womöglich gerade seinem Tod entgegenritt. Über ihm wölbten sich die Äste weiß blühender Apfelbäume in spitzem Bogen wie die Decke einer Kathedrale, von Gottes eigener Hand gestaltet. Ein Windstoß ließ Blütenblätter gleich tanzenden Schneeflocken durch die Luft wirbeln. Einen Moment lang fröstelte es den Jungen. Zu frisch noch waren die Erinnerungen an die eisigen Alpenpässe, die sie erst vor wenigen Tagen hinter sich gelassen hatten. Wieder klang das Donnern der Lawine in seinen Ohren, die den halben Tross und mit den Maultieren auch drei seiner Kameraden in die Tiefe gerissen hatte. Kaum mehr als eine Woche war seitdem vergangen.
Staunend blickte Rother zu den blühenden Ästen hinauf. Er zupfte einige der Blütenblätter aus der Mähne seiner Stute, zerrieb sie zwischen den Fingern und schnupperte dann an seiner Hand wie ein Jagdhund, der sich vergewissern wollte, seine Fährte nicht verloren zu haben. Es war der Duft des Frühlings! Noch nie hatte er gesehen, dass der Winter so schnell wich. Das verlorene Paradies, das die Bibel beschrieb, konnte nicht prachtvoller gewesen sein als dieses Land mit seinen weiten Feldern, den endlosen Obstgärten und sanften Hügeln, an deren Flanken die Rebstöcke Spalier standen wie ein Heer, das aufmarschiert war, seinen Herrn zu grüßen. Wie konnte so ein wundervolles Land nur des Kaisers aufsässigste Untertanen hervorbringen?
Ob er jemals zu den Rittern gehören würde, die für Friedrich Rotbart kämpften? Obwohl Rother gar nicht der Jüngste und Kleinste unter den Knappen des Heeres war, hatten seine Kameraden ihm den abfälligen Titel Zwergenritter verliehen. Zu dünn und schwächlich hatte auch Wibald, der Waffenmeister seines Vaters, ihn immer gescholten. Doch danach hatte der alte Krieger ihm stets das blonde Haar zerzaust und erklärt, er solle sich nur ein wenig gedulden, wachsen würde er gewiss noch.
Rother hörte hinter sich die Rufe seiner Gefährten. Kurz blickte er über die Schulter. An der Spitze der kleinen Schar ritt der hünenhafte Anno und winkte ihm. Dichtauf folgten Heinrich und Ludwig. Die drei Ritter waren am Morgen vom Erzbischof als Vorhut ausgewählt worden, und Anno hatte es Rother gestattet, mit ihnen zu reiten. Wie eine Glucke ihr Küken, so hüteten ihn die Ritter. Manchmal hatte Rother das Gefühl, in ihrer Gegenwart kaum noch atmen zu können. Trotzig hieb er seiner Stute die Fersen in die Flanken. Man würde ihn ohnehin schon schelten, weil er so weit vorausgeritten war. Was spielte es da für eine Rolle, wenn er noch ein Stück dahinpreschte, um als Erster zu sehen, was auf der anderen Seite des Hügels lag?
Als Anno seinen Hengst vor der Scheune zügelte, hätte er Rother am liebsten am Ohr gepackt und auf den Hof gezerrt, um ihm eine gehörige Tracht Prügel zu versetzen. Anno verfluchte den Tag, an dem er sich vom alten Reuschenberger hatte überreden lassen, dessen Sohn mit auf den Kriegszug nach Italien zu nehmen.
Der große, vierschrötige Ritter streckte sich. Das Gewicht von Waffen und Rüstung war noch ungewohnt. Erst seit sie vor ein paar Tagen lombardischen Boden betreten hatten, ritten die Gefolgsleute des Erzbischofs in voller Rüstung.
Mürrisch schwang Anno sich aus dem Sattel, als er bemerkte, warum Rother wie angewurzelt bei der Scheune stehen geblieben war. An einen Pfahl gefesselt hing ein Mann, halb in die Knie gesunken. Ein Dutzend Pfeile ragten aus seiner Brust. Das Blut auf seinen Kleidern war noch nicht ganz eingetrocknet. Vor ein paar Stunden hatte der Kerl noch gelebt.
Rother begann vor Ekel und Entsetzen zu würgen. Hinter dem Jungen erschienen die Schatten seiner beiden Kameraden im Scheunentor. Der bärtige, sonst so zurückhaltende Heinrich legte ihm den Arm um die Schulter und brachte den Knappen fort.
»Haben wir also das Ziel unserer Reise schon erreicht …«, sagte Ludwig leise. Er war neben den Toten getreten und berührte ihn sanft mit den Fingern.
Für Anno war Ludwig von Firneburg nichts als ein Stutzer. Der dunkelhaarige Ritter kleidete sich stets, als würde er in der nächsten Stunde zu einer Audienz beim Kaiser erwartet. Auch verstand er es wie kein anderer, den Weibsbildern mit schönen Worten den Kopf zu verdrehen.
»Welches Ziel haben wir erreicht?«
Ludwig nickte knapp in Richtung des Toten. »Sieht ganz so aus, als hätten wir nach tausend Meilen endlich den Krieg des Kaisers eingeholt. Was meinst du, wer das war? Ein lombardischer Plünderer?«
Statt einer Antwort packte Anno den Kopf des Toten bei den Haaren und hob ihn an, so dass das Wappen auf dem Waffenrock zu sehen war.
»Der rote Löwe!« Ludwig trat einen Schritt zurück und blickte zum Scheunentor.
»Das Wappen des Herzogs von Berg«, bestätigte Anno. »Einer seiner Kriegsknechte, vielleicht ein Botenreiter … Wir sollten sehen, dass wir von hier fortkommen.«
Rother war es so schwindelig, dass Heinrich ihm in den Sattel helfen musste. Er schämte sich für seine Schwäche. Seit Beginn der Reise hatten die anderen Knappen ihn wegen seiner geringen Größe verspottet und ihn stets die schmutzigsten Arbeiten erledigen lassen. Wenn sich auch noch herumsprach, wie er sich beim Anblick des ersten Toten dieses Feldzuges angestellt hatte, würde man ihn womöglich zurück an den Hof seines Vaters schicken. Diese Schande würde ein Leben lang an ihm haften!
In den Liedern der Spielleute hatte der Krieg ein anderes Gesicht gehabt; nie war da einem Recken übel geworden. Verzweifelt blickte Rother zum Himmel, über den behäbige weiße Wolkentürme trieben. Der Waffenmeister seines Vaters hatte ihn in dem Gebrauch von Schwert und Lanze unterwiesen und ihm beigebracht, wie man einen Gegner vom Pferd stieß. Doch wie besiegte man sich selbst?
Ein Pfeil schlug neben ihm gegen die Hauswand und zersplitterte. Rother fühlte sich seltsam entrückt. Die Zeit schien langsamer zu fließen, so wie während der endlosen Predigten des Hauspfaffen in der Kapelle seines Vaters.
Seine drei Gefährten reagierten wortlos. Sie ließen die Schilde an den breiten Lederriemen von der Schulter rutschen und griffen nach den schweren Helmen, die von ihren Sätteln hingen. Er sollte auch etwas tun, dachte Rother, und vermochte doch nur gebannt zuzuschauen.
Anno hob seinen wuchtigen Helm mit dem gewölbten Gesichtsschutz über den Kopf, als ein Pfeil ihn ihm aus den Händen riss. Der Ritter fluchte wie ein Maultiertreiber und deutete auf die Hügelkuppe, hinter der irgendwo, Meilen entfernt, die Reiterkolonne des Erzbischofs nahte. Eine Gruppe von Bogenschützen und Speerträgern stand zwischen ihnen und dem Heer des Erzbischofs.
Scharfer Schmerz brannte auf Rothers Wange. Die Welt veränderte sich, war ihm gerade noch alles entfernt wie in einem Traum erschienen, so schlug nun die Wirklichkeit über ihm zusammen. Lärm brandete auf ihn ein. »Auf den Gaul mit dir, Junge! Nimm die Zügel!«, schrie Heinrich ihn an. Er gehorchte.
Dann tastete er über seine Wange. Warmes Blut rann hinab. Zwei Finger breit, und der Pfeil wäre in sein Auge geschlagen. Zwei Finger zwischen Leben und Tod.
Anno führte ihre Gruppe um die Scheune herum und dann seitlich auf den Weinberg. Die Rebstöcke gaben ihnen ein wenig Deckung. Auf diesem Wege mochten sie in einem weiten Bogen zur Hauptkolonne zurückgelangen. Rothers Magen schmerzte, als habe sich dort ein Igel eingenistet, um ihn mit seinen tausend Stacheln zu peinigen. Die vier Reiter fächerten aus. Binnen weniger Augenblicke waren sie außerhalb der Reichweite der Schützen.
Rother sah, wie die Bogenschützen ihre Waffen senkten. Ein mulmiges Gefühl überkam ihn. Wie ein gaffender Trottel hatte er bei der Scheune gestanden. Nie wieder würden ihn die drei Ritter mitnehmen. Ihn an seiner Seite zu
Überarbeitete Neuausgabe 12/2010
Redaktion: Angela Kuepper
Copyright © 2010 by Bernhard Hennen Copyright © 2010 dieser Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Karte: Andreas Hancock
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN 978-3-641-03968-4
www.heyne-magische-bestseller.de
Leseprobe
www.randomhouse.de