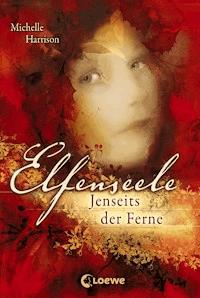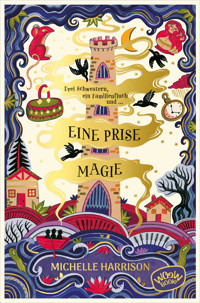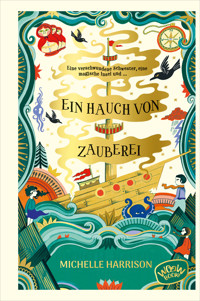Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Elfenseele
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Endlich ist es Red gelungen, einen Weg ins Elfenreich zu finden. Sie will ihren Bruder James befreien, der als Baby von Feen entführt wurde. Auf ihrem Weg zum Königshof der Elfen begegnen ihr Gefahren, wie sie sie in ihren schlimmsten Albträumen nicht gesehen hat, doch sie findet auch Verbündete, wo sie sie am wenigsten vermutet. Aber James' Freiheit hat ihren Preis: Red lässt sich auf einen Handel mit dem König der Elfen ein, der sie das Leben kosten könnte. Gemeinsam mit ihren Freunden Tanya und Fabian macht sie sich in der Menschenwelt auf eine gefährliche Suche. Sie ahnt nicht, dass der König ihr eine Falle gestellt hat, der sie nicht entrinnen kann. Mit der Elfenseele-Trilogie nimmt Michelle Harrison Leserinnen ab 12 Jahren mit in das mysteriöse Reich der Elfen. Ein packendes Fantasy-Abenteuer, das sich alle Fans von Plötzlich Fee nicht entgehen lassen dürfen! "Zwischen den Nebeln" ist der zweite Band der Elfenseele-Trilogie. Der Titel des ersten Bandes lautet "Hinter dem Augenblick".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 630
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PROLOG
Kurz vor Mitternacht flohen zwei Mädchen durch den Henkerswald und suchten mit dem Mut der Verzweiflung zu entkommen. Mit jedem ihrer gehetzten Schritte durch die beklemmende Finsternis rückte die Geisterstunde näher und damit jener magische Augenblick, in dem sich Menschenwelt und Elfenreich vereinen.
Nur mühsam hielt sich das dunkelhaarige, kleinere der beiden Mädchen noch aufrecht. Sie war Opfer einer raffinierten Intrige und Täuschung geworden und so gut wie verloren. Gelang es ihr nicht, doch noch in allerletzter Sekunde, aus dem Wald herauszukommen, würde sie ins Elfenreich hinübergerissen werden, sobald die zwei Welten miteinander verschmolzen.
Das andere Mädchen war schlaksig und jungenhaft – sie jagte mit großen Sätzen voraus, ihre grünen Augen verschleuderten Blicke, die wie Blitze waren. Aber in keiner Richtung lichtete sich der Wald, nirgends gab es auch nur die kleinste Bresche im Unterholz. Brennender Schmerz pochte in ihren Händen, aus Schnitten in den Handflächen tropfte Blut. Sie hatte sich verletzt, vor wenigen Momenten erst – beim Zerschneiden der Spinnenfäden, mit denen ihre Schicksalsgefährtin gefesselt gewesen war.
Weiter und immer weiter stürmten sie, um Haaresbreite an Bäumen vorbei und über einen Waldboden, der ein schwammiges Nichts aus Laub und Wurzeln war. In der Luft über ihnen flatterten und sausten Elfen umher; sie lauerten dem Augenblick entgegen, in dem das Mädchen ihnen ganz und gar ausgeliefert sein würde. Gesichter regten sich in der knorrigen Rinde der Bäume, an denen sie sich vorbeidrückten. Mäuler taten sich auf und riefen nach ihnen. Die Zeit lief ab und der Waldrand war weit und breit nirgends in Sicht.
Längst atmeten beide Mädchen nur noch abgehackt, aber sie hatten keine Wahl, sie mussten in Bewegung bleiben. Dann kam der Moment doch, in dem das Unvermeidliche nicht mehr länger hinausgezögert werden konnte.
»Halt«, stöhnte das kleinere Mädchen und wurde langsamer.
»Wir dürfen nicht stehen bleiben«, zischte das andere Mädchen. »Beweg dich! Ich hab gesagt: Beweg dich!«
Ihre dunkelhaarige Gefährtin hatten die letzten Kräfte verlassen. Haltlos sackte sie zu Boden, die Augen geschlossen, die Hände fest auf die Ohren gepresst, als wolle sie Geräusche aussperren, die nur sie allein hören konnte.
»Steh auf!«, flehte das größere Mädchen eindringlich. »Tanya, du kannst jetzt nicht aufgeben – hoch mit dir!«
Aber Tanya war schon viel zu weit entfernt; sie wollte nur hier auf dem Waldboden liegen bleiben und sich ausruhen. Es war Mitternacht und der Austausch begann – unaufhaltsam. Keines der beiden Mädchen konnte etwas dagegen unternehmen. Efeuranken erwachten zum Leben, schlängelten und wanden sich um Tanya – jeden Moment konnte sie jetzt in die dunklen Schlupfwinkel des Elfenreichs davongerissen werden. Das andere Mädchen riss ihr Messer heraus, hieb auf die Ranken ein und fetzte sie beiseite. Aber immer noch mehr raschelten heran, es waren zu viele. Nur Sekundenbruchteile blieben noch, bis Tanya endgültig zur Gefangenen des Elfenreichs werden würde. Es sei denn …
Die Lösung war so offensichtlich, dass das größere Mädchen kaum fassen konnte, warum sie ihr erst jetzt in den Sinn kam. Zittrig kramte sie mit ihrer blutigen Hand die kleine silberne Schere aus ihrer Tasche. Längst schon kniete sie an Tanyas Seite; in fliegender Hast drückte sie die Daumenspitze des bewusstlosen Mädchens zusammen und stach zu. Ein dunkelroter Blutstropfen bildete sich. So fest wie möglich presste sie ihren eigenen blutnassen Daumen auf die Wunde, selbst dann noch, als Tanya unter dem scharfen Schmerz erschauderte und aufschreckte.
»Wie habe ich …«, ächzte sie benommen.
Das andere Mädchen unterbrach sie. »Nehmt mich«, wisperte sie und drückte ihre Hand noch energischer auf Tanyas Wunde. Ihrer beider Blut vermischte sich und damit war Tanyas Schicksal endgültig auch das ihre. »Nehmt mich an ihrer Stelle«, wiederholte sie. »Sie hat ein Leben, in das sie zurückkehren kann. Ich nicht … Nehmt mich an ihrer Stelle.«
Die Ranken und Äste und Zweige, die Tanya bereits umschlungen hatten, hielten kurz inne … dann zogen sie sich langsam zurück, gaben sie aus ihrer Umklammerung frei und krochen auf das andere Mädchen zu. Sie spürte die kühle Feuchtigkeit dunkler Blätter auf ihrer Haut. Zweige, die zu Klauen geworden waren, nahmen sie in ihren harten Griff. Sie unterdrückte den Impuls zu fliehen; völlig reglos verharrte sie und gestattete dem Wald, sie zu verschlingen. Die Schere entglitt ihrer Hand und wurde vom Laub verschluckt. Ein Summen füllte ihre Ohren, ein tiefes Bienenschwarmsummen, das sich allmählich veränderte und zu Stimmengetuschel wurde.
Sie spürte, wie die Ranken, die sie gepackt hielten, ruckweise an ihr zerrten; wie sie hierhin und dorthin gerissen wurde, gerade so, wie eine Katze mit einer Spinne spielte. Die Stimmen wurden deutlicher; neugierige Bemerkungen von Elfen, die den Neuankömmling in ihrer Welt erwarteten. Dann zog sich das Blättergestrüpp so hastig zurück, wie es herangekrochen war, und das Mädchen blieb zusammengekauert auf dem Boden liegen, inmitten einer schemenhaften Menge elfischer Gaffer. Glitzernde Augen starrten auf sie herab; einige blickten nur neugierig, andere wachsamer. Auch Gesichter konnte sie nach und nach erkennen: junge und alte, schöne und abscheuliche. Ein paar Atemzüge lang beobachtete das Mädchen die Wesen, wie sie sie beobachteten – dann handelte sie. Ein wenig taumelnd, aber mit einem wilden Schrei kam sie auf die Füße und rannte auch schon. Der Schrei wirkte Wunder – mehr als die Hälfte der Elfen stob auseinander und huschte zurück in ihre Verstecke, und so entstanden gleich mehrere Breschen in der Masse, die sie gerade noch so undurchdringlich umgeben hatte. Das Mädchen entschied sich für die nächstgelegene und jagte darauf zu.
Ihre Lunge brannte noch immer, sie hatte sich noch nicht erholt von ihrer wilden Flucht mit Tanya. Aber jetzt war Tanya nicht mehr bei ihr; sie war in Sicherheit, auf der anderen Seite, in der Menschenwelt. Das Mädchen hörte ein Huschen und Schwirren hinter sich, Flügel peitschten die Luft. Äste krochen auf sie zu und versuchten, sie zu Fall zu bringen. Mit großen Sätzen wich sie ihnen aus, aber jeder neue Sprung fiel ihr schwerer als der vorhergehende. Eine bleierne Müdigkeit breitete sich in ihr aus.
Dann entdeckte sie die Höhle in dem gewaltigen alten Baum, einen schattigen Abgrund, gerade groß genug, um sie aufzunehmen. Im Näherkommen sah sie grüne Beeren zwischen den üppig wuchernden Blättern und erkannte sie. Nein, in diesem Baum hausten bestimmt keine Elfen! Sie schleuderte ihren Rucksack in die Aushöhlung, kletterte hinterher und zerrte Äste voller Beeren vor die Höhle, um sie zu tarnen. Jeder Muskel ihres Körpers versteifte sich, als das Hasten und Huschen ihr Versteck passierte – und sich entfernte. Alles wurde still. Sie hatte es geschafft. Sie war entkommen.
Erschöpft sank das Mädchen in einen tiefen Schlaf. Als die Sonne Stunden später aufging, erwachte sie nicht. Auch als es wieder Nacht wurde, blieb sie reglos liegen. Ringsumher wuchs und gedieh der Wald und wiegte den altehrwürdigen Baum mit seiner Höhle in blättrigen Armen.
Und das Mädchen in der Höhle schlief und schlief.
1
eit ihr kleiner Bruder von Elfen geraubt worden war, hatte Rowan Fox – oder Red, wie sie sich jetzt nannte – an nichts anderes mehr gedacht als daran, wie sie ihn wieder zurückbekommen konnte. Wie ein verzehrendes Feuer loderte das in ihr. Es wurde ihr einziger Lebensinhalt. Weniger als zwei Monate nach dem Tod ihrer Eltern vor achtzehn Monaten war er verschwunden. Red hatte die erstbeste Gelegenheit genutzt und war weggelaufen, um nach ihm zu suchen. In den folgenden Monaten schlug sie sich mehr oder weniger ehrlich durchs Leben und ließ niemals auch nur den geringsten Zweifel daran zu, dass sie ihn finden würde. Jetzt war ihre Entschlossenheit belohnt worden. Sie hatte alle Schwierigkeiten gemeistert und einen Weg gefunden. Den Weg.
Sie war ins Elfenreich gelangt. Endlich.
Der Morgen dämmerte, als sie aus einem Schlaf erwachte, der wie ein schwarzes Nichts gewesen war. Zusammengerollt lag sie im ausgehöhlten Stamm eines uralten Baumes. Fröstelnd streckte sie eine steife, kalte Hand aus und drückte ein Gewirr aus Zweigen und Dornen beiseite, das sie vor dem Wald verbarg. Helligkeit sickerte durch das Unterholz und warf Lichtsprenkel auf ihre Haut. Sie sah die Narben.
Eine dunkle Masse überkrustete ihre Handflächen. Getrocknetes Blut. Dünne Schnittwunden und Kratzer verästelten sich in ihrer Haut. Es waren zu viele, als dass sie alle hätte zählen können, aber unter dem Blut waren sämtliche Verletzungen zu silbrigen Narben verheilt. Ihr Verstand raste, wie im Zeitraffer erinnerte sie sich; sah, wie sie Tanyas magische Fesseln zerschnitt und wegriss und sich dabei die Hände zerfetzte.
Ihr leerer Magen knurrte. Als Zugabe schmerzte auch noch ihre volle Blase.
Red schnitt eine Grimasse, zog sich aus der Höhlung und wankte steifbeinig von dem Baum weg. In ihren Füßen kribbelte es, weil sie zu lange zusammengekauert gelegen hatte. Aufmerksam blickte sie sich um. Sie konnte es nicht mehr länger aushalten; sie ließ die Hose herunter und ging in die Hocke.
Eine unnatürliche Stille herrschte im Wald. Sobald Red fertig war, richtete sie sich auf und holte ihre Habseligkeiten aus der Höhlung. Sie nahm das Messer aus ihrem Rucksack, das sie immer bei sich trug, und steckte es in die Scheide an ihrem Gürtel. Dann trat sie ein paar Schritte zurück und blickte an dem Baum empor. Es war eine alte und robuste Eiche, aber dank der Vögel – oder was auch immer darin lebte – hatten sich im höchsten Wipfel die Samenkörner einer anderen Pflanze in ihrer Rinde festgesetzt und überwucherten sie nun von oben bis unten. Eine Gischt aus roten Beeren wogte vor Reds Augen. Eine Eberesche. Vogelbeeren. Sie wusste, dass Eberesche auf Englisch »Rowan« hieß. Ihr Namensvetter; obwohl sie schon seit Langem nicht mehr mit ihrem richtigen Namen angesprochen worden war. Das war in einem anderen Leben gewesen. Aber seinetwegen hatte sie sich auf ihrer Flucht gerade für diesen Baum entschieden. In den alten Märchen und Sagen hieß es, dass Vogelbeeren Schutz davor boten, verzaubert zu werden; Schutz boten vor der bösartigen Magie von Hexen … und Feen und Elfen.
Plötzlich jedoch beschlich sie eisiges Unbehagen. Die Beeren waren hart und grün gewesen, als sie kurz nach Mitternacht in ihr Versteck gekrochen war. Jetzt sahen sie rot und weich aus – sie waren über Nacht gereift. Das und die vernarbten Wunden an ihren Händen beunruhigten sie zutiefst. Es sah ganz danach aus, als sei Zeit vergangen, viel Zeit.
Angestrengt versuchte sie sich daran zu erinnern, was sie über Ebereschen wusste. Rot wurden die Beeren normalerweise erst im Herbst. Aber als sie sich kurz nach Mitternacht in der Höhle verkrochen hatte, war es Juli gewesen, Hochsommer. Etwas stimmte nicht. Sie hatte schon davon gehört, dass im Elfenreich die Uhren anders tickten, aber wenn ihre Vermutung stimmte, dann bedeutete das nichts anderes, als dass inzwischen mehr als zwei Monate vergangen waren.
Red schaute sich erneut im Wald um. Nichts regte sich. Trotzdem wusste sie, dass diese scheinbar so friedliche Abgeschiedenheit ein Trugbild war. Sie war nicht allein. Über kurz oder lang würde sich seine wahre Natur offenbaren; ein Gesicht in einer Baumrinde vielleicht. Gut möglich auch, dass sie plötzlich eine spukhafte Melodie hörte, die sie in ihren Bann schlug und zu tanzen zwang. Sie hatte schon jede Menge gehört von den Gefahren des Elfenreichs.
Jetzt war sie hier und musste auf alles gefasst sein.
Noch eine letzte Sache blieb zu erledigen, bevor sie aufbrach. Sie nutzte die knorrige Eichenrinde wie eine Trittleiter, stemmte sich hoch und streckte sich lang, bis sie einen der Ebereschenäste zu fassen bekam. Er war ein wenig dünner als ihr Handgelenk und ließ sich leicht abbrechen. Sie ruckte ihn frei und warf ihn zu Boden.
Der Ast aus Ebereschenholz war knapp dreißig Zentimeter kürzer, als sie groß war. Sie legte ihn sich in die linke Armbeuge, zog ihr Messer aus der Gürtelscheide und hackte die dünneren Seitentriebe ab, bis sie einen ordentlichen Stab in den Händen hielt. Jetzt, mit diesem zusätzlichen Schutz, war sie bereit.
Sie ging und sah nicht mehr zurück. Im Wald war es still und kühl, dicht über dem Waldboden umwirbelte sie der Dunst des frühen Morgens wie eine Geistererscheinung. Tau tröpfelte von irgendwo hoch droben. Red schnupperte; ihre Kleider rochen nach den feuchten Blättern, auf denen sie in ihrer Höhle geschlafen hatte. Danach und nach Schweiß und Blut. Sie roch fürchterlich und sie wusste es.
Erbarmungslos gegen sich selbst ging sie weiter und folgte der Sonne, die über den Bäumen höher stieg. Die Luft erwärmte sich ein wenig, ein herbstlich kühler Hauch jedoch war allgegenwärtig. Red blieb in Bewegung, den Stock sorgfältig ausbalanciert in der Rechten. Keine Bewegung im Unterholz entging ihren Augen, kein Geräusch ihren Ohren. Aber noch immer deutete nichts darauf hin, dass sie verfolgt wurde. Dann erwachte der Wald und über ihr raschelten die Blätter auf einen Schlag unter unzähligen Bewegungen. Ein paarmal sah sie hoch und erhaschte einen Blick auf große Feen- und Elfenaugen, die auf sie herabspähten. Manche verschwanden, sobald sich ihre Blicke begegneten. Andere, weniger vorsichtige, neugierigere Elfen wagten sich weiter aus ihren Verstecken hervor, um sie genauer zu betrachten, ihre Schwingen und Körperzeichnungen verschmolzen mit dem neuen kraftvollen Gold, Rubinrot und Braun der Baumkronen.
Mit einem Mal hörte sie das herrliche Geräusch fließenden Wassers. Da wurde ihr ganz leicht ums Herz. Zielstrebig hielt sie darauf zu, bis sie auf ein schmales Rinnsal stieß, das den Wald durchschnitt.
Es plätscherte fröhlich dahin, ab und zu schaukelten Blätter an ihr vorbei. Dankbar ging Red am Ufer in die Hocke und legte ihren Stock sorgfältig so vor sich ab, dass er in Reichweite war, falls sie ihn brauchte. Sie zerrte sich den Rucksack vom Rücken, zog den Reißverschluss eines der Fächer auf und nahm ihre Wasserflasche heraus. Sie schüttelte sie. Beinahe leer. Mehr als ein Schluck Flüssigkeit konnte nicht mehr darin sein. Sie schraubte den Verschluss ab und leerte das abgestandene Wasser ins Gras neben sich, dann nahm sie die Flasche und tauchte sie ins Wasser. Eiskalt und herrlich erfrischend gluckerte es über ihre Hand.
Sobald die Flasche gefüllt war, trank sie ein paar große Schlucke, bevor sie sie wieder in ihrem Rucksack verstaute. Danach wandte sie sich erneut dem Wasser zu, wusch sich behutsam das Blut von den Händen und sah ihm hinterher, wie es in dunkelroten Strudeln verschwand. Sie schöpfte sich ein paar Hände voll Wasser in Gesicht und Nacken. Erfrischt wippte sie auf die Fersen und beobachtete ihr Spiegelbild in dem Bächlein. Es wogte und schwankte mit der Bewegung des Wassers, aber im nächsten Moment fuhr sie auch schon wieder aus ihrer Versonnenheit auf. Ihre Haare waren gewachsen. Red beugte sich vor, hob eine Hand und berührte die kurz geschnittenen, wie von Mäusen angenagten Strähnen. Sie selbst hatte sie gefärbt und abgeschnitten, erst vor wenigen Tagen, damit man sie für einen Jungen hielt. Trotzdem waren sie eindeutig nachgewachsen. Am Haaransatz schimmerte auf einem Zentimeter Länge bereits wieder ihre natürliche rotbraune Haarfarbe.
Und im Wasser zitterte neben ihrem Spiegelbild plötzlich eine zweite Gestalt. Blitzschnell wie eine Katze packte Red den Ebereschenstock und fuhr herum. Nur Zentimeter entfernt stand jemand. Durch die überstürzte Drehbewegung rutschte Red ab und verlor das Gleichgewicht. Rücklings stürzte sie in den Bach und ließ ihren hölzernen Stab los. In den Bäumen über ihr stob ein Vogelschwarm auf, Feen und Elfen huschten davon, ein lautes, warnendes Kreischen erfüllte die Luft.
Als Red prustend wieder aus dem kalten Wasser auftauchte, sah sie den Ebereschenstab davontreiben. Er war längst außer Reichweite.
Eine schwielige Hand streckte sich ihr entgegen, eine dunkle Stimme sagte etwas.
»Komm, Kind …«
Das Gesicht der Frau, der diese Stimme gehörte, lag zum großen Teil im Kapuzenschatten ihres grünen Umhangs verborgen. Zu sehen waren nur lange angegraute Haare, die sich in einer wuchernden Masse bis über die Schultern ergossen. Gegenstände waren in die Strähnen eingeknotet, Lumpenfetzen und kleine Pergamentröllchen. Von dem Gesicht selbst konnte Red nur wenig erkennen. Eine gekrümmte Nase – schmaler Nasenrücken, breite Spitze – war am auffälligsten. Die Nasenlöcher waren groß und rosa gerändert. Ihre Lippen waren sichelschmal und seltsam blutleer und farblos wie ihre ganze Haut, aber wenn sie sprach, leuchtete die Mundhöhle ungewöhnlich intensiv rot. An den Mundwinkeln klebte getrockneter Speichelschorf. Es war unmöglich zu sagen, ob sie Elfe war oder Mensch.
»Komm«, sagte sie erneut, unter Schwierigkeiten, als fühle sich das Wort fremd an in ihrem Mund. Jäh krümmte sie sich vornüber und stieß ein schreckliches, abgehacktes Husten aus.
Red blieb, wo sie war. Keinen Millimeter weit rührte sie sich. Das plötzliche Auftauchen der Frau steckte ihr noch gehörig in den Knochen, ihr Herz hämmerte wie verrückt. Wie hatte sie sich nur so geräuschlos anschleichen können? Wasser perlte in kleinen Rinnsalen über Reds Gesicht, und ihre Hand umschloss den Griff ihres Messers, bereit, es zu ziehen. Sie ließ die Frau nicht aus den Augen, sah, wie sie den Kopf zur Seite neigte, und wusste, dass der Alten ihre Bewegung nicht entgangen war; aber noch steckte das Messer in der Scheide an Reds Gürtel. Red spannte die Muskeln ein wenig mehr an und tat, als sei sie drauf und dran, es herauszureißen. Obwohl sie noch immer nicht mit Sicherheit sagen konnte, ob ihr von der Frau nun Gefahr drohte oder nicht, spürte sie tief in sich ein gewaltiges Unbehagen. Sie wollte, dass die Frau verschwand, und wenn das nur dadurch zu erreichen war, dass sie ihr Angst einjagte, dann würde sie ihr eben Angst einjagen.
Die Frau wich zurück, so lautlos, wie sie gekommen war. Schon hatte sie die ersten Bäume erreicht. Red verharrte immer noch reglos und starrte ihr hinterher, bis sie außer Sicht war. Sie hatte sich auf eine merkwürdige Art und Weise bewegt; aber was genau so merkwürdig gewesen war, das konnte sie unmöglich sagen. Red bekam Gänsehaut auf den Armen und fröstelte. Ihr war kalt und Hunger hatte sie auch. Sie musste etwas Essbares finden, und das bald.
Sie nahm ihren Rucksack an sich und vergewisserte sich gewohnheitsmäßig mit einer raschen, tastenden Handbewegung, dass ihr Messer da war. Das vertraute Gefühl des kalten Griffs erleichterte sie. Sie warf sich den Rucksack über die Schulter und brach auf. Sie ging zügig und war entschlossen, eine möglichst hohe Marschgeschwindigkeit durchzuhalten, damit ihr wieder warm wurde und die Kleider trockneten. Momentan klebten sie ihr nass am Körper und aus ihren Haaren tropfte es ihr eisig in den Nacken. Sie schauderte und schritt schneller aus – und verwünschte die Tatsache, dass sie sich nicht umziehen konnte. Die Kleider, die sie am Körper trug, waren alles, was sie besaß.
Sie war noch nicht weit gekommen, als sie einen weiteren Elf sah. In der Reglosigkeit des Waldes bemerkte sie die verstohlene Bewegung in den Ästen hoch droben sofort. Ein grauhäutiges Geschöpf von der Größe eines Kleinkindes kauerte in dem Baum über ihr. Es war vierschrötig und massig. Beim Anblick der ledrigen Haut musste sie an Elefantenhaut denken. Links und rechts des birnenförmigen Schädels waren große Fledermausohren lauernd auf sie gerichtet. Das Wesen sah aus wie ein zum Leben erweckter steinerner Wasserspeier. Red hielt kurz inne, bevor sie weiterging. Keine Sekunde ließ sie ihn aus den Augen. Die Kreatur erwiderte ihren Blick mit unnachgiebigem bernsteingelben Starren und kauerte sich ein wenig tiefer auf den Ast. Schartige Klauen hielten ihn umklammert. Mit seinem Auftauchen war alles andere Rascheln und Wispern verstummt. Entweder waren die Elfen in diesem Teil des Waldes sehr schweigsam oder es lebten hier nicht allzu viele.
Noch vorsichtiger als bisher ging sie weiter, ohne langsamer zu werden – die Kreatur im Geäst über sich. Ein umgestürzter Baum lag quer über dem Pfad vor ihr, der dicke Stamm reichte ihr bis zum Knie. Davor wucherten fleischiges Farndickicht und dornige Ranken. Sie musste gut aufpassen, wohin sie trat. Für einen winzigen Moment musste sie ihren Blick von dem Wasserspeierwesen über sich losreißen, weil sie sich ganz darauf konzentrieren musste, über diesen Baumstamm zu steigen. Da passierte alles gleichzeitig. Ein ganz und gar unerwartetes Geräusch wurde über ihr laut; das Klirren und Rasseln von Metall auf Metall. Und der Boden auf der anderen Seite des umgestürzten Baumes gab unter ihrem rechten Fuß nach.
Mit einem Ruck kippte sie vornüber; das linke Bein hinter sich ausgestreckt, den linken Fuß in der Rinde des Baumstamms verhakt, schlug sie wild um sich. Ihr eigenes Gewicht riss sie weiter. Ihr Bein schrammte über die Borke. Sie hörte den Stoff reißen und spürte, wie die Haut ihres Schienbeins zerfetzt wurde. Sie brach durch dünne Äste und Laub und wirbelte kopfüber in Dunkelheit hinab. Der Waldboden verschluckte sie, und das Letzte, was sie noch bewusst wahrnahm, war ein schrilles, gackerndes Gelächter, dann wurde alles schwarz.
2
Achtzehn Monate zuvor …
Die ersten Regentropfen fielen kurz nach dem ersten Donnerschlag. Sie zerplatzten auf der Windschutzscheibe zu winzigen unordentlichen Spritzern und wurden von den Wischblättern mit einem hässlichen Scharren beiseitegefegt. Außerhalb des Wagens war der Januarnachmittag nur noch ein grau-braun-schwarzes Wogen und ergab sich dem Unwetter, das jetzt mit voller Wucht hereinbrach.
Das alles passte perfekt zu der Stimmung im Innern des Wagens. Rowan saß hinten, mit gesenktem Kopf, die langen kastanienfarbenen Haare fielen ihr bis über die Schultern. Durch die Fransen ihres Ponys konnte sie das Gesicht ihres Vaters im Innenspiegel sehen. Obwohl er den Blick auf die Straße gerichtet hielt, wusste sie, dass er in Gedanken woanders war. Sie kannte ihn, sie wusste genau, was seine zusammengekniffenen dunklen Brauen zu bedeuten hatten. Er war wütend. Wütend auf sie. Bisher hatte auf der ganzen Fahrt Stille geherrscht, doch Rowan wusste, dass sie nicht andauern würde. Sie musste nicht lange warten.
»Du hast Hausarrest.« Die Stimme ihres Vaters war beherrscht, trotzdem schwang ein scharfer Unterton darin. Er gab sich Mühe, seine Verärgerung im Zaum zu halten.
Sie nickte kaum merklich. So etwas Ähnliches hatte sie schon erwartet.
»Einen Monat lang«, fügte er hinzu.
Jetzt ruckte Rowans Kopf hoch. »Einen ganzen Monat? Aber … der Schulausflug nächste Woche … Ich habe das ganze Campingzeug doch schon!«
»Das geht alles zurück«, sagte ihre Mutter auf dem Beifahrersitz. »Wir haben die Quittungen noch. Du fährst nicht mit.«
»Aber das ist nicht fair! Es ist doch alles geplant – ihr müsst mich mitfahren lassen!«
»Hier ist nur eines nicht fair, Fräulein, und das ist dein Benehmen«, donnerte ihr Vater. »Wir sind heute deinetwegen fast gestorben vor Angst.«
Rowan strich sich die Haare zurück. »Mir ging’s bestens«, murmelte sie, starrte auf den Hinterkopf ihres Vaters und widerstand dem Zwang, die kahle Stelle anzugaffen, die sich in seinem früher einmal dichten dunklen Haarschopf ausbreitete.
»Bestens? Bestens?«, stieß ihre Mutter heraus. »Alles Mögliche hätte dir passieren können! So etwas kannst du einfach nicht machen – die Schule schwänzen und nach London fahren! Einfach so, aus einer Laune heraus! Was hast du dir nur dabei gedacht?«
»Es war nicht nur eine Laune«, sagte Rowan ganz ruhig. Ich hab’s geplant, dachte sie. Dabei schaute sie hinab auf die kleine Tüte, die sie fest umklammert hielt. Auf der Vorderseite waren die Worte The National Gallery aufgedruckt. Gedankenverloren wechselte sie die Tüte in die andere Hand.
»Du bist zwölf Jahre alt, Rowan«, fuhr ihr Vater fort. »Du hältst dich vielleicht für sehr erwachsen, aber du bist einfach noch nicht alt genug, um allein nach London auszureißen –«
»Mutterseelenallein in der U-Bahn!«, unterbrach ihre Mutter. »Mir wird ganz schlecht, wenn ich nur daran denke!« Sie griff sich an die Schläfe und massierte sie. Wie gut Rowan diese Geste kannte!
»Ich habe doch gesagt, es tut mir leid«, murmelte Rowan. Sie bemerkte, dass ihr Vater sie im Rückspiegel ansah, für einen winzigen Moment nur, dann starrte er wieder auf die Straße.
»›Es tut mir leid‹ – das sind nur Worte. So etwas zu sagen und es auch zu meinen, dazwischen liegt ein himmelweiter Unterschied.«
»Ich mein’s ja ernst.«
Ganz unerwartet drehte sich ihre Mutter um und schaute sie eindringlich an.
»Es tut dir nicht leid, dass du es getan hast. Es tut dir nur leid, dass wir dich dabei erwischt haben.«
Rowan erwiderte nichts darauf. Zum Teil hatte sie ja recht.
»Schon wieder eine Verwarnung!«, flüsterte ihre Mutter. »Drei Schulen in zwei Jahren. Und jetzt hast du auch an dieser hier schon die letzte Verwarnung –«
Ihre Stimme wurde kratzig und brach ab.
Rowan ließ den Kopf wieder hängen. Sie wusste genau, was nun kam.
»Mit deinen Verrücktheiten muss Schluss sein, Rowan«, sagte ihr Vater. »Ich meine es ernst. Ich will nichts mehr davon hören, dass du Dinge siehst, die andere nicht sehen, diese Kreaturen … diese … diese Elfen.« Das letzte Wort spie er hastig heraus, als könne er es nicht einmal ertragen, es im Mund zu spüren. »Oder ganz egal, wie du sie heute wieder nennst. Es reicht. Vielleicht hatten wir zu viel Geduld mit dir. Aber jetzt ist Schluss mit diesen Geschichten und Spinnereien. Ein für alle Mal Schluss.«
»Für dich vielleicht«, wisperte Rowan. Den Blick gesenkt, griff sie langsam in die Papiertüte und zog mehrere Postkarten heraus. Sie hatte sie in der Gallery gekauft. Sie schaute sich die erste an; das Schwarz-Weiß-Foto eines Mädchens, das, sein Kinn in die Hände gestützt, gelassen in die Kamera blickte. Im Vordergrund tanzten mehrere winzige Gestalten. Dieses Bild war Teil einer berühmten Serie von fünf Aufnahmen, die im frühen 20.Jahrhundert gemacht worden waren. Auf der Rückseite der Postkarte stand klein gedruckt der Titel: Die Cottingley-Feen. Völlig versunken betrachtete sie der Reihe nach auch die anderen Fotos. Ein in Beigetönen gehaltenes Wasserfarbengemälde von geflügelten Geschöpfen, die über den Londoner Kensington Gardens schwebten; eine Frau mit einer Maske aus grünen Blättern. Jedes Einzelne war wunderschön und faszinierend. Und auf der Rückseite einer jeden Karte, unterhalb des jeweiligen Titels, stand der Name der Ausstellung gedruckt: Feen und Elfen in der bildenden Kunst und der Fotografie.
Behutsam schob sie die Postkarten in die Tüte zurück. Das Papier knitterte und raschelte trotzdem unter ihren Fingern. Auf dem Beifahrersitz bewegte sich der blonde Haarschopf ihrer Mutter; sie hatte das Geräusch gehört und fuhr herum.
»Was hast du da?«
»Nichts«, sagte Rowan abwehrend und versuchte noch, die Tüte in ihrem Rucksack verschwinden zu lassen – aber es war zu spät.
»Hergeben! Sofort!«
Widerstrebend drückte Rowan die Tüte ihrer Mutter in die Hand. Sie hörte, wie die Postkarten erneut herausglitten; einen Sekundenbruchteil lang schien der Motor lauter zu wummern, sonst blieb alles still. Sie waren nach wie vor auf der dicht befahrenen M25 unterwegs. Genau in diesem Moment vernahm Rowan den winzigen Seufzer, und zum ersten Mal seit sie an diesem Mittag in den Wagen gestiegen war, warf sie ihrem Bruder einen Seitenblick zu. Er war noch ein Baby und schlief selig in seinem Kindersitz. Den Daumen hatte er energisch in seinen Mund gestopft, eine klebrige Speichelspur zog sich zu seinem Handgelenk hinab. Er hatte die wunderschönen Haare ihrer Mutter geerbt; goldblonde Ringellöckchen und dichte Wimpern. Dazu die großen blauen Augen. Rowan wurde sich kaum bewusst, dass sie sich durch die eigene widerspenstige rote Haarmähne strich und sie einmal mehr verfluchte. Selbst in ihrem Aussehen war sie anders als die anderen. Sie gehörte einfach nicht dazu.
Kartoniertes Papier zerfetzte. Schlagartig hatte die Wirklichkeit sie wieder.
»Was machst du da?«, rief sie und beugte sich mit einem ungestümen Ruck vor.
Ihre Mutter hatte die Postkarten entzweigerissen und machte Anstalten, sie ein weiteres Mal durchzureißen.
»Nicht!«, schrie Rowan.
»Still!«, zischte ihr Vater. »Du weckst James auf!«
Aber Rowan hatte nur Augen für die Hände ihrer Mutter und wie sie die Fotos verdrehten und sich anspannten, und plötzlich war es ihr völlig egal, ob sie ihren Bruder aufweckte. Sie war so wütend.
»Aufhören!«, schrie sie. »Hör auf damit!«
James wachte mit einem protestierenden Schluchzer auf und weinte los; sein Brüllen übertönte ihre Stimme noch. Chaos brach los im Innern des Wagens. Rowan und ihre Eltern schrien durcheinander. Das Baby kreischte. Rowan ruckte gegen den Sicherheitsgurt, beugte sich zwischen Fahrer- und Beifahrersitz so weit nach vorn wie nur möglich und griff nach den Händen ihrer Mutter. Ihre Mutter herrschte sie an, sie solle sich zurücksetzen. Draußen peitschte der Regen gegen die Windschutzscheibe, wild sausten die Wischblätter hin und her und schafften es doch nicht, für klare Sicht zu sorgen. Ganz plötzlich begriff Rowan die Hoffnungslosigkeit der Situation und gab auf und ließ sich in ihren Sitz zurückfallen. Tränen verschleierten ihre Sicht. Sie blinzelte sie weg. Neben ihr brüllte James weiter und sie streichelte ihm sanft über die Wange. Dort, wo er das teefleckbraune, wie ein Fisch geformte Muttermal hatte.
Als ihre Tränen versiegten, bemerkte sie das Huschen. Vor sich, unten im Fußraum. Sie sah genauer hin und da tat sich eine kleine Öffnung in ihrem Rucksack auf; gleich darauf erschienen zuerst zwei winzige, blasse Pfötchen in dem Spalt und dann ein Kopf, wie von einer Art Nagetier. Das Geschöpf bedachte sie mit einem missbilligenden Blick, krabbelte vollends aus dem Rucksack und sauste an ihrem Bein empor. Und biss sie. Zweimal. Rowan zuckte zusammen. Dem kleinen Gesellen gefiel es überhaupt nicht, dass sie die Feen- und Elfen-Postkarten hatte, das wusste sie. Andererseits war er nicht halb so verärgert, wie ihre Eltern gewesen wären, wenn sie gewusst hätten, dass sie nur einen Teil der Karten bezahlt hatte. Sie war nicht mutig genug gewesen, das Begleitbuch zur Ausstellung zu stehlen, aber die Postkarten waren klein und eine leichte Beute. Genau genommen war das Ganze ein Klacks gewesen – bis auf den Teil, bei dem sie erwischt worden war.
Rowan war aufgestanden, hatte gefrühstückt, sich die Zähne geputzt, geduscht und ihre Schuluniform angezogen. Sie hatte ihr Pausenbrot von der Küchentheke genommen, James’ breiverschmiertes Gesicht belächelt und ihm einen Kuss auf den blonden Kopf gedrückt. Mit einem »Tschüs!« für ihre Mutter war sie aus dem Haus spaziert und die schmale Straße mit den einfachen, aber hübschen Häusern entlanggegangen.
Alles war wie immer, nur dass sie heute am Ende der Straße statt nach links Richtung Schule nach rechts Richtung Bahnhof abgebogen war. Bevor sie ihre Fahrkarte kaufte, hatte sie sich auf der Toilette umgezogen, die Schuluniform in ihren Rucksack gestopft und die Jeans und den Pullover herausgezerrt, die sie bereits gestern Abend beiseitegelegt hatte. Ein schneller Blick in den Spiegel bestätigte ihr, dass sie ohne Schuluniform älter aussah als zwölf; vierzehn mindestens.
Kaum eine halbe Stunde brauchte sie bis zur Fenchurch Street, dann noch einmal zwanzig Minuten U-Bahn-Fahrt, und schon war sie im Herzen Londons. Die Fahrt in der U-Bahn allerdings war alles andere als ein Vergnügen. Es herrschte Berufsverkehr und sie war in dem mit Menschen vollgestopften Abteil so lange hin- und hergedrückt worden, bis sich ihre Nase hoffnungslos in der Achselhöhle eines wildfremden Mannes verkeilt hatte. Endlich am Ziel angekommen, hastete sie mit gesenktem Kopf durch die U-Bahn-Station und mied die Blicke aller ringsumher; die der Pendler und des U-Bahn-Personals genauso wie diejenigen der Bettler, die jedem, der an ihnen vorüberging, ihre Hände entgegenreckten.
Erst als Rowan an der frischen Luft war und über den Trafalgar Square schlenderte, begann sie sich besser zu fühlen. Sie wich Tauben aus, ging an den großen steinernen Löwen vorbei und stieg die Stufen zur National Gallery hoch. Drinnen herrschte geschäftiges Treiben, Besucherscharen stauten sich. Inmitten von Touristenhorden und Schulklassen auf Tagesausflügen war es lächerlich einfach, sich unauffällig durch die Kontrollen zu schmuggeln. Sie schnappte sich einen Ausstellungsführer und sonderte sich ab, ignorierte die berühmteren Attraktionen – die Botticellis und die Van Goghs – und ging stattdessen ihrer Wege in die weiter entfernten Räume, in diejenigen, in denen das zu finden war, was sie interessierte. Dort hielten sich weniger Besucher auf und es war stiller.
Wissensdurstig ließ Rowan ihre Blicke an den Wänden entlangschweifen und verschaffte sich einen ersten Eindruck davon, was sich ihr hier an Gemälden und Fotos anbot. Die Mehrzahl der Ausstellungsstücke beachtete sie nicht; besonders die zuckersüßen Kitschbilder voller wunderschöner Geschöpfe nicht, die sich in Blumenblüten kuschelten oder wie Hühner aufgereiht auf großen Fliegenpilzen hockten und gütig in die Welt blickten. Mit einem einzigen Blick tat sie sie als die märchenhaften Wunschdenkenbilder ab, die sie waren. Sie interessierten die anderen. Die düsteren Bilder von maskierten Wesen, die gut getarnt im Unterholz von Wäldern kaum zu erkennen waren; die Bilder von Menschen, die von einer magischen Melodie verhext willenlos tanzten; oder das eines Kindes, das von einer Hand geleitet auf einen Fluss zuging, während die andere Hand ein zweites Kind in das eisige Wasser drückte. Dies waren die Bilder, nach denen Rowan Ausschau hielt. Bilder, die die Wahrheit erzählten, gesehen von denjenigen, die so waren wie sie.
Jenen mit dem Zweiten Gesicht.
Sie riss sich von ihren Gedanken los und kehrte in die Gegenwart zurück. Im Wagen war es jetzt still, nur James wimmerte ab und zu noch leise. Aber sie wusste, was ihr blühte, sobald sie zu Hause ankamen und James außer Hörweite war. Sie steckte in großen Schwierigkeiten. Ihr einziger Trost war, dass sie ihren Plan letzten Endes immerhin durchgezogen hatte, ohne erwischt zu werden. Dieser Teil war erst später gekommen, unmittelbar nachdem sie das Kunstmuseum verlassen und wieder über den Platz spaziert war. Als sich die Hand wie eine Klammer über ihre linke Schulter gelegt und sie, nachdem sie mit einem Ruck herumgefahren war, in ein Gesicht gestarrt hatte, das sie hier ganz zuletzt zu sehen erwartet hätte. Das Gesicht ihres Vaters. Der Ausdruck von Erleichterung darauf war ziemlich schnell einem der Verärgerung gewichen. Er wedelte ihr mit einem Werbeblatt der National Gallery vor der Nase herum, in dem es eine Fülle von Einzelheiten zu der Ausstellung nachzulesen gab – und auf dem in Rowans Handschrift Zugverbindungen notiert waren. Bestürzt begriff sie, dass er es aus ihrem Papierkorb gefischt haben musste. Nach dem Anruf aus der Schule. Nachdem ihm mitgeteilt worden war, dass sie fehlte.
Sie konnte es trotzdem noch immer nicht glauben, dass er sie gefunden hatte.
Das Geschöpf, das nur sie sehen konnte, war zu James hinübergetrippelt, kuschelte sich jetzt in seinem Kindersitz an ihn und schnurrte leise vor sich hin. Wenn man ganz genau hinhörte, konnte man eine Art Schlaflied erkennen. Rowan fragte sich, ob James es hören konnte. Sehen konnte er das Wesen nicht, dessen war sie sich ganz sicher, aber immerhin schien er wieder einzuschlummern. Sie beobachtete das Geschöpf: Jetzt streckte es eine Pfote aus und strich ihrem kleinen Bruder behutsam ein paar goldblonde Haarsträhnen aus dem Gesicht. Seine Barthaare strichen dabei flüchtig über James’ Wange, und für einen Moment sah es so aus, als würde er, kaum merklich, im Schlaf lächeln. Und das war der Moment, in dem sich Rowans Leben für immer veränderte. Der Moment, in dem der Lastwagen die Mittelplanke durchbrach und mit ohrenbetäubendem Kreischen von Metall auf Metall in den Wagen ihrer Eltern krachte.
Rowan würde sich für immer und ewig an diese wenigen Sekunden erinnern, an jede noch so winzige grässliche Kleinigkeit. Das Zerbersten der Scheiben, die Sturzflut aus Glaskrümeln, eisigem Wind und Regen. Das Schrammen und Dröhnen, mit dem der Wagen sich unter dem malmenden Gewicht des Lastwagens verformte. James’ hilfloses Schreien, das mit dem ihren verschmolz, als der Wagen der Länge nach herumgewirbelt wurde wie ein Ahornsamen und irgendwann auf dem Dach zu liegen kam. Zerrissene Postkarten umflatterten ihren Kopf wie zerfetzte Elfenflügel.
Sie würde sich an ihren sehnlichsten Wunsch erinnern: dass ihrem kleinen Bruder bitte, bitte nichts passieren solle bei diesem schrecklichen Unglück … und daran, wie sich die hässliche, namenlose Elfenkreatur plötzlich riesengroß aufblähte und sich über James warf und ihn in einer pelzigen, schützenden Hülle umfing.
Sie würde sich an die aufblitzenden Lichter erinnern und daran, wie die eine Seite des Wagens weggeschnitten wurde; wie sie geschrien hatte, als man sie herauszog und ihren Arm brechen musste, um das tun zu können. Und nie, niemals in ihrem Leben würde Rowan das vergessen, was ihr in diesen Sekunden am meisten Angst machte – die Totenstille im zertrümmerten vorderen Teil des Wagens.
3
ls Red mühsam wieder zu sich kam, spürte sie sofort, dass sie Erdkrumen im Mund hatte. Sie spie angeekelt aus, dann presste sie sich die Hände gegen den schmerzenden Kopf. Schon jetzt konnte sie die Beule fühlen, die an ihrer Schläfe entstand. Dünne Lichtstrahlen von oben hellten die dämmrige Umgebung ein wenig auf. Sie schaute sich um; ihr Blick wurde hart.
Sie war in eine Art Loch gestürzt, so viel stand fest. Unter sich ertastete sie ein Durcheinander aus zerfetzten Zweigen, Ästen und Wurzeln; sie fühlten sich an wie zerstückelte Gliedmaßen. Ihr tat alles so weh, als hätte jemand auf sie eingetreten. Sie streckte die Hände aus, berührte ringsum nichts als Mauern aus purer Erde und schluckte trocken. Feuchte Erdklümpchen klebten an ihren Fingerspitzen. Sie spürte Wurzeln, die aus der Schachtwand herausragten, manche winzig, manche dick. Sie stützte sich ab und kam auf die Füße, bereit, sich ihrer wachsenden Angst zu stellen – der Angst davor, von einer der Henkerswaldkatakomben verschluckt worden zu sein, einer der sieben berüchtigten prähistorischen Bodenhöhlen in diesem Teil des Waldes. Ob diese Höllenlöcher mit ihren Tunnellabyrinthen wohl im Elfenreich genauso existierten wie in der Welt der Sterblichen? Sie grübelte darüber nach und vergaß das Ganze erst, als sie die Äste und Zweige sah, mit der die Lochöffnung nur knapp drei Meter über ihr locker abgedeckt worden war.
Tageslicht sickerte durch die Bresche, die sie bei ihrem Sturz gerissen hatte. Nein, das hier war keine Bodenhöhle, begriff sie. Dies hier war schlimmer. Mehr und mehr klärte sich ihr Verstand; sie konnte wieder logisch denken. Erneut strich sie mit den Händen über das Erdreich, und jetzt wusste sie, was ihr beim ersten Mal entgangen war: Diese Wände waren auf keinen Fall natürlichen Ursprungs. Abgesehen von dem Wurzelwerk waren sie zu glatt. Dieses Loch war aus einem ganz bestimmten Grund gegraben worden.
Dieses Loch war eine Fallgrube.
Ruhig ließ sie sich wieder nieder und ignorierte den Adrenalinstoß, der sie durchbrauste. Sie hatte schon schlimmere Situationen gemeistert und dabei gelernt, dass sie sich am allermeisten schadete, wenn sie jetzt in Panik geriet. Rasch überschlug sie die Abmessungen der Falle. Der Durchmesser des Schachts betrug etwa einen Meter fünfzig, seine Tiefe rund drei Meter. Mit ein bisschen praktischem Geschick und dem richtigen Werkzeug musste es ihr gelingen, hier herauszukommen. Sie zog ihr Messer und rammte es mit einem kraftvollen Stoß in die Wand. Mühelos fuhr es hinein und steckte fest. Red lehnte sich auf den Griff und testete den Halt. Die Klinge hielt unverrückbar; sie würde ihr Gewicht tragen. Mit einiger Anstrengung zerrte sie das Messer wieder heraus, dann stand sie auf und hielt Ausschau nach ihrer Ausgangsbasis für den Aufstieg.
Ihr gegenüber bewegte sich etwas in der Düsternis. Red verharrte reglos. Dumm! Sie hatte keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, dass sie hier unten möglicherweise nicht allein in der Falle saß. Wachsam machte sie einen weiteren Schritt und lauschte angestrengt. Da war es wieder: ein Scharren im Laub und auf vertrockneten Zweigen, begleitet von einem kaum hörbaren Laut. Ein Wimmern. Langsam ging sie in die Hocke und packte einen dünnen Ast, der von oben heruntergefallen war. Damit begann sie im Laub zu stochern, es anzuheben und durchzuharken. Beim dritten Versuch berührte der Stecken etwas und Rowan starrte auf einen abgemagerten jungen Fuchs hinab. Mitleiderregend deutlich zeichneten sich seine Rippen unter dem Fell ab.
Er starrte zurück, mit dem abgestumpften, hoffnungslosen Blick einer Kreatur, die sich in ihr Schicksal ergeben hatte und auf den Tod wartete. Es sah nicht danach aus, als müsste das arme Kerlchen noch lange warten. Ein Gedanke durchzuckte sie: Das Wasser in meiner Flasche. Dann riss sie sich zusammen, sperrte alles Mitleid aus ihrem Herzen aus und wandte sich wieder ihrer selbst gestellten Aufgabe zu. Sie musste an ihr eigenes Überleben denken. Wenn der Fuchs vor Durst starb, dann bedeutete das nichts anderes, als dass er schon ein paar Tage lang in dieser Falle saß. Die Chancen standen gut, dass ihr dasselbe Los drohte.
Bald darauf fand sie, wonach sie gesucht hatte, einen dicken Wurzelstrunk, der gut einen Meter über dem Boden aus dem Erdreich wuchs. Sie testete, ob er ihr Gewicht trug. Der Strunk rührte sich nicht. Sie stieg darauf und tastete an der Wand über sich umher, suchte nach etwas, woran sie sich festhalten konnte. Ihre Fingerspitzen berührten einen Steinbrocken, der fest im Erdreich verankert saß. Ermutigt stieg sie nach unten. Jetzt brauchte sie etwas, was sie zwischen der Wurzel und dem Stein in die Wand treiben konnte, sodass es ihr als weiteres verlässliches Steigeisen diente. Auf Händen und Knien machte sie sich auf die Suche. Ein Stück Holz wäre ideal gewesen – ein tragfähiger Ast, den sie mit ihrem Messer anspitzen und dann in die Wand der Fallgrube schlagen konnte.
Da machte sie eine zweite Entdeckung. Sie strich kurz mit der Hand darüber, als sie in einem Laubhaufen wühlte. Seltsamerweise wusste sie sofort, was es war, noch bevor sie es herauszog und sich anschaute. Ihre Haut prickelte, als sie den Gegenstand in den Lichtstreifen hielt. Es war ein kleiner gelber Schuh. Ein Kinderschuh … mit winzigen aufgenähten Blumen. Der muss einem kleinen Mädchen gehört haben, sagte sie sich. Einem kleinen Mädchen … nicht älter als drei oder vier Jahre, das in diese Falle gestürzt war. Ein kleines Mädchen, ganz allein im Dunkeln. Was wohl aus ihm geworden war? Plötzlich hatte Red Angst. Mit den Fingern kratzte sie festgebackenes Erdreich aus dem Schuh, dann stand sie eine Weile einfach nur da, hielt ihn in der Hand und starrte ihn an. Er sah aus, als würde er schon lange hier unten liegen. An manchen Stellen war das Leder weggefault, aber das Etikett im Innern bestätigte, dass er aus der Menschenwelt stammte. Sie schauderte und ließ ihn fallen. Er hatte einem Kind gehört, einem Kind mit einem Namen und einer Familie. Mit Eltern und vielleicht sogar einem Bruder, die sie vermissten. Einem Kind wie James.
Sie versuchte sich einzureden, dass, wer – oder was – auch immer diese Fallgrube ausgehoben hatte, sie bestimmt nur dazu nutzte, um wilde Tiere zu fangen. Ein Jäger, dem es nur um etwas zu essen ging. Dass das kleine Mädchen in dieses Loch gefallen war, musste ein Unfall gewesen sein – aber andererseits, wenn sie gerettet worden war – warum hatte man dann ihren Schuh hier unten zurückgelassen?
Sie merkte, dass sie drauf und dran war, die Nerven zu verlieren, und schaute zu dem Fuchs hinüber. Er beobachtete sie mit seinem leeren Bernsteinblick. Ganz gleich, wer diese Falle hier angelegt hatte – dieses arme Geschöpf würde ihm nichts mehr nützen; es bestand nur noch aus Haut und Knochen. So gab es nicht einmal mehr eine richtige Mahlzeit für die Krähen ab. Obwohl Red vorhin den Entschluss getroffen hatte, hartherzig zu sein, wusste sie mit einem Mal, dass sie ihn nicht einfach sterben lassen konnte. Langsam ging sie zu ihm und kniete sich neben ihm nieder. Er schaute zu ihr hoch und versuchte wegzukriechen. Sie hörte sein schwaches, kehliges Knurren – kaum mehr als die lächerliche Andeutung eines Knurrens. Immerhin, das war ein vielversprechender Anfang. Noch glühte also ein Funke Kampfgeist in ihm. Sie zerrte die Wasserflasche und eine flache Blechschale aus ihrem Rucksack. Letztere diente ihr normalerweise als Teller – wenn sie denn etwas zu essen hatte. Dann goss sie sorgfältig gerade so viel Wasser hinein, dass das arme Kerlchen in seiner Gier nicht zu schnell zu viel saufen konnte. Sie tauchte ihre Finger ein und ließ ein paar kühle Tropfen auf seine heiße, trockene Nase fallen, bevor sie die Schale so dicht wie möglich vor seine Schnauze stellte und dann an die gegenüber aufragende Wand zurückwich. Sie hatte getan, was in ihren Möglichkeiten stand. Jetzt lag es an dem Fuchs.
Sie stöberte weiter im Laub und beförderte letzten Endes tatsächlich einen robusten Ast zutage. Sie zerbrach ihn unter ihrem Stiefelabsatz in zwei Teile, schnappte sich das erste Stück und begann es mit energischen Messerschnitten anzuspitzen. Aus den Augenwinkeln heraus beobachtete sie den Fuchs. Seine Zunge schnellte hervor, er schleckte sich die Tropfen von der Nase.
»Armer Kerl«, murmelte Red. Die Ohren des Fuchses zuckten schwach, als er ihre Stimme hörte. Zu ihrem Erstaunen hob er den Kopf und reckte sich der Schüssel entgegen.
»Na los«, flüsterte sie ermutigend.
Der Fuchs senkte seine Schnauze zum Wasser hinab und begann langsam zu trinken. Wachsam behielt er sie dabei im Auge. Nur ein paar Sekunden darauf hatte er seinen allerschlimmsten Durst offenbar gelöscht und ruhte sich aus. Red schöpfte neue Hoffnung.
In den folgenden Minuten arbeitete sie beständig weiter; sie spitzte das Aststück so an, dass sie es als Pflock verwenden konnte, dann nahm sie sich die zweite Hälfte vor. Nach ein paar Minuten hob der Fuchs den Kopf erneut, schlabberte ein bisschen und ruhte sich wieder aus. Schon jetzt schimmerte neuer Lebenswille in seinen Augen. Red konzentrierte sich auf ihre Aufgabe. Der Fuchs hob von Zeit zu Zeit den Kopf, trank, sammelte seine Kräfte, trank. Als die Schüssel leer war, füllte sie wieder nach und lauschte dem geräuschvollen Schlabbern des Fuchses. Sie fragte sich, ob sie genügend Wasser hatte, um ihn zu retten – denn der Fallensteller würde bestimmt Mitleid haben mit dem abgemagerten Geschöpf und es freilassen. Wenn das Wasser nicht reichte, dann verlängerte sie mit ihrer Hilfe sein Leiden nur. Sie verdrängte diesen Gedanken. Sie war bereit, ihren Plan in die Tat umzusetzen.
Sie zog einen ihrer Stiefel aus und schlug mit dem Absatz den ersten Pflock in Hüfthöhe in die Wand aus Erde – ungefähr auf halber Strecke zwischen dem Wurzelstrunk und dem Steinbrocken, die sie vorhin ausfindig gemacht hatte. Hieb für Hieb rammte sie den ersten Pflock tiefer. Schweiß kribbelte auf ihren Unterarmen. Dann war der erste selbst gefertigte Teil ihrer Trittleiter stabil in der Schachtwand verankert; gerade so viel ragte noch heraus, um ihrem Fuß Halt bieten zu können. Den Stiefel noch immer in der Hand, stieg sie auf den zuunterst liegenden Wurzelstrunk, krallte sich mit der freien Hand an dem dickeren Steinbrocken oberhalb ihres Kopfes fest, wagte sich auf den Pflock, den sie gerade erst in die Erde getrieben hatte, und richtete sich behutsam auf. Jetzt kam der knifflige Teil: Den zweiten Pflock musste sie einschlagen, während sie hier, ohne festen Boden unter den Füßen, unsicher an die Wand geschmiegt, auf ihrer Trittleiter balancierte. Sie musste es zumindest versuchen. Und genau an dieser Stelle begann alles schiefzugehen.
Sie setzte den Pflock an, drückte ihn fest gegen die Wand und holte mit ihrem Stiefel aus – und von oben krümelte ihr lockeres Erdreich entgegen, zuerst nur wenig, dann, nach dem ersten Schlag, brachen ganze Erdklumpen los, die Wand über ihr schien sich aufzulösen. Ein Schauer aus Krumen, nur durch dünne Wurzeln noch zusammengehaltenen Brocken und sogar feinstem Sand regnete auf sie herab. Staub geriet ihr in die Augen. Sie hielt die Luft an, entschlossen, nicht einzuatmen, und fuhr fort, auf den Pflock einzuhämmern. Es nutzte nichts. Das brüchige Erdreich weiter oben, an der Öffnung, bot dem Pflock keinen Halt. Frustriert kletterte Red wieder nach unten, schüttelte sich Erde, Sand, Staub aus den Haaren und klopfte ihre Kleider sauber. Ihr Plan würde nicht funktionieren.
Sie wischte sich den Schweiß von den Augenbrauen und trank ein Schlückchen Wasser. Ab jetzt würde sie es rationieren müssen – denn es war unmöglich vorherzusagen, wie lange sie in diesem Loch festsitzen würde. Sie blickte zu dem Fuchs hinüber, und es kam ihr so vor, als würde er ein bisschen munterer dreinschauen, trotz aller Schwäche.
»Sieht so aus, als hätten wir beide nicht nur den gleichen Namen«, sagte sie zu ihm. »Wir sitzen hier unten auch in der gleichen Klemme.«
Kaum hatte sie den Satz ausgesprochen, da hörte Red ein Geräusch – von oben. Etwas näherte sich durch den Wald. Alle Erschöpfung war vergessen. Blitzschnell huschte sie in den Schlagschatten der Äste und Zweige, mit denen die Fallgrube abgedeckt war, und presste sich dort gegen die Wand. Kurz war alle Helligkeit ausgesperrt und das Loch in Finsternis getaucht; etwas verdunkelte die Bresche, die sie bei ihrem Sturz in die Abdeckung der Falle gerissen hatte. Dann wurde ein Ast, ein Zweig nach dem anderen weggehoben. Jetzt wusste sie, dass sich kein Tier dort oben zu schaffen machte, oder jemand, der nur zufällig hier vorbeigekommen war. Das musste der Fallensteller sein. Als helles Tageslicht den Schacht ausfüllte, machte sich Red keine Illusionen mehr. Es war sinnlos, zu versuchen, sich versteckt zu halten. Noch ein paar Sekunden und sie konnte sich nirgends mehr verbergen.
Beherzt trat sie aus dem Zwielicht, legte den Kopf in den Nacken und blinzelte ins Licht hinauf. »Hallo?«, rief sie. Sonnenschein blendete sie. Davor ragte ein Schatten auf; eine Gestalt in einem zerlumpten Mantel, dessen Kapuze tief ins Gesicht gezogen war und unter der lange graue Haarsträhnen hervorwucherten.
Red erkannte sie sofort. Die alte Frau!
Tausend widersprüchliche Gefühle wirbelten in ihr durcheinander. Ein Schimmer der Erleichterung darüber, dass sie gefunden worden war, wurde erstickt von Unsicherheit und Zweifeln. Wenn die alte Frau der Fallensteller war – wie hatte sie es geschafft, das Loch auszuheben? Sie sah viel zu zerbrechlich aus für solch eine Aufgabe. Dann wieder schoss ihr ein anderer Gedanke durch den Sinn: Vielleicht war diese Falle schon alt, jemand anders hatte sie gegraben, und die alte Frau hatte sie nur gefunden und beanspruchte sie jetzt für sich.
Wortlos warf die Alte etwas in das Loch herab. Reds Besorgnis schmolz, als sie ein robust aussehendes Seil mit in regelmäßigen Abständen darin eingeknüpften großen Knoten ausmachte. Die Frau half ihr, hier herauszukommen. Dankbar packte sie zu und ruckte probeweise daran. Das Seil hielt. Rasch nahm sie ihre winzige Campingschale, die noch immer vor dem Fuchs stand, und schob sie in ihren Rucksack. Der Fuchs setzte sich jetzt auf und spähte mit furchtsamen Augen nach oben ins Licht. Red warf ihm einen letzten Blick zu und hoffte, dass sie die alte Frau dazu überreden konnte, ihn laufen zu lassen – er war ohne jeden Zweifel völlig wertlos für sie. Dann machte sie sich an den Aufstieg. Anfangs konnte sie noch den Wurzelstrunk, ihren eigenen Pflock und den Steinbrocken nutzen, aber auf halbem Weg nach oben, als ihre wund gescheuerten Hände die Hauptlast ihres Gewichts tragen mussten, schossen ihr Tränen des Schmerzes in die Augen. Als sie den Schachtrand erreichte, zitterte sie am ganzen Körper vor Erschöpfung. Sie warf den ersten Arm über den Rand und krallte sich im Boden fest, gleich darauf den zweiten. Die alte Frau stand schweigend vor ihr, das Gesicht wie schon bei ihrer ersten Begegnung dunkel überschattet von der schweren Kapuze. Sie beugte sich vor und streckte Red die Hand entgegen. Dieses Mal blieb Red keine andere Wahl, als sie zu ergreifen.
Die knorrigen Finger der alten Frau packten zu und ein leiser Atemstoß war zu hören; zuerst nahm Red an, es sei ein Aufstöhnen, weil sie zu schwer war. Aber als Red näher an sie herangezerrt wurde, überwältigte sie der scheußliche Gestank dieses kleinen Ausatmens und plötzlich wurde es mehr als nur ein Seufzen. Es roch nach Fäulnis und Verfall. Sie brach vor der Frau in die Knie; gerade dass sie noch einen einzelnen schnellen Blick auf das erhaschte, was unterhalb der Kapuze verborgen lag. Auf diesen schmallippigen roten Mund, der sich zu einem abscheulichen Grinsen verzogen hatte.
Noch immer hielt die alte Frau mit einer Hand Reds Linke wie mit einer Stahlklammer gepackt und holte gleichzeitig mit der anderen Faust aus. Hilflos musste Red mit ansehen, wie sie auf sie herabsauste … und ihr einen mörderischen Hieb gegen den Kopf verpasste.
Der Schlag warf Red zu Boden, trotzdem verlor sie nicht die Besinnung. Sie hörte einen dumpfen Laut, das schmerzerfüllte Stöhnen eines Lebewesens – und wusste, dass sie selbst diesen Laut von sich gegeben hatte. Ein anderes Geräusch mischte sich damit: das gackernde Lachen des Wasserspeierwesens in den Bäumen oben. Sie versuchte, sich hochzustemmen. Unmöglich. Sie war gezwungen, hilflos auf der Seite liegen zu bleiben. Ihr Sichtfeld verdunkelte sich. Sie hatte nicht die Kraft, sich zu wehren, als ihr die Handgelenke nach hinten gerissen und wie die Füße gefesselt wurden.
Vor sich sah sie die Frau, sie beugte sich über das klaffende Loch und hievte etwas nach oben. Der Fuchs hatte sich in einem engmaschigen Netz verheddert; winselnd kämpfte er schwach dagegen an. Jetzt wandte sich die Frau wieder Red zu und warf auch über ihr etwas aus. Etwas Raues und Kratziges wurde über Reds Kopf zusammengerafft und zugeschnürt, dann wurde sie über den Boden geschleift. Steine zerkratzten ihr den schmalen Rücken.
»Wer bist du?«, keuchte Red. »Warum machst du das? Lass mich gehen!«
Die Frau gab keine Antwort. Red verdrehte und wand ihre Hände in den Fesseln, tastete nach ihrem Messer und wusste längst, dass es weg war. Die Frau hatte sie niedergeschlagen und sofort entwaffnet. Durch grob gewebten Leinenstoff konnte Red das Sonnenlicht erkennen, das durch die Äste über ihr flackerte. In ihrem Kopf pochte es. Noch immer kreischte das Etwas in den Bäumen gellend; die Schreie wurden leiser, je länger sie durch den Wald geschleift wurde.
Bald hatte sie sich gut genug von dem Schlag erholt. Ihr Kampfgeist war wieder da; sie bäumte sich auf. Die Benommenheit in ihrem Kopf wich, aber die Frau schenkte ihr keine Beachtung. Also brüllte Red wütend los, aber auch das brachte ihr nichts als Heiserkeit ein. Sie gab ihren lautstarken Protest bald auf, als ihr klar wurde, wie auffällig sorglos die Frau sich benahm. Das konnte nur eines bedeuten: Hier war weit und breit niemand, der sie hören konnte.
Als die Frau anhielt, wand Red sich in der Enge des Sacks herum. Es roch schrecklich hier drin, überall waren dunkle Flecken zu sehen. Sie presste ihr Gesicht trotzdem gegen das kratzige Sackleinen und blinzelte durch die Maschen. Da stand ein kleiner hölzerner Karren. Die Frau klinkte die Rückwand der Ladefläche auf, dann fühlte Rowan sich hochgerissen und vorwärtsgeschoben. Schmerzhaft landete sie auf der Ladefläche des Karrens. Der Fuchs wurde achtlos hinter ihr hergeworfen. Mit einem kaum merklichen Aufprall landete sein dürrer Körper auf ihr, glitt zur Seite und blieb lang ausgestreckt neben ihr liegen. Dann ein metallischer Schlag, als der Riegel wieder einrastete. Sie war auf der Ladefläche eingesperrt. Keine Chance, sich herunterrollen zu lassen – oder gar zu springen. Als Nächstes hörte sie ein Quietschen und Scharren über sich, und als sie versuchte, sich aufzusetzen, stellte sie fest, dass zusätzlich auch noch eine Art Netz über die Ladefläche gespannt war und sie zwang, liegen zu bleiben.
»Wohin bringst du mich?«, schrie sie. »Bitte – lass mich gehen! Du musst mich gehen lassen!«
Ihr Protest stieß auf taube Ohren. Wenn die Frau sie hörte, so zeigte sie es nicht. Stattdessen hörte Red, wie sie sich zum vorderen Teil des Wagens bewegte. Gleich darauf rumpelte er über unebenen Boden los.
Neben sich spürte sie den Fuchs. Er zitterte vor Angst, sein Atem kam ganz flach. Als der Karren nicht lange darauf anhielt, hatte der Fuchs ganz aufgehört, sich zu bewegen. Red hörte, wie das Netz zurückgeworfen und die Rückwand der Ladefläche wieder entriegelt wurde, dann knarrte etwas: eine Tür. Der Sack wurde oben gepackt; erneut bekam Red zu spüren, dass sie achtlos mitgezerrt, von dem Karren gewuchtet und weitergeschleift wurde – über eine Türschwelle und auf harten Boden. Aus der Kälte, die durch den Stoff sickerte, schloss Red, dass es ein Steinboden war. Nur Sekunden später wurde der Sack aufgeschnitten und sie sah ihre Vermutung bestätigt.
Sie lag in einer kleinen, zugigen Hütte. Die Wände waren aus Feldsteinen gemauert und nicht verputzt, es gab eine Holztür und kleine, windschiefe Fenster. In der am weitesten entfernten Ecke hing ein großer schwarzer Kessel über einem Feuer. Im Kessel blubberte es, dichte Dampfschwaden blähten sich darüber. Geschichten von bösen alten Hexen, die im Wald hausten, wirbelten durch Reds Kopf. Außerdem herrschte in der Hütte ein ekelerregender Gestank. Als Red den Kopf hob, ragten über ihr die Balken eines niedrigen, mit Stroh gedeckten Daches auf – und ein grausiger Anblick bot sich ihr. Plötzlich hatte sie eine Erklärung für den Gestank.
Unzählige Tierhäute aller Art waren an den Dachsparren aufgehängt; einige groß, andere klein, ältere, die bereits getrocknet waren, und frisch abgezogene, von denen es noch grotesk tröpfelte. Sie erkannte die Felle von Dachsen, Hasen, Füchsen, Rotwild und Eichhörnchen, aber es gab noch viele andere, die sie nicht identifizieren konnte. Der Geruch, der durch ihre Nase schon in sie hineinkroch, war der Gestank des Todes. Mit Tieren überfüllte Holzkäfige säumten in langen Reihen die Hüttenwände. Die Geschöpfe hinter den Gittern lebten noch, aber Red sah es ihren Augen an, dass sie wussten, welches Schicksal sie erwartete. Sie hatten vieles mit angesehen, sie wussten Bescheid.
Sie krümmte und wand sich und kämpfte verzweifelt darum, ihre Fesseln zu lockern. Die Frau hatte die Hütte verlassen, sie war draußen unterwegs und entlud den Karren. Nur zu schnell kam sie zurück, warf einen kleineren Sack auf den Hüttenboden – und verschwand wieder. Der Sack prallte gegen Red, und sie wusste, darin war der Fuchs eingesperrt. Sie schlängelte sich so herum, dass sie ihn mit ihren gefesselten Händen berühren konnte. Durch den Leinenstoff hindurch spürte sie den jämmerlich abgemagerten Körper. Völlig reglos lag er, aber er war immer noch warm. Red wusste sofort, dass er tot war, und sie war froh darüber, denn so blieb ihm wenigstens erspart zu erfahren, was ihm letzten Endes bevorstand – im Gegensatz zu den armen Wesen in den Käfigen ringsum. Sie rührte sich nicht, als die Gestalt der Frau einmal mehr die Türöffnung ausfüllte, und beobachtete aus zusammengekniffenen Augen, wie ein Korb voller Kräuter und Heilpflanzen direkt hinter der Türschwelle abgestellt wurde. Als die Frau zum dritten Mal hinausging, sah Red sich in der Hütte gehetzt nach etwas um, was ihr als Waffe dienen konnte, egal was. Sie hatte mächtig gute Augen. Der Griff des kleinen Messers fiel ihr sofort auf; es lag auf dem Herd, neben einem Berg Gemüse. Wie eine Raupe wand sie sich über den steinernen Boden darauf zu und verfluchte, dass die Feuerstelle im hintersten Winkel der Hütte war. Sie hatte kaum die Hälfte der Strecke geschafft, als hinter ihr ein asthmatisches Lachen laut wurde. Die Frau war wieder da.
Red erstarrte und schluckte hart. Widerstrebend wälzte sie sich herum. Die Frau starrte sie an, ein nachdenklicher Ausdruck lag auf ihrem runzligen Gesicht. Red bot alle Kraft auf, die sie noch hatte, schnellte sich wieder zurück und stieß und ruckte sich verbissen weiter – dem Messer entgegen. Natürlich war sie viel zu langsam, viel zu ungeschickt, und die Frau hatte die Hütte durchquert und war über ihr, bevor sie auch nur in die Nähe des Herds hatte kommen können. Red wurde an den Knöcheln gepackt und ins Zentrum der Hütte zurückgezerrt. Dann schob die Frau langsam und bedächtig die Kapuze zurück, griff sich in die verfilzte Haarflut, zupfte eine kräftige graue Locke heraus und ließ sie zu Boden fallen. Sie landete neben Red. Kleine Stofffetzen waren darin eingeflochten sowie ein winziges, patiniertes Medaillon. Es war aufgeklappt, zwei Porträtbilder konnte man darin sehen: das eines Mannes und einer Frau.
Verwirrt starrte Red hoch – und schnappte nach Luft. Die alte Frau verwandelte sich vor ihren Augen. Ihre Haare wurden heller und glatter, bis sie honigblond leuchteten. Jetzt blitzten ihre Augen bernsteinfarben, die Gliedmaßen streckten und verschlankten sich. Binnen weniger Sekunden war aus dem verhutzelten alten Weib, dem sie am Fluss begegnet war, eine weit jüngere Frau geworden. Sie hatte ein schmales, hartes Gesicht; ein grausamer Zug lag um ihren Mund.
Es schien, als sei dies eine völlig andere Person.
Jetzt, da sie ihre Verkleidung abgeworfen hatte, bewegte sie sich viel schneller. Geschmeidig ging sie neben Red in die Hocke, packte sie mit einer Hand bei den Haaren und zwang ihren Kopf zurück. Red zuckte zusammen, schaffte es jedoch, einen Schmerzenslaut zu unterdrücken. Die Frau war noch nicht fertig mit ihr. Mit der anderen Hand umfasste sie Reds Kinn und verdrehte ihren Kopf, bis er unangenehm zur Seite gedrückt war. Wie bewundernd starrte sie Red an.
»Du bist mir ja eine richtig Muntere«, stellte sie mit weicher Stimme fest. »Als ich von deiner Ankunft hörte, habe ich mich so schnell wie möglich auf den Weg gemacht. In nichts Geringerem als meiner besten … Menschenhülle … trotzdem bist du nicht darauf hereingefallen, nicht einmal der Anblick einer hilflosen alten Frau konnte dich täuschen.« Sie seufzte leise und sprach nicht gleich weiter, und Red war einmal mehr dem fürchterlichen Gestank ausgesetzt, den sie ausatmete; einem Gestank nach toten und verrottenden Dingen. »Es ist lange her, dass ich etwas so Junges hatte«, wisperte die Frau. »Aber ich bin für einen Wechsel bereit. Du wirst sehr … nützlich sein.«
»Wovon redest du?«, stieß Red entsetzt hervor. »Was meinst du damit?«