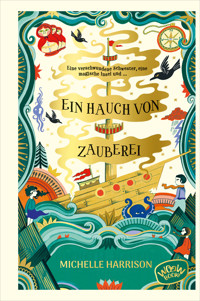
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Woow Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Widdershin-Schwestern
- Sprache: Deutsch
Mithilfe von drei magischen Gegenständen konnten Betty, Fliss und Charly den jahrhundertealten Fluch brechen, der auf ihrer Familie lastete. Doch das nächste Abenteuer wartet schon auf die Schwestern, denn ein sonderbares Mädchen steht vor dem Haus, das ein Irrlicht in seiner Tasche versteckt. Und dann ist plötzlich Charly spurlos verschwunden. Um sie wiederzufinden, müssen Betty und Fliss zu einer geheimen Insel reisen, die auf keiner Landkarte existiert …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Michelle Harrison
Ein Hauch von Zauberei
Aus dem Englischen von Mareike Weber
© Atrium Verlag AG, Imprint WooW Books, Zürich 2020
Alle Rechte vorbehalten
© Michelle Harrison 2020
Aus dem Englischen von Mareike Weber
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel A Sprinkle of Sorcery bei Simon & Schuster UK Ltd, London
Lektorat: Maren Jessen, Hamburg
Coverillustration: Melissa Castrillón
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-96177-545-3
www.WooW-Books.de
www.instagram.com/woowbooks_verlag
In liebevoller Erinnerung
an Fred Clifford, 1950–2017
Ein geborener Athlet
Liebe Leser,
als ich ungefähr elf Jahre alt war, wollte ich nach einem Streit von zu Hause weglaufen. Ich trug meinen kleinen Koffer zum Haus meiner Tante und meines Onkels, die zwei Straßen weiter wohnten, und beschloss, nie wieder zurückzukehren. Nachdem meine Tante Tee gekocht und sich meine Sorgen angehört hatte, sagte sie: »Ich denke, es ist Zeit, dass wir deine Mum anrufen und ihr sagen, wo du bist, meinst du nicht?« Und eine Weile später kam Mum vorbei, um mich abzuholen.
Wenn ich heute auf dieses Erlebnis zurückblicke, muss ich schmunzeln, aber es hat mir einen Denkanstoß gegeben: Was würde jemand erleben, der weggelaufen ist, ohne genau zu wissen, wohin? Jemand, der nicht zurückkann, weil es zu gefährlich ist? Als ein fremdes Mädchen im Wildschütz auftaucht, geraten die Widdershins-Schwestern Betty, Fliss und Charlie kopfüber in ein magisches Abenteuer. Ein Abenteuer um eine geheimnisvolle Landkarte, ein verfluchtes Schiffswrack und eine alte Legende, in der womöglich mehr als ein Körnchen Wahrheit steckt …
Macht euch bereit, die Schwestern auf einer Reise ins Unbekannte fern von Krähenstein zu begleiten, beschützt nur durch einen Hauch von Zauberei. Doch nehmt euch vor den Piraten in Acht!
Ein tollkühnes Leseabenteuer wünscht euch
Michelle Harrison
Prolog
Es war einmal eine mächtige Hexe, die lebte am Rande einer Marsch. Ganz einsam lebte sie dort, doch sie hatte einen Gefährten: einen großen schwarzen Raben.
Jeden Tag kamen Menschen zu ihr, um ihren Beistand zu suchen, und jeden Tag half die Hexe ihnen, ohne mehr als eine kleine Geste oder einen kleinen Gefallen dafür zu verlangen. Ihr Zauber konnte vieles heilen: von kleinen Warzen bis zu großen Sorgen; von gebrochenen Fingern bis zu gebrochenen Herzen.
Eines Tages bekam sie Besuch vom Herrscher des Landes, der in Verkleidung erschien. Der Lord war ein grausamer Mann. Er hatte von der Hexe und ihrer Zauberkunst gehört und konnte es nicht ertragen, dass jemand reicher oder mächtiger sein sollte als er. Beruhigt stellte er fest, dass die Hexe alles andere als reich war, doch dann geschah etwas Unerwartetes: Der Lord begann sich in die Hexe zu verlieben. Die Hexe allerdings erwiderte seine Gefühle nicht, selbst als der Lord seine Tarnung fallen ließ und sich zu erkennen gab.
Der Lord konnte die Hexe nicht vergessen und kehrte zurück, um sie zu besuchen. Er konnte nicht verstehen, warum die Hexe seine Liebe nicht erwiderte. Erzürnt befahl er seinen Schergen, sie zu blenden. »Wenn du mich nicht sehen und lieben willst, dann sollst du niemanden sehen«, verkündete er. Doch die Männer des Königs hatten Mitleid mit ihr und ließen ihr ein Auge.
»Du kannst mir mein Auge nehmen«, sagte die Hexe zum Lord, »aber ich werde dich immer klar sehen.« Und sie verzauberte einen alten Stein mit einem Loch in der Mitte, damit dieser Hühnergott ihr als magisches Auge das verlorene ersetzte.
Als der Lord zum dritten Mal zurückkam und sich die Gefühle der Hexe für ihn noch immer nicht geändert hatten, geriet er erneut in Zorn. Dieses Mal forderte er, dass man ihr die Stimme nehmen sollte.
»Wenn du nicht sagen willst, dass du mich liebst«, donnerte er, »dann sollst du überhaupt nicht sprechen.« Und er befahl seinen Männern, ihr die Zunge aus dem Mund zu schneiden und sie in die Marsch zu werfen. Doch nachdem der Lord gegangen war, krächzte der Rabe der Hexe mit einer heiseren, knarzenden Stimme: »Du hast mir vielleicht meine Zunge genommen, aber du wirst mich nie zum Schweigen bringen.«
Bei seinem letzten Besuch sah der Lord, was er der Hexe angetan hatte, und konnte ihren Anblick nicht ertragen. »Seht, wie hässlich und seltsam sie ist!«, rief er. »Hört, wie sie durch ihren Raben spricht, diesen Todesboten! Tötet sie!«
Da beschwor die Hexe einen dichten Nebel herauf und floh in einem kleinen Holzboot durch die Marsch. Mit nichts als ihrem Hexenkessel, ihrem Raben und ihrem magischen Hühnergott ruderte sie weit aufs Meer hinaus, bis sie ein winziges Stück Land erreichte. Diese Insel, umgeben von Wasser, so weit das Auge reichte, machten die Hexe und ihr Rabe zu ihrem Zuhause.
Eine ganze Zeit lang lebten die Hexe und der Rabe dort ein einfaches und zufriedenes Leben und wurden von niemandem behelligt. Die Hexe war alt geworden und interessierte sich nicht mehr für die belanglosen Wünsche anderer.
Eines Tages jedoch wurde sie von einer Gruppe Fischer entdeckt, die durch eine launenhafte Strömung in die Nähe der Insel getrieben worden war. Die Hexe hatte Mitleid mit ihnen. Sie blies in eine große Muschel und rief einen Wind herbei, der die Fischer sicher wieder auf den Heimweg brachte. Zu Hause angekommen, erzählten die Fischer von der merkwürdigen Frau, die ihnen auf so magische Weise geholfen hatte. Es dauerte nicht lange, und all dies kam auch dem boshaften Lord zu Ohren. Er war inzwischen verheiratet und hatte die Hexe fast vergessen, aber die Geschichte der Fischer weckte seine Neugier, und er konnte nicht mehr ruhig schlafen, seit er wusste, dass die Hexe am Leben war.
Da nahm der Lord ein Boot und ruderte aufs Meer hinaus, bis er den zerklüfteten Felsen fand, auf dem die Hexe mit ihrem Raben lebte. Zuerst erkannte er sie kaum, denn sie war alt und bucklig und grau, wettergegerbt durch tausend Seestürme. Doch als der Rabe sprach, wusste er, dass sie es war, und auch die Hexe erkannte den Lord wieder.
»Ich bin gekommen, um dich um Vergebung zu bitten«, sagte er. »Ich habe dir Unrecht angetan, und es tut mir leid.«
Die Hexe dachte über seine Bitte nach. Trotz ihres aufwallenden Grolls gegen ihn hatte sie noch immer ein gutes Herz, und so beschloss sie, ihm eine Chance zu geben, seine Untaten wiedergutzumachen.
Sie füllte ihren Hexenkessel mit Meerwasser und warf eine Feder von ihrem Raben und einige Gegenstände hinein, die das Meer angespült hatte: einen alten Stiefel, ein zerrissenes Fischernetz, einen Knopf, ein Buttermesser und ein Hufeisen. Zum Schluss gab sie ihren Hühnergott in die Mischung, den Stein mit dem Loch, der ihr als magisches Auge diente.
Als das Wasser im Kessel verkocht war, hatten sich alle Gegenstände auf die eine oder andere Weise verwandelt. Die Rabenfeder war jetzt ein goldenes Ei. Der Stiefel hatte sich in ein Paar wunderschöne neue Schuhe verwandelt, gefertigt aus feinstem Leder. Aus dem Hufeisen war eine Hasenpfote geworden, wie man sie als Glücksbringer trug, aus dem Knopf ein Umhang von weichstem Samt, aus dem Buttermesser ein juwelenbesetzter Dolch und aus dem Fischernetz schließlich eine Rolle aus festem Zwirn. Nur der Hühnergott blieb unverändert. Die Hexe holte den Stein aus dem Kessel und schleuderte ihn weit ins Meer hinaus.
»Du hast die Wahl«, krächzte der Rabe. »Für was auch immer du dich entscheidest – es wird dich zu dem führen, was du verdient hast. Der Stein ist jetzt eine Insel. Wenn du wirklich Vergebung willst, suche die Insel und bring mir das erste lebendige Etwas, auf das du dort stößt. Wenn du das schaffst, wird dir vergeben. Nimm dir einen Gegenstand aus dem Kessel, aber sei gewarnt: Nur eines dieser Dinge wird dir von Nutzen sein, weil es verzaubert ist. Die anderen werden großes Unglück bringen.«
Die Augen des Lords funkelten listig. »Was gibt es denn noch auf dieser Insel?«
»In ihrem Inneren schlummern unerschöpfliche Reichtümer«, antwortete der Rabe. »Aber darum musst du dich ja nicht kümmern. Du bist ja schon reich.«
Ohne zu zögern, griff der Lord in den Hexenkessel und befühlte die merkwürdigen Gegenstände, bevor er sich schließlich für den Dolch entschied. Dann machte er sich auf den Weg. Fasziniert malte er sich die geheimnisvolle Insel aus, schwor sich aber, dass er dem Befehl der Hexe folgen und mit dem ersten lebendigen Etwas von dort zurückkehren würde. Doch als er sich der Insel näherte, musste er ständig daran denken, was sich wohl in ihrem Inneren befinden mochte.
Ich bin zwar reich, dachte er, aber es gibt Männer, die sind noch viel reicher als ich, und zu denen möchte ich gehören. Es dauerte nicht lange, und seine Augen leuchteten so hell wie die Juwelen, die er sich ausmalte.
»Ich werde das erste lebendige Etwas mitnehmen, das mir begegnet«, sagte er zu sich selbst, »und dann ziehe ich weiter, um die Reichtümer zu finden. Die Hexe wird das nie erfahren, und wenn ich zurückkomme, kann ich ihr immer noch das Gewünschte abliefern.«
Als er sein Boot festmachte, entdeckte der Lord eine kleine verflochtene Wurzel, die in den Felsspalten am steilen Ufer der Insel wuchs. Er rupfte sie aus, stopfte sie in seine Tasche und kletterte dann die Felsen hinauf. In diesem Moment durchbrach ein krachender Donnerschlag die Stille. Der Lord rutschte aus und blieb mit dem Fuß in einer tiefen Felsspalte stecken, die sich plötzlich vor ihm aufgetan hatte. Sosehr er sich auch bemühte, er konnte sich nicht befreien. Nicht einmal der Dolch konnte ihm helfen, denn seine Klinge gab nach und bog sich wie das Schilf im Wind …
Er wurde nie wieder gesehen.
Für den Lord war dies das Ende, doch gleichzeitig war es der Beginn einer Geschichte, die von Generation zu Generation weitererzählt wurde: die Fabel von der einäugigen Hexe, die stets danach strebte, die Habgierigen auszutricksen und die Tugendhaften zu belohnen. Mit der Zeit veränderte sich die Geschichte, doch die Insel blieb, genauso wie die Hexe und der Rabe und die geheimnisvollen Gegenstände, die in den jeweiligen Nacherzählungen verschiedene sein konnten. Manchmal geriet die Geschichte für Jahre in Vergessenheit, doch von Zeit zu Zeit tauchte sie wieder auf und kam den Menschen zu Ohren: den Bedürftigen, den Strebsamen und den Habgierigen. Denn Geschichten können die Menschen überdauern, die sie erzählen, genauso wie Magie.
Und genauso wie eine Geschichte hinterlässt Magie immer eine Spur.
Kapitel 1Der Wildschütz
Die Gefängnisglocke begann kurz nach dem Abendessen zu läuten.
Es war ein tiefes, monotones Dong … Dong …, als würde die Glocke zwischen ihrem dumpfen Raunen immer wieder kurz Luft holen.
Im Schankraum des Wildschütz wiederum schwoll das Raunen der Gäste an wie das prasselnde Feuer im Kamin.
Betty Widdershins hörte auf zu kehren und hob erschrocken den Blick, als das Gemurmel durch die Kneipe ging. Ihre ältere Schwester, Felicity, die alle nur Fliss nannten, wischte gerade eine Bierlache von der Theke. Sie sah auf und begegnete Bettys Blick. Die Glocke war eine Warnung: Geht nicht auf die Straße! Bleibt in den Häusern! Verriegelt eure Türen! Fliss legte ihren Putzlappen zur Seite und begann die Stammgäste zu bedienen, die an die Theke strömten, um sich nachschenken zu lassen. Das Lästern machte die Kunden durstig.
»Da ist jemand ausgebrochen, oder?«, fragte eine mürrische Charlie, die Jüngste der Widdershins-Schwestern. Sie saß am Tresen und zupfte missmutig an einer Rüsche ihres Kleides.
»Ja«, antwortete Betty. Sie dachte zurück an die anderen Male, als die Glocke geläutet hatte. So nah am Gefängnis auf der anderen Seite der Marsch zu leben, war eines der schlimmsten Dinge an Krähenstein. Ausbrüche waren zwar selten, aber sie kamen immer noch vor und versetzten jedes Mal den ganzen Ort in Aufruhr.
»Was für ein Lärm!«, beschwerte sich Charlie und steckte sich die Finger in die Ohren.
»Das kann man wohl sagen!« Die Großmutter der Mädchen, Bunny Widdershins, knallte übellaunig einen Krug Kräftigen Keiler auf den Tresen, und das Bier schwappte ihrem grauhaarigen Kunden über die Hände. »Das ist das Letzte, was wir heute gebrauchen können!« Sie warf dem Kunden einen vernichtenden Blick zu. »Und ich dachte, ich hätte dich gebeten, dich ein bisschen schick zu machen, Fingerty? Schlimm genug, dass wir draußen von lauter Gesocks umgeben sind, da müssen doch unsere Kunden nicht auch noch aussehen wie die letzten Landstreicher!«
»Ich hab mich doch schick gemacht!«, protestierte Fingerty beleidigt, aber er zog trotzdem einen Kamm aus seiner Westentasche und fuhr damit durch seine strähnigen Haare. Bunny stampfte davon, wahrscheinlich, um sich einen ordentlichen Zug aus ihrer Pfeife zu genehmigen.
Fliss schob Fingerty ein Gläschen Portwein zu. »Der geht aufs Haus«, sagte sie mit einem flüchtigen Lächeln. »Aber kein Wort zu Granny.« Fingerty leckte sich die Lippen, und sein mürrischer Gesichtsausdruck wurde weicher.
Betty lehnte den Besen an den nächstgelegenen Kamin und blickte sich um. Sie versuchte, die Kneipe mit den Augen eines Fremden zu sehen. Das war nicht einfach, denn die Widdershins arbeiteten nicht nur im Wildschütz, sie lebten auch dort. Betty war so an den schäbigen Anblick des Hauses gewöhnt, dass ihr die abgewetzten Teppiche und die abblätternde Tapete kaum noch auffielen. Doch heute schien die verschlissene Einrichtung hervorzustechen wie eine Krähe inmitten von Rotkehlchen.
Sie fuhr sich mit der Hand über die feuchte Stirn. Es war eigentlich zu warm, um alle Feuer anzuzünden, aber Granny hatte darauf bestanden, damit die Kneipe gemütlicher wirkte. Betty und ihre Schwestern waren den ganzen Tag damit beschäftigt gewesen, Feuerholz aufzuschichten, den Boden zu wischen und die Zapfhähne zu polieren, bis sie glänzten. Fliss hatte sogar etwas gebacken, um das Haus mit einem heimeligen Duft zu erfüllen. So weit, so gut … wenn Grannys üble Laune die Atmosphäre nicht verdorben hätte.
Betty ging zu Charlie hinüber, die sich jetzt schon zum dritten Mal in zehn Minuten am beschlagenen Fenster herumdrückte.
»Granny sollte nicht so mit Gästen reden«, sagte Charlie. »Oder wir haben bald keine mehr!«
Betty schnaubte. »Glaubst du wirklich? Der Fuchsbräu ist fast zwei Meilen entfernt, und das Bier kostet dort das Doppelte!« Sie beugte sich zum Fenster vor und wischte einen kleinen Flecken frei, um durch die beschlagene Scheibe spähen zu können. »Sie müssten doch längst hier sein.«
»Die sollen sich mal beeilen, damit ich endlich dieses furchtbare Kleid ausziehen kann!«, murrte Charlie und zappelte unruhig. »Vornehme Kleider kratzen einfach wie verrückt!«
»Immerhin sind es zur Abwechslung mal nicht die Läuse, die jucken«, sagte Betty.
Charlie grinste und zog ihre Nase mit den vielen Sommersprossen kraus. Ausnahmsweise sah sie ganz manierlich und präsentabel aus. Ihr braunes Haar war ordentlich gebürstet und mit Schleifchen zu zwei glänzenden Zöpfen gebunden, aber Betty wusste, das würde nicht lange andauern.
»Ich hatte schon ewig keine Läuse mehr«, entgegnete Charlie stolz und steckte ihre Zunge durch die Lücke, wo ihr die zwei Schneidezähne fehlten. »Ganze sechs Wochen!«
»Alle Achtung«, murmelte Betty und starrte geistesabwesend aus dem Fenster. Über den Nestleinpark brach schon die Dämmerung herein, aber man konnte noch ein paar leuchtend bunte Frühlingsblumen erkennen. Die Blütenköpfe nickten im Wind, der über das Gras strich und das Schild an der Hauswand des Wildschütz quietschen ließ. Betty musterte das Schild, dessen große Aufschrift hin und her schwang wie eine winkende Hand, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte: ZUVERKAUFEN.
»Sie kommen bestimmt«, sagte Betty, aber mit jeder verstreichenden Minute war sie sich da weniger sicher. Das Schild quietschte noch einmal, und es klang fast wie ein gehässiges Lachen. Eine schwarze Krähe hatte sich darauf niedergelassen, und während sie Betty mit glänzenden Knopfaugen anstarrte, hockte sich eine zweite Krähe dazu und dann eine dritte. Ein alter Krähenspruch ihrer abergläubischen Großmutter kam ihr in den Sinn.
Eine bringt Marschnebel,
zwei bringen Sorgen,
drei eine lange Reise am Morgen …
Betty beobachtete, wie die dritte Krähe sich in die Luft erhob und nur noch zwei zurückblieben. Sie glaubte doch gar nicht an all diesen Unsinn, warum also war sie so nervös?
»Ihr werdet sehen, bis zum Frühling ist die Kneipe verkauft«, hatte Vater zu ihnen gesagt, nachdem er das Schild in der ersten Woche des neuen Jahres angebracht hatte. Aber der Wildschütz war immer noch nicht verkauft. Aus Wochen waren Monate geworden, und jetzt war schon fast Mai. Granny hatte die Kneipe anfangs gar nicht verkaufen wollen. Es war Bettys Idee gewesen, und es hatte einige Überredungskunst gebraucht, bis Granny einsah, dass es Zeit war, die Flügel auszubreiten und Krähenstein zu verlassen.
»Die Welt steht uns offen«, hatte Betty sie beschworen. »Denk doch nur! Wir könnten ein kleines Café am Meer aufmachen oder vielleicht sogar eine Eisdiele … etwas, was uns allen mehr Spaß macht.«
Die Erwähnung von Eiscreme war natürlich genug gewesen, um Charlie zu überzeugen, und so hatte sich die Idee weiterentwickelt.
Aber zu gehen war nicht so einfach, wie Betty sich das vorgestellt hatte. Der Wildschütz mochte nicht mehr ganz so heruntergekommen sein wie früher, aber er war alles andere als prunkvoll. Es verging keine Woche, ohne dass sich ein Dachziegel löste oder ein Fensterladen kaputtging. Auch heute war ihr Vater dabei, im Obergeschoss etwas zu reparieren.
»Es ist ein Renovierungsobjekt mit Potenzial«, hatte Granny fröhlich zu den einzigen zwei Interessenten gesagt, die sich das Haus angeguckt hatten, seit es zum Verkauf stand. »Der Wildschütz ist seit Jahren im Besitz der Familie Widdershins!«
Doch das eigentliche Problem, das wussten sie alle, war nicht die Kneipe. Es war die Lage. Der Heimatort der Widdershins befand sich am Rande einer feuchten, trostlosen Marschlandschaft, die von einem riesigen Gefängnis überragt wurde, und war kein Ort, den man freiwillig besuchte. Krähenstein war die größte von vier Inseln, die als Inseln des Jammers bekannt waren. Viele der Bewohner hatten Verwandte im Gefängnis, in deren Nähe sie sein wollten. Und die zahlreichen Insassen kamen von allen Teilen der Inselgruppe.
Gefährliche Insassen, dachte Betty schaudernd. Betrüger, Diebe und sogar Mörder … alle nur eine Fährüberfahrt entfernt auf der Insel der Sühne gefangen. Dahinter lag die kleinere Insel der Klagen, wo Krähensteins Tote beerdigt wurden. Als Letztes kam die Insel der Qualen, die einzige der Inseln, auf der Betty und ihre Schwestern noch nie gewesen waren. Dorthin nämlich schickte man die Verbannten, und alle anderen durften die Insel nicht betreten.
Betty warf einen Blick zu Fingerty, der immer noch zusammengesunken auf seinem Barhocker saß. Auf seiner gerunzelten Stirn zuckte ein Muskel im Takt der schallenden Glocke.
Jeder kannte seine Vergangenheit, zuerst als Gefängniswärter und dann als Betrüger. Er wusste mehr über die Insel der Qualen als jeder andere im Wildschütz, denn er hatte einst verzweifelten Menschen von dort zur Flucht verholfen.
»Das kommt jetzt aber wirklich zum ungünstigsten Zeitpunkt«, sagte Fliss. »Wir haben uns solche Mühe gegeben, damit alles hübsch und freundlich aussieht, und nun macht dieser Lärm da draußen alles zunichte!«
»Die Glocke macht überhaupt nichts zunichte«, meinte Granny, die gerade die Treppe heruntergekommen war. »Sie verkündet nur die Wahrheit!« Sie deutete entnervt auf die Möbel um sie herum, und ihre Augen flackerten so wütend wie das lodernde Feuer im Kamin. »Was dachten wir denn, wem wir was vormachen können? Als ob diese Kaschemme irgendetwas anderes wäre als eine Absteige für … den Abschaum der Gesellschaft!«
»Granny!«, rief Fliss. »Das ist wirklich furchtbar, so was zu sagen.«
»Aber es stimmt!«, erwiderte Granny patzig und nahm sich ein Glas, um sich einen Schluck Whisky einzuschenken. »Wir können diese Spelunke herausputzen, wie wir wollen, und es wird doch keinen Unterschied machen. Ich hab es ja von Anfang an gesagt: Aus einem Ackergaul kann man kein Rennpferd machen!«
Charlie machte ein entrüstetes Gesicht. »Der arme Gaul! Warum sollte man das tun?«
»Das ist doch nicht wörtlich gemeint«, erklärte Fliss. »Granny meint einfach, dass es keinen Zweck hat, dieses Haus als etwas anderes auszugeben, als es ist.«
»Heißt das, ich kann jetzt dieses Kleid ausziehen?«, fragte Charlie sofort.
»Noch nicht«, sagte Betty. »Vielleicht kommen sie ja doch noch.«
»Sie sind schon fünfzehn Minuten zu spät«, sagte Granny missmutig.
»Vielleicht …«, begann Fliss zögerlich. »Ich meine … wäre es denn so schlimm hierzubleiben?«
»Was?«, rief Charlie entsetzt. »Warum sollten wir das tun, wenn wir doch eine Eisdiele aufmachen könnten?« Ihre grünen Augen wurden ganz rund und gierig. »Denkt doch nur an all die Sorten … Sauce mit roten Beeren …«
»Ganz abgesehen davon, dass es mich noch verrückt macht, mit euch beiden ein Zimmer zu teilen«, warf Betty ein.
»Ich finde es schön, sich das Zimmer zu teilen!«, protestierte Charlie.
»Ich ja eigentlich auch«, lenkte Betty ein, »aber wir haben bald keinen Platz mehr. Du mit all deinen Tierchen und Fliss mit ihren Bergen von Liebesbriefen …«
»Berge ja wohl kaum«, murmelte Fliss mit hochrotem Kopf. »Der springende Punkt ist: Das hier ist unser Zuhause.«
Betty spürte, wie die Wut in ihr hochkochte. Dass Fliss auch immer so sentimental sein musste!
»Ich weiß«, seufzte Granny und fuhr mit sanfterer Stimme fort: »Aber der Gedanke, dass wir nicht weg können … nun ja, das gibt einem weniger das Gefühl von einem Zuhause als von einem … einem Gefängnis.«
Die Mädchen verstummten und wechselten Blicke. Niemand wusste so gut wie sie, was für ein Gefühl es war, gefangen zu sein. Bis zu Bettys dreizehntem Geburtstag hatten die Widdershins unter einem Fluch gelebt, der sie daran hinderte, Krähenstein zu verlassen. Doch gemeinsam hatten Betty und ihre Schwestern den Fluch gebrochen … mithilfe einer Prise Familienmagie. Es war ein Geheimnis, das nur die drei Schwestern teilten. Und die Widdershins-Schwestern waren gut darin, Geheimnisse zu bewahren.
»Fliss«, sagte Charlie unvermittelt und schnupperte. »Was riecht hier so …?«
»Zum Donnerraben!«, rief Fliss und rannte die Treppe nach oben. Ein paar Minuten später kam sie mit einem Blech angebrannter Lebkuchen zurück und begann sie herumzureichen.
»Das kann ich nich’ essen«, maulte Fingerty, nachdem er ein angesengtes Gebäckstück inspiziert hatte. »Da brech ich mir ja die Zähne ab!«
»Die sind doch nur an den Rändern angebrannt«, sagte Fliss gekränkt. Sie schob sich ihren dunklen Pony aus der Stirn und blinzelte.
Betty griff nach dem am wenigsten verkohlten Lebkuchen, den sie finden konnte, und bemühte sich, nicht zu husten, als sie den Rauch im Rachen spürte. »Mmh«, murmelte sie wenig überzeugend.
Bevor Fliss etwas entgegnen konnte, nahm Charlie sich zwei große Lebkuchen. »Einer für mich und einer für Hopsi.«
»Fängst du schon wieder mit dieser Ratte an?«, fragte Granny und stemmte die Hände auf die Hüften. »Ach, Charlie. Wenn du dir schon ein Haustier einbilden musst, warum kann es nicht ein nettes sein?«
»Ratten sind nette Tiere«, sagte Charlie und biss unverdrossen in ihren Lebkuchen. »Und keine Sorge, Granny. Hopsi sitzt sicher in meiner Rocktasche.«
»Nun, dann pass auf, dass er auch da bleibt«, murrte Granny.
Betty überließ Charlie und Granny ihrem Geplänkel über Ratten und erfundene Haustiere. Sobald Fliss nicht hinsah, warf sie den angebrannten Lebkuchen in den nächsten Kamin. Dann trat sie wieder ans Fenster und spähte zwischen einem Zweig getrockneter Vogelbeeren und Grannys anderen Glücksbringern in die Dämmerung hinaus. Abendnebel kroch von der Marsch herauf, und das ungute Gefühl, das Betty schon zuvor beschlichen hatte, verstärkte sich. Sie hatte sich immer über Grannys Aberglauben lustig gemacht, aber niemand konnte leugnen, dass die Widdershins in der Vergangenheit geradezu vom Pech verfolgt gewesen waren. Vielleicht war das Pech etwas, dem sie nicht so leicht entkommen konnten … wie Krähenstein selbst.
Da tauchte im Nebelgrau eine Gestalt auf. Ein Wärter pirschte auf der anderen Seite des Parks von Haus zu Haus und klopfte an die Türen. Betty wusste, ihm würden weitere folgen. Um nach demjenigen zu suchen, der es gewagt hatte zu flüchten. Die Wärter würden nicht aufgeben, bis der Gefangene gefunden war. Schon bald würden sie durch den Park zum Wildschütz herüberkommen, argwöhnisch herumschnüffeln und jede Menge Fragen stellen.
Betty spähte angestrengt nach draußen. Unter dem mächtigen Eichenbaum im Park bewegte sich etwas. Im Schatten unter seinen Zweigen lungerten zwei Gestalten und starrten zum Wildschütz herüber. Es war schwer zu erkennen, aber es schienen Männer zu sein. Bettys Herz schlug schneller. Das mussten die Leute sein, auf die sie warteten, die potenziellen Käufer … Brüder, hatte Granny gesagt. Ihren Gesten nach zu urteilen, stritten sich die beiden.
Einer von ihnen fuchtelte ungeduldig mit den Händen und machte einen Schritt auf den Wildschütz zu. Der andere schüttelte den Kopf, deutete zuerst auf die Kneipe und dann auf den Wärter, der von Tür zu Tür ging. Mit schwerem Herzen beobachtete Betty, wie die Männer sich umdrehten und in Richtung Fähre zurückgingen, ihre Schritte im Takt der läutenden Gefängnisglocke. Sie konnte sich vorstellen, was sie jetzt zueinander sagten: Das lohnt sich nicht … Was ist das überhaupt für ein Ort hier? Da finden wir doch was Besseres …
Betty wandte sich vom Fenster ab. Ihre Augen brannten vor Rauch und Enttäuschung. Granny hatte recht, dachte sie. So schnell würden sie die Kneipe nicht loswerden.
Doch Granny hatte nicht in allem recht. Die Widdershins würden in dieser Nacht doch noch Besuch bekommen … wenn auch nicht den, mit dem sie gerechnet hatten.
Kapitel 2Das Zeichen der Krähe
Charlie!«, rief Fliss aufgebracht, als sie aus dem Badezimmer kam. »Warum ist mein Bett voller Krümel?«
»Weil ich auf meinem nicht sitzen konnte.« Charlie wischte sich mit dem Ärmel Butter vom Kinn und deutete auf das Bett, das sie mit Betty teilte. »Sie hat sich mal wieder total breitgemacht. Wie immer.«
Fliss schwebte einmal quer durch das Zimmer der Mädchen und rubbelte ihre kurzen dunklen Haare trocken. Ein Schwall süßlichen Rosenblütendufts folgte ihr. Fliss fegte die Krümel von ihrem Kopfkissen, stellte sich vor den Spiegel und kämmte sich zufrieden seufzend die frisch gewaschenen Haare.
Betty sah von den Landkarten auf, die sie auf dem Bett ausgerollt hatte. »Wenigstens eine von uns freut sich über Grannys neue Anweisung, zweimal in der Woche zu baden«, sagte sie.
Es war Abend geworden. Die Dunkelheit schien durch die zugigen Fenster dringen zu wollen, und von unten war Gemurmel zu hören, als Granny ankündigte, den Wildschütz für heute zu schließen.
Vorhin, als die Wärter gekommen waren, mit Schlagstöcken an die Tür gepocht und mit bellender Stimme ihre Fragen gestellt hatten, war es ganz still geworden in der Kneipe, während die Glocke draußen umso lauter zu tönen schien. »Zwei Ausreißer«, hatten sie berichtet. »Eine Person wurde halb ertrunken an Land gespült und wird die Nacht wohl nicht überleben. Die andere ist noch auf freiem Fuß …« Ein Raunen war durch die Kneipe gegangen, und ungefähr eine Stunde nachdem die Wärter sich davongemacht hatten, war die Glocke endlich verstummt.
Betty hatte damit gerechnet, erleichtert zu sein – nun mussten sie den Gesuchten gefunden haben –, doch es gelang ihr noch immer nicht, das unbehagliche Gefühl abzuschütteln. Aber das hatte bestimmt nur mit dem bedrohlichen Auftreten der Wärter zu tun, sagte sie sich. Zuletzt waren sie vor ein paar Monaten in die Kneipe geplatzt, auf der Suche nach zwei Wärtern, die spurlos verschwunden waren, und auch damals hatten sie alle in Aufregung versetzt.
»Ich kann es nicht erwarten, bis wir das Haus verkauft haben«, sagte Charlie und riss Betty wieder in die Gegenwart zurück. Sie stopfte sich ein weiteres Stück Toast in den Mund. »Dann können wir endlich mit diesem Verkleiden und ständigen Waschen aufhören. Ein Mal baden in der Woche ist schlimm genug.«
»Ferkel«, murmelte Betty, auch wenn sie Charlie insgeheim zustimmte. Nicht dass sie etwas gegen das Baden an sich gehabt hätte. Es nervte sie nur, dass ihre Haare dadurch noch krauser wurden, als sie es ohnehin schon waren.
»Was guckst du dir denn diesmal an?«, fragte Charlie und hockte sich auf die Bettkante.
»Alle möglichen Orte«, sagte Betty. Für einen Moment waren die Sorgen, die heute den ganzen Tag an ihr genagt hatten, verflogen, und sie spürte die Begeisterung, die sie immer überkam, wenn sie Landkarten betrachtete. Es gab so viel zu entdecken! Außerhalb von Krähenstein wartete eine ganze Welt auf sie. Wohin würde es sie wohl verschlagen?
»Wie wäre es damit: Groß Schnoddburg. Das klingt doch spannend. Da gibt es Wald und eine Burgruine …«
Fliss schnaubte. »Der Klang sagt doch noch nichts darüber aus, wie ein Ort wirklich ist!«
»Bei Krähenstein schon«, gab Betty zurück. »Das klingt genauso düster, wie es ist.«
»Was ist damit?«, fragte Charlie und kam mit ihrem klebrigen Zeigefinger gefährlich nah an Bettys wertvolle Karten heran. »Da ist ein Strand in der Nähe. Bett…Bett…«
»Bettlersheim«, las Betty. »Klingt auch nicht gerade einladend. Aber wenn man arm ist, darf man nicht wählerisch sein, sagt Granny immer. Und das trifft auf uns wohl auch zu.« Sie schob Charlies Hand zur Seite. »Hast du dich schon wieder über die Lavendelmarmelade hergemacht, du gefräßiges Monster?«
»Genau.« Charlie leckte sich die Finger und hüpfte vom Bett. Sie ging hinüber zur Kommode, auf der eine bunt bemalte Matroschka stand, und drehte geschickt an den hölzernen Puppen.
Betty erkannte, was Charlie vorhatte. »Nicht!«, flüsterte sie, aber es war zu spät. Mit einer einzigen Bewegung hatte Charlie die zwei Hälften der äußersten Puppe einmal entgegen dem Uhrzeigersinn herumgedreht. Dabei waren ihre Augen in schelmischer Erwartung auf Fliss gerichtet.
Fliss, die damit beschäftigt war, selbst gemachtes Duftwasser auf ihre Handgelenke zu tupfen, schrie auf, als plötzlich und wie aus dem Nichts eine dreibeinige Ratte vor ihr auftauchte.
»Charlie!«, kreischte sie. Die Parfümflasche, die ihr aus der Hand rutschte, landete auf dem Fußboden und lief aus. »Du und diese verfluchte Ratte! Mach das nicht noch mal!«
Charlie hob die Ratte hoch und brach in Gekicher aus. »Oh, Hopsi«, flüsterte sie schadenfroh. »Der haben wir aber einen schönen Schrecken eingejagt, was?«
Fliss presste die Lippen aufeinander. »Diese Puppen sind kein Spielzeug, das weißt du genau.«
»Da hat Fliss recht«, sagte Betty. Sie rollte ihre Landkarten zusammen und verstaute sie. Dann nahm sie ihrer kleinen Schwester flink die Matroschka aus der Hand und zupfte Charlie sanft am Zopf. »Das hier ist nicht irgendein Zaubertrick, den du nach Lust und Laune vorführen kannst.« Betty strich zärtlich über das glatte Holz. »Die Puppen sind ein Geheimnis … und sie sind etwas ganz Besonderes. Sie sind das Wertvollste, was wir besitzen.«
Sie hatte die Matroschka zu ihrem dreizehnten Geburtstag bekommen, ein Geschenk, das unter den Widdershins-Töchtern von Generation zu Generation weitergereicht worden war. Aber es waren keine gewöhnlichen Holzpuppen.
»Ich nenne es eine Prise Magie«, hatte Granny gesagt. Und Betty hatte staunend und vollkommen fasziniert beobachtet, welche außergewöhnliche Fähigkeit die Matroschka hatte. Indem Betty etwas Kleines von sich selbst in die zweitgrößte Puppe legte, konnte sie sich unsichtbar machen. Und wenn sie eine Kleinigkeit, die jemand anderem gehörte, in der dritten Puppe versteckte, löste sich auch diese Person scheinbar in Luft auf. In beiden Fällen mussten die Puppen ineinandergesteckt und exakt zugedreht werden. Sobald die Hälften der äußersten Puppe wieder perfekt zusammengeschraubt waren, wurde die jeweilige Person – es konnten auch mehrere sein – unsichtbar. Um den Zauber rückgängig zu machen und wieder sichtbar zu werden, musste man die obere Hälfte der äußersten Puppe einmal ganz gegen den Uhrzeigersinn herumdrehen.
Betty öffnete die Matroschka und schüttelte ungläubig den Kopf. Dort im Hohlraum der dritten Puppe lag ein langes, dünnes Schnurrbarthaar der Ratte Hopsi.
»Das kann auch nur dir einfallen, eine Ratte unsichtbar zu machen«, sagte Betty und strubbelte Charlie durch die ohnehin schon zerzausten Haare. Trotzdem konnte sie sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
Charlie tippte sich auf ihre kleine Stupsnase und grinste breit. »Irgendwie muss ich Hopsi doch vor Granny verstecken.«
»Ich wünschte, du würdest ihn auch vor mir verstecken«, nörgelte Fliss.
»Wer wird hier versteckt?« Eine dröhnende Stimme ließ die drei Mädchen zusammenzucken.
Ohne zu überlegen, schraubte Betty die Matroschka zu und fügte die äußeren Hälften so zusammen, dass die Ratte auf Charlies Arm unsichtbar wurde. Als der Vater der Mädchen den Kopf zur Tür hereinsteckte, ließ Betty die Matroschka schnell hinter ihrem Rücken verschwinden.
»Niemand!«, riefen die Schwestern im Chor.
Barney Widdershins grinste. Seine Wangen waren rund und rosig wie die Grannys, und sein Haar war genau so ein Vogelnest wie das von Charlie. »Für einen Moment hab ich gedacht, Fliss versteckt mal wieder einen neuen Freund«, scherzte er.
Fliss wurde rot und warf ihr Handtuch nach ihm.
»Willst du noch irgendwohin?«, fragte Betty, denn ihr war aufgefallen, dass ihr Vater seinen Mantel trug.
Er nickte und kratzte sich das stoppelige Kinn. »Ich nehme die letzte Fähre nach Marschweiler. Dort wird morgen früh eine Kneipe versteigert, und ich hab mir gedacht, vielleicht kann ich da auch jemanden für den Wildschütz interessieren. Morgen zum Abendessen sollte ich zurück sein.« Er zwickte Charlie in die Nase. »Das heißt, wenn du mir etwas übrig lässt!«
Die scherzenden Worte ihres Vaters ließen Bettys Unbehagen verblassen. Wenn jemand einen potenziellen Käufer für den Wildschütz beschwatzen konnte, war es Barney Widdershins. Er hatte eine besondere Gabe, die Leute um den Finger zu wickeln, etwas, das Fliss von ihm geerbt hatte (wie auch die Neigung, Dinge auszuplappern, die besser ungesagt blieben).
Nachdem er ihnen allen einen kratzigen Abschiedskuss gegeben hatte, ging er die knarrenden Treppenstufen hinunter. Hoffnungsvoll sah Betty ihm durch das Fenster nach, wie er den Nestleinpark durchquerte und in einem immer dichter werdenden Nebel verschwand.
Einige Zeit später schreckte Betty aus dem Schlaf, als der Wind am Fenster rüttelte und einen feuchten Luftzug über ihr Kissen streichen ließ. Schlaftrunken vergrub sie sich tiefer unter ihre Decke. Doch etwas brachte sie dazu, die Augen zu öffnen.
Es war ganz still im Zimmer. Zu still. Charlie war kein leiser Schläfer, und normalerweise wurde die Stille durch ihr Schnaufen und Schnarchen unterbrochen. Aber jetzt hörte Betty nichts als das Geräusch ihres eigenen Atems. Sie drehte sich auf die Seite und blinzelte das letzte bisschen Müdigkeit weg.
Auf Charlies Hälfte war das Bett ganz zerwühlt. Und Charlie lag nicht unter ihrer Decke.
Betty setzte sich auf und lauschte. Konnte es sein, dass ihre kleine Schwester dabei war, den Vorratsschrank zu plündern, wie sie es manchmal nachts tat? Charlie wusste, dass sie nichts zu essen stibitzen sollte, aber ihr ständig knurrender Magen war immer stärker als sie. Letztes Mal hatte sie einen halben Laib Brot verputzt, der fürs Frühstück vorgesehen gewesen war. Da war Granny richtig sauer geworden. Sie hatte Charlie damit gedroht, die gruselige Kammer auf dem Flur aufräumen zu müssen.
Dann soll Granny das eben morgen früh regeln, dachte Betty und gähnte. Doch sie saß immer noch aufrecht im Bett, horchte und wartete darauf, ein verräterisches Klappern oder Klirren aus der Küche zu hören. Aber nichts dergleichen geschah. Mit wachsender Neugier stand Betty auf und schlüpfte in ihre Stiefel.
Auf der anderen Seite des Zimmers schlummerte Fliss seelenruhig in ihrem Bett. Sie sieht aus wie eine Elfe, dachte Betty. Ihre kurzen dunklen Haare standen in Büscheln von ihrem ovalen Gesicht ab, und selbst im Schlaf schien sie zu vornehm zu sein, um etwas so Gewöhnliches zu tun wie zu schnarchen.
Betty legte sich einen warmen Umhang über die Schultern, schlich zur Tür und wartete. Aus Grannys Zimmer war grummelndes Schnarchen zu hören. Sie warf einen Blick in Richtung Küche. Alles war dunkel und still.
Betty trat auf den Flur hinaus und stieg die Treppe hinab. Als sie unten angekommen war, wurde der Geruch nach Bier und Grannys Pfeifenrauch immer stärker. Langsam stieß Betty die Tür auf und blieb wie angewurzelt stehen. Grannys Hufeisen über dem Türrahmen hing falsch herum. Wie hatte denn das passieren können? Alle wussten, wie penibel Granny darauf achtete, dass das Hufeisen richtig hing, damit das Glück nicht herauspurzeln konnte. Schnell drehte Betty das Eisen herum und ärgerte sich im Stillen über sich selbst. Hufeisen, Krähen … sie war ja schon fast so schlimm wie Granny! Und trotzdem … da war es wieder, dieses nagende, mulmige Gefühl.
Betty ließ ihren Blick über die leeren Tische und Stühle schweifen. Die glimmenden Kohlen in den Kaminen spendeten noch immer ein wenig Wärme in der Kneipe. Doch Charlie war nicht zu sehen.
Bettys Herz begann schneller zu schlagen. Ruhig bleiben, sagte sie sich. Sechsjährige Mädchen verschwinden nicht einfach sang- und klanglos vom Erdboden. Schon gar nicht ein solcher Wildfang wie Charlie Widdershins.
Konnte es sein, dass sie schlecht geträumt hatte und zu Granny ins Bett geschlüpft war? Es lohnte sich nachzusehen. Doch als Betty sich umdrehte, um wieder nach oben zu gehen, stolperte sie über etwas Warmes und Fauchendes zu ihren Füßen.
»Pfui!«, fauchte Betty zurück (zum einen, weil sie sich ärgerte, und zum anderen, weil das »Etwas« tatsächlich auf diesen Namen hörte). Die Katze warf ihr einen bösartigen Blick zu und schlich ins Hinterzimmer, wo sie mit einem kehligen, fordernden Mauzen an der Tür kratzte.
»Ich bin doch nicht dein Diener!«, raunte Betty, aber als Pfui sie mit ihren giftigen, grellen Augen fixierte, wurde ihr klar, dass es natürlich genau so war. Wenn sie die Katze jetzt nicht hinausließe, würde sie einen unangenehmen Preis dafür zahlen, denn meistens war es Betty, die eine solche stinkende Angelegenheit am nächsten Morgen beseitigen musste.
»Verfluchte Katze«, murrte sie und steckte den Schlüssel ins Schloss. Zu ihrem Erstaunen stellte sie fest, dass die Tür schon offen war. »Das wird doch nicht …«
Ein kalter Windhauch strich Betty um die Knöchel, als sie die Tür aufstieß. Sie trat nach draußen in den Hinterhof, und Pfui schoss an ihr vorbei. Der Mond stand verschleiert am nebligen Himmel, und in der Luft lag der salzige Geruch der Marsch. Betty strengte ihre Augen an, um etwas erkennen zu können, denn der Nebel um sie herum war dicker als die Rauchwolken, die Granny aus ihrer Pfeife ausstieß. Auf dem kopfsteingepflasterten Hof standen überall Kisten mit leeren Glasflaschen und übereinandergestapelte Bierfässer, die an die Brauerei zurückgehen sollten.
Betty ging zwischen den Kisten hindurch und spähte in die dunklen Ecken des Hinterhofs. Ein leises Wispern drang an ihre Ohren, und für einen winzigen Moment kamen ihr die Geschichten in den Sinn, die man sich seit jeher in Krähenstein erzählte. Legenden von Fischern und entflohenen Gefangenen, die sich im Nebel verirrt hatten und deren Seelen jetzt durch die Marsch spukten. Doch dann schüttelte Betty sich. Sie hatte sich fest vorgenommen, solche Dinge nicht zu glauben.
»Charlie?«, flüsterte sie in die Dunkelheit. »Bist du hier draußen?«
Schweigen. Dann wieder ein leises Wispern, gefolgt von einem schlurfenden Geräusch. Hinter einem Bierfass tauchte ein kleiner Kopf mit zwei unordentlichen Zöpfen auf. Zwei weit aufgerissene Augen starrten sie an.
»Verflixte Krähe, Charlie!«, knurrte Betty. Die Gedanken an Geister verblassten, und ihr Herzschlag beruhigte sich. »Was machst du mitten in der Nacht hier draußen?« Fröstelnd zog sie ihren Umhang fester um die Schultern und lief hinüber in die entfernteste Ecke des Innenhofs. Dort gab es eine winzige sumpfige Grasfläche und ein spärliches Blumenbeet.
Charlie hatte sich auch etwas Warmes übergezogen und schien in ihrer dunklen Kleidung fast mit den Schatten zu verschmelzen.
Zu ihren Füßen neben dem Blumenbeet lagen eine Schaufel und eine Streichholzschachtel mit etwas Kleinem und Gefiedertem darin. Es bewegte sich nicht. Betty schluckte. Bestimmt war Pfui der Übeltäter gewesen.
»Charlie!« Bettys Mitleid schlug in Verärgerung um. Jetzt war ihr klar, warum ihre tierverrückte kleine Schwester sich mitten in der Nacht aus dem Haus geschlichen hatte. Sie deutete auf das Blumenbeet, in dem eine ganze Reihe von Zweigen steckten, von denen jeder ein winziges Grab markierte. »Du weißt doch, was Granny gesagt hat: keine Tierbeerdigungen mehr!«
Sie brach ab, als sie bemerkte, dass Charlie kaum zuhörte.
»Was ist los mit dir?«, fragte Betty. »Warum sagst du nichts?«
Charlie trat unruhig auf der Stelle und zeigte mit einem zittrigen Finger auf die Getränkekisten hinter sich. In dem dunklen Spalt zwischen zwei Kisten kauerte ein kleines Mädchen. Betty starrte sie an. Das Mädchen war ungefähr so alt wie Charlie, sechs oder sieben vielleicht. Ihr schmales schmutziges Gesicht war tränenverschmiert, und von der geflickten, abgetragenen Kleidung bis zum Hunger in ihren Augen war ihr die Armut anzusehen.
»Wer … wer ist das?«, brachte Betty hervor.
»Ich weiß auch nich’«, flüsterte Charlie. »Ich bin bloß nach draußen geschlichen, um den Vogel zu beerdigen, und da hab ich sie hier gefunden.«
Das Mädchen starrte sie mit großen Augen an und zitterte. Charlie ging in die Knie und streckte ihr eine Hand entgegen. »Wer bist du?«, fragte sie leise. »Du brauchst keine Angst zu haben. Wir tun dir nichts.«
Das kleine Mädchen zitterte, aber sie antwortete nicht. Ihre unordentlichen Haare hingen in lockigen Strähnen herunter, und die feuchten Kleider klebten ihr auf der Haut.
»Wie bist du hier reingekommen?«, fragte Betty. Ihre Stimme klang schärfer, als sie beabsichtigt hatte. Das Mädchen wich in die dunkle Ecke zurück, aber irgendwie hatte sie ein Leuchten an sich. Betty fiel auf, dass die Glasflaschen in der Nähe glitzerten, auch wenn das Mondlicht gar nicht überall hinreichte. Hatte das Mädchen womöglich eine Laterne bei sich …?
»Schau mal.« Charlie deutete auf die Pforte in der Mauer. Sie war verriegelt, aber es gab einen Spalt, wo das Holz morsch geworden war. »Da muss sie sich durchgezwängt haben.«
Betty runzelte verstört die Stirn. In ihrem Hinterkopf prickelte es.
»Warum versteckst du dich?«, hakte Charlie vorsichtig nach, als würde sie mit einem verängstigten Tier sprechen. Dann zog sie erschrocken die Hand zurück, denn hinter dem zerschlissenen Kleid des Mädchens schwebte eine leuchtende Kugel hervor.
»Ein Irrlicht!«, stieß Betty aus. Sie packte Charlie und zog sie ein Stück zur Seite, als die Leuchtkugel vor ihnen in der Luft verharrte. »Ein Irrwisch! Das Mädchen kommt aus der Marsch!«
Charlie wich zurück und stolperte fast über die Schaufel, die daraufhin über den Boden schepperte. Ihr kleines Gesicht war angstverzerrt, und ihre Hände machten schnell das Zeichen der Krähe, das Granny ihnen beigebracht hatte, um das Böse abzuwehren.
Betty zögerte. Dann machte sie es ihrer Schwester nach, auch wenn es eigentlich ihrer praktischen Veranlagung widersprach, solchen Aberglauben ernst zu nehmen. Sicher ist sicher, dachte sie düster. Granny hatte sie immer gewarnt, dass die Irrlichter aus der Marsch Unheil brachten. Die Menschen in Krähenstein waren mit Geschichten über diese glimmenden Lichtkugeln aufgewachsen, die Reisende im Nebel auf Irrwege führten und für immer verschwinden ließen. Wie Granny sahen viele Leute in den Irrlichtern geisterhafte Nachklänge der vielen Leben, die bei der Überquerung der Marsch verloren gegangen waren.
Der Irrwisch schwebte vor dem Mädchen, ohne näher zu kommen. Sein unheimliches silbriges Licht warf gespenstische Schatten auf ihr schmales Gesicht und ließ sie auf einmal älter erscheinen.
»Charlie«, sagte Betty leise. »Geh lieber wieder ins Haus. Und du …« Sie wandte sich an das Mädchen. »Du gehst besser dahin zurück, wo du hergekommen bist.«
»Das kann ich nicht.«
Das Mädchen wisperte so leise, dass Betty für einen Moment glaubte, sie hätte sich ihre Antwort nur eingebildet, doch die Verzweiflung in ihren Augen war echt. Und noch etwas anderes lag in dem Blick des Mädchens: Entschlossenheit.
»Das kann ich nicht«, wiederholte sie, lauter diesmal. »Und das werde ich nicht.«
»Betty«, sagte Charlie, die das Mädchen nicht aus den Augen gelassen hatte. »Ich glaub, sie braucht unsere Hilfe.«
»Charlie Widdershins!«, zischte Betty. »Ich hab dir doch gesagt, du sollst reingehen! Wir wissen überhaupt nichts von ihr, was sie will oder warum sie dieses … dieses Ding bei sich hat!«
»Es tut euch nichts«, begann das Mädchen, doch dann verstummte sie, als auf der anderen Seite der Hinterhofmauer schlurfende Schritte zu hören waren. Sie wich erneut zurück und sah so klein und ängstlich aus, dass sich auch in Betty Mitleid regte. Charlie hatte recht. Das Mädchen war offensichtlich in Schwierigkeiten. Aber warum?
Eine mürrische Stimme war zu hören. »Wenn ich es dir doch sage, da war Licht. Eine Laterne oder so was …«
Jemand rüttelte an der Pforte. Betty erstarrte, als der Strahl einer Taschenlampe durch den Spalt im morschen Holz drang und die glänzenden, feuchten Pflastersteine abtastete. Sie packte Charlie am Ärmel und kauerte sich mit ihr hinter ein großes, leeres Bierfass – gerade noch rechtzeitig. Das Licht der Taschenlampe wanderte flackernd über den Hof, und Betty presste einen Finger auf ihre Lippen, um das Mädchen und Charlie aufzufordern, still zu sein. Ausnahmsweise tat ihre kleine Schwester, was sie von ihr verlangte.
Betty unterdrückte einen Aufschrei, als etwas – eine Faust? – die Pforte traf und Holzsplitter über die Pflastersteine fliegen ließ. Ein kräftiger Tritt, und die Pforte würde einbrechen. Kein Wunder, dass Granny Vater seit Wochen gedrängt hatte, sie zu reparieren.
Bettys Herz klopfte wild. Suchten diese Leute das Lumpenmädchen? War sie etwa eine der Personen, die ausgebrochen waren? Das konnte doch nicht sein … Die Glocke hatte vor Stunden aufgehört zu läuten … und soweit man wusste, gab es im Gefängnis von Krähenstein nur männliche Insassen. Betty rechnete damit, dass die Pforte jeden Moment zersplittern würde, aber von der anderen Seite war ein gebelltes Kommando zu hören: »Nicht.«
Stille. Dann folgte ein undeutliches Geraune, das Betty nicht verstehen konnte. Die schweren Schritte zweier Stiefelpaare entfernten sich von der Pforte. Betty horchte angestrengt, bis kein Geräusch mehr zu hören war. Zittrig erhob sie sich und machte Charlie ein Zeichen. Einen Moment zögerte sie noch, dann winkte sie auch das geheimnisvolle Mädchen heran, deutete auf die Hintertür und formte lautlos die Worte: »Los, rein!«
Kapitel 3Die schwarze Feder
Betty zog die Hintertür so leise wie möglich hinter sich zu und schob mit Mühe den schwergängigen Riegel vor. Schließlich rastete er mit einem lauten Klicken ein, das sie alle drei zusammenschrecken ließ. Betty fluchte leise vor sich hin, Augen und Ohren besorgt auf die Treppe gerichtet. Oben rührte sich nichts.
»Hier rein«, flüsterte sie. »Verdammt!«, entfuhr es ihr, als Pfui ihr zum zweiten Mal in dieser Nacht um die Füße strich und sie zum Stolpern brachte. »Verflixte Katze!«
Sie führte Charlie und das Mädchen in den Schankraum, wo sie schnurstracks auf den Kamin zuliefen. »Wir dürfen nicht zu viel Licht machen«, warnte Betty sie. »Und legt kein neues Feuerholz nach. Frischer Rauch aus dem Schornstein könnte um diese Zeit verdächtig aussehen.«
Aber vor wem verstecken wir uns überhaupt?, fragte Betty sich, während sie hektisch überprüfte, ob auch alle Vorhänge zugezogen waren und niemand neugierige Blicke in die Kneipe werfen konnte. Wer mochten die Männer dort draußen sein – und waren sie auch wirklich nicht mehr in der Nähe? Das ZUVERKAUFEN-Schild quietschte im Wind. Betty kontrollierte die vorderen Türen und vergewisserte sich, dass sie ebenfalls abgeschlossen waren. Dann eilte sie zurück zum Kamin und riss ihrer kleinen Schwester gerade noch im letzten Augenblick den Schürhaken aus der Hand, denn Charlie hatte schon versucht, die glühenden Kohlen wieder zu entfachen. Das fremde Mädchen hatte seine klammen Finger nach der letzten Wärme des Kamins ausgestreckt, ihre Haut war totenblass, und sie zitterte am ganzen Leib.
»Hier«, sagte Charlie und kramte ein halbes Butterbrot aus ihrer Manteltasche hervor. »Das hab ich heute Mittach für meine Ratte aufgehoben.«
»Mittag«, murmelte Betty. »Nicht Mittach.«
»Ist doch dasselbe«, sagte Charlie achselzuckend und hielt dem Mädchen großzügig das halbe Brot hin. »Du siehst aus, als ob du es dringender brauchst.«
Betty beobachtete das Mädchen – und das Irrlicht – wachsam. Das Mädchen stopfte sich das Butterbrot in den Mund, ohne sich im Geringsten daran zu stören, dass es trocken und zerdrückt war. Betty fiel es schwer, nicht an die Geschichten von heimtückischen Kobolden und Elfen zu denken, die urplötzlich vor der Haustür standen und einem etwas zu essen abluchsten. Wenn man nicht aufpasste, wurde man sie nie wieder los. Hätte Granny uns über die Jahre nur nicht so viel abergläubischen Unsinn eingetrichtert, dachte Betty. Mitten in der Nacht in der schummrigen Kneipe beschlich einen tatsächlich das Gefühl, das Auftauchen der Fremden könnte Unheil bringen. Das Irrlicht schwebte in der Nähe ihres nassen Rocksaums. Ein paarmal driftete es näher ans Feuer, als würde es hypnotisch angezogen von etwas, das glühte wie es selbst, doch dann kehrte es schnell an die Seite des seltsamen Mädchens zurück.
Betty bekam eine Gänsehaut. Sie hatte schon so manches Mal Irrwische in der Marsch gesehen, aber noch nie aus solcher Nähe. Im Innern des Irrlichts flimmerte ein helles Glühen, ein schwaches Flackern wie ein Herzschlag. Schaurig schön, fast betörend. Es war leicht nachzuvollziehen, warum die Leute ihnen folgten … Erschrocken zuckte Betty zusammen. Sie blinzelte und zwang sich wegzusehen.
»Du hast noch fünf Minuten«, sagte sie etwas schärfer, als es nötig war. »Wenn du aufgegessen hast, sollte die Luft rein sein.«
Das Mädchen schien Bettys Worte nicht gehört zu haben. Sie starrte weiter mit verlorenem, verängstigtem Blick in die Flammen.
In Bettys Herz regte sich Mitleid. Hätte das Mädchen nicht das Irrlicht dabeigehabt, wäre sie nicht so misstrauisch gewesen, aber der Anblick dieses schwebenden, leuchtenden Etwas war zutiefst beunruhigend. Granny wäre außer sich, wenn sie wüsste, dass Betty es ins Haus gelassen hatte. Bei dem Gedanken daran kribbelte es in ihrem Nacken. Ein Teil von ihr wollte dem Mädchen helfen; der andere Teil wünschte, dass sie ihm nie begegnet wären. Und das alles nur wegen Charlie und ihren verdammten Tieren!
»Wie heißt du?«, fragte Charlie und kauerte sich zu dem Mädchen neben den Kamin. Aus der anderen Manteltasche zog sie einen angeknabberten schwarzen Lebkuchen hervor und reichte ihn ihr.
Das Mädchen biss hinein, warf einen verstohlenen Blick auf den Irrwisch und sagte zögerlich: »Ich … bin … Willow. Vielleicht solltet ihr mich einfach so nennen.« Dann ging ihre Stimme in ein Flüstern über, das Betty jetzt kaum noch verstehen konnte, und das war vielleicht auch gut so. Je weniger sie wussten, desto besser.
»Wie alt bist du?«, fragte Charlie. »Ich bin sechs, aber nächste Woche werde ich sieben.«
»Ich bin neun«, antwortete Willow. »Die Leute sagen, ich bin klein für mein Alter.«
»Du meinst, etwas kümmerlich?«, fragte Charlie wenig einfühlsam.
»Keine weiteren Fragen mehr, Charlie«, sagte Betty beklommen. »Es wird Zeit, dass du wieder ins Bett kommst.« Und Willow muss verschwinden, bevor Granny aufwacht, fügte sie in Gedanken hinzu. Sie weigerte sich, dem Mädchen selbst Fragen zu stellen, auch wenn sie einige hatte. Es war gefährlich, zu viel zu wissen, vor allem, wenn draußen Fremde nach dem Mädchen suchten.
Doch Charlie ließ sich nicht beirren und freute sich ganz offensichtlich, Besuch in ihrem Alter zu haben. »Willst du mal meine Ratte streicheln?«, fragte sie. »Hopsi ist unsichtbar.«
Willow sah von ihrem Lebkuchen auf. »Du hast eine Ratte als eingebildeten Freund?«
Charlie grinste. »Nein, Hopsi ist bloß unsichtbar – wie ich gesagt hab. Hier.«
»Charlie!«, warnte Betty, doch es war zu spät. Charlie hatte eine Hand in ihrer Tasche vergraben und wühlte darin herum. »Komm schon, Hopsi!«, sagte sie schließlich und zog ihre Hand wieder heraus. Willow starrte ungläubig von Charlies hohler Hand zu ihrem Gesicht.
»Fühl mal«, sagte Charlie. »Er sitzt direkt hier in meiner Hand.«
Willow streckte ihre Finger aus, die sogar noch dreckiger waren als Charlies. Es war offensichtlich, dass sie das Ganze für einen Trick hielt, doch dann stieß sie einen leisen Schrei aus.
»Oh! Da ist ja wirklich was in deiner Hand! Es ist ganz warm und … pelzig.«
»Sag ich doch«, prahlte Charlie. »Ich musste ihn unsichtbar machen, damit Granny ihn nicht entdeckt und ihn mir wegnimmt.«
»Aber … wie?«, begann Willow.
Betty warf Charlie einen weiteren warnenden Blick zu, doch sie hätte sich keine Sorgen machen müssen.
»Das kann ich dir nicht sagen«, antwortete Charlie. »Es ist ein Geheimnis, das nur ich und meine Schwestern kennen.« Sie deutete mit einem Nicken auf das Irrlicht, das mit kleinen tänzelnden Bewegungen näher auf Charlie zuschwebte, als wäre es neugierig geworden. »Und was ist damit?«
Willow starrte das leuchtende Etwas nachdenklich an. »Was habt ihr denn von Irrlichtern gehört?«, fragte sie schließlich.
»Viele Dinge«, hörte Betty sich sagen, während ihr vage bewusst wurde, dass sie schon wieder gebannt auf den Irrwisch starrte. »Dass sie böse Geister sind, oder Kobolde oder die Seelen von Menschen, die in der Marsch ertrunken sind. Einige Leute sagen aber auch, es sind nichts als Sumpfgase.« Sie starrte auf den Irrwisch, der jetzt sogar noch näher – noch mutiger?, dachte sie – auf Charlies ausgestreckte Hand zuschwebte. »Aber wenn ich mir dieses Etwas hier ansehe, ist mir klar, dass es mehr ist als Sumpfgas. Es ist zu … lebendig. Zu neugierig.«
»Lebendig?«, brachte Willow heiser hervor. »Nicht direkt, aber früher einmal.«
»Wer … wer war es denn?«, fragte Charlie.
Willow sagte nichts. Sie streckte ihre Hände noch einmal über das glimmende Feuer und bewegte ihre Finger hin und her. Dabei rutschte ihr Ärmel ein Stück nach oben und gab den Blick auf ein kleines dunkles Mal frei, das auf ihr Handgelenk tätowiert war.
»Was ist das?«, fragte Charlie und beugte sich vor.
Aber Betty wusste es schon, und der Anblick erfüllte sie mit ebenso viel Angst und Grauen wie das Irrlicht.
»Eine Krähenfeder«, sagte Willow leise.
»Dann bist du also wirklich eine von denen, die geflohen sind«, sagte Betty mit klopfendem Herzen. »Aber … aber nicht aus dem Gefängnis. Von der Insel der Qualen! Du gehörst zu den Verbannten!«
Willow nickte und sah sie mit weiten Augen an. »Bitte ruft nicht die Wärter«, flehte sie. »Ich gehe auch bald. Ich … ich brauchte nur einen Platz, um mich für einen Augenblick zu verstecken und nachzudenken. Sobald ich weg bin, könnt ihr behaupten, dass ich nie hier war, dass ihr mich nie gesehen habt.«
»Aber das ergibt doch keinen Sinn«, sagte Betty langsam. »Warum haben sie aufgehört, die Glocke zu läuten, wenn du noch nicht gefunden wurdest?« Da kamen ihr die Worte der Wärter wieder ins Gedächtnis. Zwei Ausreißer … eine Person halb ertrunken an Land gespült … wird die Nacht wohl nicht überleben.
»Wer … wer war denn bei dir?«, fragte Betty behutsam.
»Meine Mutter«, krächzte Willow. »Ich bin mir nicht einmal sicher, ob die Wärter wussten, dass wir zu zweit waren, dass ich bei ihr war … aber dann ging etwas schief …« Willows Miene verdüsterte sich. »Ich … wir wurden getrennt, und danach ging alles so schnell, und dann … dann konnte ich sie nicht mehr finden. Und dann hörte die Glocke nach ewig langer Zeit auf zu läuten. Deshalb weiß ich jetzt, dass sie … dass die Wärter …«
»… sie gefangen haben«, beendete Charlie atemlos den Satz.
Betty wandte beunruhigt den Blick ab. Die an Land gespülte Person, von der die Wärter gesprochen hatten, musste Willows Mutter sein – doch davon schien Willow nichts zu ahnen. Betty konnte sich nicht überwinden auszusprechen, was sie vermutete.
Willow schluckte hörbar und nickte. Ihre Augen glänzten im dämmerigen Licht. Eine Hand wanderte zu ihrer Rocktasche und tätschelte sie, als wollte sie sich vergewissern, dass sie etwas darin nicht verloren hatte. Der Irrwisch schwebte um sie herum und erinnerte Betty an Fliss, wie sie jedes Mal um Charlie herumscharwenzelte, wenn die sich die Knie aufgeschlagen hatte.
Charlie streckte den Arm aus und nahm sanft Willows Hand, um die tätowierte Feder auf ihrer Haut zu betrachten. »Hat es wehgetan?«
Willows Unterlippe zitterte. »Ja.« Dann starrte sie gedankenverloren ins Feuer und beruhigte sich ein wenig. »Alle auf der Insel bekommen eine Markierung. Ich habe noch Glück gehabt – meine ist ja nur klein …«
Charlie starrte sie mit offenem Mund an. »Du meinst, andere Leute kriegen noch größere?«
»Ja. Ich hab nur eine Feder bekommen, weil es nicht mein eigenes Verbrechen war«, erklärte Willow.
»Wessen Verbrechen war es dann?«, fragte Betty, die ihre Neugier nicht unterdrücken konnte. Man erzählte sich viel über das Leben auf der Insel der Qualen, aber Genaues wusste niemand darüber. Allgemein bekannt war nur, dass dort gefährliche Menschen lebten. Ehemalige Sträflinge, die nach ihrer Haft keine Bleibe fanden, und andere, die aus Krähenstein verbannt worden waren. Es war ein Auffangbecken für Übeltäter.
Bevor Willow antworten konnte, wurden sie von einem empörten Quieken aus Charlies Richtung unterbrochen. Der Irrwisch schwirrte um ihre Handfläche herum, sichtlich fasziniert von der Ratte, die man nicht sehen konnte.
»Ganz ruhig, Hopsi«, sagte Charlie und ließ ihre Hand in der Tasche verschwinden. Betty beobachtete, wie sich der Stoff bewegte, als das unsichtbare Tier sich in Charlies warmer Manteltasche vergrub.
»Sie spüren Leben«, sagte Willow leise. »Sie werden davon angezogen. Deshalb kommen sie auch näher, wenn man ihnen draußen in der Marsch begegnet. Meistens sind sie harmlos, aber manche …«
Ein lautes Pochen an der Haustür ließ sie zusammenzucken.
»Aufmachen!«, bellte eine Stimme. »Im Namen von Krähenstein!«
»Wärter!«, zischte Betty entsetzt. Sie starrten einander an und wagten nicht, sich zu rühren. Von oben war das Quietschen von Sprungfedern zu hören, als sich jemand im Bett umdrehte. Dann war es wieder still.
»Wenn wir ganz leise sind, denken sie vielleicht, wir schlafen, und gehen wieder«, flüsterte Charlie, aber sie hatte den Satz kaum beendet, als ein weiteres lautes Hämmern die Tür erzittern ließ. Der Riegel hob sich und klapperte.
»Die geben nicht auf«, sagte Betty mit matter Stimme.
»Sie dürfen mich hier nicht finden«, sagte Willow zitternd. »Bitte! Ich gehe hinten raus, ich …«
»Nein.« Betty überlegte schnell und ergriff die Initiative. »Sie haben bestimmt die zerbrochene Pforte im Hinterhof gesehen und sich zusammengereimt, dass du hier bist. Wir müssen damit rechnen, dass einer von ihnen hinter dem Haus steht, um dich dort abzufangen.«
»Bitte verratet mich nicht«, flehte Willow.
Betty zögerte. Jeder, der dabei erwischt wurde, entflohene Gefangene zu verstecken, wurde selbst ins Gefängnis geworfen oder sogar verbannt. Jemandem von der Insel der Qualen zu helfen, würde sicher ähnliche Strafen nach sich ziehen. Aber wenn sie Willow an die Wärter auslieferten … Auf jeden Ausbruchsversuch stand die Todesstrafe.
Das Poltern an der Tür nahm ihr die Entscheidung ab.
»AUFMACHEN!«, brüllte eine Stimme.
»Schnell, hier entlang!« Betty packte Charlies Hand und lotste Willow in Richtung Treppe. Ihr Herz pochte so heftig wie das Klopfen an der Tür.
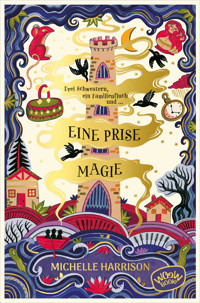













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














