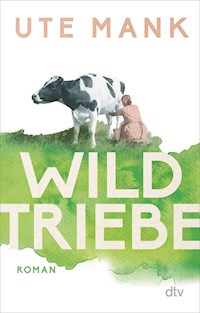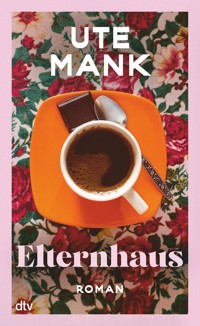
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Schwestern zwischen Zukunft und Vergangenheit Ein Thema, das uns alle angeht: Was passiert, wenn unsere Eltern alt werden? Sanne, die nur ein paar Straßen von ihren Eltern entfernt lebt, bekommt deren Alltag hautnah mit. Immer häufiger muss sie helfen, den Eltern wächst das Haus über den Kopf. Und so beschließt sie, dass die beiden umziehen müssen. Doch sie fällt diese Entscheidung allein, immerhin ist sie die Älteste. So viel mehr als vier Wände und ein Dach: das Elternhaus. Als ihre Schwester Petra von den Plänen erfährt, ist sie entsetzt. Wie kann Sanne die Eltern entwurzeln? Wie kann sie alles zerstören, was Sinnbild ihrer gemeinsamen Kindheit ist? Diese Pläne reißen Petra den Boden unter den Füßen weg. Eine emotionale Reise in die Vergangenheit und ein liebevoller Blick auf die oft schwierige Familie. Das angespannte Schwesternverhältnis wird auf eine existentielle Probe gestellt. Und auch die Kleinste, Gitti, gerät zwischen die Fronten. Die Geschwister müssen sich die Frage stellen, wann sie sich so unglaublich fremd geworden sind? Und wie es sich anfühlt, plötzlich kein Elternhaus mehr zu haben? Doch sind Wände, Fenster und Türen wirklich so wichtig? Eine Familiengeschichte, die unter die Haut geht. Klug beobachtend und mit liebevollem Blick erzählt Ute Mank von alten Eltern, entfremdeten Schwestern und von einem Haus, das so viel mehr ist als vier Wände und ein Dach. »Wo Nostalgie aufhört, fängt Ute Manks Erzählkunst an, so nah, so traurig-schön, dass man sich gern darin verliert.« Sandra Lüpkes
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ute Mank
Elternhaus
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Elke und Roger
Wie einen Schild trug Sanne den Umzugskarton vor sich her, als sie auf das schmale Haus zuging.
»Da bist du«, sagte die Mutter, die im Rahmen der Haustür stand.
Natürlich bin ich da, dachte Sanne. Über den Kartonrand lächelte sie die Mutter an. Ihr Lächeln erschien ihr falsch.
Die Mutter wandte sich zur Seite, drückte sich an die Wand. Mit dem Karton an ihrer Kittelschürze entlangschabend, drückte Sanne sich an ihr vorbei, weil zwischen ihnen kein Platz war.
Die Mutter wollte die Haustür hinter ihr schließen.
»Lass offen«, sagte Sanne über die Schulter. »In meinem Auto sind noch viel mehr Kartons.«
»Da bist du«, sagte auch der Vater, der in diesem Moment aus der Küche in den Flur trat.
Zusammen mit ihm trug sie die Umzugskartons ins Haus. Der Vater immer bloß einen, Sanne drei, vier auf einmal.
Sie stellten ein paar ins Wohnzimmer, lehnten sie an die Wand zwischen Vitrine und Sofa. Da war ein wenig Platz. Da standen sie nicht im Weg. Die, die in den oberen Stock mussten, trug Sanne, um dem Vater die Treppen zu ersparen.
In den Zimmern sah alles aus wie immer. Seltsamerweise überraschte sie das. Als müsste man es bereits sehen. Als müsste sich schon Wesentliches verändert haben.
Was hatte sie erwartet? Dass die Eltern schon begonnen hätten? Geschirr zusammengestellt und gestapelt? Vielleicht schon in Zeitungen gewickelt und auf die Tische und Fensterbänke verteilt. Die Gardinen abgenommen, Teppiche zusammengerollt?
All das würde sie tun müssen. Die Eltern würden bloß helfen. So gut sie konnten. Denn weil sie nicht mehr so gut konnten, hatte Sanne deren Auszug angezettelt. Du tust das Richtige, Sanne, sagte sie sich.
Gitti hatte widerwillig zugesagt zu helfen. »Samstag? Nein, das geht überhaupt nicht.« Sanne hatte nicht gefragt, warum das überhaupt nicht ginge. »Sonntag? Na gut.«
Gitti stand nicht hinter Sannes Plänen. »Du entmündigst sie, triffst Entscheidungen über ihren Kopf hinweg. Sie sind ja nicht senil. Und das mit dem Haus bewältigen sie noch ganz gut, finde ich.«
Sanne war anderer Meinung. Aber sie war oft anderer Meinung als Gitti. Besonders, was die Eltern betraf. Schließlich hatte sie sie vor Augen. Wohnte am nächsten dran. Zwanzig Minuten Fußweg, drei Minuten mit dem Auto. Sie kümmerte sich, wenn die Eltern anriefen. Könntest du vielleicht. Hierbei helfen. Das besorgen. Wir brauchen dringend.
Sie hatte sich auch gekümmert, als die Mutter im vergangenen Winter so krank geworden war. Was hieß gekümmert. Sanne war täglich vorbeigekommen, hatte Essen gebracht, Betten abgezogen, eingekauft, Medikamente besorgt und das Haus geputzt. Der Vater hatte ihr hilflos zugesehen. Hatte auch mal einen Tee gekocht, der Mutter die Hand gehalten und war x-mal am Tag die Treppe hinauf- und hinuntergelaufen, ohne recht zu wissen, wozu.
Als die Mutter zum ersten Mal für ein, zwei Stunden das Bett hatte verlassen können, war sie so wackelig auf den Beinen gewesen, dass sie sich nicht traute, die Treppe hinunterzugehen in ihre Küche.
»Da habt ihr’s«, hatte Sanne triumphierend gesagt und war sich doch schäbig dabei vorgekommen.
»Frag doch Petra, ob sie auch beim Packen helfen kann«, hatte Gitti noch gesagt, nachdem sie beide sich mühsam auf den Sonntag geeinigt hatten.
Sie sah auf die Straße tief unter sich und nippte an ihrer Tasse. Bitter. Es störte Petra nicht, es musste so sein. Bürokaffee.
Sie beobachtete die Autos. Wie sie die sechsspurige Straße entlangschnürten, manche sich zwischen zwei Fahrzeuge auf der Nebenspur einfädelten, vor der Ampel hielten, wieder anfuhren. Aus einer schmalen Seitenstraße kam ein Lkw. Sie reckte den Kopf ein wenig. Sah zu, wie er auf die sechsspurige einbog, zwischen all den anderen Autos weiterfuhr und nach rechts aus ihrem Blickfeld verschwand.
Von hier oben wirkte alles wie von einer fernen Kraft gesteuert. Die dicken Fensterscheiben schluckten die Geräusche komplett. Kein Hupen, kein Motorlärm drang zu ihr herauf. Wenn man dort unten mitfuhr, war es Chaos.
Petra stand gern dort, die Arme so verschränkt, dass die Kaffeetasse direkt vor ihrem Mund balancierte. War die Tasse leer, holte Petra sich eine zweite. War die leer, war die Pause zu Ende.
Sie ließ ihren Blick auch über das gegenüberliegende Hochhaus mit seinen spiegelnden Scheiben gleiten. Manchmal konnte sie schemenhaft jemanden laufen sehen. Oder gestikulieren. Was dort gearbeitet wurde, wusste sie nicht. Aber die dort drüben wussten genauso wenig, was auf der ihnen gegenüberliegenden Seite, was in Petras Büro gearbeitet wurde.
Es wüsste auch dann keiner, wenn man besser bei den anderen hineinschauen könnte. Sahen Büros nicht überall gleich aus? Bildschirme auf jedem Tisch. Telefon. Schreibtischlampe. Das Persönlichste eine Grünpflanze. Ein Foto vielleicht noch. Vom Ehemann, der Ehefrau, der Familie. Auf Petras Tisch stand nicht einmal eine Pflanze.
Sie nahm den letzten Schluck aus der ersten Tasse und ging in die winzige Teeküche. Niemand begegnete ihr. Dann stellte sie sich wieder ans Fenster.
Abstand, dachte sie. Es ist der Abstand, der alles so geordnet wirken lässt.
Schon oft hatte sie diese Feststellung getroffen. Meistens dachte sie dabei auch an ihr Elternhaus.
Zu dem hatte Petra ebenfalls Abstand. Wohnte weit weg, fuhr selten hin.
War sie dort, fühlte sie sich wie ein Gast, nicht wie ein Familienmitglied. Die Eltern rissen sich ein Bein für sie aus. Wollte sie etwas helfen, hieß es: »Ach, lass doch. Ich mach das schon.«
Ihre Gespräche waren schwerfällig. Die Themen gingen immer wieder aus. Was sollte Petra auch erzählen? Von ihrer Arbeit? Die war den Eltern kaum zu erklären. Von Jürgen? Die Eltern wussten nicht einmal, dass es ihn gab.
Sie fuhr wieder nach Hause und kam jedes Mal mit einem Gefühl der Erleichterung in ihrer Wohnung an.
Aus der Ferne ließ sich ganz anders an die Familie denken. Wärmer. Herzlicher. In imaginierten Gesprächen, in denen sie sich wunderbar mit allen verstand. Auch mit Sanne und mit Gitti.
Es dauerte immer eine ganze Weile, bis sich solche Fantasien wieder in Sehnsucht verwandelten.
Aus dieser Sehnsucht wurde ein Bedürfnis, wenn Petra feststellte, dass sie immer häufiger und in ganz unverhofften Momenten und Situationen an die Eltern und die Schwestern dachte.
Dann war es nicht mehr weit bis zu dem Moment, in dem sie beschließen würde, mal wieder nach Rotshausen zu fahren.
Petra setzte ihre Tasse für den letzten Schluck Kaffee an den Mund. Aber sie war schon leer.
In ein paar Stunden würde sie ihren Computer ausschalten, den Stuhl dicht an den Schreibtisch schieben und die Schubladen abschließen. Sie würde über den Flur, dessen Teppichboden das Geräusch ihrer Schritte schluckte, zum Fahrstuhl gehen und nach unten fahren. Beim Öffnen der großen Glastür, durch die sie nach draußen treten musste, würde sie wie immer erschrecken über den Lärm. Sie würde die Schultern einziehen und zur U-Bahn-Haltestelle laufen.
Erst als Gitti gesagt hatte, du kannst doch Petra fragen, hatte Sanne an sie gedacht. Nie informierte sie die Schwester über irgendwelche Ereignisse im Elternhaus. Nicht über die kleinen, nicht über die großen. Sie hatte ihr auch nicht Bescheid gegeben, als die Mutter so krank gewesen war. Es war ihr nicht einmal in den Sinn gekommen.
So weit wie Petra weg wohnte, konnte sie sowieso nicht um spontane Hilfe gebeten werden. Kannst du mal? Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht.
Überhaupt war ja Petras ganzes Leben weit weg von Sannes. Die Schwester wohnte in tollen Wohnungen. Mehrzahl. Denn Petra zog ständig um. Jede neue war noch ein bisschen schicker als die alte. Ein paar wenige ausgewählte Möbelstücke in großen Zimmern. Konnte man so machen, wenn man allein lebte.
Hab ich eigentlich ihre aktuelle Adresse?, überlegte Sanne.
Und sowieso war immer alles tipptopp bei Petra. Hatte bei ihr ja auch nie schmutzige Kinderhände gegeben, die ihre Spuren überall hinterließen. Und bestimmt hatte sie auch eine Putzfrau. Die reinemachte, während sie auf der Arbeit war. So, wie die Mutter früher bei den besseren Leuten reinegemacht hatte.
Wann war sie das letzte Mal bei Petra gewesen? Ewig her. Wenn, dann sahen sie sich bei den Eltern. Im schmalen Haus. Und benötigten eine Weile, bis die Fremdheit ein wenig verschwand. Und kaum war sie ein wenig verschwunden, reiste Petra schon wieder ab.
Wann hatte diese Fremdheit eigentlich begonnen? Schon mit Gittis Einzug im Kinderzimmer? Oder erst später? Als Petra angefangen hatte zu studieren und sie schon mit Uwe ein Haus gebaut hatte? Als ihre Leben sich maximal auseinanderentwickelt hatten? Sanne hatte keine Antwort, hatte gerade sowieso keine Zeit für solch komplizierte Fragen.
Ein wenig hatte Gittis Bemerkung Sanne erschreckt. Doch sofort hatte sie sich dagegen gewehrt. Innerlich.
Petra machte doch hier sowieso nie einen Finger krumm. Ließ sich bedienen von vorn bis hinten. Und falls sie doch mal ansetzte, helfen zu wollen, sagten die Eltern sofort, lass nur, ich mach das schon.
Sie würden gut ohne Petra auskommen.
Petra nahm nie die Rolltreppen, weil sie nicht still auf einer Treppe stehen wollte, wo sie sich nicht dagegen wehren könnte, dass sich jemand direkt hinter sie stellte, ihr auf den Kopf atmete. Höchstens um den Preis, auszuweichen, aber damit dem, der zwei Stufen unter ihr stand, zu nahe zu kommen.
Sie hastete die Stufen hinunter, überholte dabei die auf den Rolltreppen.
Dem Bettler, der unten gegenüber der Treppe saß, warf Petra zwei Euro in den Kaffeebecher. Sie hatte immer ein paar Zweieurostücke in der Manteltasche. Wenn sie erst ihr Portemonnaie hervorholen müsste und im Kleingeldfach herumfingern, würde nie ein Bettler etwas von ihr bekommen. Sie fand die ganze Situation peinlich. Die Herablassung, die darin lag. Sie konnte keinem in die Augen sehen. Und wusste, dass auch das herablassend wirken musste.
Oft dachte sie daran, wie sie einmal als Kind an der Hand der Mutter in Lahnfels einkaufen gewesen war. Wie alt war sie gewesen? Vier? Oder schon sechs? Sie waren an einem Mann vorbeigekommen, der auf dem Bürgersteig gesessen hatte. Petra hatte stehen bleiben wollen, ihn neugierig betrachten. »Was macht der Mann da, Mama? Warum sitzt der auf der Straße?« Die Mutter hatte sie schnell weitergezogen. Mit hoch erhobenem Kopf. »Der bettelt«, hatte sie gesagt. »Denen darf man aber nichts geben. Hörst du? Die kaufen sich nur Schnaps von dem Geld.« Dass die Mutter so etwas wusste, hatte Petra beeindruckt. Aber sie hatte auch gemeint, Angst in den Augen der Mutter zu sehen. Als Petra sich noch einmal nach dem Bettler umgedreht hatte, hatte der zwinkernd gelächelt und ihr gewinkt. Obwohl er nichts von ihnen bekommen hatte.
Damals hatte es auch noch Hausierer gegeben. Menschen, die an die Türen kamen und Kleinigkeiten verkauften. Schuhbändel und Schuhcreme. Oder Mausefallen und Küchendraht. Manche auch Seifen und Putzlappen. Im schmalen Haus wurden sie schnell abgewehrt, die Tür nachdrücklich geschlossen. Dabei noch einmal an der Klinke gerüttelt. War die Tür auch wirklich zu? Oder die Eltern öffneten erst gar nicht, weil sie den Hausierer schon über den Gartenweg hatten kommen sehen, sondern standen hinter der Gardine und sagten: »Pst. Wir sind nicht zu Hause.« Hausierer waren unheimlich gewesen.
Als Petra längst lesen konnte, hatte sie in Lahnfels mal an einer Hauswand ein Schild gesehen: Betteln und Hausieren verboten. Ob es so ein Schild heute noch irgendwo gab? Hausierer waren längst ausgestorben. Bettler nicht.
Petra schob sich durch die Menschenmenge, wurde gerempelt und rempelte selbst. Freitagnachmittags um halb fünf war der Bahnsteig brechend voll. Um diese Jahreszeit hatten manche Leute noch T-Shirts an, andere trugen bereits Daunenanoraks. Die meisten starrten auf ihre Handys. Ein paar telefonierten auch und ihre Gesprächspartner plärrten aus den lautgestellten Geräten. Andere hatten Kabel aus den Ohren hängen und redeten, die Blicke ins Ungefähre gerichtet, als führten sie Selbstgespräche.
Ein junges Pärchen stand in weltvergessener Umarmung mitten im Getümmel. Es rührte Petra. Als das Mädchen ihren Blick auffing, sah sie schnell woanders hin.
In ihrem Rücken fuhr die Gegenrichtungsbahn ein. Die Anzeige auf ihrer Seite sagte: Noch eine Minute. Petra starrte auf die gegenüberliegende Wand und hörte dabei zu, wie die Frau neben ihr jemandem ihr Nachhausekommen ankündigte. »Bin in einer Viertelstunde da. Soll ich noch was mitbringen?«
Die Bahn kam herangerauscht und überfuhr das Werbeplakat der Supermarktkette, die Lebensmittel liebte. Petra fragte sich jedes Mal, ob dort auch jemand arbeiten dürfte, der einfach nur einen Job haben wollte. Geld verdienen. Egal mit was. Und sie überlegte, ob sie ihre Tabellen liebte. Liebe war ein sehr großes Wort. Petra benutzte es nicht gern. Nicht für Dinge. Nicht einmal gern für menschliche Beziehungen.
Sanne öffnete den Kofferraum. Doch bevor sie die letzten Kartons herausnahm, hielt sie inne. Sie ließ die Klappe offen, lehnte sich an ihr Auto und sah mit verschränkten Armen auf das Haus.
Engbrüstig stand es weit zurück in dem großen Garten. Der Lebenstraum der Eltern, so schmal und unscheinbar. Ein verwitterter Nussbaum hatte es im Lauf der Jahre überragt.
Sie hätte es wachsen sehen, das Haus, hatten die Eltern immer erzählt. Hätte in ihrem Sportwagen gejauchzt über jede neue Reihe Steine. Manchmal glaubte Sanne sich daran zu erinnern. Aber konnte man sich wirklich an die Zeit als Einjährige erinnern? Und war nicht überhaupt das, was Kindheit genannt wurde, eine Erfindung? Innere Bilder, von denen man nicht wusste, ob sie aus den Fotoalben stammten? Erinnerungen, von denen man nicht wusste, ob es nicht die immer wieder erzählten Anekdoten waren? Du warst so. Du hast immer. Wenn man dich … dann.
Wohl jeden Abend war die Mutter mit ihr zur Baustelle gewandert. Ein Henkelmann mit Essen für den Vater, oder eine große Brotdose, oder auch beides, im Netz am Lenker des Kinderwagens verstaut. Denn der Vater war nach der Arbeit nicht nach Hause gekommen. Zu Hause war auch gar nicht zu Hause gewesen. Bloß anderthalb Zimmer bei den Großeltern. In einem schiefen Mietshäuschen direkt unterhalb der Rotshäuser Kirche. Die Sonntagsglocken hatten das Geschirr in der Vitrine zum Klappern gebracht.
Das so gesparte Geld konnte man in Steine investieren. Und in Dachziegel. Und in Fenster. Und in Türen.
Der Vater war morgens zur Arbeit gegangen, abends zur Baustelle und danach direkt ins Bett. Rechtschaffen müde.
Sanne war nicht ganz zwei Jahre alt gewesen, als sie in ein Kinderzimmer mit Märchentapete gezogen war. Bis dahin hatte sie im Gitterbett am Fußende des Elternbetts geschlafen. Das stand auch im neuen Haus wieder dort. Aber nun mit der kleinen Schwester, mit Petra darin.
Alles war noch viel zu groß gewesen. Das Zimmer. Das Bett. Die Tapete hatte sie verzaubert und geängstigt zugleich. Besonders der Wolf von den sieben Geißlein. Grausam hatte er ausgesehen.
Hatte sie geweint? Hatten die Eltern sie getröstet? Vielleicht zu sich ins Bett geholt? Sanne erinnerte sich nicht und war doch sicher, dass kein Aufhebens um ihre kindlichen Ängste gemacht worden war. Überhaupt wurde um die Gefühle von Kindern kein Aufhebens gemacht. Schon gar nicht, wenn man ihnen etwas zu bieten hatte. Mehr, als man selbst je bekommen hatte.
Als das schmale Haus fertig gewesen war, war der Vater trotzdem nach Feierabend nicht nach Hause gekommen. Er hatte auf anderen Baustellen zu tun. Bei den Kollegen, die ihm geholfen hatten, half nun er, deren Häuser zu bauen. Dazu Schwarzarbeit, wo sie sich ihm bot. Geld verdienen. Sanne hatte ihren Vater wenig gesehen. Und wenn sie ihn sah, war er oft müde. Schlief auf dem Sofa. Oder auf der Gartenbank. »Sei leise, Papa schläft.« Dieser Satz gehörte zur Melodie ihrer Kindheit.
Sanne war leise gewesen. Diesen schlafenden Vater zu wecken, und sei es nur aus Versehen, hätte sie nie gewagt.
Einmal hatte sie sich dicht neben ihn gestellt und ihn eingehend betrachtet. Die dunkle Haut mit den Bartstoppeln. Den etwas geöffneten Mund, aus dem es leise pfiff. Die steile Falte zwischen den Augenbrauen. Wie ein Graben. Sie hatte in die Nasenlöcher mit den dunklen Haaren geguckt, die ihr immer größer zu werden schienen, je länger sie hinsah. Wie Höhlen, von denen man nicht wissen konnte, was sich darin verbarg.
Irgendwann war die Mutter gekommen und hatte sie weggerissen. Was machst du denn da. Sanne erinnerte sich an ein Gefühl der Erleichterung. Als hätte die Mutter sie gerettet. Wie alt war sie da gewesen? Fünf? Sanne hatte sich als klein in Erinnerung, kaum über das Sofa hinausragend.
Der wache Vater war ein gutmütiger, sanfter Mann gewesen. Mit großen, rauen Händen, die alles konnten. Aus Holz lustige Sachen schnitzen. Spielzeug reparieren. Auch die zerbrechlichen Puppen.
Sanft hatte der Vater sogar gewirkt, wenn es Dresche gegeben hatte. Er hatte den Stock geführt, wie er seine Werkzeuge handhabte. Mit selbstverständlicher Präzision, die Tätigkeit nicht infrage stellend. Was getan werden musste, musste getan werden.
Dresche war damals üblich. In allen Häusern. Oft wusste man es schon vorher. Das gibt Dresche. Weil man zu spät nach Hause kommen würde. Weil man die Hose zerrissen hatte, den Ball kaputt gemacht.
»Wart nur, bis der Papa nach Hause kommt.« Die Taten hatten die Mütter gesammelt und den Vätern abends vorgelegt. Die Jungen bekamen öfter Dresche als die Mädchen. Und härtere. Sanne hatte manchmal das Gefühl gehabt, sie bekäme Jungsdresche.
Uns hat das auch nicht geschadet, hatten die Eltern später gesagt, wenn die Rede darauf gekommen war. Es waren Kindheitsanekdoten geworden, über die gelacht wurde. »Weißt du noch? Als du in den Bach gefallen warst? Da hat es ordentlich was gegeben.« Auch für Unfälle wurde man bestraft. »Warum hast du nicht aufgepasst?«
Gitti hatte nicht mehr so viel Dresche bekommen. Die Jüngste. Die Erziehungskraft der Eltern ließ mit jedem Kind nach. Das wusste Sanne inzwischen aus eigener Erfahrung. Damals hatte sie einfach nur die Ungerechtigkeit gespürt.
Die Mutter winkte aus dem Küchenfenster und rief etwas. Sanne sah auf ihre Uhr. Zehn. Die Glocken fingen an zu läuten. Daran hatte sich nichts geändert. Um viertel vor acht hatten sie das schon getan. Und um sechs würden sie wieder läuten. Das war aus den Dorfzeiten geblieben. Rotshausen war schon lange in die Stadt, in Lahnfels, hineingewachsen. Oder Lahnfels in Rotshausen? Egal. Jahrzehnte schon war das Dorf ihrer Kindheit Stadtteil.
»Soll ich Kaffee machen?«, fragte die Mutter.
»Lass uns lieber gleich anfangen«, sagte Sanne.
Eine Krähe flog aus dem Baum vor der Haustür auf. Der erinnerte Petra immer an den Nussbaum vor dem schmalen Haus. Warum genau dieser, hätte sie nicht sagen können. Ein Nussbaum war es nicht. Auch unterschied er sich nicht von den anderen Bäumen in ihrer Straße.
Die Krähe setzte sich auf das Halteverbotsschild, balancierte geschickt darauf herum und stieß dabei laute Rufe aus. Krah, krah. So als grüße sie. Guten Abend. Petra nickte ihr zu.
Bevor sie den Schlüssel ins Schloss ihrer Haustür stecken konnte, öffnete sie sich von selbst. Ein junger Mann erschien im Türrahmen, und es entstand dieser Tanz, wenn jeder dem anderen den Vortritt lassen will. Petra machte zwei Schritte rückwärts. Der Mann ebenfalls, dabei den Türgriff in der Hand behaltend. Petra trat wieder vor, der Mann auch. Dann grinste er, machte ein paar weit ausholende Schritte nach hinten und hielt ihr demonstrativ die Tür auf. »Sonst warten die Kumpels morgen noch auf mich.«
»Danke«, murmelte Petra.
Das automatische Licht schaltete sich ein, als sie durch den breiten Flur des Vorderhauses ging. Es roch unangenehm. So, wie wenn man die Klappe eines der großen Müllcontainer im Innenhof öffnete.
Sie blieb bei den Briefkästen stehen, schloss ihren auf, obwohl schon von außen zu sehen war, dass nichts drin war. Gewohnheit. Bei den Müllcontainern sah sie nach, ob bei irgendeinem ein Deckel offen stand. Aber sie waren alle geschlossen.
Im Hinterhaus drückte sie auf den Knopf des Fahrstuhls. Es dauerte ewig. Als sie schon beschlossen hatte, die Treppen zu nehmen, fuhren die Türen des Aufzugs auseinander. Zwei Mädchen in rosafarbenen Anoraks sahen Petra entgegen und brachen in verlegenes Kichern aus. Vermutlich waren sie mit dem Fahrstuhl spazieren gefahren.
Die beiden Mädchen verständigten sich kurz mit Blicken, liefen dann rechts und links an Petra vorbei, fassten sich hinter ihrem Rücken an den Händen und hüpften durch den Gang.
Petra sah ihnen hinterher. Großstadtkinder. Sie war bis heute keine richtige Großstädterin. Das, was sie vor allem schätzte, war die Anonymität. Weder den jungen Mann an der Haustür noch diese Kinder konnte sie irgendeiner Wohnung hier zuordnen. Und sie ging davon aus, dass auch sie selbst nicht zugeordnet wurde.
In Rotshausen, in der Fliederstraße, war das unvorstellbar. Dass man nicht einmal die Gesichter seiner Nachbarn kannte.
Bin wieder da!«, rief Sanne. Niemand antwortete. Sie bückte sich, um die Bändel ihrer weißen Turnschuhe zu lösen, die, die sie auch zur Arbeit trug. Wo sie den ganzen Tag auf den Beinen war. Ich werde den ganzen Tag auf den Beinen sein, hatte sie am Morgen bei der Überlegung gedacht, welche Schuhe sie am besten anzöge.
Und sie war den ganzen Tag auf den Beinen gewesen. Aber Sanne taten jetzt nicht bloß die Füße weh. Das Elternhaus auszuräumen verlangte eine Anstrengung, mit der sie nicht gerechnet hatte. Sie hatte nichts mit Ausdauer oder trainierten Muskeln zu tun. Sowieso mussten sie keine Sofas und Schränke tragen. Das würden die Möbelpacker machen. Sanne hatte keinen Namen für die Kraft, die sie den ganzen Tag benötigt hatte. Sie fühlte nur, dass sie verbraucht war. Zumindest für heute.
»Keiner da?«, machte Sanne einen zweiten Versuch. Ihre Jacke hatte sie ordentlich auf einen Bügel gehängt und sah sich suchend nach einem freien Haken dafür um. In einem wilden Durcheinander hingen Mäntel, Anoraks und Sakkos übereinander.
Ich muss aufräumen, dachte Sanne und versuchte den Kleiderbügel an der Hutablage aufzuhängen, aber er fiel sofort wieder herunter. Sanne nahm die Jacke vom Bügel und warf sie mit Schwung auf die Garderobe, wo sie auf zwei Sporttaschen gerade so hängen blieb.
Warum muss eigentlich ich aufräumen und nicht alle anderen?, dachte Sanne.
Auch ihr zweiter Ruf war unbeantwortet geblieben. Freitagabend. Da waren die Kinder, die längst keine Kinder mehr waren, aber sagte man als Mutter nicht immer weiter die Kinder?, da waren sie unterwegs. Lisa, die noch zu Hause wohnte. Und Philipp, der wochenends hauptsächlich deswegen nach Hause kam, um mit seinen alten Kumpels auszugehen.
Party. Disco.
Nein, heute gingen sie nicht mehr in die Disco. Lisa grinste nachsichtig, wenn Sanne Disco sagte. Disco gehörte in Sannes Jugendzeit. I am what I am.
Und zu Lady Bump hatten sie in Rotshausen noch ein paar Jahre länger die Hüften gegeneinander geschubst als in Lahnfels.
»Guck! Guck!«, hatte Sanne geschrien, als Penny McLean mal im Fernsehgarten aufgetreten war. »Darauf haben wir getanzt. Genau so.« Als Lisa sie mit hochgezogenen Augenbrauen befremdet angesehen hatte, war Sanne aufgesprungen und hatte versucht, ihre Tochter vom Sofa zu ziehen. »Komm, ich zeig’s dir!« Aber es hatte Lisa nicht interessiert, wie ihre Mutter in ihrer Jugendzeit getanzt hatte. Philipp, der sich, noch völlig verschlafen, zu ihnen gesellt hatte, hatte peinlich berührt auf sein Smartphone gestarrt, Uwe den Kopf geschüttelt und gefragt, wann es denn Mittagessen gebe.
Sannes wilde Begeisterung war genauso schnell in sich zusammengefallen, wie sie aufgeflammt war. Plötzlich hatte sie nicht nur sehnsüchtig an ihre Jugend gedacht, sondern auch an die Zeit, als sie sonntags, Lisa und Philipp an sie gekuschelt, die Sendung mit der Maus geschaut hatten. Als das Fernsehen und sie den beiden noch die Welt erklären konnten.
In solchen Augenblicken meinte Sanne, diese Zeit nicht genug genossen zu haben. Aber wie hätte sie auch wissen können, wie schnell sie verging. Wie schnell die Kinder einem entwuchsen. Wie schnell man sich neben ihnen uralt fühlen würde. Bei den eigenen Eltern hatte man es nicht sehen können. Weil einem deren Jugendzeit genauso egal gewesen war wie jetzt Lisa und Philipp die ihre. Weil einem die eigenen Eltern schon immer alt vorgekommen waren.
Jetzt erklärten Philipp und Lisa öfter Sanne die Welt. Die Welt, in der zumindest Philipp, obwohl der Jüngere, längst eigene Wege ging, bloß noch am Wochenende kam und sich von Sanne seine Wäsche waschen ließ.
Gleich nach dem Abitur war er ausgezogen, weil es technische Studiengänge in Lahnfels nicht gab. Aber vielleicht wäre er auch ausgezogen, wenn er sich für Philosophie oder so entschieden hätte? Sanne hätte es nicht sagen können.
Lisa war nach dem Abitur geblieben, studierte in Lahnfels. Germanistik und ein Fach, in dem Medien vorkam, dessen genaue Bezeichnung Sanne sich aber nicht merken konnte.
Lisa würde auch weiterhin bleiben. Mindestens noch vier Semester. Bis zu ihrem Masterabschluss. Vier Semester waren zwei Jahre. Das Haus ohne Lisa wollte Sanne sich nicht vorstellen.
Sie ging in die Küche. Auf dem Weg zum Kühlschrank machte sie die offen stehende Klappe des Backofens zu. Auf der Herdplatte lagen zwei Tiefkühlpizzakartons. In einem lag noch ein Viertel. Jemand hatte seine Pizza nicht aufgegessen. Sanne nahm es und biss hinein. Aus dem Kühlschrank holte sie sich eine Flasche Weißwein, angelte sich, das Pizzastück zwischen den Zähnen, ein Glas aus dem Schrank, ging hinaus auf die Terrasse und ließ sich in einen Stuhl fallen.
Das Tageslicht machte ganz langsam einer fahlen Dämmerung Platz. Hinter den Fenstern der Nachbarn schimmerte es hier und da bläulich. Das Haus von Marion und Heiko konnte sie von hier aus nicht sehen, es lag auf der anderen Seite.Seit ihrem letzten Doppelkopfabend wich sie den beiden sowieso lieber aus. Also Heiko. Sie wich Heiko lieber aus.
Wo war eigentlich Uwe? Sanne war durcheinander, den ganzen Tag hatte sie immer wieder überlegen müssen, welcher Wochentag war. Freitag. Natürlich. Uwe spielte Badminton. Oder? War sein Skatabend? Was hatte er am Morgen zum Abschied noch mal gesagt?
Sanne fuhr sich mit der Zunge über die Zähne. Die kalte Pizza hatte einen pelzigen Belag darauf hinterlassen. Sie spülte mit Weißwein. Ein paar Gläser würde sie noch trinken müssen, bis der Belag verschwunden wäre. Aber ihr war sowieso nach Trinken. Nach Rauchen auch.
Doch sie hatte keine Zigaretten. Uwe war gegen Rauchen. Morgen mit dem Vater mal wieder eine? Der hatte berufsmäßig geraucht. Und konnte es jetzt im Alter nicht mehr lassen.
Hätte ich mir doch bloß zwei, drei Zigaretten aus seiner Schachtel mitgenommen, dachte Sanne. Dazu ein kleines Feuerchen. Rauchen, trinken, in die Flammen gucken. Den Tag hinter sich lassen.
Doch das Holz für die Feuerschale war aus.
Petra hatte die Beine weit von sich gestreckt. Sie bewegte die Zehen in den Nylonstrümpfen, sah durch das riesige Fenster dem Septemberhimmel beim Dämmrigwerden zu und nippte an ihrem Weinglas. Wochenende. Nichts, das Petra dringend herbeisehnte. Gott sei Dank, zwei Tage frei.
Vielmehr waren es für sie viele Stunden, die ausgefüllt werden mussten. Spazieren gehen? Wohin? Ins Museum? Überhaupt vor die Tür? Oder lieber Lesen? Fernsehen? Es gab Wochenenden, an denen Petra sich freute, wenn endlich Sonntagabend war.
Aus der Wohnung über ihr kamen gedämpfte Schritte, nebenan scharrte etwas leise über die Wand. Die sanften Geräusche waren ihr schon vertraut.
Alle Wohnungen waren gleich ausgestattet. Fußbodenheizung. Eichenparkett. Offene Küche. Nur die Größe unterschied sich. Petra hatte das Zweieinhalb-Zimmer-Apartment. Seit einem halben Jahr.
Häufig schon war sie umgezogen. Alle zwei, drei Jahre. Manchmal auch erst nach vier. Immer dann, wenn das Gefühl dringlicher wurde, es müsse irgendwo einen besseren Platz für sie geben, begann sie zu suchen.
Das Kriterium für ihre allererste Wohnung nach dem Studium war die Entfernung von zu Hause gewesen. Weit weg. Fünfhundert Kilometer. In eine große Stadt. Ein neues Leben anfangen. Eins ohne Herkunft. Niemandem begegnen, der sagte: Ach, guck mal, das ist doch die, wie hieß sie noch?, aus unserer Nachbarschaft. Die war doch immer ein bisschen seltsam, oder?
In Rotshausen wussten sie noch nicht, dass Petra schon wieder umgezogen war. »Für dich braucht man ja ein Extra-Adressbuch«, hatte Sanne schon beim letzten Mal gesagt. Und den Kopf geschüttelt. Hast du nichts Besseres zu tun, hatte Petra herausgehört. Und: Na ja, wer keine Familie hat, kann sich solche Sperenzchen leisten. Petra war sich mangelhaft vorgekommen. Mangelhaft kam kurz vor ungenügend.
Sanne wohnte in ihrem eigenen Haus. Aus einem selbst gebauten Haus zog man nicht einfach wieder aus. Sanne hatte auch noch das Haus der Eltern bekommen. Obwohl sie auf es herabsah, kopfschüttelnd »diese winzigen Zimmer« sagte. Sie ist die Älteste, hatte es geheißen.
Petra ertappte sich seitdem öfter bei der Angst, das schmale Haus könne sich unter Sannes Obhut auflösen und entschwinden.
So, wie schon das Kinderzimmer verschwunden war. Für ein Gästezimmer. Am Telefon hatte ihr die Mutter erzählt, dass das Etagenbett zu Kleinholz geworden war. »Sanne hat es mitgenommen für ihre neue Feuerschale. Ist das nicht praktisch?«
Petra hatte daran gedacht, dass ihr Bett schon einmal fortgekommen war. Für dieses nun verbrannte Etagenbett, weil Gitti vom Elternschlafzimmer ins Kinderzimmer ziehen sollte.
Das Bett, das bis dahin Petras gewesen war, hatte der Vater von der Wand weggezogen und es geschickt in seine Einzelteile zerlegt. Petra war nicht von seiner Seite gewichen, hatte jedem seiner Handgriffe genau zugesehen. Wie er Schrauben herausgedreht und mit einem Gummihammer verkantete Bretter vorsichtig gelöst hatte.
Noch am selben Tag hatte der Vater das Etagenbett gebaut. Viel später erst war Petra klar geworden, dass er die Teile dafür vorbereitet haben musste. Bretter gesägt und gehobelt und Löcher für die Schrauben vorgebohrt. Von langer Hand waren die Änderungen im Kinderzimmer geplant worden. An diesem Tag jedoch war es ihr vorgekommen wie ein Wunder. Eins, das sie ihren angestammten Platz im Kinderzimmer kostete.
Petra, das Telefon mit der Stimme der Mutter am Ohr, hatte Sanne vor sich gesehen, wie sie ein Feuer aus dem Stockbett machte.
Sanne, die sich als Kind manchmal nachts über sie gebeugt hatte, so dicht, dass Petra ihre Haut hatte riechen können. Überall hätte sie diesen Geruch erkannt, ihre Schwester daran blind identifizieren können. Sannes Kopf hatte einen Augenblick über ihr geschwebt, bevor sie wieder in ihr Bett geschlichen war. Petra hatte die Augen einen Spaltbreit geöffnet und sie beobachtet, wie sie noch einen Blick zurückgeworfen, dann vorsichtig ihre Bettdecke angehoben und sich wieder hingelegt hatte. Die Decke fest um sich herumgestopft, sodass sie ausgesehen hatte wie eine dicke Rolle mit Haaren oben dran. Petra hatte noch einen Moment Sannes und Gittis Atem gelauscht, den sie genau hatte unterscheiden können, nicht bloß, weil er aus verschiedenen Richtungen kam und weil Gitti manchmal leise schnarchte. Auch als Gitti die Mandeln entfernt worden waren und sie danach nicht mehr schnarchte, konnte sie es auseinanderhalten. Manchmal war es ihr vorgekommen wie das Flüstern von Luftgeistern.
Nachdem Petra auf die rote Taste gedrückt, das Gespräch mit der Mutter mit einem »Bis bald« beendet hatte, dieses übliche »Bis bald«, das den nächsten Anruf, den nächsten Besuch im Ungefähren ließ, war ihr gewesen, als hätte das verschwundene Kinderzimmer, das verbrannte Stockbett die Kraft, auch noch die Erinnerungen zu vernichten. Als hingen die am Holz des Betts. An den abgetretenen Leiterstufen. An den winzigen Kratzern, an den Kerben, die das Holz im Lauf der Jahre erlitten hatte.
Hing die Erinnerung nicht an konkreten Gegenständen? Die man nur anschauen und befühlen musste, um die Gefühle wieder hervorzulocken? Sich ihrer zu versichern?
Warum wusste Sanne nichts von solchen Dingen. Dachte immer nur praktisch. Wie auch die Mutter immer nur praktisch gedacht hatte.
Sanne stand auf und ging mit bloßen Füßen ein paar Schritte in ihren Garten. Das Gras war nass und es fühlte sich beinahe an, als wate sie durch ein Bachbett. Bei den Strauchrosen, umfasst von der Buchsbaumhecke, die Uwe regelmäßig zinnenartig zurechtstutzte, drehte sie sich um und betrachtete ihr Haus.
Die braunen Fenster mit den innenliegenden Sprossen, die ihnen einen ländlichen Charme hatten verleihen sollen, ohne das Putzen zu einer Mühe zu machen. Den Erker, an dessen Seite sich die Terrasse befand, die Loggia unter dem oberen Giebel, die Brüstung aus braunem Holz. Damals der Gipfel der Baumode.
Der Vater hatte geholfen. Jedes Wochenende hatte er die Speismaschine längst angestellt, wenn Sanne Frühstück für die Arbeiter gebracht hatte. Und ein paar Flaschen Schnaps. Für die Bierkästen sorgte Uwe. Uwe machte überhaupt mehr Hilfs- und Zutragearbeiten. Er war handwerklich nicht sehr geschickt. Doch jeder tat, was er konnte. Eigenleistung sparte eine Menge Geld.
Wie stolz waren sie gewesen, als sie in das noch nicht einmal verputzte Haus eingezogen waren. Raus aus der kleinen Mietwohnung, die von Anfang an als Übergangslösung gedacht gewesen war. Das Geld sparen für ein Haus. Wie es schon die Eltern gemacht hatten.
Rund um das Haus noch Matsch und Schotterhaufen. Wo im Laufe des Sommers für die Terrasse gepflastert werden sollte, hatten Bohlen gelegen. Damit sie trotzdem schon dort sitzen konnten.
Fünfeinhalb Monate später war Lisa geboren worden. Baukind. Das war keine Seltenheit. Ihr Leben hatte sich für Sanne vollkommen angefühlt. Als wäre alles erfüllt, was sie sich immer gewünscht hatte.
Jetzt, in der Dämmerung, hatte das Haus etwas Düsteres. Sah nicht die Fassade auch schmuddelig aus? Wann hatten sie die eigentlich zuletzt streichen lassen?
Und wo war dieses Gefühl? Während sie dastand, mit Blick auf ihr Haus, so, wie sie am Morgen auf das Elternhaus geguckt hatte, fragte Sanne sich, wann genau ihr das eigentlich abhandengekommen war.
Als Uwe spätabends nach Hause kam, saß Sanne immer noch draußen. »Was machst du denn hier?«, rief er erschrocken. Oder vorwurfsvoll?
»Mir ist kalt«, nuschelte Sanne.
»Kein Wunder«, sagte Uwe und blieb mit verschränkten Armen bei der Terrassentür stehen. »Hast du getrunken?«
Sanne schwenkte die leere Weinflasche und musste bei dem Gedanken grinsen, dass Uwe nicht wissen konnte, dass es die zweite war. Nein. Die zweite war es auch gar nicht. Es war die anderthalbte. Die erste war angebrochen gewesen. Die anderthalbte also. So viel war’s nun auch wieder nicht, Sanne.
»Habe ich das jetzt laut gesagt?« Sanne sah Uwe fragend an.
»War’s so schlimm bei deinen Eltern, dass du dich betrinken musstest?«, fragte Uwe. Aber seine Frage klang nicht, als ob er wirklich wissen wollte, wie es bei Sannes Eltern gewesen war. Und als ob er Sanne trösten würde, falls es wirklich so schlimm gewesen war, dass sie sich betrinken musste. Das hörte Sanne sogar mit ihrem vernebelten Hirn heraus. Oder vielleicht hörte sie es sogar, weil ihr Hirn vernebelt war?
»Nein, es war nicht schlimm.« Sanne hatte Mühe mit dem s und dem sch. Sie drehte sich zu Uwe, aber der stand gar nicht mehr dort. Hatte sie sich so lange Zeit gelassen mit der Antwort?
Mit ihrem Einzug in das Kinderzimmer hatte Gitti endgültig Petras Stellung als kleine Schwester übernommen.
Sanne dagegen war die Große geblieben. Sie wurde für Gitti sogar eine noch größere große Schwester. Sanne ging auf in ihrer neuen Rolle. Petra fand keine andere. Sie ging unter. Untergehen wurde ihre Lebensform. Untergehen konnte man überall. Zu Hause. In der Schule. Im Studium. Bei der Arbeit. Der Beruf, den sie sich ausgesucht hatte, eignete sich bestens zum Untergehen. An jeder ihrer Arbeitsstellen hatte sie das aufs Neue ausprobiert.
Nur manchmal streckte sie den Kopf über die Wasseroberfläche. Unbeholfen, ungeschickt. Manchmal passierten ihr dann merkwürdige Dinge. So wie die Sache mit dem Klavier.
Ein Kollege hatte mit zwei Leuten in der Teeküche gestanden und erzählt, er räume gerade das Haus seiner Eltern aus, und da gebe es auch ein Klavier, das er nun loswerden müsse. Petra hatte sich gerade ihren zweiten Kaffee geholt und sich schnell wieder an dem Grüppchen vorbeidrücken wollen. Schon fast aus der Tür, hatte sie sich zu ihrer eigenen Überraschung umgedreht und »Ich würd’s nehmen« gesagt. Alle drei waren zu ihr herumgefahren und hatten sie angestarrt. Petra hatte sich ein schwarzes Loch gewünscht.
Aber dann hatten die Kollegen plötzlich auf sie eingeredet. Gleichzeitig. Beinahe war es Petra so vorgekommen, als hätten sie sich gefreut, mal ein paar Worte aus ihrem Mund zu hören. Oder hatten sie bloß diese Peinlichkeit übertünchen wollen?
Ob sie spielen könne? Welche verborgenen Talente sie denn noch habe?
Es sei aber gewiss total verstimmt, gab der Kollege, der das Haus seiner Eltern räumte, zu bedenken. Seit mindestens zwanzig Jahren habe da niemand mehr drauf gespielt. Und er schon mal gar nicht. Seit er zu Hause ausgezogen sei, habe er keine Taste mehr berührt. Klavier, das sei für ihn immer ein Folterinstrument gewesen. Aber er und seine Schwester hätten es lernen müssen. Familientradition.
Wieder in ihrem Büro, hatte Petra den Kopf geschüttelt. War sie verrückt geworden? Was wollte sie denn mit einem Klavier?
Das Instrument war in Petras Wohnzimmer gelandet. Zusammen mit einer alten Klavierbank, bezogen mit mürbem, goldschimmernden Samt. Wie Fremdkörper nahmen sie sich zwischen ihren gradlinigen Möbeln aus. Wie seltsame Gäste, die es sich ungebeten bequem gemacht hatten.
Ab und zu schob Petra sich auf die samtene Bank. So wie jetzt. Sie stellte ihr Weinglas neben die Lampe, hob den Deckel von den Tasten und betrachtete sie.
Manchmal schlug sie auch ganz vorsichtig einen Ton an, zog die Finger aber jedes Mal schnell wieder zurück.
Klaviere hatten in den Häusern der besseren Leute gestanden. Klavier spielen hatten die Kinder besserer Leute gelernt. So wie die in den Reihenhäusern gegenüber dem schmalen Haus.
Sie und die Schwestern hatten Blockflöte gelernt. Aber nur, weil es Flötenunterricht in der Schule gegeben hatte. Das war für die Eltern nichts anderes gewesen als Schreiben, Rechnen oder Lesen. Ein Schulfach eben. Nur das Üben wurde als lästiger empfunden. Bist du bald fertig? Kümmer dich lieber um deine Rechenaufgaben. Rechnen. Oder Schreiben. Das machte wenigstens keinen Lärm.
Wusste der Kollege eigentlich, dass es gut war, etwas zu müssen? Gezwungen zu werden, eine Fähigkeit auszubilden?
Petra hatte wenig müssen. Außer aufs Gymnasium. Doch auch da überlegte sie manchmal, ob es wirklich ein Muss gewesen war.
Eines Tages hatte es geheißen: »Du kommst aufs Grimm-Gymnasium.« Als hätte das Schicksal das bestimmt. Als könnte man sich nicht dagegen wehren, obwohl man es gerne würde. Petras Klassenlehrerin war den Eltern vielleicht wirklich so vorgekommen wie das Schicksal. Eine vehemente Frau, die Widerspruch nur in Ausnahmefällen duldete.
Niemand in Petras Familie war je auf ein Gymnasium gegangen.
Das Wort aus dem Mund der Eltern hatte fremd geklungen. Fast, als schämten sie sich. So wie man sich für ein dummes Kind schämte, konnte man sich offenbar auch für ein kluges schämen. Sie ist aus der Art geschlagen.
Nie waren sie zu einem Elternabend gegangen. Bloß zur Aufnahmefeier, wo sie mit eingezogenen Köpfen und auf den Boden blickend gesessen hatten. Petra hatte Mitleid mit ihnen empfunden. Und das Gefühl gehabt, den Eltern eine Zumutung zu sein. Eine, die sie sich nicht einmal selbst ausgesucht hatte.
Petra klappte den Klavierdeckel wieder zu.
Uwe war weg, hatte aber das Deckenlicht angelassen. Sanne sah in ihr hell erleuchtetes Wohnzimmer.
Mindestens drei Mal so groß wie das der Eltern. Platz für ausladende Polstermöbel. Einen wandfüllenden Schrank. Auch den Essplatz konnte man von hier aus sehen. Weil keine Wand und keine Tür dazwischen war. Wie beinahe unerhört ihr das damals alles vorgekommen war.
Doch vielleicht war der Mutter das Wohnzimmerchen, dessen Schränke sie am Vormittag gemeinsam ausgeräumt hatten, ja auch ganz unerhört vorgekommen, dachte Sanne plötzlich. Der Mutter, die in dem schiefen Mietshäuschen am Kirchberg ausgehalten hatte, mit dem Säugling und mit den Schwiegereltern und mit dem immer abwesenden Mann.
Das winzige Zimmer war ihr vielleicht wie ein Saal vorgekommen, das Häuschen wie ein Palast. Wie ein eigenes Neuschwanstein, wohin die Eltern, als sie sich auch noch ein Auto hatten leisten können, einmal einen Ausflug gemacht hatten. Wochenlang hatte die Mutter davon geschwärmt.
Für das Kind Sanne war das Wohnzimmer ja auch beeindruckend gewesen. Nicht wegen der Größe. Sondern weil es nur sonntags benutzt wurde. Zum Kaffeetrinken. Dann saß die ganze Familie, steif, als seien sie Gäste in ihrem eigenen Haus, auf dem Sofa. Die Kuchenteller auf dem niedrigen Tisch davor. Es musste sich weit vorgebeugt werden, um mit der Gabel in die Kuchenstücke stechen zu können. Auch die gehörten zum Sonntag. Vorsichtig mussten die Bissen zum Mund balanciert werden, damit nichts auf dem Teppich landete. Oder auf dem Sofa. Oder auf den Sonntagskleidern. Die Mutter beobachtete sie genau dabei. Denn sie war es, die das Unglück beseitigen musste, sollte sich eins ereignen. Die Buttercreme vorsichtig vom Teppich oder vom Sofa kratzen, anschließend mit Fleckenwasser darüberreiben und dabei schimpfen. Kannst du nicht aufpassen? Der gute Teppich. Das gute Sofa. Das gute Kleid.
Alle waren erleichtert, wenn die Mutter den Kaffeetisch abgeräumt hatte. Dann wurde der Fernseher eingeschaltet und geschaut, was gerade über den Bildschirm flimmerte. Bilder aus fernen Ländern, Personen, die eine Bedeutung hatten, die niemand so genau kannte oder verstand, auch die Eltern nicht, manchmal ein lustiger Film.
Im Frühling und im Sommer wurde auch je nach Wetter ein Spaziergang gemacht. Gemessen ging man durch Rotshausen, begegnete anderen sonntäglichen Familien, mit denen ein paar Worte gewechselt wurden. Schön, so ein Sonntag, gell? Man kann es sich mal so richtig gemütlich machen.
Sonntage waren dumpfe, bewegungslose Tage gewesen. Sie waren erleichtert gewesen, wenn sie abends die Kleider ausziehen durften, die die Mutter sorgfältig auf Bügel hängte. Bis zum nächsten Sonntag.
Spätestens in der Pubertät waren sie den Sonntagen ausgewichen und hatten sich lustig darüber gemacht. Die Mutter nachgeäfft, wenn sie es nicht hören konnte: »Der gute Teppich, kannst du nicht aufpassen?«, sich dabei vor Lachen geschüttelt. Als könnte man so gleich die Kindheit mit abschütteln.
Der gute Teppich der Eltern war irgendwann gegen Teppichboden ausgewechselt worden. Bloß noch saugen, nicht mehr um den Teppich herum feucht wischen müssen. Der Teppich- war Laminatboden gewichen. Viel praktischer. Kann man wischen. Auch hatten sich die Eltern vor Kurzem zum zweiten Mal ein neues Sofa gekauft. Und schon lange benutzten sie das Zimmer jeden Tag.
Nur der Schrank war geblieben, war immer noch der aus der Kindheit. Dunkles Holz. Und in der Mitte des Aufsatzes zwei Glasschiebetüren, hinter denen säuberlich aufgereiht hauchdünne Gläser standen. Und das gute Kaffeeservice. Auch das war noch das aus der Kindheit.
Benutzt wurde anderes Geschirr. Die Gläser dicker, die Tassen größer. Die Vitrine war Museum.
Heute hatten die Mutter und Sanne die hauchdünnen Gläser vorsichtig in Zeitungspapier gewickelt. »Die haben wir zur Hochzeit bekommen«, hatte die Mutter protestiert, als Sanne sie hatte überreden wollen, sie auszusortieren. »So ein Umzug ist doch eine gute Gelegenheit, Ballast abzuwerfen.«
Jetzt tat es Sanne leid, das Hochzeitsgeschenk der Eltern Ballast genannt zu haben.
Irgendwo klingelte ihr Handy. Petra fand es in ihrer Manteltasche. Zwei verpasste Anrufe, sagte das Display. Den ersten hatte sie gar nicht gehört. Jürgens Nummer. Petra rief nicht zurück. Sie wollte nicht, dass seine Frau oder seine Kinder ihn ansähen und fragten: Wer war denn das? Und er müsste dann stottern und lügen. Sie verleugnen.
Nie hatten sie das so verabredet. Aber Jürgen hatte auch nie gefragt: Warum rufst du nicht einfach zurück?
Nicht einmal eine Nachricht schickte sie ihm. Auch die machten Töne. Und auch dann könnten Frau und Kinder fragen, wer schreibt dir?
Petra setzte sich wieder aufs Sofa und starrte auf das Telefon in ihren Händen. Ob Jürgen noch mal anrief? Nachrichten schickte er nie. Er fand diese Tipperei lästig.
Ab dem Gymnasium hatten die Eltern nicht mehr verstanden, was sie machte. Sie hatten »Wie war’s in der Schule« gefragt, und Petra hatte »gut« geantwortet.
Mehr wurde nicht von ihr erwartet. Oder? Petra wusste nie, was die Eltern in ihr sahen. Bei den Schwestern hieß es, die Sanne ist so. Die Gitti so. Typisch Sanne. Typisch Gitti. Die Petra? Ja, die Petra. Hm. Es schien nichts zu geben, was typisch für sie war. Oder war es etwas Unangenehmes, etwas, das nicht ausgesprochen werden durfte?