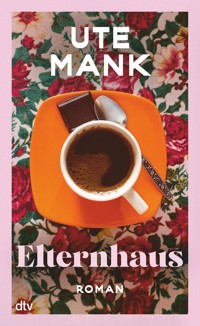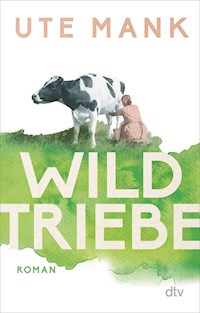
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Frauen auf einem Hof – im Kampf um Selbstbestimmung, Anerkennung und Freiheit Drei Frauen auf einem Hof - auf der Suche nach Selbstbestimmung, Anerkennung und Freiheit Alle alten Höfe hatten einen Namen. Er ging auf die Vorfahren zurück, auf deren Namen, Berufe oder EIgenschaften. Der Hausname war wichtiger als der amtliche Nachname. Denn er gab allen Auskunft darüber, wer man war. Aber viel mehr noch sagte er einem, wie man zu sein hatte. Ute Manks faszinierender Debütroman – jetzt im Taschenbuch Für die alte Großbäuerin Lisbeth gibt es nichts Wichtigeres als den Hof, sein Erhalt ist ihr Lebenssinn. Nie hat sie die damit verbundenen Pflichten hinterfragt. Doch mit Schwiegertochter Marlies kommt eine neue Frau ins Haus, die keineswegs klaglos und ohne eigene Wünsche das Leben einer Bäuerin führen will. Das Kaufhaus in der nächsten Stadt wird für Marlies zum Sehnsuchtsort im Wirtschaftswunderdeutschland, arbeiten möchte sie dort, einen Jagd- und Traktorführerschein machen, das Leben soll doch mehr zu bieten haben. Die beiden Frauen tragen fortan stille Kämpfe aus, um Haushaltsführung, um Kindererziehung. Doch eigentlich werden viel größere Dinge verhandelt: Lebensmodelle, Vorstellungen vom Frausein, vom Muttersein. Und doch ist da ein verbindendes Element: Marlies' Tochter Joanna, die ihren ganz eigenen Weg geht und nach dem Abitur nach Uganda aufbricht … Ein großer Familien- und Frauenroman zwischen Tradition und Fortschritt »Mit großem Einfühlungsvermögen beschreibt Ute Mank in ihrem beeindruckenden Debüt ›Wildtriebe‹ die Frauen aus drei Generationen mit ihren Ecken und Kanten, ihren Geheimnissen und Lieben.« Gala »Ein sehr besonderer Generationenroman, der berührt und in dessen Figuren man sich ganz wunderbar verlieren kann.« Delmenhorster Kreisblatt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ute Mank
Wildtriebe
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für meine Töchter
Alle alten Höfe hatten einen Namen. Er ging auf die Vorfahren zurück, auf deren Namen, Berufe oder Eigenschaften. Der Hausname war wichtiger als der amtliche Nachname. Denn er gab allen Auskunft darüber, wer man war. Aber viel mehr noch sagte er einem, wie man zu sein hatte. Der Bethches-Hof verdankte seinen Namen den Frauen. Seit Generationen hießen sie hier Elisabeth, wurden aber Lisbeth genannt, weil Namen in der Gegend nie so ausgesprochen wurden, wie sie im Taufregister standen. Aus Katharina wurde Katrine, aus Dorothea Dorth. Und aus Elisabeth eben Lisbeth.
Der Bethches-Hof war einer der größten in Hausen, diesem typischen Fachwerkdorf mitten in Hessen. Wie ein Hufeisen war er angelegt. Links das große zweistöckige Wohngebäude. Der Kellersockel aus den schwarzen Basaltbrocken der Gegend, darüber das Fachwerk. Dunkelgraue Balken mit weiß ausgeputzten Gefachen. Geradeaus die Scheune mit dem riesigen Tor. Auch sie aus Basalt und Fachwerk. So wie auch die Ställe auf der rechten Seite. Alles war miteinander verbunden, ein Rahmen für den riesigen Misthaufen, der die Größe des Hofs bekräftigte. Doch nein. Den gab es ja nicht mehr. Bloß noch die Kuhle.
Nur Joannas lange Beine waren zu sehen, als sie über den Hof ging. Rechts und links ein Arm. Alles andere, selbst der Kopf, war vom Rucksack verdeckt. Ein riesiges Ding. Und doch klein dafür, dass er das Gepäck für ein ganzes Jahr enthielt. Sie wollte nicht zum Flughafen gefahren werden. Nicht einmal zum Bahnhof, wo sie in den Zug nach Frankfurt steigen würde.
Marlies stand am Küchenfenster, hatte es trotz der Kälte geöffnet. Am frühen Morgen hatte das Pflaster auf dem Hof verdächtig geglitzert. Einen Moment hatte sie gedacht, es hätte gefroren. Obwohl es Juni war. So etwas hatte es schon gegeben bei der Schafskälte. Aber bloß regennass waren die huckeligen Basaltsteine gewesen. Marlies beugte sich hinaus. Sie hätte ihr gern wenigstens gewinkt, aber Joanna drehte sich nicht um. Mit entschlossenen Schritten lief sie durchs Hoftor. Noch für einen Moment konnte Marlies ihr hinterhersehen, wie sie die Brunnenstraße hinaufging, dann würde sie rechts abbiegen und aus ihrem Blickfeld verschwinden.
Marlies hatte das schmerzhafte Empfinden, Joanna verschwände nicht bloß aus ihren Augen. Ihr war, als hätte ihre Tochter sie ihrer Zukunft beraubt, indem sie die eigene in die Hand nahm. Indem sie nichts als auf und davon und weit weg wollte.
Geredet und geredet hatten sie. Das heißt, Marlies hatte geredet. Auf Joannas Bettkante. Joanna mit angezogenen Beinen in der äußersten Ecke. Mit verschlossenem Gesicht. Nachdem Marlies an Joannas Zimmertür geklopft und deren genervten Gesichtsausdruck einfach übersehen hatte. Willst du das wirklich machen? Was bringt dir das? Du verlierst ein ganzes Jahr.
Joanna wollte. Was war ein Jahr, wenn man neunzehn war. Das ganze Leben vor sich.
Und Marlies spürte, es ging ihr in Wahrheit gar nicht um dieses eine Jahr. Trotzdem hackte sie immer weiter darauf herum. Weil sie nicht sagen konnte, ich ertrage es nicht, wenn du so weit weg gehst. In ein solch fremdes Land. Was ist, wenn du einen Unfall hast, beraubt wirst, dir eine seltsame Krankheit holst? Marlies spürte auch, es ging ihr in Wahrheit nicht um die Entfernung und das fremde Land. Aber sie konnte auch nicht sagen, ich ertrage es nicht, hier ohne dich zu sein. Kaum bist du groß, soll ich dich hergeben. Wo ich dachte, jetzt könnte unsere beste Zeit beginnen. Ich könnte dir ein bisschen beim Studentenleben zugucken. So etwas hatte ich nämlich nie. Aber vor allem dachte ich, wir könnten wie zwei erwachsene Frauen miteinander umgehen. Miteinander sprechen. Der ganze Kinderkram, die Pubertät endlich hinter uns.
Afrika, hatte Joanna eines Mittags gesagt. Uganda, um genau zu sein. Was anderes machen als lernen. Was Sinnvolles. Alle Köpfe waren zu ihr herumgefahren. Vier Paar große Augen hatten sie angesehen und »Afrika?« geechot.
Die Küchentischdebatten über ein aussichtsreiches Studium waren da schon eine ganze Weile eingeschlafen. Auch die hatte Marlies so eifrig geführt, als ginge es um ihre Zukunft, nicht um Joannas. Gedanken über ihre eigene Zukunft wich sie sowieso lieber aus.
»Es gibt Tausende Studiengänge«, hatte Joanna gesagt. »Ethnologie, Linguistik, Prähistorische Archäologie, Klassische Philologie.« Sie leierte Fächer herunter, von denen sie wohl glaubte, sie müssten in den Ohren ihrer Eltern besonders fremd oder exotisch klingen.
»Und was macht man später damit?«, hatte Konrad gefragt, Joanna die Schultern gezuckt.
Lisbeth und Alfred hatten stumm dabeigesessen und von einem zum anderen geguckt. Karl konnte nichts mehr sagen. Lisbeth trug die Witwentracht, die Röcke, das Leibchen, die Schürze ganz in Schwarz und die Borten ohne Verzierungen.
»Vielleicht muss man das ja nicht unbedingt gleich wissen«, sagte Marlies, für die die aufgezählten Fächer verlockend klangen. Als hätte Joanna von faszinierenden Ländern erzählt, fern von der Lebenswelt des Hofs. Länder, für die man in keinen Zug und in kein Flugzeug steigen musste. Die man mit dem Kopf bereisen konnte.
Als Joanna nicht mehr zu sehen war, blickte Marlies zu Konrad. Mit verschränkten Armen lehnte er an einer der Stalltüren und hatte seiner Tochter ebenfalls hinterhergesehen.
Was er wohl fühlte? Mit dem Rücken an der Stalltür, hinter der sich keine Kühe mehr befanden? Wo er doch Landwirt mit Leib und Seele war, aber nun in eine seelenlose Fabrik arbeiten gehen musste. Bloß abends noch ein paar Felder bestellte, noch ein paar Schafe hielt, weil die nicht viel Arbeit machten. Nebenerwerbslandwirt. Mondscheinbauer. Tat es ihm weh, seine Tochter ziehen zu lassen? Was hatte er sich für Joanna gewünscht? Hatte er sich überhaupt etwas gewünscht? Oder konnte er sie leicht freigeben? Auf dem Hof gab es ohnehin keine Zukunft für sie. Für niemanden gab es hier eine Zukunft.
Er tat Marlies leid. Aber sie tat sich auch leid. Im Augenblick waren sie beide bemitleidenswert. Ach, eigentlich waren sie alle zu bemitleiden.
»Mach das Fenster zu«, sagte Lisbeth. »Mich friert.« Marlies gehorchte und wandte sich dem Küchentisch zu, auf dem noch das Frühstück stand. Sie fing an, das Geschirr abzuräumen. Lisbeth zog ihr Schultertuch enger um sich, schob ihren Stuhl zurück und verließ mit geradem Rücken und erhobenem Kopf die Küche.
Marlies blickte ihr mit einem Stapel Teller in der Hand hinterher, bis sich die Küchentür hinter ihr schloss. Wolltest du auch mal weg von hier, hätte sie ihr am liebsten hinterhergerufen? Sie stellte die Teller wieder auf den Tisch und ließ sich auf einen Stuhl fallen.
Wie Joanna das Abiturzeugnis gebracht hatte. Achtlos aus der Schultasche gezogen, so wie sie auch Informationsblätter herausgeholt hatte, die die Eltern unterschreiben mussten.
Marlies meinte, sie hätte berauscht sein müssen. Sie hatte ein Leuchten im Gesicht ihrer Tochter erwartet, doch nicht einmal ein Lächeln darin gefunden. Dieser Abschluss schien ihr nicht viel zu bedeuten. Oder hatte sie bloß so getan? Cool wirken? Unbeeindruckt? Nicht auf den eigenen Stolz und schon gar nicht auf den der Eltern angewiesen erscheinen?
Marlies war stolz. Und berührt. Ihre Tochter hatte das Abitur. Andächtig hatte sie das Zeugnis in die Hand genommen. Unterschreiben musste sie es nicht mehr. Joanna war volljährig.
Aufs Gymnasium gewollt hatte sie damals nicht. Weil ihre besten Freundinnen nicht mitkommen würden. Wie Zehnjährige eben sind. Marlies hatte dafür gekämpft. Auch weil es außer ihr sonst niemand für wichtig gehalten hatte. Lisbeth nicht. Und Konrad auch nicht. Ob Joanna ihr heute dankbar dafür war? Marlies hätte es plötzlich gern gewusst.
Für sie als Handwerkertochter war das Gymnasium nicht vorgesehen gewesen. Nicht, weil man eine wie Marlies nicht aufs Gymnasium gelassen hätte.
Ihre Tochter ist sehr gut in der Schule, hatte der Lehrer damals gesagt. Sie hätte das Zeug zu mehr. Das Wort Abitur hatte er gar nicht ausgesprochen. Die Eltern hatten die Köpfe geschüttelt. Wozu? Eine Ausbildung war doch was. Für ein Mädchen sowieso.
Eine Lehre im Kaufhaus in Lahnfels. Vom Dorf in die Stadt. In die kleine Universitätsstadt, die alle meinten, wenn sie sagten, heute gehe ich in die Stadt. Das war doch was. Nach der Lehre von Haushaltswaren zu Damenmoden. Das war doch was. Ein Aufstieg, so war es Marlies vorgekommen. Nur wenig jünger als Joanna war sie da gewesen.
Ein Arbeitsvertrag. Hundertzwanzig Mark im Monat. Ein Konto eröffnen. Marlies erinnerte sich an den stolzen Gang zur Sparkasse. An ihre erste Abhebung. Dreißig Mark bitte, hatte sie zu dem Mann hinter der Glasscheibe gesagt. Ihre Hände hatten vor Aufregung gezittert, als sie die Scheine, die er ihr unter der Scheibe durchgeschoben hatte, in ihr Portemonnaie steckte. Sandalen hatte sie sich gekauft. Weiße Riemchensandalen. Nichts für die Aussteuer, keine Jacke, überhaupt nichts Nützliches. Riemchensandalen mit Absätzen, so hoch, dass sie erst das Laufen mit ihnen üben musste. Beinahe sündig war es ihr vorgekommen. Konrad und sie kannten sich da schon, waren verliebt, ein Paar.
»Erinnerst du dich an meine Riemchensandalen?«, fragte sie Konrad, der in diesem Augenblick in die Küche kam. Er guckte verständnislos.
»Sommer ’69«, sagte Marlies und sah Konrad an, dass er die Frage schon wieder vergessen hatte. Sie ließ einen wehmütigen Blick über sein Gesicht gleiten. Warum sprachen sie nie über ihre Anfangszeit? Als sie noch jung gewesen waren. Das Leben leicht. Voller Hoffnungen, von denen man gar nicht gewusst hatte, auf was genau. Vielleicht würde es helfen.
»Hast du den Traktorschlüssel gesehen?« Suchend fasste Konrad in seine Hosentaschen, als hätte er darin bisher noch nicht nachgesehen.
Die Sandalen hatte sie zur Kirmes angezogen, sich dabei an Konrad geklammert, der ihr den Arm fest um die Schultern gelegt hatte.
»Hast du schon in der Jacke nachgeguckt, die du gestern anhattest?« Konrad verschwand wieder.
»Oder am Schlüsselbrett?«, rief Marlies. So wie sie ihm diese beiden Sätze schon oft hinterhergerufen hatte. Gewohnheit. Seit über zwanzig Jahren. Wenn Konrad Schlüssel suchte.
Den, in den man mit neunzehn verliebt war, heiratete man auch. Bloß nicht schwanger werden bis dahin. Sowieso nicht so schnell, aber auf keinen Fall vor der Hochzeit. Marlies’ Freundin Bärbel hatte heiraten müssen, wie man damals sagte. Eine verschämte Feier. Das Kleid trotzdem weiß, aber nur, weil der Bauch sich noch nicht allzu sehr wölbte. Marlies hatte sich gefragt, ob Bärbel wohl auch heiraten würde, wenn sie nicht schwanger geworden wäre.
Obwohl das Heiraten an sich ja damals gar nicht infrage gestanden hatte. Schwanger oder nicht. Ein Zusammenleben ohne Trauschein wurde wilde Ehe genannt. Wild hatte dabei keinen verlockenden Klang, sondern stand für Verdorbenheit. Und kam selten vor, jedenfalls bei den rechtschaffenen Leuten.
Bärbels Ehe hielt bis heute.
Marlies sah auf die Uhr. Ob Joannas Bus schon am Bahnhof angekommen war? Joanna nahm seit vier Jahren die Pille.
Durch das Fenster sah sie Alfred über den Hof schlurfen, der alte Hund ihm auf den Fersen. Der Traktor tuckerte. Ein selten gewordenes Geräusch auf dem Bethches-Hof. Konrad hatte den Schlüssel wohl gefunden.
Endlich erhob Marlies sich, nahm den Tellerstapel wieder auf und räumte ihn in die Spülmaschine. So lange hatte sie getrödelt, dass sie direkt mit den Vorbereitungen für das Mittagessen anfangen musste, wenn es rechtzeitig auf dem Tisch stehen sollte. Pünktliche Mahlzeiten bestimmten seit je den Tagesablauf. Und die Milchkühe. Aber die gab es nicht mehr.
Marlies schnippelte Zwiebeln und schon rollten die Tränen. Nicht alle waren den Zwiebeln geschuldet. Sie schniefte und wischte sich mit dem Unterarm über die Nase. Dann schob sie die Würfel vom Brett in das zischende Öl und holte das Gemüse aus dem Einkaufskorb. Obwohl es in Lisbeths Garten schon reichlich Gemüse und auch Salat gab, hatte sie Zucchini gekauft. Lisbeth würde es bemäkeln. Doch manchmal brauchte Marlies solch winzige Genugtuungen. Nicht immer genau das tun, was von einem erwartet wurde.
Hatte sie das nicht sowieso viel zu lange getan? Doch wäre jetzt irgendetwas anders, wenn sie öfter Nein oder ich bin der und der Meinung oder wir müssen das so und so machen gesagt hätte?
Als Marlies das Wasser für den Reis aufsetzte, sah sie wieder nach der Uhr. In drei Stunden würde Joanna in Frankfurt das Flugzeug besteigen. Schon hundert Kilometer entfernt. Irgendwann in der Nacht, eher am Morgen schon, würden es mehr als sechstausend sein.
Entfernt hatte sie sich schon eine ganze Weile. Innerlich.
Drei Jahre nach Bärbel hatten Konrad und sie geheiratet.
Ihr hättet Joanna nicht gehen lassen dürfen!« Lisbeth stach in das Gemüse, das sie an Gurken erinnerte. Vorsichtig kaute sie. Keine Gurke. Aber nicht schlecht. Doch das würde sie niemals zugeben. Gekauftes Gemüse, wo es im Garten gerade so viel Kohlrabi gab. Und Möhren.
Auffordernd sah Lisbeth zu Konrad. Wie ähnlich er Karl sah. Ganz der Karl, hatten auch die Leute oft gesagt, als er ein kleiner Junge gewesen war. Lisbeth erinnerte sich noch gut an ihre Freude darüber.
Konrad sah nicht von seinem Teller auf. Marlies sagte bloß: »Ach ja?«
Lisbeth war enttäuscht. Sie tippte Alfreds Arm an. Alfred war auf dem Hof, seit sie denken konnte. »Was meinst du denn?« Doch auch er wusste nichts zu sagen, sah sie bloß ratlos an.
Als Lisbeth in Joannas Alter gewesen war, war der Krieg fast zu Ende. Von den Bomben und Zerstörungen hatte man in Hausen nicht viel mitbekommen. Doch die jungen Männer hatten das Dorf verlassen müssen. Sie wurden woanders gebraucht. Die deutschen Grenzen sollten immer weiter ausgedehnt werden. Feldpostbriefe aus Orten mit eigenartigen Namen waren in Hausen angekommen.
Die Arbeitskraft der Männer war zu ersetzen gewesen. Zuerst kamen Polen, wenig später Franzosen, dann Russen.
Fünfundvierzig, im späten Frühjahr, waren die fremden Männer wieder weg. Aber die Hausener Männer kamen nicht wieder. Lisbeths Bruder Heiner war gefallen, und Hans, der nächstjüngere, auch. Doch zum Trauern ließ man Lisbeth keine Zeit. Der Tod ihrer Brüder hatte sie zur Hoferbin gemacht. Niemand sprach das aus. Oder fragte sie, ob ihr das recht sei, ob sie vielleicht andere Pläne habe. Aber man sprach ja überhaupt nicht viel. Der Hof, die Arbeit sagte einem, wie man zu leben hatte.
Bloß Lisbeths Mutter verfiel in dauerhaften lähmenden Kummer über den Tod ihrer Söhne. Umso fester musste Lisbeth anpacken. Das heißt, angepackt hatte sie, seit sie denken konnte. Als die Schule mit vierzehn zu Ende war, arbeitete sie den ganzen Tag mit. Die Frauen waren fürs Haus zuständig. Für die Stuben, die Wäsche, für das Nähen und Flicken, das Kochen und Backen. Für den Garten. Und wenn bei der Feldarbeit besonders viele Hände gebraucht wurden, gingen sie auch mit auf die Äcker.
Doch jetzt, wo die Mutter nachts wie ein Gespenst durchs Haus schlich und tagsüber müde war, überall einschlief, hatte Lisbeth plötzlich auch das Sagen. Ich verlass mich auf dich, sagte der Vater jeden Morgen und legte seine Hände auf ihre Schultern. Schwer ließ er sie für einen kleinen Moment dort liegen. Lisbeth kam es jedes Mal vor, als lege er ihr ein Kummetgeschirr um, wie den Pferden oder den Ochsen, wenn sie den Wagen ziehen mussten. Sie sah zum Vater auf und nickte. Bloß nicht merken lassen, wie schwer gerade alles war.
Die Mägde waren nervös, wollten eingeteilt werden. Dabei war es Lisbeth immer so vorgekommen, als ob jede genau wüsste, was sie zu tun hat. Nun liefen sie morgens durcheinander wie Hühner. Wer von uns geht mit in den Stall melken? Wer fegt die Stuben aus? Von wie viel Pfund Mehl soll Brot gebacken werden? Wie viel gute Butter an die Streusel für den Sonntagskuchen? Die Bohnen sind reif, müssen gepflückt werden, aber ich soll mit auf den Acker, die Rüben hacken. Eine der Mägde war neu. Vierzehn. Gerade aus der Schule gekommen. An ihr ließen die älteren ihre Kopflosigkeit aus. Sie bekam viel Schelte und weinte oft. Und Lisbeth schwirrte der Kopf.
Alfred war es, der irgendwie die Zeit fand, sie mit Kleinigkeiten zu unterstützen, der ihr das Holz in die Küche trug und auch gleich ein Stück nachlegte, damit das Feuer im Herd nicht ausging, während Lisbeth mit der kleinen Magd Berge von Kartoffeln schälte.
Wie hatte sie noch geheißen? Diesen Namen kannst du nicht vergessen haben, dachte Lisbeth erschrocken. Ein dünnes, kleines Mädchen. Mit braunen Locken, die sich immer aus den Zöpfen lösten. Aus Hausen war sie. Das Gesinde kam fast immer aus Hausen oder den direkten Nachbardörfern. Man kannte die Familien. Wusste, wen man sich ins Haus holte.
Lina! Hirtes Lina! Jetzt fiel es ihr wieder ein. Sieben Geschwister, ein kleiner Hof, die Eltern froh, einen Esser weniger am Tisch zu haben.
»Meine Mutter ist auch nicht gesund«, sagte Lina eines Tages, als sie zusammen Äpfel einweckten. Da war schon der Herbst gekommen. Lina hatte sich eingearbeitet und Lisbeth war viel sicherer geworden.
Lina schälte die Äpfel, Lisbeth schnitt die Kerngehäuse heraus. Einen Teil der geernteten Äpfel hatten sie schon im Herd getrocknet und bewahrten sie in einem sauberen Kissenbezug auf. Es gab auch einen mit Birnenstücken, den sogenannten Hutzeln.
»Wer macht denn dann bei euch das Haus?«, fragte Lisbeth.
»Die große Schwester. Und ich helfe abends.« Nach dem Abendessen verließen die Mägde und Knechte das Wohnhaus und gingen in ihre Kammern, die über den Ställen lagen. Dass Lina dann nach Hause ging, hatte Lisbeth nicht gewusst.
Lina sah sie erschrocken an.
Lisbeth sagte nichts. Sollte sie ihr verbieten, zu Hause zu helfen? Sie gar entlassen? Das brachte sie nicht fertig. Sie mochte das Mädchen. Wie ein kleiner Geist schien sie immer genau dort zu sein, wo man sie brauchte. Und hatten sie sich nicht beide zugleich in eine neue Lage hineinfinden müssen? Lina in einen unbekannten Haushalt? Und Lisbeth, die völlig unerwartet das ganze Hauswesen übernehmen musste?
Lisbeth sah auf Linas dünne Arme. Jemand musste darauf achten, dass die kleine Magd wenigstens genug aß. Vielleicht ein bisschen mehr Butter aufs Brot? Aber die anderen durften nicht denken, dass jemand vorgezogen wurde. Sie würde Alfred fragen. Er saß beim Gesinde. Am anderen Ende des Tischs. Sicher wusste er Rat.
Lisbeth füllte die Apfelstücke in die bereitgestellten Einmachgläser. Lina gab Zucker dazu und füllte Wasser ein. Mit einem pieksauberen Tuch wischte Lisbeth die Glasränder und die Deckel ab. Dann die Gummiringe, Deckel und Klammer drauf und in den großen Einkochtopf.
Beim Einkochen war Sauberkeit alles, das hatte die Mutter Lisbeth immer eingeschärft. Sonst stand man irgendwann im Keller vor Reihen von verschimmelten Vorräten, weil die Gläser sich geöffnet hatten. Den ganzen Winter wurden die Einmachgläser regelmäßig überprüft. Wenn man tatsächlich eins erwischte, bei dem sich der Deckel abheben ließ, und das kam immer vor, dann wurde das Obst oder das Gemüse sogleich verwendet.
Zusammen hoben Lisbeth und Lina den schweren Topf auf den Herd. Lina schürte das Feuer noch einmal kräftig, bevor sie die Apfelschalen in einem Korb zu den Schweinen trug. Als sie wiederkam, wischte sie den Tisch fürs Abendessen sauber. Lisbeth stemmte sich bereits einen großen runden Laib Brot mit dem Rand gegen den Bauch und führte das scharfe Messer Scheibe für Scheibe schräg zum Körper hin. Auch einen zweiten Laib würde sie so aufschneiden. »Nächste Woche müssen wir wieder backen«, sagte sie. Lina nickte und legte jedem ein Messer an seinen Platz. Das Abendbrot wurde auf dem bloßen Tisch gegessen. Die Küche füllte sich. Der Vater sprach das Tischgebet. Segne, Gott, was du uns gegeben hast. Amen. Alle waren müde und sprachen nicht viel. Nur Lisbeths kleine Geschwister plapperten, das Tagwerk war auch heute wieder erfüllt.
Scharrend schob Alfred seinen Stuhl nach hinten und stand steifbeinig auf. Erstaunt sah Lisbeth auf ihren Teller. Ohne es zu merken, hatte sie ihn leer gegessen.
Auch die Zeit verging fast unmerklich. Man konnte sie nicht festhalten. Die Menschen genauso wenig. Lisbeth hätte Joanna gern festgehalten.
Es konnte doch nicht sein, dass nun auch noch die Menschen den Hof verließen. Dass alles keinen Sinn mehr hatte, außer von der Vergangenheit zu zeugen.
»Nimmst du mal eben die Hände weg?« Marlies wischte über den Tisch. Den Herd mit dieser blinkenden Glasplatte hatte sie bereits gesäubert. Einmal mit einem Tuch drüber. Fertig. Wenn Lisbeth da an früher dachte. Mit der Asche aus der Feuerstelle wurde die Eisenplatte bearbeitet. Feines Schleifpapier für die verkrusteten Stellen. Und einmal in der Woche wurde die Platte frisch geschwärzt.
Missmutig blickte Lisbeth auf das moderne Ding. Auf diese Knöpfe, mit denen sie sich immer noch schwertat. Der alte Herd war zwar geblieben. Aber wenn Lisbeth den jetzt ansah, wie er nutzlos herumstand, ohne Ofenrohr, ohne Verbindung zum Kamin, dann wäre es ihr lieber, er wäre fortgekommen. Zum Alteisenhändler. Doch er war an die Wand links neben der Tür gerückt worden, da, wo es gar keinen Kamin gab. Zur Zierde. Ist doch hübsch, hatte Marlies gesagt und fein gelächelt. Lisbeth war sich nicht sicher, ob ihre Schwiegertochter sie nicht ein bisschen verhöhnen wollte.
Aber es war ja nicht nur der Herd. So vieles war nur noch Zierrat, stand zwecklos herum. Für Lisbeth waren all die Dinge Zeugen eines für immer verlorenen Nutzens. Auch die Tonkrüge, die nun auf dem alten Herd standen und manchmal mit Blumen gefüllt wurden. Früher war das Zwetschenmus in ihnen aufbewahrt worden.
Die Zwetschen waren vor den Äpfeln gekommen. Zusammen mit den Zuckerrüben. Die Rüben wurden in der Waschküche im großen Kessel zu Sirup gekocht. Der Kessel wurde danach nicht ausgewaschen, sondern die Zwetschen, von vielen Händen entsteint, kamen direkt hinein und wurden zu Mus gekocht. Der Siruprest im Kessel gab dem Mus etwas Süße.
So war alles durchdacht gewesen, nichts wurde verschwendet, nichts war bloß zum Vergnügen. Ein immerwährender Kreislauf, ein Werden und Vergehen. Das Getreide wurde geerntet. Die Körner wurden zu Mehl. Das Stroh wurde dem Vieh eingestreut. Es wurde zu Mist, der wieder den Acker düngte, auf dem neues Getreide wachsen würde.
Lisbeth war damals schnell hineingewachsen in ihre Aufgaben als Hofbesitzerin. Immer stolzer war sie geworden. Sie war nicht einfach nur das Mädchen von Bethches, das darauf wartete, geheiratet zu werden. Das vom Elternhof gehen und sich in einen fremden Haushalt hineinfinden, sich einer Schwiegermutter und vielleicht sogar Schwägerinnen unterordnen musste. So wie alle ihre Freundinnen. So wie Käthe, die von Schreiners zu Michels Käthe geworden und unglücklich gewesen war. Die sich oft bei Lisbeth ausgeweint hatte, weil sie in ihrem neuen Zuhause nichts recht zu machen schien.
Sie, Lisbeth, das wusste sie damals, würde für immer auf diesem, ihrem eigenen Hof bleiben. Nie würde sie die Schultern hoch- und den Kopf einziehen müssen. Wie Käthe. Wie fast alle Frauen zu dieser Zeit. Erst als Käthes Schwiegermutter gestorben war, hatte die ihren Kopf wieder hoch getragen, Lisbeth ihren immer schon.
Sie erhob sich vom Tisch. Marlies war längst verschwunden, ohne dass Lisbeth es bemerkt hatte. Ich gehe in den Garten, beschloss sie. Da funkt mir immer noch niemand dazwischen. Und bestimmt brauchen die Endivien Wasser.
Ein langes Kleid hatte Marlies bei der Hochzeit getragen. Lieber hätte sie ein kurzes gehabt. Mit weiten Ärmeln.
Unbedingt kurz, wenn du mit der Mode gehen willst, hatten auch Marlies’ Kolleginnen gesagt. In den Mittagspausen hatten sie Zeitschriften gewälzt. Mit einem Eifer, als stünden sie selbst kurz vor ihrer Hochzeit. Guck doch mal hier. Das ist toll. Und das. Das hier erst.
Als Marlies dann vor dem dreiteiligen Spiegel der Frisierkommode im Schlafzimmer ihrer Eltern gestanden hatte, dem einzigen großen Spiegel im ganzen Haus, hatte sie gemeint, in einem kurzen Kleid würde sie sich nicht so fremd fühlen wie in dem langen. Mit schmalen Ärmeln und Spitze am Oberteil. Spitze hatte sie auch nicht gewollt. Aber der Mutter zuliebe. Die hatte es sich so vorgestellt. Und Marlies hatte sie nicht enttäuschen wollen.
Immer hatte sie es der Mutter recht machen wollen. Machte das nicht eine gute Tochter aus? Ihre Mutter hatte doch nur sie. Für die beiden Brüder galten andere Regeln. Für Marlies galt die Mutter.
Marlies wusste, worauf es ankam. Schon als Kind hatte sie es gewusst. Und auch später. Die feinen Sonntagskleider nicht gleich schmutzig machen. Bei den Schularbeiten ordentlich auf die Linien schreiben, die Zahlen sauber in die Kästchen. Nicht vorlaut sein. Als Jugendliche sich schick machen, damit einen die Jungs wahrnahmen und die Alten zu den Eltern sagten, was habt ihr nur für eine hübsche Tochter. Doch auf keinen Fall über die Stränge schlagen. Ruhig ein bisschen mehr vom Leben wollen als die Mutter, die hatte ja ihre Träume für Marlies, aber bloß nicht zu viel.
Oft musste Marlies die Mutter nicht einmal ansehen, um zu wissen, was sie zu tun hatte. Auf der Haut konnte sie es spüren. Als hätte die Messfühler, um die Blicke der Mutter zu deuten. Deren kleinste Missstimmung wahrzunehmen. Auch in dem Brautmodenladen hatte es funktioniert.
Marlies beugte sich vor und fasste nach den beiden beweglichen Teilen des Spiegels, schwenkte sie so, dass sie sich von den Seiten sehen konnte. Sie musterte sich im linken Flügel und drehte den Kopf zum rechten. Sie stellte sich seitlich zum Spiegel und bog den Rücken, bis sie sich auch ein wenig von hinten betrachten konnte. Die Beine, die von dem weiß glänzenden Stoff umflossen wurden, konnte sie aber nicht sehen.
Als sie noch klein gewesen war, war sie einfach auf die Frisierkommode geklettert, wenn sie heimlich eins der Kleider aus dem Schlafzimmerschrank der Mutter geholt und angezogen hatte. Dazu ein Paar ihrer Stöckelschuhe. Sie war hinaufgeklettert, hatte Schimpfe und einen Sturz riskiert. Nur damit sie es ganz betrachten konnte, dieses Mädchen in den wunderbaren Sachen der Mutter. Dieses kleine Mädchen, das das Großsein nur spielen wollte.
Für einen Moment stellte sie sich vor, auch das Brautsein nur zu spielen. Ein Kleid anhaben, wie man es sonst nie trug, auch nie wieder tragen würde. Es würde sie den ganzen Tag behindern mit seiner Feierlichkeit, mit dem vielen unnützen Stoff. Sie würde anders stehen, anders gehen und sich anders setzen. Anders tanzen auch. Konrad und sie hatten ein paar Stunden in einer Lahnfelser Tanzschule genommen. Walzer. Um abends den Tanz zu eröffnen. Den Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer tanzen wir.
Doch wenn sie dieses Kleid ausziehen würde, irgendwann nachts, wäre es nicht wie bei dem kleinen Mädchen, das einfach wieder in seine Kindersachen geschlüpft war und sich zurückverwandelt hatte in die Sieben- oder Acht- oder Zehnjährige. Nie wieder würde sie die junge Frau sein, die sie gewesen war, bevor sie dieses Kleid angezogen hatte. Marlies richtete die Flügel wieder genau aus. Im sachten Winkel zum mittleren, feststehenden Spiegel.
Die Mutter half ihr ins Auto. Auf der Beifahrerseite, die sonst ihr vorbehalten war. Zuerst hinsetzen, dann die Beine vorsichtig nachziehen. In einem kurzen Kleid hätte sie auch viel besser einsteigen können.
»Pass doch auf, Kind. Du machst es ja gleich schmutzig!«, rief die Mutter, als Marlies am Türschweller hängen blieb.
Vorsichtig drückte die Mutter die Tür zu und klemmte dabei fast den Schleier ein. Nun rief Marlies, pass doch auf. Mehrere Schichten Tüll saßen hoch auf ihren Haaren und gingen bis zu den Schultern.
Der Schleier breitete sich aus, reichte dem Vater bis vors Gesicht, als Marlies sich auf dem Beifahrersitz zurechtrückte. Unwirsch schob er ihn zur Seite. »Was machst du denn!«, schrie die Mutter von draußen. Sie riss die Tür wieder auf und ihre Hände flatterten um Marlies Kopf herum wie aufgeregte Vögel.
Ich muss schließlich was sehen, sagte der Vater. Ihr wollt ja wohl heil in Hausen ankommen. Die Mutter reichte Marlies den Strauß. Blassrosa Rosen mit viel Schleierkraut.
Endlich saßen sie alle. Die Mutter hinter dem Vater, weil Marlies ja auf ihrem Platz saß.
Die Brüder fuhren mit ihren eigenen Autos. In Hausen nicht gleich zur Kirche, sondern auf den Hof.
Eine Menge Leute standen schon dort und sahen Marlies zu, wie sie umständlich wieder aus dem Auto herauskletterte. Sie entdeckte Konrad nicht gleich und ein Gefühl von Verzagtheit stieg in ihr auf. Aber er lehnte am Geländer der Treppe und machte offenbar Witzchen mit einem seiner vielen Cousins. Die beiden lachten.
Marlies stöckelte zu ihm und hakte sich unter. Er kam ihr fremd vor in seinem feierlichen Anzug. Und wegen der Haare. Offenbar war auch er beim Friseur gewesen. Die Koteletten waren sauber rasiert, die Locken mit irgendeinem glänzenden Zeugs glatt gestriegelt, wodurch sie noch dunkler, fast schwarz aussahen. Er sah aus wie Roy Black mit zwanzig, bloß der Scheitel etwas strenger. Ein paar Mal fuhr er sich mit dem Finger unter den Hemdkragen, während sie standen und warteten, dass die Hochzeitsgäste sich hinter ihnen formierten. Er fühlt sich auch unbehaglich, dachte Marlies und drückte seinen Arm. Mit einem schiefen Lächeln sah er sie an und sein Blick sagte, wir werden das hier schon anständig hinter uns bringen, oder?
Die Glocken fingen an zu läuten. »Wir müssen!«, rief Lisbeth und stupste Konrad in den Rücken. Marlies drehte sich zu ihr um. Sie ist mindestens so aufgeregt wie Konrad und ich, dachte sie. Hochzeit ihres einzigen Kinds.
Unaufhörlich zupfte Lisbeth an den breiten Bändern, die von dem Käppchen auf ihrem Dutt bis weit auf ihren Rücken herunterhingen. Dunkelgrün glänzend und prächtig bestickt, wie auch der Rock und die Schürze ihrer Tracht.
Als sie aus der alten Dorfkirche wieder herauskamen, hatten ein paar Hausener Kinder ein Band über dem Weg gespannt. Jemand reichte Marlies und Konrad einen Beutel mit Bonbons und einen mit Pfennigen und Groschen. Marlies warf die Bonbons, Konrad die Münzen. Die Kinder sprangen danach, was auf den Boden fiel, sammelten sie auf. Dann zerschnitten sie das Band und machten dem Brautpaar den Weg wieder frei.
Auch eine Menge Erwachsener hatten sich vor der Kirche versammelt und guckten neugierig. Viele Frauen und ältere Hausener. Die Frauen, um das Aussehen der Braut zu bereden. Hübsch, die Spitze. Langer Schleier ist aber doch schöner. Oder? Die Älteren, um zu sehen, wer alles unter den Gästen war. Den da, den mit den längeren Haaren, den kenne ich gar nicht. Hainmüllers Marie und der Franz sind anscheinend gar nicht eingeladen.
Von der Kirche ging es zu Fuß ins neue Bürgerhaus. Gerade wurde in jedem Dorf so eins gebaut. Für Vereinsfeiern, Leichenschmäuse und Hochzeiten. Es roch noch nach dem Klebstoff des grauen Fußbodens und nach Farbe.
Tische in langen Reihen. Papiertischdecken. Torte an Torte. Marlies’ Mutter und Lisbeth hatten gebacken und gebacken. Und die Nachbarsfrauen, bei denen man sich revanchieren würde, wenn eins von deren Kindern heiratete.
Bethches’ Nachbarinnen hatten alles hergerichtet und spülten das Geschirr.
Gleich nach dem Kaffeetrinken wurde Marlies von ihren Brüdern und drei von Konrads Cousins entführt. Weil Konrad Klostermuths Kneipe für ein zu naheliegendes Versteck hielt, suchte er sie überall, nur nicht dort. Zuerst bei sich zu Hause, kletterte sogar bis auf den Heuboden der Scheune, dann suchte er bei seinen Cousins zu Hause und fuhr schließlich sogar in die Lahnfelser Eisdiele, in der sie nach ihrem allerersten Kinobesuch gewesen waren. Währenddessen saß Marlies mit den Männern zweieinhalb Stunden in der Gastwirtschaft.
Klostermuths Martha hatte einen Lappen geholt und einen Stuhl für sie abgewischt. Nicht, dass was an dein Kleid kommt. Dann gab’s eine Runde Schnaps aufs Haus. Die Skatrunde gesellte sich zu ihnen und stieß mit an. Auf die Braut. Die Männer tranken noch ein paar Bier. Zahlt ja der Bräutigam, grinsten sie, wenn sie ihre Gläser zur Theke hin hoben. Noch eins. Nach einer Stunde zogen sie die Krawatten herunter und öffneten den obersten Kragenknopf. Marlies trank Limonade. Sie konnte sich ja schlecht betrinken. Wie eine exotische Blume saß sie zwischen den immer aufgekratzteren Männern. Nach anderthalb Stunden wurde sie wütend. »Hast du mich überhaupt gesucht?«, rief sie, als Konrad endlich auftauchte. »Prima Versteck«, spotteten die Entführer und bestellten eine letzte Runde. »Hätten wir gar nicht gedacht.«
Zum kalten Büffett waren sie gerade so im Bürgerhaus zurück. »Wo bleibt ihr denn?«, rief Lisbeth.
Darauf, dass irgendwann jemand unter den Tisch kroch und ihr einen Schuh vom Fuß zog, war Marlies besser vorbereitet. Sie hatte ihre Brautschuhe gegen Bärbels ausgetauscht. »Aber dann hast du ja nur noch einen«, hatte sie gesagt, als Bärbel ihr die Schuhe anbot. »Macht doch nichts«, hatte Bärbel gesagt und grinsend hinzugefügt: »Wenn ich noch mal heirate, kauf ich mir einfach neue.« Als Bärbels Schuh unter Gejohle versteigert worden war, zog Marlies ihre eigenen wieder an.
Dann spielte eine Zweimannband. Mit Konrad tanzte sie den Schneewalzer und mit ihrem Vater und Karl Foxtrott. So wanderte sie von Arm zu Arm. Alle wollten wenigstens einmal mit der Braut tanzen.
Weit nach Mitternacht saß sie todmüde da. Das Kleid war zerdrückt. Den Schleier hatte sie um zwölf abgenommen. Sie fühlte den Wörtern Ehefrau und Schwiegertochter nach.
Jetzt war sie Bethches Marlies.
Die Apfelblüten hatten die kalte Nacht schadlos überstanden. Dankbare Pflänzchen. Lisbeth zupfte hier und da ein welkes Blatt ab und goss eine Kanne Wasser darüber.
Oft ging sie zum Friedhof. Besuchte Karl. Seit zwei Jahren lag er hier. Im Herbst pflanzte sie ihm Stiefmütterchen aufs Grab, die sie in ihrem Garten selbst gezogen hatte. Wenn der Spätwinter mild war, blühten sie schon Anfang März. Mitte Mai, gleich nach den Eisheiligen, rupfte Lisbeth sie aus und pflanzte rote und weiße Apfelblüten. Ein paar Tagetes dazwischen, für die Schnecken, damit die nicht an die Apfelblüten gingen. Apfelblüten, die gar keine waren, sondern nur so hießen. Bevor Lisbeth wieder ging, strich sie über den Stein und sprach ein bisschen mit Karl.
Joanna ist am Morgen weg. Nach Afrika. Aber das weißt du ja schon, dass sie da hin will. Mit dem Flugzeug.
Lisbeth sah nach oben zum Himmel, als würde es gerade über sie hinwegfliegen, als könne sie es genau in diesem Moment sehen. Auch sonst sah sie öfter nach diesen glitzernden Dingern, die wie ferne Vögel über den Himmel glitten und so hübsche Streifen hinter sich herzogen. Dort drin zu sitzen konnte sie sich nicht einmal im Traum vorstellen. Aber sie träumte auch gar nicht davon, hatte keine Sehnsucht nach solcherlei Abenteuern. Doch nun trug so ein Ding ihre einzige Enkelin davon.
Afrika! Kannst du dir das vorstellen, Karl? Auf einer Farm will sie dort arbeiten. Also, auf einem großen Bauernhof eigentlich. Wo wir doch selbst einen haben. Sie ist doch die, die jetzt Verantwortung übernehmen müsste. So wie ich damals. Damit sich alles doch noch zum Guten wendet. Das muss es doch. Oder, Karl?
Joanna hatte ihren Schulatlas geholt, um Lisbeth zu zeigen, wo ihre Reise hinging. Lass ihn mir da, hatte Lisbeth gesagt. Das Buch lag nun aufgeschlagen auf ihrem Nachttisch.
Den ersten schwarzen Menschen hatte Lisbeth am Kriegsende gesehen. In Uniform. Sie erinnerte sich gut an ihren Schrecken und die Angst. Heute trug nur noch der Fernseher Bilder aus Afrika zu ihr. Häuser, die in Lisbeths Augen diese Bezeichnung nicht verdienten. Hungernde Kinder, die ihr Mitleidstränen in die Augen trieben. Erwachsene, die ihrer Meinung nach nicht fleißig genug waren. Sonst könnten sie ihre Kinder doch ernähren, oder? Na ja, ein bisschen war sicher auch der Krieg schuld, der dort immerzu herrschte. Der hatte auch damals hungernde Menschen durch Hausen getrieben. Für den Krieg konnte niemand etwas.
Muss das Kind in solch ein Land, Karl? Unser Leben hat sich in Hausen abgespielt. Haben wir was vermisst? Hat uns was gefehlt?
Nie hatte Lisbeth Sehnsucht verspürt, irgendwo anders zu sein. Nicht einmal im Urlaub. Freizeit, gar mehrere Wochen, hatten sie und Karl sowieso nicht gekannt. Im Sommer konnte man vom Hof nicht weg. Der Sommer war voller Arbeit. Und im Winter war man zu müde zum Verreisen. Und außerdem brauchte das Vieh die Menschen das ganze Jahr.
Jeden Morgen um fünf Kühe melken. Und Kühe kannten ihre Zeit. Sie riefen, wenn man sich verspätete. Sie riefen so laut, dass die Nachbarn es hörten. Und wenn die Nachbarn die brüllenden Kühe hörten, fragten die sich, was denn heute bei Bethches los sei. Ist da jemand krank? Oder sind die etwa nicht aus den Betten gekommen?
Lisbeth winkte Schreinerleus Lene zu, die das Grab ihrer Eltern gegossen hatte. Die winkte mit der leeren Kanne zurück und rief: »Wie geht’s so?«
»Muss ja!«, rief Lisbeth. Lene nickte.
Lisbeth machte sich auf den Rückweg. Sie ging an Höfen vorbei, auf denen es, außer vielleicht einer Katze, kein einziges Tier mehr gab, und verbot sich den Gedanken, dass es bei ihnen kaum besser war.
Höfe, wo aus den Ställen Garagen für die Autos geworden waren. In manchen standen auch Pferde. Aber nicht, um Wagen oder Pflüge zu ziehen, sondern bloß zum Reiten. Zum Spaß.
Hier und da wurde Lisbeth gegrüßt. Von den Alten immer noch ein wenig ehrerbietig. Die hatten, genau wie sie, immer noch das alte Hausen im Kopf. Mit seiner Rangordnung, auf der der Bethches-Hof ganz oben gestanden hatte.
Knechte und Mägde hatten sein Ansehen ausgemacht. Wer viel Gesinde hatte, der hatte viel Arbeit. Und viel Arbeit hieß, es gab viel Vieh und viel Land. Zeichen des Wohlstands waren auch Bethches Pferde gewesen. Sie hatten den Pflug und die Egge gezogen. Die ärmeren Bauern spannten ihre Kühe ein, die ihnen auch die Milch gaben. Tiere, die bloß gefüttert werden mussten, konnten sie sich nicht leisten. Und sie schickten ihre Kinder, kaum dass sie aus der Schule waren, zum Arbeiten auf den Bethches-Hof.
Lange vorbei, dachte Lisbeth schmerzerfüllt. Und nahm die Grüße der alten Hausener Kleinbauern doch immer noch beinahe hoheitsvoll entgegen. Wie es sich für eine vom Bethches-Hof gehörte.
Zwei Zimmer im zweiten Stock auf der linken Seite hatten Marlies und Konrad nach der Hochzeit bezogen. Mehr Eigenes hatte es nicht gegeben. Das eine Zimmer war mit nagelneuen Schlafzimmermöbeln eingerichtet worden, gekauft im Lahnfelser Möbelgeschäft, wo alle ihre Möbel kauften. Marlies hatte sie mit ihrer Mutter ausgesucht. Macht ihr das nur, hatte Konrad gesagt. Die Möbel bezahlten Marlies’ Eltern. Helles Holz, hochglänzend. Und Teppichboden. Auf bloßen Füßen durchs ganze Zimmer gehen. Nur saugen, nicht wischen. Luxus.
Aus dem anderen Zimmer sollte ihr Wohnzimmer werden. Bis sie sich für eine Einrichtung entscheiden würden, stellten sie ein Sammelsurium aus Marlies’ Mädchenzimmer und Konrads Zimmer hinein. Marlies’ Kinderschreibtisch, ihr mit bunten Aufklebern verzierter Schrank, Konrads Jugendbett, ein niedriges Bücherregal, ein orangefarbener plüschiger Sessel. Daneben ein Glastischchen. Und die Kisten mit Marlies’ Aussteuer. Bettwäsche, Tischwäsche, Töpfe, Besteck, Essservice.
Doch zu ihrem eigenen Wohnzimmer brachten sie es nie. Das Leben fand draußen und in der Küche statt. An den Sonntagen im großen Wohnzimmer, das eigentlich Lisbeths und Karls war. Sonntags kam immer Besuch. Tanten und Onkel, Cousins und Cousinen von Konrad. Wenn gelacht wurde und durcheinandergeredet, verlor das Zimmer mit seinen ehrfurchtgebietenden dunklen Möbeln seine Steifheit.
In diesem Zimmer hatte Marlies zum ersten Mal ihrer Schwiegermutter gegenübergestanden. Konrad und sie kannten sich da schon fast zwei Jahre. Sein Mädchen mit nach Hause bringen bedeutete damals etwas. Das war beinahe eine Verlobung. Entsprechend aufgeregt war Marlies gewesen. Schweigend hatte Lisbeth in ihrer feierlichen Sonntagstracht sie von oben bis unten gemustert. Die frische Dauerwelle. Die großen Ohrringe. Die lackierten Fingernägel. Den Rock, der Marlies plötzlich absurd kurz vorkam. Verlegen hatte sie die Knie zusammengedrückt. Sich diesem Blick zu stellen war schlimmer gewesen als ihre Kaufmannsprüfung.
»Komm, setz dich, Mädchen«, hatte Karl sie schließlich erlöst. Er hatte ihr die Hand auf den Rücken gelegt und sie zu einem Stuhl geschoben. Und zu Lisbeth »Willst du nicht den Kaffee holen?« gesagt.
Lisbeth schenkte ein. In die Tassen mit dem Goldrand. Das Sonntagsgeschirr. Marlies hatte Angst, Kaffee auf der weißen Leinentischdecke zu verschütten und verschluckte sich gleich am ersten Bissen Kuchen. Wie zur Beruhigung legte Konrad ihr unter dem Tisch die Hand aufs Bein, aber Marlies schob sie weg. Er war genauso nervös wie sie.
Es war Sommer gewesen. Die Fenster hatten offen gestanden. Man hatte die Kühe und die Schweine gehört. Und gerochen. Es hatte Marlies nichts ausgemacht. Sie kam zwar nicht vom Bauernhof, aber doch vom Dorf. Drei Orte weiter. Als Kind hatte sie mit den Bauernkindern gespielt, war zum Milch und Eier holen auf den Nachbarhof geschickt worden, wo auch die Essensreste im Eimer hingetragen wurden. Für die Schweine. Marlies hatte auch manches, was sie nicht essen mochte, vom Tisch geschmuggelt und heimlich in die Tröge geworfen, den Tieren dabei zugeguckt, wie sie ihre Rüssel genüsslich danach ausstreckten und es schmatzend verschlangen.
Bauernhöfe kannte sie also. Was Bäuerin sein bedeutete, wusste sie nicht und dachte auch nicht daran, dass sie eine werden würde. Jedenfalls nicht an diesem Nachmittag, an dem es bloß galt, vor den Augen von Konrads Mutter zu bestehen.
Karl hatte Marlies ein bisschen über ihr Zuhause ausgefragt.
»Ach! Eine Schlosserei?« Lisbeths Augenbrauen hatten sich gehoben. »Kein Hof?« Sie hatte Konrad angesehen, und Marlies hatte in diesem Blick zu lesen gemeint: Wen hast du uns denn da gebracht! Sie, auf unserem Hof?
Konrad hatte kaum merkbar die Schultern gehoben, Karl eine Flasche Schnaps aus dem Büfett geholt. Lisbeth hatte abgelehnt und das Geschirr zusammengeräumt. Marlies hatte sich zweimal nachschenken lassen und, als der Birnenbrand sich wärmend in ihr ausgebreitet hatte, gedacht, ich werde sie schon noch von mir überzeugen. Das wäre doch gelacht.
Sehr firm ist sie nicht in der Hausarbeit«, sagte Lisbeth zu Karl. Abends, wenn sie noch in der Küche zusammensaßen oder auf dem Hof. Sie sagte es in den ersten Wochen nach der Hochzeit. Und sie sagte es auch nach bald zwei Jahren noch.
»Gib ihr halt Zeit«, sagte Karl auch nach bald zwei Jahren noch.
»Aber ich hab ihr doch schon so viel Zeit gegeben«, sagte Lisbeth.
Dass das nötig sein würde, hatte sie sich gedacht. Von dem Moment an, als Marlies ihr in der Stube gegenübergestanden und sie versucht hatte, ihr Entsetzen zu verbergen. Über dieses Mädchen, wie einem Modeheft entsprungen. Mitten in ihrer guten Stube. Das soll die Zukunft auf dem Bethches-Hof sein?, hatte sie gedacht. Künstliche Locken? Schaukelnde Ringe an den Ohren, beinahe so groß wie die, die man den Bullen durch die Nase zog? Bunte Fingernägel? Dass Konrad so etwas schön findet, hatte sie verwundert gedacht. Zum Verlieben. Und er war verliebt gewesen. Bis über beide Ohren. Das konnte man sehen.
Nicht, dass sie erwartet hatte, er würde eine Trachtenfrau bringen. Die gab es nicht mehr. Aber hier wurde doch Kraft und Ausdauer gebraucht, Sinn für die Arbeit. Und nicht den Kopf voller Modeflausen. Und die Hände so fein gemacht, dass ans Anpacken nicht zu denken war.