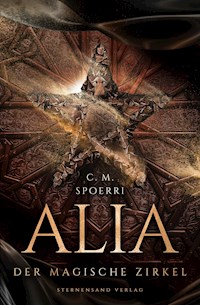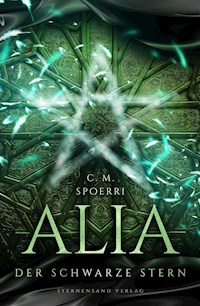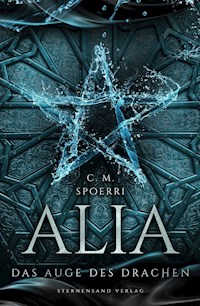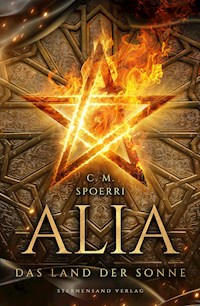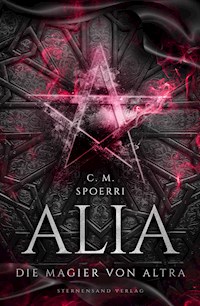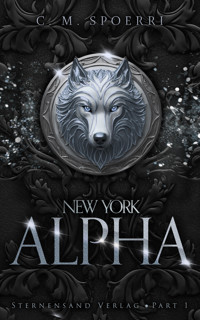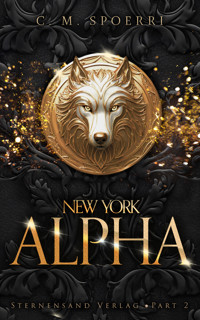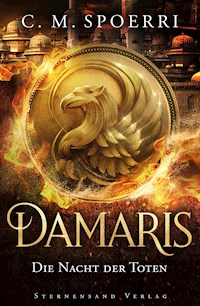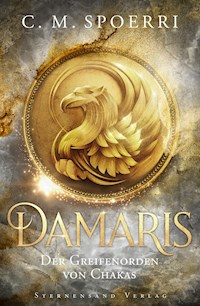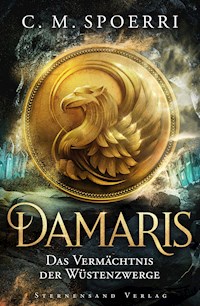Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Dein Weg zu mir
- Sprache: Deutsch
Partys. Reisen. Flirten. Das bestimmt den Alltag von Emilia dos Santos - bis sie vom plötzlichen Tod ihrer Eltern erfährt. Mit einem Mal ist ihr sorgloses Leben vorbei. Sie soll nach alter Familientradition das Weingut im Napa Valley weiterführen und sieht sich damit einer Verantwortung gegenüber, der sie sich nicht gewachsen fühlt. Ganz und gar nicht. Da hilft es auch wenig, dass ihr Jugendfreund Alejandro wieder auftaucht und sie unterstützen will. Denn seine Nähe verwirrt und verunsichert Emilia nicht nur, sondern stellt sie zusätzlich vor die unangenehme Aufgabe, ihren bisherigen Lebensstil zu hinterfragen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Widmung
Kapitel 1 – Emilia
Kapitel 2 – Emilia
Kapitel 3 – Alejandro
Kapitel 4 – Emilia
Kapitel 5 – Alejandro
Kapitel 6 – Emilia
Kapitel 7 – Emilia
Kapitel 8 – Alejandro
Kapitel 9 – Emilia
Kapitel 10 – Emilia
Kapitel 11 – Emilia
Kapitel 12 – Alejandro
Kapitel 13 – Emilia
Kapitel 14 – Alejandro
Kapitel 15 – Emilia
Kapitel 16 – Alejandro
Kapitel 17 – Emilia
Kapitel 18 – Alejandro
Kapitel 19 – Emilia
Kapitel 20 – Emilia
Kapitel 21 – Alejandro
Kapitel 22 – Emilia
Kapitel 23 – Alejandro
Kapitel 24 – Emilia
Kapitel 25 – Emilia
Kapitel 26 – Emilia
Kapitel 27 – Emilia
Kapitel 28 – Emilia
Kapitel 29 – Alejandro
Kapitel 30 – Emilia
Kapitel 31 – Alejandro
Kapitel 32 - Emilia
Kapitel 33 - Alejandro
Dank
Über die Autorin
C. M. SPOERRI
Emilia
Dein Weg zu mir
New-Adult
Liebesroman
http://cmspoerri.ch
1. Auflage, Mai 2016
© Sternensand-Verlag GmbH, Zürich 2016
Umschlaggestaltung: Rica Aitzetmüller | Cover&Books
Lektorat / Korrektorat: Wolma Krefting | bueropia.de
Satz: Sternensand Verlag GmbH
ISBN (Taschenbuch): 978-3-906829-18-0
ISBN (epub): 978-3-906829-19-7
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für Dich
Kapitel 1 – Emilia
Leben … was bedeutet das eigentlich? Ist es eine reine Funktion des Körpers? Ein Geschenk Gottes? Ein Fluch des Teufels? Ein Witz des Universums?
Ich war mir nicht sicher. Nicht mehr. Bis vor einem Monat hätte ich diese Frage noch mit »Geschenk« beantwortet. Ganz spontan und vollkommen überzeugt. Doch seit ich am eigenen Leib hatte erfahren müssen, dass Leben immer und unausweichlich auch Tod bedeutet, hatte ich keine Ahnung mehr, ob ich es als Geschenk ansehen sollte.
War es nicht viel eher ein schlechter Scherz, dass wir jederzeit aus dem Leben weggefegt werden konnten, wie Spielfiguren von einem Schachbrett? Dass der Tod jeden von uns ereilen konnte, mochte derjenige noch so gesund sein? Noch so stark? Noch so herzensgut?
Ich fuhr mir mit beiden Händen über das Gesicht und starrte mit einem leisen Seufzen auf die Papiere, die sich vor mir stapelten. Im Schein der Kerze wirkten sie bedrohlich mit all den Schatten, die sie noch zahlreicher erscheinen ließen. Diese Menge an Unterlagen, von denen mir der größte Teil vorkam wie ein unlösbares Rätsel.
Aber ich würde lernen, sie zu verstehen. Ich musste es lernen. Das war ich meinen Eltern schuldig …
Mein Papá hatte mich zeit seines Lebens immer wieder in die Buchhaltung einführen wollen, aber Zahlen waren mir – seit ich der ersten davon in der Schule begegnet war – schon immer suspekt gewesen. Ein vollkommenes Mysterium, dessen Inhalt, Bedeutung und Funktion sich mir nie hatte erschließen wollen.
Jetzt aber wünschte ich mir, ich hätte mich weniger gegen die Bemühungen von Papá gesträubt. Hätte in der Schule besser aufgepasst. Hätte nur eine Stunde lang richtig zugehört. Hätte mich mehr angestrengt. Hätte nicht die letzten fünf Jahre fernab meiner Heimat gelebt …
Hätte …
Wenn ich in den vergangenen Wochen etwas gelernt hatte, dann, dass Leben vor allem eines bedeutete: bereuen.
So viele Momente hatte ich ungeachtet vorbeistreichen lassen. Ich hatte vor mich hin gelebt, ohne zu überlegen, was der nächste Tag mir bringen würde. Ohne mich darum zu kümmern, was die Welt von mir hielt, auf der ich meine wilde Party feierte. Ich war egoistisch und hatte im Moment gelebt, ohne an Konsequenzen zu denken.
Frei von Sorgen. Frei von Verantwortung. Frei von Schuldgefühlen.
Dass diese jedoch eines Tages über mich hereinstürzen konnten, wie ein Sommergewitter über einen warmen Sonnentag, hätte ich nie für möglich gehalten. Ziemlich sicher hätte ich sogar jeden ausgelacht, der mir dies prophezeit hätte.
Ich hatte eine schöne Jugend und eine noch viel sorglosere Kindheit. Es hatte mir an nichts gemangelt und doch hatte ich immer nach etwas gesucht, das mein Leben noch erfüllter werden ließ.
Noch besser. Noch fantastischer. Noch einmaliger.
Daher war ich mit achtzehn Jahren aus dem Napa Valley weggegangen. Nach New York unter dem Vorwand, dort einen Kunstkurs zu besuchen, den ich nach wenigen Wochen an den Nagel hängte. Mir war das Feiern nun mal wichtiger gewesen, als etwas zu lernen.
Ich hatte etwas Bedeutungsvolles und Besonderes gesucht. Ein Abenteuer, ein Erlebnis, das nur ich alleine erzählen könnte. Es war wie eine einzige, große Party gewesen, ein riesiges Fest in einem Schnellzug, der mit rasanter Geschwindigkeit durch ein Leben voller Oberflächlichkeiten fuhr. Wo man alles und jeden umarmt, geküsst und geliebt hatte. Jedem zuprostete und mit jedem feierte.
Mein Leben hatte aus Abenteuer bestanden, aus besonderen Momenten … sehr vielen davon.
Bis … ja, bis zu diesem Moment vor fünf Wochen, der meinen Party-Zug so rasch entgleisen ließ, dass ich es kaum nachvollziehen konnte. Als die beiden wichtigsten Menschen einfach weggefegt wurden.
In dieser schwarzen Stunde hatte ich zu meinem eigenen Entsetzen feststellen müssen, dass ich selbst immer noch eine Spielfigur war, obwohl ich geglaubt hatte, mein Schachbrett-Leben im Napa Valley zurückgelassen zu haben. Obwohl ich angenommen hatte, die volle Kontrolle über mein Party-Zug-Leben zu besitzen.
Allerdings war ich eine erbärmliche, hilflose Spielfigur ohne die zwei Menschen, die mich immer unterstützt hatten. Die immer für mich da gewesen waren, egal, wie weh ich ihnen getan hatte.
Jetzt glitt mein Blick zum Bild, das vor mir auf dem alten Schreibtisch stand. Es war der Schreibtisch meines Vaters, aus massivem Eichenholz gefertigt. Ich griff nach dem Foto und fuhr mit dem Zeigefinger über das schwarze Seidenband, das über den Bilderrahmen gespannt worden war. Es stand als Einziges zwischen mir und den beiden Personen, die darauf abgebildet waren. Und doch kam es mir vor, als ob dieser schwarze Streifen mich stärker von ihnen trennte, als jede Mauer es gekonnt hätte.
Denn das Foto zeigte meine Eltern. Meinen Papá und meine Mamá. Die Aufnahme stammte vom letzten Winzerfest hier auf dem Hof, wie die traditionellen Trachten und die Trauben-Dekorationen um sie herum verrieten.
Ich war damals nicht hier gewesen, hatte es nicht für nötig empfunden, wegen eines kleinen Festes in die Provinz zurückzukehren. Wo mir doch an anderen Orten die Welt offenstand und ich viel bessere Partys feiern konnte.
Es sollte ihr letztes Fest gewesen sein …
Beide hielten ein Glas von unserem neusten Jungwein in den Händen, der ein äußerst guter Jahrgang geworden war. Sie lachten mich an, sahen fröhlich aus. Als würden sie über einen guten Scherz grinsen. Man merkte nicht, dass sie ihre Tochter vermissten, spürte nichts von der Enttäuschung, die ich für sie bedeutet haben musste.
Ihre lachenden Gesichter versetzten mir jedes Mal einen Stich in meinem Herzen …
Ich hatte durch meinen dummen Egoismus so viel verpasst … ich würde sie nie wieder so fröhlich sehen können – auch nicht traurig, wütend oder in sonst einer Stimmung.
Denn sie waren fort und würden nie wieder zu mir zurückkommen.
Und ich hatte neben dem Schmerz, den ich verarbeiten musste, mit einem Mal mehr Verantwortung, als ich mir je hatte vorstellen können. Mehr Sorgen, als es gut für mich war und Schuldgefühle … eine Menge davon.
Ich war erst dreiundzwanzig und nicht darauf vorbereitet, so rasch erwachsen zu werden. Ein Leben zu führen, das allem widersprach, was ich immer geliebt hatte. Dinge infrage zu stellen, die so viele Jahre alltäglich gewesen waren. Es war ein erdrückendes Gefühl.
Fühlte sich so Erwachsenwerden an? So schmerzhaft? So beängstigend?
Manchmal glaubte ich, dass das alles nur ein Albtraum war, aus dem ich jeden Moment aufwachen könnte – so wie die Albträume, die mich in letzter Zeit ständig plagten.
Manchmal hatte ich das Gefühl, dass Papá in den nächsten Sekunden durch die Tür seines Arbeitszimmers kommen und mich fragen würde, was ich in seinen Unterlagen zu suchen hätte. Er würde es nicht verärgert sagen, sondern eher skeptisch, weil er wusste, wie wenig ich mit Buchhaltung anfangen konnte. Er würde mich vom Schreibtisch wegziehen, mich umarmen und mit seiner großen Hand über mein Haar fahren. Und ich würde meine Arme fest um ihn schlingen und nie wieder loslassen. Nie mehr.
Wir hatten immer eine besondere Verbindung zueinander gehabt, mein Vater und ich. Er war ein eindrucksvoller Mann gewesen. Mit breiten Schultern, Schnauzbart und dickem Bauch. Papá war ein Mensch, den jeder sofort in sein Herz geschlossen hatte. Er hatte es verstanden, einen für sich einzunehmen, war Geschäftsmann mit Leib und Seele. Und einem sehr großen Herzen. Seine dunklen Augen hatten stets gefunkelt, als würden sie ein Geheimnis bergen, das nur er alleine kannte. Das früh ergraute Haar ließ ihn älter wirken, als er eigentlich war und er hatte stets darauf geachtet, seinen Scheitel exakt an derselben Stelle zu tragen. Ebenso wie er nie ohne seine Taschenuhr unterwegs gewesen war. Die Uhr, die er mit in sein Grab genommen hatte.
Meine Mutter hatte ihn geliebt. Nein … sie hatte ihn vergöttert. Und er sie. Sie waren eines dieser wenigen Ehepaare gewesen, die sich blind vertrauten, die alles miteinander durchstanden, teilten und deren Liebe mit jedem Jahr zu wachsen schien.
Als sie sich kennenlernten, war Mamá ärmer als eine Kirchenmaus gewesen und hatte sich mit dem Ausbessern von Kleidung über Wasser gehalten. Aber ihr Leben hatte sich geändert, als Carlos, wie mein Vater hieß, in ihren kleinen Laden im Napa Valley gekommen war, um seine Winzertracht nachbessern zu lassen. Es war Liebe auf den ersten Blick und ein Jahr später hatte er sie zu seiner Frau gemacht. Als sie bald darauf mich bekommen hatten, war ihr Glück perfekt gewesen – so schien es jedenfalls. Sie konnten ja nicht ahnen, dass ich ein egoistischer Freigeist war, der lieber die Welt erkunden wollte, statt im Betrieb meiner Eltern mitzuarbeiten.
Sie waren erfolgreich mit dem Weingut, das mein Vater von seiner Familie – mexikanischen Einwanderern – übernommen hatte. Papá hatte das vollbracht, wozu mein viel zu früh verstorbener Großvater nicht mehr in der Lage gewesen war: Er hatte das Gut in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem der bekanntesten im ganzen Valley gemacht und war vermögend geworden mit dem Weinhandel.
Nicht so reich, dass wir uns eine Villa wie die wirklich Reichen hier in der Region leisten konnten. Aber zumindest so, dass unser Familienname ›dos Santos‹ etwas bedeutete und dass wir ein gutes Leben führten. Wir hatten sogar einen eigenen Hausdiener – Miguel, mein Ein und Alles. Ich liebte ihn wie den Großvater, den ich nie kennengelernt hatte, und seinen Neffen Alejandro wie meinen Bruder.
Ich würde das Erbe meiner Familie weiterführen, das hatte ich an ihrem Grab geschworen. Es war Zeit, die egoistische Party-Emilia in eine seriöse Geschäfts-Emilia umzuwandeln … leider war ich wohl diejenige, die am wenigsten an dieses Wunder glaubte. Dennoch bemühte ich mich.
Ich hatte mich für die Abendschule angemeldet, um mich in Sachen Buchhaltung endlich auf den neusten Stand zu bringen. Die würde morgen beginnen und ich hoffte, mir bis dahin einen Überblick über die Unterlagen meines Vaters verschafft zu haben – leichter gesagt, als getan …
»Señorita Emilia«, erklang die warme Stimme von Miguel, der jetzt in der Tür erschien. »Arbeiten Sie immer noch?«
Er war ein Mann um die sechzig Jahre. Sein dunkles Haar, das er meist offen trug, fiel ihm in Locken bis zu den Schultern und er hatte einen gepflegten Dreitagebart, der ebenso von Silberfäden durchzogen war wie der Rest seiner Haare. Man konnte ihm ansehen, dass er ein gebürtiger Mexikaner war – so wie Papá. Deswegen hatten sich die beiden wohl auch so gut verstanden. Seine dunklen Augen blickten gütig und besorgt gleichermaßen. Vor allem jetzt, als er mich musterte.
Ich stellte das Bild wieder hin und hob den Kopf, während ich mir eine Haarsträhne aus der Stirn strich. Ein müdes Lächeln glitt über mein Gesicht, als mir bewusst wurde, dass längst die Nacht hereingebrochen war. Ich hatte es gar nicht bemerkt, hatte nur irgendwann die Kerze auf dem Tisch entzündet, damit ich besser lesen konnte. Die Lampe hier im Arbeitszimmer funktionierte leider nicht mehr.
»Ja, Miguel«, seufzte ich. »Ich versuche immer noch, aus der Buchhaltung meines Vaters schlau zu werden …«
Miguel schüttelte den Kopf. »Sie sollten sich ausruhen, Señorita. Es bringt nichts, wenn Sie arbeiten, bis Sie vor Müdigkeit umfallen.«
Ich sah ihn gequält an. »Es bringt mir aber auch nichts, wenn ich mich ausruhe. Ich kann ohnehin nicht schlafen …«
»Ich werde Ihnen einen Tee aufsetzen. Einen, den meine Mutter mir immer gekocht hat. Und dann werde ich das Abendessen für Sie nochmals aufwärmen. Sie haben heute noch gar nichts Richtiges gegessen … Was halten Sie davon?«
Ich erhob mich, trat auf ihn zu und legte eine Hand auf seine Schulter. »Du bist so gut zu mir, Miguel«, sagte ich leise. »Ich danke dir. Aber ich habe keinen Hunger … doch den Tee werde ich gerne nehmen.«
»Señorita, Sie sollten unbedingt etwas essen, um bei Kräften zu bleiben.« Miguel hob belehrend einen Zeigefinger in die Luft.
»Ich weiß, ich weiß … aber immer wenn ich Essen sehe, vergeht mir der Appetit«, murmelte ich und senkte den Blick.
»Ich werde Ihnen ein Brot streichen – keine Widerrede.« Miguel wandte sich ab, um seinen Plan in die Tat umzusetzen.
Ich sah ihm mit einem schwachen Lächeln hinterher. Er meinte es ja nur gut, das wusste ich. Und ich liebte ihn dafür. Er war jetzt – abgesehen von Alejandro – alles, was mir von meinem alten neuen Schachbrettleben geblieben war. Miguels Neffe war derzeit nicht auf dem Gut, er arbeitete in Sacramento, machte dort im Anschluss an sein Wirtschaftsstudium eine Ausbildung zum Sommelier. Aber in seinen Ferien kam er meist, um in den Weinbergen zu helfen. So wie auch morgen. Miguel war deswegen schon ganz aus dem Häuschen und hatte für einen Moment sogar die Trauer um meine Eltern vergessen, als die Mail mit Alejandros Ankündigung gekommen war.
Ich hatte meinen Jugendfreund seit fünf Jahren nicht mehr gesehen, nur ab und an eine Mail oder SMS mit ihm ausgetauscht. Miguel schwärmte davon, dass sein Neffe ein stattlicher junger Mann geworden sei, was mich hatte lächeln lassen. Ich hatte Alejandro als schlaksigen Jungen in Erinnerung, mit Pickeln und einer Zahnspange, die er viel zu lange hatte tragen müssen.
Ich freute mich darauf, ihn morgen wiederzusehen. Er war irgendwie ein Teil meiner Familie, auch wenn wir nicht miteinander verwandt waren. Doch er kannte mich schon von Kindesbeinen an und war früher mein bester Freund gewesen. Es würde guttun, mit ihm über diese sorglose Zeit zu sprechen, in alten Erinnerungen zu schwelgen …
Ich kehrte zurück zum Arbeitstisch, blies die Kerze aus und folgte dann Miguel in die Küche, wo dieser den Tee aufsetzte.
Jetzt knurrte mein Magen doch und ich seufzte leise. Hoffentlich würde der Appetit dieses Mal bleiben, wenn ich das Essen vor der Nase hatte …
Kapitel 2 – Emilia
Als ich aus dem Schlaf hochfuhr, war es noch mitten in der Nacht. Ich zitterte am ganzen Körper und spürte einen Schweißfilm auf meiner Oberlippe, den ich mit bebenden Fingern wegwischte. Auch wenn ich wusste, dass es nur ein Albtraum gewesen war, so wollte sich mein Herz einfach nicht so schnell beruhigen.
Diese Albträume suchten mich in letzter Zeit fast jede Nacht heim. Ich saß alleine inmitten unserer Weinreben und mit einem Mal roch ich Rauch. Wenn ich aufsprang, konnte ich die Flammen bereits sehen, die mich in Windeseile umschlossen, mir jeglichen Weg zur Flucht versperrten und ihren brennenden Kreis immer enger um mich zogen, bis ich vor lauter Qualm kaum mehr atmen konnte. Das war meist der Moment, in dem ich schreiend erwachte – oder stumm, so wie gerade eben.
Jeder Psychologe hätte mir wohl attestiert, dass das Feuer für die Verantwortung stand, der ich mich ausgeliefert fühlte. Aber ich war nicht gewillt, mir von diesen Albträumen Angst einjagen zu lassen.
Ich schlug die Decke zurück, setzte mich an den Bettrand und griff nach dem Glas Wasser, das ich immer auf meinem Nachttisch stehen hatte. Erst als das kühle Nass meine Kehle herunterrann, konnte ich mich ein wenig beruhigen. Es fühlte sich an, als ob das Wasser das Feuer aus meinem Traum löschen könnte – aber nur für kurze Zeit. In der nächsten Nacht würde der nächste Albtraum kommen, so viel war gewiss.
Meine Hände zitterten immer noch leicht, als ich das Glas wieder hinstellte und zum Fenster trat. Die Vorhänge wehten im Wind, der die warme Sommernacht erträglicher werden ließ. Ich schob den Stoff ein wenig zur Seite, um aus dem halb geöffneten Fenster auf die Weinberge zu sehen, die unser Gutshaus umgaben. Jetzt, wo sie so still und friedlich im Mondlicht vor mir lagen, war der Albtraum weit entfernt. Kein Feuer war zu sehen und dennoch raste mein Puls immer noch.
Ich wartete, bis mein Herzschlag sich vollends normalisiert hatte, dann ging ich seufzend wieder ins Bett zurück, legte mich auf die dünne Decke und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Meine Finger spielten mit dem Zopf, zu dem ich mein langes Haar in der Nacht stets flocht, damit es mich beim Schlafen nicht störte. Ich hatte es in den letzten fünf Jahren wachsen lassen, bis es mir weit über den Rücken reichte. Es war immer mein ganzer Stolz gewesen und ich mochte es, wenn andere es bewunderten. Die Pflege bedeutete zwar viel Aufwand, doch das war es mir wert. Mamá hatte ihr Haar auch immer lang getragen, seit ich denken konnte.
Meine Gedanken glitten wieder zu meinen Eltern und ich versuchte vergebens, die aufkommenden Bilder und Gefühle zu verdrängen, die mich jedes Mal bei der Erinnerung an diesen unheilvollen Tag ereilten. Dem Tag, an dem mich die schrecklichste Nachricht meines Lebens erreicht hatte.
Ich war gerade in New York mit meiner besten Freundin Kate (ihr richtiger Name war Kathleen, aber den mochte sie nicht) von einem Club zum nächsten unterwegs gewesen. Wir hatten bereits den x-ten Martini bestellt, als Miguels Anruf kam.
»Señorita Emilia, es ist etwas passiert«, waren seine ersten Worte gewesen.
Ich hatte ihm sofort angehört, dass etwas Schreckliches geschehen sein musste. Miguel hatte noch nie so verzweifelt und traurig geklungen wie in diesem Moment.
»Was ist los?«, hatte ich gegen die Musik des Clubs gerufen und versucht, das Beben aus meiner Stimme zu verbannen. Mein Herz hatte mit einem Mal bis zum Hals geschlagen und ich musste schwer schlucken.
»Señorita … es tut mir so leid … Ihre Eltern … sie hatten einen schlimmen Autounfall.«
Ich hatte kaum mehr atmen können. Es war, als hätte jemand in meinen Magen getreten und gleichzeitig eine Schlinge um meinen Hals gelegt, die sich immer mehr zuzog.
»Was ist mit ihnen? Leben sie?«, hatte ich ins Telefon geschrien, als ich meine Stimme wiedergefunden hatte, ungeachtet des schockierten Gesichtes von Kate.
Ehe er antworten konnte, hatte ich die Antwort bereits gekannt. Er hatte zu lange gewartet … zu sehr um Worte gerungen. Das leise Seufzen am anderen Ende der Leitung würde ich für immer in meinem Ohr hören, wenn ich an diesen Augenblick dachte. Es hatte fast wie ein Schluchzen geklungen und mir war es eiskalt über den Rücken gelaufen.
»Sie … sie sind tot«, hatte er leise gesagt.
In dem Moment war nicht nur mein Herz, sondern meine ganze Welt stehen geblieben. Ich konnte mich nicht mehr genau erinnern, was ich danach getan oder gesagt hatte, wusste nur noch, dass ich in Tränen ausgebrochen war und einen Heulkrampf bekam.
Wäre meine Freundin nicht gewesen, hätte ich wahrscheinlich mitten in einem der angesagtesten Clubs von New York einen Nervenzusammenbruch erlitten. Aber sie hatte mich in meine kleine Wohnung gebracht und war die ganze Zeit bei mir geblieben, während sie den schnellstmöglichen Flug nach Santa Rosa gebucht hatte. Kate hatte mich begleitet, mich sicher hierhergebracht. Leider hatte sie gleich darauf nach New York zurückkehren müssen, da sie von ihrer Arbeit nicht freibekommen hatte.
Das war vor fünf Wochen gewesen.
Im Nachhinein hatte ich keine Ahnung mehr, wie ich die Kraft aufbrachte, einen Untermieter für meine New Yorker Wohnung zu finden, den Umzug und die Beerdigung zu organisieren, die vielen Trauerkarten zu verschicken und dafür zu sorgen, dass unsere Angestellten ihrer Arbeit weiter nachgingen. Es fühlte sich an, als wäre ich in eine Art ferngesteuerten Modus gefallen.
Wahrscheinlich hätte ich das alles gar nicht erst geschafft, hätte Miguel mich nicht unterstützt.
Alejandro hatte nicht zur Beerdigung kommen können, worüber er untröstlich gewesen war. Er hatte meine Eltern wie seine eigenen geliebt, denn diese waren leider ebenfalls viel zu früh verstorben. Seinen Vater hatte er nie kennengelernt, seine Mutter war an Brustkrebs gestorben, als er kaum fünf Jahre alt gewesen war. Seither hatte er bei Miguel gelebt, der ihn mit auf das Gut gebracht hatte. Alejandro musste früh erwachsen werden und war daher bereits als Kind seinen Kameraden weit voraus gewesen, was die Sicht auf das Leben anging. Wie er wohl jetzt sein mochte?
Ich wälzte mich im Bett herum und versuchte, mich auf andere Gedanken zu bringen. Ich dachte an New York, meine kleine Wohnung und an meine Freunde, die ich dort zurückgelassen hatte. An Charles, mit dem ich noch vor drei Monaten zusammen gewesen war und den ich jetzt vermisste. Wir waren ein halbes Jahr lang ein Paar gewesen – meine bisher längste Beziehung. Ich hatte ihn sehr gemocht, aber mehr konnte ich ihm nicht geben. Schließlich hatten wir uns getrennt … und weil ich den Mut nicht fand, von mir aus Schluss zu machen, hatte ich ihm sehr wehgetan. So weh, wie man einem Menschen, der einen liebt, nur tun konnte.
Dennoch war er als Freund an meiner Seite geblieben. Der Grund dafür war mir immer noch ein Rätsel. Vielleicht hoffte er auch einfach, dass ich es mir noch anders überlegen würde. Jedenfalls hatte er sich nach einem Monat der Funkstille bei mir gemeldet und wir hatten beschlossen, Freunde zu bleiben.
Ich war weder gut darin, Schluss zu machen, noch ›Nein‹ zu sagen, was ich in dem Augenblick hätte tun sollen. Denn meine Nähe tat ihm ganz offensichtlich nicht gut, den traurigen Blicken nach zu schließen, die er mir immer zuwarf, wenn wir uns als Freunde trafen. Und trotzdem war ich selbstsüchtig genug, ihn mit meinen Problemen zu belasten.
In den ersten Tagen nach dem Unfall meiner Eltern hatte er jeden Tag angerufen, um zu fragen, wie es mir ging. Dann waren seine Anrufe spärlicher geworden. Jetzt war es schon fast eine Woche her, seit wir miteinander telefoniert hatten.
Gegebenenfalls würde ich ihn morgen anrufen. Ja, das wäre gar keine so schlechte Idee. Das würde mir gut tun.
(Hatte ich schon erwähnt, dass ich manchmal egoistisch war?)
Meine Gedanken glitten zu meiner Freundin Kate, die ich in New York ebenfalls zurückgelassen hatte. Sie hatte mich unbedingt nochmals besuchen wollen und angekündigt, nächste Woche hierher zu kommen. Das war immerhin ein kleiner Lichtblick.
Vielleicht würde ich sie zuerst anrufen. Sie war immer für mich da gewesen, nur hatte sie einen Beruf, der sie stark forderte. Sie war Kunsthändlerin – eine Arbeit, die man ihr nicht unbedingt zugetraut hätte, wenn man sie sah. Aber sie hatte einen Weg gefunden, ihr Auftreten, das an einen Punk in Stewardess-Verkleidung erinnerte, zu ihrem Vorteil zu nutzen. Ihre Haare färbte sie fast täglich in einem anderen Ton und ihr Wesen glich dem eines Kolibris, der von Blüte zu Blüte flog, ohne sich auf eine davon festzulegen.
Kate hatte ich an meinem ersten Tag in New York kennengelernt, als ich an einem Straßen-Imbiss einen Hot Dog kaufen wollte. Sie war zufällig vorbeigelaufen und hatte angehalten, um mir lautstark zu erklären, wie ungesund dieses Junkfood sei und wie viele Bakterien sich auf meinem Würstchen gerade tummelten. Seither hatte ich zwar keinen Hot Dog mehr gegessen, aber dafür eine gute Freundin gewonnen.
Kate hatte ich es zu verdanken, dass ich in den fünf Jahren, die ich im Norden Amerikas verbrachte, so viele Menschen kennenlernte wie nie zuvor. Sie war kontaktfreudig, flirtete gern und schaffte es innerhalb weniger Sekunden, jemanden für sich zu einzunehmen.
Da sie oft auf Geschäftsreisen war, begleitete ich sie, weil ich nichts Besseres zu tun hatte. Ich lebte von Gelegenheitsjobs als Au-pair, Bedienung oder Mädchen für alles. Es war ein rastloses Leben gewesen, aber ich hatte dieses Leben geliebt, da es mich immer wieder von Neuem überraschen konnte.
Kate hatte oft versucht, mich zu verkuppeln, hatte mir diverse Männer vorgestellt und selten meinen Geschmack verfehlt. Einmal hatte ich ihr scherzhaft vorgeworfen, dass sie mich zur größten Schlampe Nordamerikas machen wollte – sie hatte daraufhin nur einen Lachanfall bekommen und gemeint, dann müsste ich aber noch etwas lockerer werden.
Sie hatte recht. Ich hatte zwar viele Dates, aber selten ging ich mit meinen ›Eroberungen‹ nach Hause. Dazu fehlte mir dann schlussendlich doch meist der Mut.
(Hatte ich schon erwähnt, dass ich manchmal feige war?)
Während ich über meine Vergangenheit und die beängstigende Zukunft nachdachte, fielen mir irgendwann die Augen zu und ich träumte wirre Dinge, die ich am Morgen darauf nicht mehr zuordnen konnte. Immerhin plagten mich keine Albträume mehr in dieser Nacht.
Noch ehe der erste Hahn krähte, stand ich auf, duschte und zog mich an, um in die Weinreben zu gehen.
Es war ein altes Ritual, das ich bereits als kleines Mädchen geliebt hatte. Ein Ritual, das ich von Papá übernommen hatte. Wenn man noch vor dem ersten Tageslicht auf den Hügel, der östlich von unserem Gut lag, kletterte, konnte man den Sonnenaufgang in all seiner Pracht bewundern.
Ich hatte das lange nicht mehr getan – nicht, seit ich hierher zurückgekehrt war. Aber heute war mir danach. Ich musste raus, musste die Sonne sehen und den Kopf frei kriegen, um meine Sorgen für ein paar Minuten zu vergessen. Zudem zog mich etwas auf den Hügel.
Morgens waren die Temperaturen ziemlich frisch, also schlang ich ein großes Tuch um meine Schultern, das zu dem hellen Sommerkleid passte, das ich heute trug. Mein Haar ließ ich offen, ich würde es später wieder zu einem Zopf flechten oder einem Dutt hochstecken, wenn ich mich in die Dokumente meines Vaters vertiefte.
Leise, um Miguel, der im Erdgeschoss und ein paar Zimmer neben der Eingangstür schlief, nicht aufzuwecken, schlich ich durchs Haus, hinaus auf den Hof. Princesa, unsere Mischlingshündin, kam mir schwanzwedelnd über den Platz vor dem Gutshaus entgegengelaufen und leckte meine Hand, als ich mich zu ihr hinunterbeugte und sie zwischen den Ohren kraulte.
»Na, mein Mädchen?«, flüsterte ich und gab ihr einen Kuss auf die feuchte Schnauze. »Kommst du mit zum Hügel?«
Princesa wedelte noch begeisterter und deutete ein ›Wuff‹ an, das jedoch kaum zu hören war. Sie wusste, dass sie vor dem ersten Sonnenstrahl nicht bellen durfte, sonst würde Miguel ihr wieder einen Eimer Wasser über den Kopf gießen. Diese Lektion hatte sie nach nur einem einzigen Mal gelernt – sie war ein kluges, wenn auch altes Mädchen.
Princesa hinkte neben mir her – ihr Bein lahmte seit zwei Jahren, wie mir Miguel erzählt hatte. Das Einzige, was äußerlich auf ihr hohes Alter hinwies, das sie als Hündin bereits erreicht hatte. Zudem war sie auf einem Auge blind und hörte nicht mehr richtig, aber dennoch verkörperte sie die pure Lebensfreude und mir war gar nicht bewusst gewesen, wie sehr ich sie in all den Jahren fernab der Heimat vermisst hatte.
Den Weg hinauf zum Hügel hätte ich wahrscheinlich auch mit verbundenen Augen oder im Schlaf gefunden. Ich war ihn in meinem Leben bereits viele hundert Mal gegangen. Alleine, mit Papá, mit Alejandro … ich wusste gar nicht mehr, wie oft mich meine Füße zwischen den Reben hinauf zur alten Eiche geführt hatten, die dort oben stand und über unser Gut wachte.
Nachdem Princesa ein paar Minuten freudig hechelnd neben mir hergetappst war, begann sie mit einem Mal zu rennen – nun ja, so schnell sie eben rennen konnte.
Wir waren jetzt fast bei der Hügelspitze angelangt und ich nahm an, dass sie als Erste oben sein wollte. Also beschleunigte ich ebenfalls meine Schritte, um sie einzuholen – und hielt erstaunt inne, als ich bemerkte, dass bei der Eiche jemand stand.
Da die Dunkelheit noch nicht gänzlich verflogen war, konnte ich nur die Umrisse erkennen, die sich gegen den heller werdenden Horizont abzeichneten. Es musste ein Mann sein, für eine Frau waren die Schultern zu breit.
Einen Augenblick lang überlegte ich, ob ich umkehren sollte. Ich hatte keine Lust darauf, mich mit jemandem zu unterhalten. Ich war hierhergekommen, um alleine zu sein, meinen Gedanken nachzuhängen und die Sorgen von den Sonnenstrahlen wegwischen zu lassen.
Dann bewegte sich der Mann jedoch und schien mir entgegenzublicken. Jetzt war’s ohnehin zu spät. Er hatte mich bereits gesehen und es hätte lächerlich gewirkt, wenn ich jetzt noch umgekehrt wäre.
Also ging ich das letzte Stück auf die Eiche zu. Princesa bellte leise und wedelte wie verrückt, als sie bei der Person ankam, die nun in die Hocke ging, um die Hündin zu kraulen.
Mit einem Schlag wurde mir bewusst, wer es sein musste. Denn Princesa begegnete Fremden immer mit gewissem Argwohn. Also musste sie diesen Mann kennen.
»Alejandro?«, fragte ich vorsichtig.
Der junge Mann erhob sich und blickte mir entgegen. Ich war jetzt nur noch ein paar Schritte von ihm entfernt und konnte ihn deutlich sehen – zumal der Horizont sich bereits in jenen rotschimmernden Ton verfärbte, der den Morgen ankündigte.
Er trug dunkle Jeans und ein weißes T-Shirt, das jedoch eng genug war, um zu erkennen, dass er darunter gut gebaut sein musste. Er überragte mich um mindestens einen Kopf. Das halblange Haar war so schwarz, wie ich es in Erinnerung hatte, und etwas zerzaust, als sei er eben noch mit der Hand hindurchgefahren. Um sein Kinn konnte ich einen Schatten erkennen, der ein angedeuteter Dreitagebart sein musste.
Miguel hatte recht behalten: Das war tatsächlich nicht mehr der Alejandro, den ich vor fünf Jahren das letzte Mal gesehen hatte. Vor mir stand ein attraktiver, junger Mann, der mir mit funkelnden Augen entgegensah. Die lateinamerikanische Herkunft war nicht zu verleugnen, seine braun gebrannte Haut konnte ich sogar im Dämmerlicht erkennen.
»Emilia?«, fragte er in demselben überraschten Tonfall. Er hatte eine angenehm tiefe Stimme, die warm und sanft klang. So ganz anders als beim letzten Mal, als ich ihn hatte sprechen hören. Augenblicklich verzog sich sein fein geschwungener Mund zu einem erfreuten Lächeln und er kam auf mich zu. »Ich hätte mir denken können, dass ich dich hier antreffe.«
Als er bei mir angekommen war, breitete er die Arme aus und zog mich an sich, ehe ich etwas erwidern konnte.
Ich roch sein Aftershave sowie das Waschmittel, mit dem sein T-Shirt gewaschen worden war. Beides zusammen vermischte sich mit seinem männlichen Duft zu einem Geruch, der mir zwar fremd war, den ich aber auf der Stelle mochte. Mein Kopf legte sich an seine Brust und meine Arme wie von selbst um seine Taille.
Ich hatte recht gehabt mit meiner Vermutung: Er war wirklich gut gebaut.
»Es tut mir so leid, was mit Carlos und Sofía passiert ist«, flüsterte er nahe an meinem Ohr. »Ich habe mir gewünscht, ich hätte für dich da sein können, aber ich konnte die Schule nicht verlassen, wir waren mitten in den letzten Semesterprüfungen.«
»Jetzt bist du ja hier«, murmelte ich an seiner Brust und gestattete mir, einen Moment lang zu genießen, wie stark er sich anfühlte. Er musste die letzten fünf Jahre jede Minute im Fitnesscenter verbracht haben, so hart, wie seine Muskeln unter meinen Fingern wirkten.
»Ja, ich werde hierbleiben, solange ich kann«, fuhr er fort. »Ich habe sogar mit meinem Dozenten ausgemacht, dass ich das Herbstsemester verschiebe, damit ich euch helfen kann.«
»Das ist … das ist nicht nötig«, stammelte ich und stemmte mich von ihm weg, um ihm ins Gesicht zu blicken. »Ich komme schon alleine zurecht.«
Seine Brauen hatten sich zusammengeschoben und seine dunklen Augen sahen mich eindringlich an. »Claro que si. Diese Sturheit hast du von deinem Vater«, sagte er in tadelndem Tonfall, um dann etwas sanfter fortzufahren: »Keiner kommt alleine zurecht. Wir alle sind ab und an auf Hilfe angewiesen. Selbst eine solch eigensinnige und zugegeben starke Frau wie du.«
Es war das erste Mal, dass er mich als ›Frau‹ bezeichnete. Früher hatte er mich immer ›mi chiquitita‹, ›mein kleines Mädchen‹, genannt. Es fühlte sich irgendwie komisch an, von ihm jetzt als Frau angesehen zu werden, aber gleichzeitig auch gut.
Ich sah ihm in die dunkelbraunen Augen, die warm auf mich gerichtet waren (hatte er schon immer diese hellen Sprenkel darin gehabt?). »Ich weiß, wie viel dir die Sommelier-Ausbildung bedeutet«, versuchte ich nicht minder eindringlich meine ›Sturheit‹ zu begründen. »Ich möchte nicht, dass du sie meinetwegen vernachlässigst oder aufschiebst.«
»Ich schiebe sie nicht auf, ich kann einiges auch von hier aus erledigen«, erwiderte er und lächelte mich versöhnlich an.
Ich spürte unversehens ein Kribbeln in meinem Bauch, als seine weißen Zähne blitzten. Er hatte mich noch nie auf diese umwerfende Art angelächelt. Dieser neue Alejandro begann mir mit jeder Sekunde besser zu gefallen.
Als hätte er meine Gedanken erraten, wurde sein Lächeln noch strahlender. »Und jetzt hör auf mit mir diskutieren zu wollen und lass uns den Sonnenaufgang anschauen. Den Anfang haben wir bereits verpasst.«
Er zog mich an der Hand das letzte Stück zur Eiche, wo er sich niederließ und neben sich auf den sandigen Boden klopfte. »Komm, Emilia. Setz dich zu mir.«
Princesa gehorchte auf der Stelle und legte sich neben ihm flach auf den Boden, während ihr Schwanz immer noch aufgeregt hin und her fegte.
Ich sah skeptisch die schmutzige Erde an – wohl eine Sekunde lang zu skeptisch.
»Wenn du Angst wegen dem hellen Kleid hast, setz dich auf meinen Schoß, ich beiße nicht«, meinte Alejandro mit einem amüsierten Schmunzeln.
Früher hätte ich das sofort getan, aber jetzt fühlte es sich komisch an. Ich hatte das Gefühl, ich würde ihn nicht mehr wirklich kennen – er war so erwachsen geworden. Und ich auch. Es war nicht mehr dasselbe wie früher, als wir als Kinder miteinander getobt hatten und beste Freunde waren. Etwas hatte sich in den fünf Jahren verändert – wir hatten uns verändert.
Er seufzte leise und ließ seine Augen blitzen. »Komm schon, Emi, seit wann zierst du dich denn so?«
Er nannte mich absichtlich bei meinem Spitznamen, den ich immer schon gehasst hatte, um mich zu provozieren. Das war mir bewusst. Und es klappte leider viel zu gut, denn ich hatte plötzlich nur noch den Wunsch, ihm die Sicht auf den Sonnenaufgang zu versperren.
Schwungvoll setzte ich mich auf seine ausgestreckten Beine und warf mein langes Haar nicht minder schwungvoll nach hinten, sodass es direkt in seinem Gesicht landete.
»He, ich kann nichts mehr sehen!«, rief er aus.
Gut so. Ich grinste in mich hinein und richtete dann den Blick auf den Horizont.
Was ich dort sah, erinnerte mich wieder daran, warum ich es früher so geliebt hatte, hierherzukommen. Die Sonne ließ soeben unwirkliche Farben als ihre Vorboten an den Himmel steigen, wie eine Diva, die zuerst den roten Teppich ausbreiten lässt, ehe sie den Schaulustigen unter die Augen tritt. Dieses Farbenspiel war mit keiner Kamera und keinem Pinsel festzuhalten. Man musste es mit eigenen Augen gesehen haben.
Ich spürte, wie Alejandro mein Haar zusammennahm und es zwischen sich und meinem Rücken einklemmte, ehe er sein Kinn auf meiner Schulter abstützte und die Arme um meinen Bauch legte.
»Es ist wunderschön«, hörte ich seine Stimme an meinem Ohr flüstern.
Sein Atem kitzelte meinen Hals, sodass sich meine Nackenhärchen aufstellten.
Noch nie hatte ich ihn so intensiv gefühlt wie in diesem Moment. Zum ersten Mal wurde mir bewusst, dass er ein Mann war. Kein pickeliger Junge mit Zahnspange. Nein, Alejandro war wirklich erwachsen geworden. Würde ich ihn nicht seit meiner Kindheit kennen, hätte ich ihn wohl ohne zu zögern, als ›heiß‹ bezeichnet. Er hätte jedem Chippendale Konkurrenz machen können mit seinen Muskeln, seinem markanten Kiefer, seinem dunklen, zerzausten Haar.
Ja, er war ein Mann … ein heißer Mann … und ich saß gerade auf seinem Schoß, verdammt!
Mit einem Mal fühlte ich mich unwohl und versuchte krampfhaft, so gelassen wie möglich zu wirken. Wie beiläufig legte ich meine Hände auf seine Unterarme, die er um meinen Bauch geschlungen hatte, und strich über die dunklen Härchen auf seiner Haut, während ich den Blick weiterhin auf den Sonnenaufgang gerichtet hielt. Ich atmete tief die kühle Morgenluft ein.
Diese Kombination ließ mich tatsächlich entspannter werden. Je länger ich der Sonne zusah, desto mehr lösten sich meine Sorgen auf. Vergangenheit und Zukunft verschwammen zum Moment. Und endlich fühlte sich mein zerstörtes Schachbrett-Leben wieder etwas vollständiger an. Weil eine wichtige Figur zu mir zurückgekehrt war: Alejandro.
Kapitel 3 – Alejandro
Ich spürte sie mit jeder Faser meines Körpers. Sie wog etwas mehr, als ich erwartet hatte, was aber vor allem daran lag, dass sie in den vergangenen Jahren Rundungen an den richtigen Stellen bekommen hatte.
Sie fühlte sich verdammt gut an. So richtig gut. Wie sie auf mir saß, den Rücken gegen meine Brust gelehnt, den Blick auf den Horizont gerichtet, wo die Sonne nun langsam zu sehen war. Ihre Finger streichelten meine Unterarme, sodass darauf ein feines Kribbeln entstand.
Ich fühlte, wie sich ihre Schulter beim Atmen hob und senkte, da ich immer noch mein Kinn darauf gelegt hatte. Ihr Haar duftete nach Vanille, was mir fast die Sinne zu vernebeln drohte.
Wusste sie, wie schön sie in den letzten fünf Jahren geworden war? Wie verdammt sexy?
Als sie vorhin auf mich zutrat, musste ich erst ungläubig blinzeln, ehe ich sie wiedererkannte. Das konnte doch nicht meine Emilia sein. Meine Chiquitita, die stets etwas zu schlaksig und etwas zu unbeholfen gewesen war.
Allein wie sie sich bewegte … elegant, anmutig und voller Grazie – eine richtige Señora … obwohl sie gerade dabei gewesen war, einen Hügel zu erklimmen. Ihr Körper war verführerisch weiblich und ihr Gesicht nun nicht mehr das eines Mädchens, sondern einer Frau. Einer wunderschönen Frau.
Jetzt erkannte ich zum ersten Mal auch die Ähnlichkeit mit ihrer verstorbenen Mutter. Auch sie war eine Schönheit gewesen, allerdings schon etwas älter. Und ich hatte sie wie meine eigene Mutter geliebt, weswegen ich sie nicht als wirkliche Frau wahrgenommen hatte, sondern eben als … Mutter.
Aber Emilia … Dios mío, sie war überwältigend.
Spürte sie, dass mein Herz gerade etwas schneller schlug, während ich versuchte, die männliche Regung zwischen meinen Beinen zu unterdrücken? Ihr Hintern saß genau dort, wo es in den vergangenen Sekunden verdächtig eng in meiner Hose geworden war.
Ich wusste, ich sollte solche Gefühle ihr gegenüber eigentlich nicht haben, schließlich war sie fast wie meine Schwester. Und dennoch konnte ich nicht anders, als diese Frau zu bewundern – nein, zu begehren.
»Warum bist du schon hier?«, riss mich Emilia aus meinen Gedanken, die alles andere als mit dem Sonnenaufgang beschäftigt waren. »Wir haben dich erst gegen Mittag erwartet.«
»Du scheinst dich ja wahnsinnig darüber zu freuen, dass ich dir Gesellschaft leiste«, erwiderte ich scherzhaft und kniff sie leicht in den Bauch, sodass ihr ein empörter Schrei entfuhr und sie auf meinem Schoß herumhopste.
Mierda … ich mochte diesen Schrei augenblicklich und das Hüpfen auf meinen ohnehin engen Hosen machte es auch nicht unschuldiger.
Ich überlegte, wie sie sich wohl anhören würde, wenn …
Nein, nein, stopp! Falsche Gedanken! Falscher Zeitpunkt! Falscher Ort!
Sie drehte ihren Kopf unwirsch zu mir herum. »Benimm dich!«
Sí, das befahl ich mir gerade selbst …
Ich riss mich zusammen und atmete tief durch, um ihre Frage zu beantworten. »Ich habe extra einen Zug früher genommen und bin das letzte Stück durch die Nacht hindurch hierher getrampt.« Meine Stimme klang ein bisschen belegt, aber nur ein bisschen. Ihr schien es glücklicherweise nicht aufzufallen. »Ich wollte unbedingt vor Sonnenaufgang hier sein. Jetzt ist mir auch klar, dass ich das deinetwegen wollte.«
Zu direkt? Womöglich.
Zu schnulzig? Bestimmt.
Aber es war mir egal, ich hatte noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich Emilia mochte. Ich mochte sie bereits zu der Zeit, als andere Jungs in meinem Alter sich noch nichts aus Mädchen gemacht hatten. Leider war ich immer viel zu schüchtern gewesen, um ihr meine Gefühle zu offenbaren. Obwohl sie natürlich unübersehbar gewesen sein mussten. Doch sie hatte stets so getan, als bemerkte sie es nicht, was es mir leichter machte, mich in ihrer Gegenwart nicht allzu befangen zu fühlen.
Früher hatten wir viel miteinander unternommen und uns fast jeden Tag gesehen. Es hatte mir zwar das Herz zerrissen, als sie vor fünf Jahren einfach fortging, doch irgendwie war ich auch erleichtert darüber gewesen. Denn das war der Moment, in dem ich erkannt hatte, dass ich ihr nicht gleich viel bedeutete wie sie mir. Ich war für sie nicht mehr oder weniger als ein älterer Bruder. Sie für mich jedoch so viel mehr und keinesfalls weniger …
Doch vorhin, als ich sie umarmt hatte, da hatte ich etwas gespürt. Vielleicht sie auch – keine Ahnung. Jedenfalls war da etwas zwischen uns gewesen, einen kurzen, magischen Moment lang. Die Art, wie ihre Finger über meinen Rücken gestrichen hatten – so wie sie es bis eben noch an meinen Unterarmen taten. Forschend. Langsam. Als würde sie mich neu entdecken.
Ich hoffte bloß, ich bildete mir nichts ein.
Wer wusste schon, was das Schicksal für uns vorgesehen hatte? Ich würde jedenfalls alles daran setzen, ihr zu zeigen, dass ich für sie da wäre. Dass ich ihr in dieser schweren Stunde ihres Lebens helfen würde, sie unterstützen und das Gut mit ihr zusammen weiterleiten. Dafür wäre ich sogar bereit gewesen, meine Ausbildung zum Sommelier, die ich in nur einem Jahr abgeschlossen hätte, in den Wind zu schießen.
Emilia hatte sich in der Zwischenzeit wieder dem Sonnenaufgang zugewandt. Der Himmelskörper stieg jetzt wie eine goldene Kugel über den Horizont und ließ alles um sich herum in Rot und Orange erstrahlen.