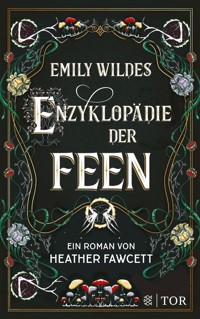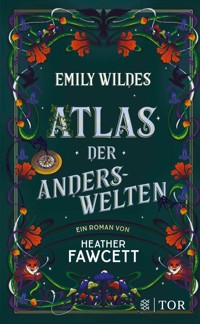
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Emily Wilde
- Sprache: Deutsch
Eine Reise in die mysteriöse Welt der Feen. Der zweite Band von Heather Fawcetts Cozy-Fantasy-Sensation. Emily Wilde ist die führende Expertin in Sachen Feen in Cambridge, und ihr neues Forschungsprojekt ist revolutionär: Sie möchte eine Karte der Anderswelten zeichnen, um die verschlungenen Wege dieser zauberhaften Wesen besser zu verstehen. Ihr Freund und akademischer Rivale Wendell Bambleby unterstützt sie, wo er nur kann, zumal er als exilierter Feenprinz darauf hofft, eines Tages in sein Reich zurückkehren zu können. Eilig hat er es eigentlich nicht damit, doch als magisch begabte Attentäter seiner Mutter in Cambridge auftauchen, die auf ihn und Emily einen Anschlag verüben, bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Flucht nach vorne anzutreten: Emily und Wendell reisen nach Österreich, wo sie eine Tür zur Anderswelt vermuten, hinter der das Reich der Feenkönigin beginnt. Für Fans von Neil Gaiman, Mary Brennan und Holly Black
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Heather Fawcett
Emily Wildes Atlas der Anderswelten
Roman
Über dieses Buch
Emily Wilde ist die führende Expertin in Sachen Feen in Cambridge, und ihr neues Forschungsprojekt ist revolutionär: Sie möchte eine Karte der Anderswelten zeichnen, um die verschlungenen Wege dieser zauberhaften Wesen besser zu verstehen.
Ihr Freund und akademischer Rivale Wendell Bambleby unterstützt sie, wo er nur kann, zumal er als exilierter Feenprinz darauf hofft, eines Tages in sein Reich zurückkehren zu können. Eilig hat er es eigentlich nicht damit, doch als magisch begabte Attentäter seiner Mutter in Cambridge auftauchen, die auf ihn und Emily einen Anschlag verüben, bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Flucht nach vorne anzutreten: Emily und Wendell reisen nach Österreich, wo sie eine Tür zur Anderswelt vermuten, hinter der das Reich der Feenkönigin beginnt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Heather Fawcett hat bereits zahlreiche Kinder- und Jugendbücher geschrieben. »Emily Wildes Enzyklopädie der Feen« ist ihr erster Fantasyroman für Erwachsene. Sie hat einen Master in englischer Literatur und arbeitete als Archäologin, Fotografin, technische Redakteurin und Backstage-Assistentin für ein Shakespeare-Theaterfestival. Sie lebt auf Vancouver Island, Kanada.
Inhalt
14. September 1910
14. September – Abend
15. September
17. September
20. September
21. September
22. September
24. September
27. September
2. Oktober
4. Oktober
5. Oktober
6. Oktober
6. Oktober – spät
7. Oktober
8. Oktober
9. Oktober
10. Oktober
11. Oktober
11. Oktober – Abend
13. Oktober?
? Oktober
9./10./10.
12. Oktober
29. Dezember
Die Autorin
Die Übersetzerin
14. September 1910
Der Fuß passte nicht in meine Aktentasche, deshalb wickelte ich ihn in ein Tuch und stopfte ihn in den alten Rucksack, den ich manchmal bei meinen Expeditionen bei mir trage. Überraschenderweise – obwohl es eigentlich nicht überraschen sollte, da es sich immerhin um den Fuß einer Fee handelt – ist er weder schmutzig noch haftet ihm ein übler Geruch an. Er ist natürlich längst mumifiziert und würde bei einem beiläufigen Blick wie ein Ziegenhuf erscheinen, vielleicht wie eine ungewöhnliche Opfergabe, die aus dem Grab eines alten Pharaos ausgegraben wurde. Schlecht riecht er wie gesagt nicht, aber seit ich den Fuß in mein Büro gebracht habe, steigt mir hin und wieder der Duft von Wildblumen und zertretenem Gras in die Nase, mit einem Windhauch, dessen Ursprung ich nicht entdecken kann.
Ich betrachtete meinen nun prall gefüllten Rucksack und kam mir zutiefst albern vor. Es ist für mich keine Freude, einen Fuß über den Campus zu schleppen, das können Sie mir glauben. Aber Überreste von Feen, selbst mumifizierte, entschwinden zuweilen, wenn es ihnen gefällt, und ich würde vermuten, dass Füße besonders zu einer solchen Wanderlust neigen. Ich werde ihn mit mir herumtragen müssen, bis seine Nützlichkeit erschöpft ist. Große Güte.
Das leise Läuten der Standuhr erinnerte mich daran, dass ich mich zum Frühstück mit Wendell verspätete. Aus Erfahrung weiß ich, dass er das Essen zu mir bringt, wenn ich unsere Verabredung nicht einhalte, in einer solchen Menge, dass die ganze Fakultät nach Eiern riecht, und dann muss ich den restlichen Tag Professor Thornthwaites spitze Bemerkungen über seinen empfindlichen Magen ertragen.
Ich steckte mir die Haare neu auf – sie sind viel zu lang geworden, weil ich in den letzten Wochen wieder einmal in meiner Forschung vergraben war und kaum einen Gedanken für etwas anderes übrig hatte. Wendells Tür hat mich mehr in ihren Bann geschlagen als jedes andere akademische Rätsel, dessen ich mich entsinnen kann. Meine Haare sind nicht der einzige Teil meiner Erscheinung, den ich in letzter Zeit vernachlässigt habe – mein braunes Kleid ist zerknittert, und ich bin nicht ganz sicher, wie sauber es ist; ich habe es in einem Berg anderer Kleidungsstücke mit ähnlich fragwürdigem Reinheitszustand auf dem Boden meines Kleiderschranks gefunden.
»Komm, mein Lieber«, rief ich Shadow. Gähnend erhob der Hund sich von seinem Bett vor dem Petroleumofen und stemmte die mächtigen Pfoten gegen den Boden, um sich zu strecken. Ich hielt einen Moment inne und ließ den Blick zufrieden durch mein Büro schweifen – mit der unkündbaren Stelle, die mir vor kurzem gewährt wurde, habe ich auch ein deutlich geräumigeres Büro geerbt und bin jetzt drei Türen weiter von Wendell entfernt (der sich über die zusätzlichen sieben Meter natürlich schon beklagt hat). Die Standuhr gehört zum Zimmer, ebenso die üppigen Damastvorhänge vor dem Schiebefenster mit Blick auf den Teich des Knight College – auf dem gerade vereinzelte Schwäne schwammen – und der prächtige Eichenschreibtisch, dessen Schubladen mit schwarzem Samt ausgekleidet sind. Ich habe es natürlich um Bücherregale ergänzt und um eine Leiter, mit der ich die obersten Bände erreiche, während Wendell mir zwei Fotografien aus Hrafnsvik aufgedrängt hat, von denen ich zuvor nichts gewusst hatte; eine zeigt mich in einem verschneiten Garten neben Lilja und Margret, die andere das Dorf; außerdem eine Vase mit getrockneten Blumen, die ihren Duft nie verlieren, und das frisch gerahmte Gemälde von Shadow, das er zu meinem achtundzwanzigsten Geburtstag in Auftrag gegeben hatte – nun gut, darüber kann ich mich nicht beschweren. Mein Ungetüm sieht darauf ganz bezaubernd aus.
Mein Weg führte vorbei an mehreren Studenten, die tief versunken waren in den Sesseln des Gemeinschaftsraums der Dryadologischen Fakultät, einem offenen Bereich zwischen den Büros mit einem gemütlichen Kamin, in dem an diesem warmen Septembertag kein Feuer brannte, und einer beeindruckenden Reihe von Fenstern, mehrere Manneslängen hoch, oben mit kleinen Halbmonden aus Buntglas versehen und direkt gegenüber der erhabenen gotischen Fassade der medizinischen Bibliothek, deren Nähe Thema unzähliger spöttischer Bemerkungen über die Anfälligkeit von Dryadologen für eigentümliche Verletzungen ist. In einer Ecke steht ein Bronzegefäß voller Salz – auf dem Campus erzählt man sich, es sei als Scherz aufgestellt worden, aber schon viele Studenten standen nach ihrer ersten Vorlesung über Kobolde mit bleichem Gesicht davor und füllten sich die Taschen mit Salz. Nicht, dass man sich große Sorgen machen müsste, schließlich kommen üblicherweise keine Feen in unsere Fakultät spaziert, um zu hören, was wir über sie sagen (abgesehen von Wendell). Die vereinzelten dicken Läufer auf dem Boden dürfen nur mit Vorsicht betreten werden, weil sie durch die vielen Münzen darunter uneben sind. Wie beim Salz begann auch diese Tradition höchstwahrscheinlich eher als humorvolle Zerstreuung denn als ernsthafter Versuch, das kleine Volk aus unseren Mauern fernzuhalten, und hat sich mittlerweile zu einer Art Glücksritual entwickelt, bei dem Studenten vor Prüfungen oder Vorträgen einen Half Penny auf den Boden legen. (Angeblich sollen weniger abergläubische junge Leute auch schon etwas von dem bescheidenen Schatz für ihren Pubbesuch stibitzt haben.)
Shadow schnaubte glücklich, als wir das Gebäude verließen – normalerweise ist er ein stiller Hund –, stürzte sich auf das sonnenbeschienene Gras und schnupperte nach Schnecken und anderen Leckereien.
Ich folgte in behäbigerem Tempo und genoss die Sonne auf meinem Gesicht und auch die leichte Kühle im Wind, die den nahen Herbst ankündigte. Gleich neben dem Hauptgebäude der Dryadologie stand die prächtige, mit Efeu bewachsene dryadologische Bibliothek an einer Rasenfläche mit Eiben und Weiden, die in diesem Teil Großbritanniens als Lieblingsbäume der Feen bekannt sind. Mehrere Studenten machten ein Nickerchen unter dem größten Baum, einer mächtigen weißgrauen Weide, von der man (fälschlicherweise, fürchte ich) behauptet, ein Leprechaun würde darunter schlummern, und eines Tages würde er erwachen und dem ersten Schlafenden, den er erblickt, die Taschen mit Gold vollstopfen.
Als ich in den Schatten dieser Bibliothek trat, verspürte ich ein wohliges Gefühl der Verbundenheit. Ich höre fast Wendells spöttische Worte, weil ich mich einer Bibliothek nahe fühle, aber das kümmert mich nicht; immerhin liest er nicht meine Tagebücher, auch wenn er sich nicht zu schade dafür ist, mich damit aufzuziehen, dass ich diese Angewohnheit nach unserer Abreise aus Ljosland nicht abgelegt habe. Es drängt mich, weiterzuschreiben; ich merke, dass es mir sehr dabei hilft, meine Gedanken zu ordnen.
Ich betrachtete immer noch die Bibliothek, als ich eine Kurve im Weg erreichte – was unklug war, wie sich herausstellte, denn ich stieß mit einem Mann zusammen, der mir entgegenkam, so heftig, dass ich fast das Gleichgewicht verlor.
»Es tut mir sehr leid«, setzte ich an, aber der Mann winkte nur unhöflich ab. Er hielt eine große Anzahl Bänder in den Händen und schien sie zusammenknoten zu wollen.
»Haben Sie noch welche?«, fragte er. »Die hier werden nicht reichen.«
»Ich fürchte nicht«, antwortete ich behutsam. Für dieses Wetter war der Mann seltsam gekleidet, er trug einen langen, mit Pelz gefütterten Mantel und klobige Stiefel, die ihm bis zu den Knien reichten. Er hielt nicht nur in den Händen Bänder, er hatte sich auch eine lange Kette daraus mehrmals um den Hals geschlungen, weitere quollen aus seinen vollen Taschen. Es war eine wilde Mischung in zahlreichen Farben und Längen. Mit den Bändern und seiner stattlichen Größe wirkte der Mann wie ein zum Leben erwachter Maibaum. Er schien bereits in die Jahre zu kommen, seine Haare waren noch größtenteils braun, wenn auch ein, zwei Töne heller als seine Haut, vielleicht von der Sonne gebleicht, aber sein struppiger Bart war weiß.
»Wofür reichen sie nicht?«, erkundigte ich mich.
Der Mann bedachte mich mit einem ganz unerfindlichen, durchdringenden Blick. Wie er mich ansah, wirkte auf eine Weise vertraut, die ich nicht recht beschreiben konnte, obwohl ich sicher war, dass mir dieser seltsame Mensch noch nie begegnet war. Ein Schauder streifte meinen Hals wie eine kalte Fingerspitze.
»Der Pfad ist ewig«, sagte er. »Aber Sie dürfen auf keinen Fall schlafen – ich habe es getan, und es war ein Fehler. Wenden Sie sich bei den Geistern mit Asche in den Haaren nach links, wieder nach links beim Tannenwald, dann geradeaus durch das Tal, in dem mein Bruder sterben wird. Wenn Sie vom Weg abkommen, verlieren Sie nur sich, aber wenn Sie den Pfad verlassen, verlieren Sie alles, von dem Sie nicht einmal wissen, dass Sie es haben.«
Ich starrte ihn an. Der Mann sah nur auf seine Bänder, als würde ich ihn nicht mehr interessieren, und setzte seinen Weg fort. Natürlich drehte ich mich um, weil ich sehen wollte, wohin er ging, und war nur ein wenig überrascht, als er verschwunden war.
»Hm!«, grummelte ich. »Was hältst du davon, mein Liebster?«
Shadow hatte sich für den Mann nicht besonders interessiert; jetzt beäugte er eine Elster, die auf den Rasen heruntergeflattert war und an einem Wurm zog. Ich legte die Begegnung zu den Akten und setzte meinen Weg über den begrünten Campus fort.
Wendells Lieblingscafé thront am Ufer des Flusses Cam neben der Pendleigh Bridge. Von unseren Büros aus läuft man eine Viertelstunde dorthin, und ginge es nach mir, würden wir uns etwas Näheres suchen, aber er ist sehr eigen, was das Frühstück angeht, und behauptet, das Café Archimedes – es grenzt an das mathematische Institut – sei das einzige Lokal, in dem man weiß, wie man Eier richtig pochiert.
Wie üblich war Wendell leicht auszumachen; seine goldenen Haare zogen den Blick an wie ein Leuchtfeuer, wenn sie zwischen den im Wind schwankenden Ästen aufschimmerten. Er saß an unserem üblichen Tisch unter dem Kirschbaum, die elegante Gestalt über den Tisch gebeugt, einen Ellbogen aufgestützt und die Stirn in die Hand gelegt. Ich verkniff mir ein Lächeln.
»Guten Morgen«, flötete ich hörbar zufrieden mit mir. Ich kam genau zur rechten Zeit, denn es war gerade serviert worden; der Speck und die Eier dampften ebenso wie der Kaffee in Wendells Tasse.
»Liebe Emily«, sagte er, als ich mich setzte. Er sparte sich die Mühe, den Kopf zu heben, und lächelte mich von der Seite her an. »Du siehst aus, als hättest du einen Ringkampf mit einem deiner Bücher verloren. Darf ich fragen, wer gewonnen hat?«
Ich ignorierte die Frage. »Auf dem Weg hierher ist etwas Sonderbares geschehen«, sagte ich und beschrieb meine Begegnung mit dem rätselhaften Bändermann.
»Vielleicht hat meine Stiefmutter doch noch beschlossen, mir ihre Meuchelmörder auf den Hals zu hetzen.« Er klang abfällig, als wären Meuchelmörder nicht en vogue.
Natürlich sparte ich mir den Hinweis, dass der Fremde Wendell nicht erwähnt hatte und keinerlei Verbindung zu ihm oder seinen Problemen zu haben schien, weil ich wusste, dass ich auf taube Ohren stoßen würde, und sagte nur: »Besonders bedrohlich hat er nicht gewirkt.«
»Vielleicht war er ein Giftmischer. Das sind häufig eigenartige, nervöse Gestalten, die mit großer Vorliebe in Rätseln sprechen. Sicher, weil sie ständig zusammengekauert irgendwas abwiegen und dabei die Dämpfe einatmen.« Verdrossen beäugte er seinen Kaffee, ließ einen weiteren Löffel Zucker hineinplumpsen und stürzte ihn in einem Zug herunter.
Ich füllte für Shadow einen Teller mit Eiern und Würstchen und stellte ihn unter den Tisch, wo der Hund es sich zufrieden gemütlich machte, dann hängte ich meinen Rucksack beiläufig über die Stuhllehne. Zu meiner Belustigung nahm Wendell das machtvolle Feenartefakt, das ich zum Frühstück mitgebracht hatte, immer noch nicht zur Kenntnis. »Riechst du das auch?«, fragte ich unschuldig, als mir wieder wie aus dem Nichts der Duft von Wildblumen in die Nase stieg.
»Was denn?« Er kraulte Shadows Ohren. »Probierst du ein Parfum aus? Falls ja, fürchte ich, es wurde von deinem üblichen Aroma von Tintenfässchen und Bibliotheken überdeckt.«
»Ich rede nicht von mir«, sagte ich ein wenig zu laut.
»Wovon dann? Diese verdammten Kopfschmerzen setzen meine Sinne völlig außer Gefecht.«
»Ich glaube, so funktioniert das nicht«, erwiderte ich amüsiert. Nur leicht allerdings; er sah wirklich aus wie der wandelnde Tod. Seine sonst rosige Haut war gräulich blass, unter den dunklen Augen lagen Schatten. Er brummte etwas Unverständliches, rieb sich die Stirn und zerzauste dabei die goldenen Locken, die ihm vor die Augen gefallen waren. Ich widerstand dem vertrauten Drang, ihm die Haare zurückzustreichen.
»Dieses Ritual, sich jedes Jahr selbst zu vergiften, habe ich ehrlich gesagt nie verstanden«, sagte ich. »Was soll daran reizvoll sein? Sollte ein Geburtstag nicht etwas Erfreuliches sein?«
»Ich glaube, die Sterblichen wollen den Gedanken an ihr unerbittlich nahendes Ableben verdrängen. Ich habe mich bloß ein wenig mitreißen lassen – der verdammte Byers und seine Trinkspiele. Und dann haben sie einen Kuchen aufgetischt – oder waren es zwei Kuchen? Wie auch immer. Nie wieder.«
Ich lächelte. Trotz Wendells Angewohnheit, sich über Erschöpfung, schmerzende Füße und unzählige andere Wehwehchen zu beklagen – meist dann, wenn von ihm harte Arbeit gefordert ist –, sieht man ihn selten tatsächlich leiden, und in gewisser Weise verschaffte es mir Genugtuung. »Mir ist es gelungen, meinen dreißigsten – und letzten Monat auch meinen einunddreißigsten – zu begehen, ohne mich bis zur Besinnungslosigkeit zu betrinken. Das ist durchaus möglich.«
»Du hast dich auch um neun Uhr zurückgezogen. Reid, Thornthwaite und wir anderen haben deinen Geburtstag länger gefeiert als du. Du treibst es nur in anderer Hinsicht zu weit, Em.« Etwas – vielleicht hatte ein Zeh des Feenfußes gezuckt – hatte schließlich doch seine Aufmerksamkeit erregt, denn sein trüber Blick fiel misstrauisch auf meinen Rucksack. »Was hast du da drin? Und was soll dieses Grinsen? Du heckst doch was aus.«
»Ich weiß gar nicht, was du meinst.« Ich presste die Lippen aufeinander, um besagtes Grinsen zu unterdrücken.
»Hast du dich wieder verzaubern lassen? Muss ich einen neuen Rettungsplan schmieden?«
Ich warf ihm einen finsteren Blick zu. Ich fürchte, ich habe immer noch nicht meinen Ärger darüber verwunden, dass er mich Anfang des Jahres auf Ljosland vom Hof des Schneekönigs gerettet hat, und ich habe mir geschworen, dass ich ihn retten werde, wenn wir wieder in Schwierigkeiten mit den Feen geraten. Ja, mir ist klar, dass es unlogisch ist, weil Wendell dafür in eine Notlage geraten müsste, die man am besten vermeiden sollte, aber so ist es nun. Ich bin fest entschlossen.
»Das erkläre ich alles morgen«, versprach ich. »Sagen wir für den Moment einfach, dass ich bei meinen Forschungen einen Durchbruch erzielt habe. Darüber plane ich einen gebührenden Vortrag.«
»Einen Vortrag?« Er wirkte amüsiert. »Für einen einzigen Zuhörer. Kannst du nicht einmal etwas tun, ohne mit einem Zeigestock und einem Stapel Schaubilder zu wedeln?«
»Für zwei Zuhörer«, berichtigte ich. »Ich muss wohl auch Ariadne einladen, oder nicht?«
»Falls du es nicht tust, wäre sie sicher verärgert.«
Ich stach mit dem Messer in die Butter und bestrich meinen Toast mit unnötig schroffen Bewegungen. Ariadne ist die älteste Tochter meines Bruders. Zum Sommersemester kam sie von tiefer Liebe für die Dryadologie beseelt nach Cambridge, was mein Bruder wie erwartet der umfangreichen Liste von Dingen hinzufügte, die er mir verübelt. Mit ihren gerade mal neunzehn Jahren ist sie bei weitem die klügste Studentin, die ich je unterrichtet habe, und sichert sich mit beeindruckendem Eifer, was sie will, sei es eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft, abendliche Tutorien oder Zugang zu jenem Teil der Bibliothek der Dryadologie, der eigentlich den Dozenten vorbehalten ist und in dem wir unsere besonders seltenen Texte aufbewahren, von denen die Hälfte verzaubert ist. Ich fürchte jedoch, manche ihrer Erfolge hängen weniger mit ihrer Überzeugungskraft zusammen und eher mit ihrer Angewohnheit, mich immer wieder an ihren regen Briefwechsel mit Thomas zu erinnern. So sehr ich mir auch einrede, es kümmere mich kein bisschen, was mein Bruder – zwölf Jahre älter als ich und mein genaues Gegenteil – über mich denkt, schiebt sich doch immer wieder sein missbilligendes Gesicht vor mein geistiges Auge, wenn sie ihre Korrespondenz erwähnt, und alles in allem würde ich es vorziehen, ihm nicht noch weitere Punkte für seine Liste zu liefern.
»Geht es um meine Tür?« Eine fast kindliche Hoffnung brachte Leben in Wendells abgespanntes Gesicht.
»Natürlich«, sagte ich. »Ich bedaure nur, dass es so lange gedauert hat, eine brauchbare Theorie zu entwickeln. Morgen werde ich alles enthüllen. Ich muss nur noch ein paar Einzelheiten näher bestimmen – außerdem hast du heute Nachmittag zwei Vorlesungen.«
»Erinnere mich nicht daran.« Er stützte wieder die Stirn in der Hand. »Wenn ich sie überstanden habe – falls ich sie überstehe –, gehe ich nach Hause und vergrabe mich in Kissen, bis dieses verdammte Hämmern aufhört.«
Ich stupste die Schale mit den Orangen in seine Richtung. Er hatte wenig gegessen, was ihm gar nicht ähnlich sah. Er nahm eine, schälte sie, betrachtete sie einen Moment und legte sie dann weg.
»Hier«, sagte ich und gab ihm meinen gebutterten Toast. Wenigstens den konnte Wendell herunterwürgen, und es schien seinen Magen halbwegs zu beruhigen, so weit, dass er sich über die Eier hermachen konnte, die ich auf seinen Teller schaufelte.
»Wo wäre ich ohne dich, Em?«
»Wahrscheinlich würdest du immer noch auf der Suche nach deiner Tür durch Deutschland tingeln«, sagte ich. »Währenddessen könnte ich ruhiger schlafen, weil mir nicht der Heiratsantrag eines Feenkönigs auf der Seele liegen würde.«
»Deine Seele wäre befreit, wenn du annehmen würdest.« Er legte eine Hand auf meine und strich neckend mit dem Daumen über meine Fingerknöchel. »Soll ich einen Aufsatz über das Thema schreiben? Ich kann dir eine umfangreiche Liste von Gründen erstellen, warum du einwilligen solltest.«
»Das kann ich mir vorstellen«, bemerkte ich trocken. Gänsehaut kroch meinen Arm hinauf. »Und wie würde der erste lauten? Dass ich in den Genuss von unentwegt sauberen Böden und staubfreien Bücherregalen kommen würde und dazu einer endlosen Litanei, ich solle besser Ordnung halten?«
»Ah, nein. Er würde lauten, dass unsere Ehe dich davon abhalten würde, in die Wildnis zu ziehen und andere Feenkönige heiraten zu wollen, ohne dich zu vergewissern, ob sie aus Eis bestehen.«
Ich griff nach seiner Tasse – ich wollte ihm den Kaffee nicht tatsächlich in den Schoß gießen, allerdings hätte man es mir nicht vorwerfen können, wäre mir die Tasse aus der Hand geglitten –, aber er hatte sie schon weggezogen. Seiner schnellen Bewegung hatte ich mit meinen sterblichen Reflexen nichts entgegenzusetzen.
»Das ist unfair«, beschwerte ich mich, aber er lachte mich nur aus.
Wir haben uns angewöhnt, über seinen Heiratsantrag Scherze zu machen, obwohl es ihm immer noch ernst ist, wie er mir unzählige Male versichert hat. Ich dagegen wünschte, ich könnte die Angelegenheit wirklich mit Humor betrachten – sie bringt mich bisweilen um den Schlaf. Es verdreht mir den Magen, während ich das hier auch nur aufschreibe, und generell vermeide ich so gut wie möglich, über die Sache nachzudenken, damit ich nicht in leise Panik verfalle. Zum Teil liegt es wohl daran, dass ich mich bei der Vorstellung, überhaupt zu heiraten, am liebsten in die nächste Bibliothek zurückziehen und mich zwischen den Bücherstapeln verstecken würde; die Ehe erschien mir immer als sinnloses Unterfangen, bestenfalls als Ablenkung von meiner Arbeit und schlimmstenfalls als sehr große Ablenkung von meiner Arbeit gepaart mit einem Leben voll ermüdender gesellschaftlicher Verpflichtungen.
Gleichzeitig bin ich mir völlig im Klaren darüber, dass ich Wendell schon vor langem hätte abweisen müssen und dass es grausam ist, ihn hoffen zu lassen. Ich will zu Wendell nicht grausam sein; wenn ich nur daran denke, befällt mich ein seltsames, unangenehmes Gefühl, als würde die Luft aus meinem Körper gepresst. Nur müsste man tatsächlich eine ausgemachte Idiotin sein, um einen Angehörigen des Kleinen Volks zu heiraten. Es gibt höchstens eine Handvoll Geschichten von solchen Verbindungen, die ein gutes Ende nehmen, und ein ganzer Berg von ihnen endet mit Wahnsinn oder einem vorzeitigen und unschönen Tod.
Außerdem ist mir natürlich in jedem wachen Moment bewusst, wie absurd es ist, dass ein Feenkönig mir einen Antrag gemacht hat.
»Gib mir wenigstens einen Tipp«, bat er, nachdem wir uns ein paar Minuten lang unserem Essen gewidmet hatten.
»Nicht, bevor du mit deinem Aufsatz angefangen hast.«
»Ich weiß es ja zu schätzen, dass sich deine Gedanken nur darum drehen, mich zu heiraten«, sagte er, »aber ich meinte deinen Durchbruch. Hast du eingegrenzt, wo sich meine Tür befinden könnte?«
»Ah.« Ich ließ meinen Crêpe sinken. »Ja. Allerdings bin ich bei meiner Recherche auf viele Orte gestoßen, die in Frage kämen, deshalb könnte man eher sagen, dass ich einen ausgemacht habe, der besonders vielversprechend wirkt. Wie gut kennt du die Arbeit von Danielle de Grey?«
»De Grey? Nicht besonders gut. Hatte eine rebellische Ader; verschwand vor Jahrzehnten, als sie in irgendein Feenreich geriet. Ihre Forschung ist größtenteils diskreditiert worden, oder?«
»Sie wurde diskreditiert. Sie wurde in vier Ländern verhaftet, im bekanntesten Fall hatte sie ein Feenschwert vom Anwesen eines französischen Herzogs gestohlen. Damit hat sie einen Fluch aufgehoben, der auf der Familie lag, und er hat ihr nicht mal dafür gedankt. Ich fand ihre Forschung immer vorbildlich. Es ist eine Schande, dass sie nicht mehr zitiert wird. Ich habe es einmal versucht, als Doktorandin, aber meine Betreuerin hat mir klargemacht, dass es unklug wäre.«
»Keine große Überraschung. Wissenschaftler sind eine konservative Bande. De Grey klingt, als wäre sie dafür viel zu unterhaltsam gewesen.«
»Sie hatte bahnbrechende Ideen. Sie war felsenfest überzeugt, dass die Feen aus verschiedenen Regionen engeren Kontakt pflegen, als die Wissenschaftler vermuten – damals nannte man es die Handelswegetheorie. Sie hat ein Klassifizierungssystem entwickelt, das heute noch nützlich wäre, wenn es sich etabliert hätte. Als sie verschwand, untersuchte sie gerade eine Unterart der Faune.«[1]
Wendell verzog das Gesicht. »Ich hasse Faune – in meinem Königreich leben auch welche. Bösartige kleine Biester – und dabei nicht mal interessant. Ich weiß nicht, warum Dryadologen so viel Aufhebens um sie machen. Was in aller Welt haben sie mit meiner Tür zu tun?«
Ich beugte mich vor. »In deinem Königreich leben sogar verschiedene Arten von Faunen, oder?«
Er seufzte. »Jetzt frag mich nicht nach den Namen, ich flehe dich an. Ich meide diese Wesen, so gut es geht.«
Ich zog ein Buch aus meiner Tasche – in meinem Rucksack hatte ich natürlich nichts weiter verstaut, falls der Fuß versuchen sollte herauszuhüpfen, sobald ich die Klappe öffnete. Ich schlug die markierte Seite auf und gab es Wendell. »Erkennst du ihn?«
»Sie«, korrigierte Wendell geistesabwesend, während er die Zeichnung betrachtete. Die grobe Skizze zeigte ein haariges Wesen mit Ziegenbeinen und Hufen – viele Faune wechseln zwischen einem aufrechten Gang und einer Art gebücktem Schlingern wie ein Menschenaffe. Aus dem Kopf des Fauns ragten zwei majestätische Hörner, so spitz wie Messerklingen. »Ja. Sie leben in den Bergen östlich von meinem Schloss.«
»De Grey hat sie Baumfaune genannt – nicht, weil sie im Wald leben, sondern weil ihre Hörner mit ihren feinen Details an Baumringe erinnern. Das kommt nur bei dieser Spezies vor.«
Ich nahm ihm das Buch aus der Hand, bevor er die Bildunterschrift lesen konnte – ich wollte ihn morgen überraschen. Er schien es zu erraten und lächelte.
»Mehr bekomme ich heute nicht, oder? Eine Geschichte über eine in Misskredit geratene Wissenschaftlerin und einen Vortrag über gemeine Feen? Dabei hältst du mir ständig vor, ich sei ein Geheimniskrämer.«
»Wer zehn Jahre lang erfolglos eine schlichte Feentür gesucht hat, kann sicher noch einen Tag länger warten, ohne zu murren«, sagte ich merklich selbstgefällig. »Reich mir mal den Tee.«
Er nahm die Kanne und schenkte mir ein. Ich erstarrte.
»Was ist?«, fragte er und stellte die Kanne ab. Wortlos zeigte ich auf die Tasse. Mein Tee war bläulich-schwarz, und auf der Oberfläche schwammen winzige Seerosenblätter, die perfekte weiße Knospen umhüllten. Schatten huschten über das Wasser, als hinge darüber ein dunkles Blätterdach, durch das dünne Sonnenstrahlen drangen.
Wendell fluchte. Er griff nach der Tasse, aber ich hatte schon die Hände darumgelegt. »Blühen sie gerade auf?«, fragte ich. Tatsächlich, während ich zusah, öffnete sich eine weitere Blüte, ihre Blätter wiegten sich in einem Wind, der nicht dem ruhigen Wetter in Cambridge entsprang. Ich konnte den Blick nicht abwenden.
Das eigentümliche Gebräu roch himmlisch, wie Tee und doch ganz anders, bitter und blumig. Ich neigte die Tasse, um einen Schluck zu trinken, aber plötzlich bedeckte Wendells Hand den Tassenrand – er besaß die befremdliche Gabe, sich so schnell zu bewegen, dass meine sterblichen Augen ihm nicht folgen konnten. »Nicht«, sagte er und drückte die Tasse herunter.
»Gift?«
»Natürlich nicht. Es ist nur Tee. Wie er üblicherweise an meinem Hof zum Frühstück serviert wird.«
»Ah.« Sterbliche sollten grundsätzlich im Feenreich nichts zu sich nehmen – vor allem keinen Feenwein, der den Menschen ihre Hemmungen nimmt. Wer sich auf eine Festlichkeit der Feen locken lässt und etwas trinkt, tanzt meist, bis er stirbt oder die Feen seiner überdrüssig werden, was oft auf dasselbe hinausläuft.
»Im Moment bin ich nicht in der Stimmung, um zu tanzen«, sagte ich. »Danke, dass du meinen Tee verdorben hast.«
»Das war natürlich keine Absicht. Ich wollte nicht –« Stirnrunzelnd schüttelte er den Kopf.
Ich kippte den Tee auf den Rasen – zumindest den aus der Kanne; die Tasse hielt Wendell immer noch in der Hand. »Ich habe noch nie gesehen, dass du deine Magie nicht im Griff hattest. Hast du gerade an zu Hause gedacht?«
»Nicht mehr als sonst.« Er nippte am Tee, schloss kurz die Augen und zuckte dann mit den Schultern. »Wahrscheinlich eine Folge meines Katers.«
Ich beobachtete ihn nachdenklich. Er winkte einen Kellner heran und bestellte frischen Tee. Dann wandte sich unser Gespräch einer vertrauten Diskussion über die Fakultätspolitik zu. Normalerweise interessiert sich Wendell kaum für dieses Thema, aber weil er mit seinem Charme andere leicht dazu bringen kann, ihn ins Vertrauen zu ziehen, ist er trotzdem eine hervorragende Quelle für Klatsch und Tratsch. Zurzeit wetten wir alle darauf, wie wohl die anhaltende Fehde zwischen den Professoren Clive Errington und Sarah Alami ausgehen wird, die wegen eines falsch abgestellten Teetabletts im Dozentenzimmer ausgebrochen war und sich zu Vorwürfen professioneller Sabotage ausgeweitet hatte. Alami ist überzeugt davon, dass Errington ihren Spiegel mit dem darin gefangenen Feenlicht zerschlagen hat, während Errington glaubt, Alami sei ihm in die Wilshire Downs gefolgt und habe für die Brownies, die er untersucht, schimmelige Scones ausgelegt, was diese angeblich tief beleidigt habe.
»Entschuldigung?«
Ich drehte mich um und sah direkt neben mir eine junge Wissenschaftlerin mit einem zögerlichen Lächeln auf dem geröteten Gesicht. »Es tut mir leid, Sie zu stören, Professor. Ich nehme an einer Ihrer Vorlesungen teil – Dryadologie der frühen Neuzeit?«
»Ah, ja«, sagte ich, obwohl ich sie nicht einordnen konnte. Nun ja, in dieser Vorlesung sitzen immerhin mehr als hundert Studenten.
»Sie finden es sicher albern.« Sie drückte ihr Buch noch fester an sich – es war meine im Sommer erschienene Enzyklopädie der Feen. »Aber ich wollte Ihnen sagen, wie inspirierend ich Sie finde. Ich bin hergekommen, um Architektur zu studieren, wissen Sie – na ja, meine Eltern wollten es so. Aber jetzt habe ich mich Ihretwegen entschieden, einen Abschluss in Dryadologie zu machen, so wie ich es immer wollte.«
»Es freut mich, dass ich Sie inspiriert habe. Aber dieser Beruf ist weder leicht noch sicher.«
»Oh, das weiß ich«, sagte die junge Frau mit strahlenden Augen. »Aber ich …«
Ihr Blick fiel auf Wendell, der seinen Stuhl nach hinten gekippt hatte und mich lächelnd ansah, und sie schien zu vergessen, was sie sagen wollte. Zuerst dachte ich, sie habe sich nur von seinem Äußeren ablenken lassen – das ist nicht ungewöhnlich, selbst bei Menschen, die ihn gut kennen. Wenn es nur um sein Aussehen ginge, könnte man sich wahrscheinlich daran gewöhnen, aber Wendell strahlt eine – ich kann es nicht besser ausdrücken – eine Lebendigkeit aus, die sich kaum übersehen lässt. Man kann sie nur schwer beschreiben, und vielleicht ist sie allen Feenherrschern eigen; ich weiß es nicht. Er hat eine bestechende Präsenz, die Aufmerksamkeit erregt.
Erst als ihr Blick zu mir zurückhuschte, erkannte ich es. In ihrem Ausdruck lag etwas, das mir auch bei den Bewohnern von Hrafnsvik aufgefallen war. Ich presste die Lippen zusammen.
Die junge Frau bedankte sich bei mir und verabschiedete sich eilig. Stirnrunzelnd wandte ich mich Wendell zu.
»Was ist?«, fragte er.
»Ich glaube, die Gerüchte über dich haben Cambridge erreicht«, sagte ich.
»Ach, große Güte.«
In Hrafnsvik hatten die Dorfbewohner gewusst, wer Wendell wirklich war – es hatte sich nicht vermeiden lassen. Wendell und ich hatten uns deswegen keine allzu großen Sorgen gemacht – es war ein kleines, abgelegenes Dorf, und wir nahmen an, dass sich sein Geheimnis leicht würde bewahren lassen.
Er schloss die Augen und rieb sich den Nasenrücken. »Wie ist es dazu gekommen?«
»Keine Ahnung. Aber wir leben in einer modernen Welt, Wendell. Der Dekan hat jetzt ein Telefon in seinem Büro stehen. Nicht, dass er es benutzen könnte …«
Er griff nach der Kaffeekanne, und ich erkannte, dass ich seine Reaktion falsch gedeutet hatte – er machte sich überhaupt keine Sorgen, nur sein Kater setzte ihm noch zu. »Tja.«
»Tja?«, wiederholte ich. »Wir wissen nicht, wie viele dieses Gerücht gehört haben, und auch nicht, wie viele es glauben. Wir sollten es lieber ernst nehmen. Zumindest musst du von jetzt an vorsichtiger sein. Du siehst dich nicht immer vor – ich bin nicht der einzige aufmerksame Mensch auf diesem Planeten, weißt du. Und das war hoffentlich die letzte Kanne Tee, die du versehentlich verzaubert hast.«
»In der Fakultät würde es niemand glauben«, sagte er. »Kannst du dir das vorstellen? Sie würden sich wie leichtgläubige Trottel vorkommen. Und du weißt, dass sie alles tun würden, um das zu vermeiden.«
»Das weiß ich nicht«, sagte ich. »Du hast viele Feinde. Einige von ihnen würden dich mit Vorliebe als Bösewicht hinstellen, und ich glaube, ein Gerücht, dass du herzlose Feenspielchen mit uns treibst, um uns alle lächerlich aussehen zu lassen, würde sich dazu bestens eignen. Wir dürfen unsere Finanzierung nicht verlieren, Wendell. Wir brauchen sie, wenn wir deine Tür finden wollen.«
»Das ist alles gar nicht gut für meine Kopfschmerzen.« Er nahm meine Hand. »Es ist nicht schlimm, Em. Es ist nur ein Gerücht. Man könnte fast glauben, dir sei mehr als mir selbst daran gelegen, meine Tür zu finden!«
»Das dürfte kaum möglich sein.« Immerhin klagt er ständig über Heimweh.
»Nein, wahrscheinlich nicht.«
Ich zog meine Hand zurück, die sich überhitzt anfühlte. »Natürlich ist mir deine Tür wichtig. Sie gehört zu den interessantesten Rätseln, die mir in meiner Karriere begegnet sind, und ich bin fest entschlossen, es zu lösen. Du kennst mich doch.«
Er lächelte. »Ja. Allerdings.«
Kurz danach ließ er mich am Tisch allein, um vor seiner ersten Vorlesung ein Nickerchen von etwa einer Stunde zu halten, das hoffentlich seine Kopfschmerzen lindern würde. Ich blieb bei Tee und Toast sitzen und schrieb an meinem Brief an Lilja und Margret weiter. Ich korrespondiere regelmäßig mit den beiden, ebenso wie mit Aud und – sporadischer – mit Thora. Ich stellte mir vor, wie Lilja den Brief vor dem Kamin in dem kleinen Häuschen öffnete, in dem sie mit Margret lebte – sie würden zweifellos schon an den Winter in Hrafnsvik denken.
Lilja und Margret bekunden nach wie vor großes Interesse an Wendells Heiratsantrag und fragen in jedem Brief, ob ich eine Entscheidung getroffen habe. Anfangs antwortete ich mit vagen Andeutungen, warum es unklug sei, einen Angehörigen des Kleinen Volks zu heiraten, aber als ihre Fragen nicht aufhörten, ignorierte ich sie am Ende einfach. Ich vermisse beide und wünschte mir, ich könnte sie wiedersehen – vor allem mit Lilja konnte ich immer ganz ungezwungen plaudern.
Meine Sorgen schwanden, als ich mich mit Shadow an meiner Seite auf den Rückweg zum Büro machte. Ich schwebe in einer Wolke der Zufriedenheit, seit mir meine Anstellung auf Lebenszeit gewährt wurde – ein Höhepunkt einer jeden akademischen Karriere, aber für mich umso mehr, weil Cambridge die einzige Heimat ist, die ich je wirklich gekannt habe. Die uralten Gemäuer strahlen jetzt eine freundliche Aura aus, die Gehwege unter meinen Füßen wirken angenehmer.
Als ich so weiterschlenderte und an den Stapel Arbeiten auf meinem Schreibtisch dachte, die ich noch benoten musste, fiel mir ein, warum mir der finstere Blick des Mannes mit den Bändern so vertraut vorgekommen war. Denselben Blick hatte ich unzählige Male von älteren Professoren geerntet, oft nachdem ich ihnen in wissenschaftlichen Fragen widersprochen hatte. Aus diesem Blick sprach pure Enttäuschung, die ich so nur von Wissenschaftlern kannte, und das würde meine Reaktion erklären – einen kurzen Moment lang hatte ich mich wie eine Studentin gefühlt, die vergessen hatte, ihre Texte zu lesen.
»Hm«, sagte ich wieder, als ich die Begegnung in Gedanken noch einmal durchspielte und sie aus neuen Blickwinkeln betrachtete. Aber weil ich aus diesem Rätsel nicht schlauer wurde, schob ich es zunächst beiseite.
Fußnoten
[1]
Trotz der Einwände von Evans (1901), Blanchet (1904) und anderen ist »Faun« weiterhin die anerkannte Bezeichnung für alle Arten gemeiner Feen mit Hufen, ungeachtet ihrer Größe oder Herkunft. Sie gehört zu einer Reihe von Begriffen, deren Ursprung sich bis zu den Wurzeln der Dryadologie im Griechenland des frühen 17. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt.
14. September – Abend
Tja.
Ich weiß nicht recht, womit ich anfangen soll.
Das Naheliegendste wäre wohl der scheußliche Vorfall im Vorlesungssaal, aber meine Gedanken huschen vor ihm davon wie Fische vor einem Schatten, der aufs Wasser fällt. Ich begreife nicht, wie Wendell nach so etwas schlafen kann, und doch liegt er nebenan und schnarcht friedlich. Andererseits passt es zu ihm, dass er seinem Kater mehr Aufmerksamkeit widmet als einem Mordversuch.
Als ich nach dem Frühstück in mein Büro zurückkehrte, wartete Ariadne schon auf mich. Ich hatte einen Umweg über das Museum für Dryadologie und Ethnofolklore gemacht, um mir einige Präpariernadeln zu leihen und sie in den verflixten Fuß zu stecken, der mittlerweile alle paar Sekunden zuckte. Die Nadeln waren aus Eisen gefertigt und ihre Köpfe aus alten Pennys – viele Feen verabscheuen sowohl Metall als auch menschliches Geld, deshalb können die Nadeln einen etwaigen Nachhall von Verzauberungen in Feenartefakten unterdrücken. Aber die Kuratorin – eine Dr. Hensley – bedachte mich nur mit einem unheilvollen Blick und ließ mich wissen, die Nadeln seien fast ausgegangen. Wir sind uns nicht gerade freundschaftlich verbunden, Dr. Hensley und ich. Sie hat es mir schwer verübelt, dass ich kürzlich ein bestimmtes Artefakt für Shadow ausleihen wollte, und erklärt, das Museum sei keine »Bibliothek, die gelangweilten Wissenschaftlern zum Zeitvertreib dient«. Nichts stellt meine Geduld so sehr auf die Probe wie jemand, der Bibliotheken beleidigt, und so waren wir nach einem knappen Wortgefecht im Bösen auseinandergegangen. Wahrscheinlich sollte ich mich glücklich schätzen, dass ich nicht mit einer Salve aus Staubtüchern aus dem Museum gejagt wurde.
»Geht es dir gut?«, erkundigte sich meine Nichte, als ich in gründlich verhagelter Stimmung in mein Büro stürmte. Ich bejahte, trotzdem lief sie los, um mir einen Tee aus dem Aufenthaltsraum zu holen, obwohl ich ihr nachrief, das sei nicht nötig.
Ariadne sieht meinem Bruder recht ähnlich, sie hat ein rundes Gesicht mit einer langen, von Sommersprossen übersäten Nase und dazu die haselnussbraunen Augen und den hellbraunen Teint ihrer Mutter. Im Gegensatz zu meinem wortkargen Bruder strotzt Ariadne allerdings auf ermüdende Art vor Energie. Das wäre nicht weiter schlimm, würde sie nicht ständig um mich herumwieseln, weil sie sich selbst zu meiner Assistentin ernannt hat, was ich nie erbeten oder gewollt habe.
»Haben nicht alle Wissenschaftler deines Rangs Assistenten?«, fragte sie mich einmal mit einem Blick voll treuherziger Bewunderung. Ich konnte zur Antwort nur etwas stammeln und wünschte mir, mein Ego ließe sich nicht so leicht einwickeln. Ehrlich gesagt gibt es Momente, in denen mich ihre Anwesenheit doch nicht stört.
»Hast du die Spengler’schen Landkarten gefunden?«, fragte ich sie, als sie zurückkehrte, und ignorierte den Tee, zu dem sie mir einen Teller meiner Lieblingskekse mitgebracht hatte. Mein schroffes Benehmen konnte ihrem scheinbar unerschöpflichen Frohsinn nichts anhaben, und so holte sie ihre Aktentasche und zog eine Mappe mit zwei sorgfältig zusammengefalteten Bögen Pergamentpapier heraus.
»Danke«, sagte ich widerwillig. Ich hatte nicht erwartet, dass sie die Karten so schnell finden würde. »Dann lagen sie wirklich in einem der Stapel im Keller versteckt?«
Sie schüttelte den Kopf. »Sie waren in die Geschichtsbibliothek gebracht worden – auf die Etage für germanische Kulturen. Ich musste mit einem halben Dutzend Bibliothekare sprechen, aber als ich es erst einmal herausgefunden hatte, waren die Karten leicht zu finden.«
»Ah.« Insgeheim war ich beeindruckt. Ariadne könnte die fähigste Studentin sein, die ich je unterrichtet habe. Was schon an sich ein Ärgernis ist – wäre sie offensichtlich unfähig, hätte ich eine Ausrede, um sie loszuwerden.
»Möchtest du sie sehen?«, fragte sie. Vor Aufregung wippte sie leicht auf und ab, wie ein Kind, und ich musste mich zusammenreißen, um ihr nicht auf den Fuß zu treten, damit sie sich zügelte.
»Leg sie hierhin.«
Sie breitete die Karten auf dem Schreibtisch aus und beschwerte die Ecken mit einigen meiner Feensteine. Ich strich mit beiden Händen über das alte Pergament – die Karten waren nicht die Originale, sondern Kopien, die Klaus Spengler in den 1880er Jahren angefertigt hatte. Die Originale, mittlerweile verschwunden oder in den Untiefen irgendeines Universitätsarchivs verlegt, waren vor über fünfzig Jahren von Danielle de Grey angefertigt und nach ihrem Verschwinden 1861 bei ihren persönlichen Dingen entdeckt worden.
Als ich die Karten berührte, blieb mein Blick wie so häufig am fehlenden Finger meiner linken Hand hängen. Wendell hatte angeboten, einen Blendzauber zu wirken, der so lebensecht war, dass mir kaum ein Unterschied zu vorher auffallen würde, aber ich hatte abgelehnt. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht, damit mir die leere Stelle als Erinnerung – und Warnung – dienen kann. Wendell behauptet, ich würde sie als makabres Andenken an meine Zeit am Hof eines Feenkönigs behalten wollen, eine Erfahrung, derer sich nur wenige Wissenschaftler rühmen können. Dem widerspreche ich nachdrücklich, auch wenn eine leise Stimme in mir fragt, ob er nicht recht haben könnte.
Die erste Karte zeigte eine Bergregion aus der Vogelperspektive. Als einzige Siedlung war ein kleines Dorf mit der Beschriftung St. Liesl eingezeichnet, das auf einer Hochebene zwischen den Gipfeln lag. Auf der zweiten Karte sah man die Umgebung des Dorfs mit vielen weiteren beschrifteten Einzelheiten wie Pfaden, Flüssen, Seen und vermutlich geographischen Besonderheiten – mein Deutsch ist eingerostet.
»Ich kann es immer noch kaum glauben.« Ariadnes Worte ließen mich zusammenzucken – ich hatte nicht bemerkt, dass sie sich so nah heruntergebeugt hatte. »Danielle de Grey hat diese Karten gezeichnet. Danielle de Grey!«
Meine Mundwinkel zuckten. Bei der crème de la crème der Dryadologie mochte de Grey nicht in hohem Ansehen stehen, aber bei den jüngeren Wissenschaftlern war sie durch ihr ehrfurchtsloses Wesen und das Rätsel um ihr Verschwinden zu einer Volksheldin geworden.[1]
»Werden wir herausfinden, was mit ihr geschehen ist?«, fragte Ariadne mit gedämpfter Stimme.
»Das ist durchaus möglich«, antwortete ich ausweichend und faltete die Karten zusammen.
»Wann brechen wir auf?«
»Sobald Wendell und ich alles vorbereiten können. Hoffentlich noch in diesem Monat.«
Shadow schnaubte leise. Er saß im Eingang und fixierte mit dem Blick eine Stelle den Flur hinunter – die Tür zu Wendells Büro. Ich dachte daran, wie er während des gesamten Frühstücks an Wendells Bein gelehnt und sich nicht einmal gerührt hatte, um zu betteln. Dabei verbanden sich mehrere Momente und halbfertige Gedanken zu einem beunruhigenden Muster.
»Ariadne«, sagte ich, »wann hast du gestern Abend das Pub verlassen?«
Sie verzog das Gesicht. »Spät, fürchte ich. Beim Aufwachen hatte ich ziemliche Kopfschmerzen, aber zum Glück habe ich meine morgendlichen Exerzitien. Davon werde ich immer munter, egal, wie der Abend war. Zuerst drehe ich eine schnelle Runde ums Tenant’s Green. Danach mache ich meine Atemübungen, die –«
»Warst du den ganzen Abend in Wendells Nähe? Dr. Bamblebys, meine ich.«
»Den größten Teil.« Sie überlegte. »Allerdings war es an unserem Tisch recht voll. Nach einer Weile habe ich mich zu seinen Doktoranden gesetzt, um den Professoren Platz zu machen.«
»Und kanntest du jeden in der Gruppe? Waren nur Dozenten und Studenten da, oder hat ihm auch jemand gratuliert, der nicht zur Universität gehörte?«
»Na ja – das weiß ich nicht genau. Die meisten waren aus der Dryadologischen Fakultät, und es waren einige Bibliothekare und Professoren für Kunstgeschichte da, mit denen Dr. Bambleby befreundet ist. Aber am späteren Abend sind einige aufgetaucht, die ich nicht kannte.«
»Kannte Dr. Bambleby sie?«, fragte ich.
Sie lachte. »Ich bin nicht sicher, dass er mich am Ende des Abends noch gekannt hat. Die meisten von uns waren in einem ähnlichen Zustand. Es war eine großartige Geburtstagsfeier.«
Ich trommelte mit den Fingern auf den Tisch und überlegte, Wendell zu Hause einen Besuch abzustatten – aber warum sollte das nötig sein? Um bei ihm nach dem Rechten zu sehen? Bei einem Feenkönig?
Bevor ich mich dafür oder dagegen entscheiden konnte, erklangen Schritte auf dem Flur. Äußerst energische Schritte, begleitet von ebenso energischen, leicht schnaubenden Atemzügen. Shadow knurrte, und ich rechnete fast damit, dass gleich eine schauderhafte Fee in mein Büro stürmen würde, aber Ariadne raunte schnell: »Das wird der Dekan sein – er hat dich vorhin schon gesucht. Ihm brennt was auf den Nägeln –« Sekunden später platzte tatsächlich der Dekan in mein Büro.
Dr. Farris Rose dient seit mehr als zehn Jahren als Dekan. Er hat den Posten von Letitia Barrister übernommen, die auf den Hebriden von einem Bogle entführt worden und mehrere Wochen später auf etwa neunzig Jahre gealtert zurückgekehrt war (bei ihrem Verschwinden war sie achtundvierzig gewesen). Rose ist ein korpulenter Mann mit einem mähnenhaften weißen Haarkranz um die Halbglatze und von unbestimmbarem Alter – unter Dryadologen eine verbreitete Eigenschaft –, was in diesem Fall irgendwo zwischen fünfzig und Ende siebzig bedeutete. Selbst unter Wissenschaftlern gilt er als exzentrisch, weil er darauf besteht, seine Kleidung allzeit auf links gedreht zu tragen – was zwar nützlich ist, um der Aufmerksamkeit des Kleinen Volks zu entgehen und ihre Zauber zu stören, aber es allgemein so zu halten, gilt doch als etwas ungeschliffen – und so viele Münzen in den Stoff zu nähen, dass er bei jeder plötzlichen Bewegung klimpert. Tätowierungen, angeblich in der Form von Schutzsymbolen, ziehen sich von seinen Handgelenken bis wer weiß wohin – ich habe sie noch nie entblößt gesehen, und über ihren Endpunkt wird unter den Studenten und teils auch den Dozenten lebhaft spekuliert. Seine Beiträge zur Forschung sind umfangreich und anerkannt – immerhin hat er die Sandstone-Theorie[2] aufgestellt –, aber er hat kaum Freunde, und Gerüchten zufolge wurde er nur widerstrebend zum Dekan ernannt, weil niemand, der ihm ebenbürtig war, den Posten haben wollte. Aber auch das ist nicht besonders bemerkenswert; eine deutliche Mehrheit der Dryadologen lebt wie Katzen, wachsam und feindselig beäugt man sich gegenseitig.
Es war sofort offensichtlich, dass Rose tatsächlich eine Laus über die Leber gelaufen und ich irgendwie daran schuld war. Bei meinem Anblick schien es ihm im ersten Moment die Sprache zu verschlagen, und so knallte er wortlos ein großes Buch auf meinen Schreibtisch und stieß damit das Teetablett herunter. Ariadne schrie leise auf und lief hin, um die Scherben aufzulesen.
»Was in aller Welt –!«, setzte ich an.
»Wo steckt er?«, fragte Rose. Seine blasse Haut war gerötet. »Sie beide sind doch wie Pech und Schwefel.«
»Ich habe keine Ahnung«, entgegnete ich frostig, weil er damit natürlich nur einen meinen konnte. Dann besann ich mich, nicht zuletzt wegen Roses Position, und fügte ruhiger hinzu: »In etwa einer Stunde hat er eine Vorlesung; vielleicht erwischen Sie ihn noch, bevor –«
»Schon gut«, unterbrach er mich. Was ich zuerst für Wut gehalten hatte, erkannte ich jetzt als selbstgerechten Triumph. »Vielleicht ist es besser so. Schließlich müssen wir Sie beide ohnehin jeden für sich rauswerfen.«
Ich erstarrte. Das einzige Geräusch kam von den Scherben der Teetasse, die Ariadne auf das Tablett legte – klirr, klirr, klirr. »Was?«
»Nicht sofort«, gab er widerwillig zu. »Ich muss noch meine Beweise zusammentragen und sie dem Lehrkörper vorlegen. Aber ich werde für morgen eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Die anderen werden meinen Schlussfolgerungen zweifellos zustimmen.«
Ich fühlte mich, als würde mich eine starke Strömung immer weiter hinaus aufs Meer ziehen. Zu allem Übel war mein Verstand wie leergefegt – all meine sorgsam geordneten Gedanken und Theorien hatten mich verlassen. »Ich bin unkündbar – Sie können nicht –«
»Sind Sie wirklich so einfältig?« Seine Stimme klang derart verächtlich, dass ich mich auf meinem Stuhl nicht rühren konnte. »Natürlich können wir Sie rauswerfen, wenn es Beweise für Fehlverhalten gibt. Und wie gesagt – ich habe Beweise.«
Mit einer Kopfbewegung deutete er auf das Buch, das ich völlig vergessen hatte. Ich schlug es mit zitternden Händen auf. Es waren gebundene Zeitschriftenbände – Theorie und Praxis der Dryadologie, Jahrgang 17 von 1908. Mir fiel auf, dass Rose zwei Artikel markiert hatte. Sie stammten von Wendell.
Ich stöhnte innerlich. »Es geht um die Schwarzwaldexpedition.«
»Nein«, sagte er. »Ich konnte keine überzeugenden Beweise finden, dass er seine Beobachtungen in diesem Fall gefälscht hat. Wie die meisten erfolgreichen Scharlatane ist er geschickt darin, seine Spuren zu verwischen. Aber manchmal macht er doch Fehler.« Er tippte auf das Inhaltsverzeichnis und las vor: »›Hahn im Korb: Belege für Tierhaltung der Hausbrownies in den walisischen Marschen.‹ Darin behauptet er, einfache Hausfeen würden es übernehmen, Wölfe von den Schafen zu vertreiben – mit ihren Besen und Staubwedeln, nehme ich an? Ich habe mit den Bauern gesprochen, die er angeblich befragt hat – sie haben keine Probleme mit Wölfen, weil besagte Wölfe schon vor Jahrzehnten erschossen wurden. Und dieser Artikel über eine große Ansammlung von Feensteinen, die er in den Dolomiten aufgespürt hat und die beweisen sollen, dass dort eine Schlacht der höfischen Feen stattgefunden hat – er hat mehrere Steinmetze der Gegend bezahlt, um die Steine in einem bestimmten Muster aufzustellen. Die meisten sind meinen Fragen ausgewichen, aber das Gerücht machte unter den Dorfbewohnern die Runde, und irgendwann konnte ich einen davon überzeugen, zu reden.«
Ich schlug das Buch zu. Selbst in kleinen Dosen empfand ich Rose als einschüchternde Gestalt, und als er jetzt vor mir stand und mich finster musterte, musste ich um meine Stimme ringen. Sie klang dünn, verglichen mit Roses klangvollem Bariton, der mir für Podien und Hörsäle wie geschaffen schien. »Was hat das mit mir zu tun? Mein Name hat keine Verbindung zu einem dieser Artikel. Ich habe nicht behauptet, dass sie authentisch sind, und Sie sind einfältig, wenn Sie glauben, Sie könnten meine Karriere gefährden, weil ich mit jemandem befreundet bin.«
Er lächelte verkniffen. »Ich habe Ihre Abhandlung über das Kleine Volk von Ljosland gelesen, die Sie beide dieses Jahr unter so großem Rummel in Paris vorgestellt haben. Sie ist Humbug.«
Vor Empörung klappte mir die Kinnlade herunter. Die Wut war eine Erleichterung – viel besser als die nackte Panik, die mich zuvor befallen hatte. »Humbug? Wie können Sie es wagen –«
»Wie ich es wagen kann? Ihre Behauptungen sind derart aberwitzig, da kann ich nur staunen, dass Sie dachten, Sie würden damit durchkommen. Ein Wechselbalg, der sich wie ein Kobold benimmt? Feen, die so mächtig sind, dass sie das Nordlicht zur Erde herabziehen können? Blanker Unsinn.«
»Wenn Sie mit den Bewohnern des Dorfs Hrafnsvik sprechen, werden sie Ihnen berichten –«
»Ich muss mit niemandem sprechen. Es passt in das Muster, das wir von Bambleby kennen – abenteuerliche, unlogische Behauptungen, die von der bisherigen Forschung nicht gestützt werden.«
»Sie wollen mich rauswerfen lassen, weil Sie das Verhalten des Kleinen Volks unlogisch finden?« Ich musterte ihn von oben bis unten und fragte mich, wie ich diesen Mann je respektieren konnte. »Das machen Sie wegen meiner Enzyklopädie, oder?«
Seine Miene versteinerte. »Was Sie da andeuten, gefällt mir nicht, Emily.«
Ich lachte ungläubig. »Mir gefällt es nicht, wenn man mir berufliche Verfehlungen vorwirft.«
Seine Reaktion hatte meinen Verdacht bestätigt. Mir waren Gerüchte zu Ohren gekommen, dass Rose an einer eigenen Enzyklopädie des Kleinen Volks arbeitete – wie es hieß, soll das Projekt den Großteil seiner Laufbahn beansprucht haben. Er hatte es mir gegenüber nicht erwähnt, als mein Buch erschien, und auch davor nicht, aber seitdem ist unsere ohnehin unterkühlte Beziehung nahezu frostig geworden.
»Ich will nichts Ungehöriges andeuten«, sagte ich. »Deshalb spreche ich es einfach aus: Sie haben etwas gegen mich. Sie haben Jahre an Ihrer eigenen Enzyklopädie gearbeitet und sich an Kleinigkeiten festgebissen, wie Sie es immer tun, und geblendet von Ihrer Arroganz, haben Sie keinen Gedanken daran verschwendet, dass Ihnen jemand zuvorkommen könnte. Meinen Ruf zu ruinieren würde Ihnen helfen, nicht wahr? Mir ist oft aufgefallen, Sir, dass wir Wissenschaftler gern über das unmoralische Verhalten des Kleinen Volks den Kopf schütteln und doch bei zahlreichen Gelegenheiten beweisen, dass wir nicht auf dem hohen Ross sitzen sollten.«
»Das reicht.« Die Worte klangen so schneidend, dass ich zusammenzuckte. »Sie haben nicht die leiseste Ahnung, was Sie da reden. Statt die nötige Arbeit zu leisten, um sich hervorzutun, wollten Sie Ihre Karriere mit Täuschungen vorantreiben, und dafür werden Sie die Konsequenzen tragen.« Er wandte sich zum Gehen – recht dramatisch, fand ich, aber ich war nicht in der Stimmung, darüber zu schmunzeln. Ich hatte ein flaues Gefühl im Magen.
An der Türschwelle blieb er stehen. »Er hält heute also eine Vorlesung? Vielleicht sehe ich sie mir an.«
Jetzt wurde mir richtig schlecht. Die ranghöchsten Professoren beurteilen regelmäßig unsere Vorlesungen; was sie dort sehen, fließt in unsere jährliche Leistungsbewertung ein. Nur hatte Rose eindeutig etwas anderes im Sinn. Ich stellte mir vor, wie Wendell seine Studenten mit absurden Behauptungen unterhielt oder Grundwissen durcheinanderwarf, weil er sich nicht dazu herabließ, mal die Bücher aufzuschlagen, die er selbst als Lektüre aufgegeben hatte, oder wie Wendell seine Vorlesung gleich ganz schwänzte, um ein ausgedehntes Nickerchen zu machen. Alles schien möglich.
Rose lächelte leicht über meine Reaktion und marschierte davon; seine lächerliche, auf links gedrehte Jacke klimperte, als der Saum gegen meinen Türrahmen schlug. Ariadne hockte immer noch neben den Porzellanscherben und den verstreuten Keksen. Sie war blass, und einen langen Moment sahen wir uns nur totenstill an.
Wendell war nicht in seiner Wohnung, also musste er sich an einen seiner anderen Lieblingsorte für kurze Schläfchen zurückgezogen haben, entweder in den Schatten einer Weide am ruhigen Ende von Brigthwell Green oder auf die Bank im Pappelhain am Fluss. Ariadne und ich teilten uns auf, um an beiden Orten nachzusehen, aber er hatte sich entweder doch gegen das Nickerchen entschieden oder ein neues Versteck entdeckt, denn wir fanden keine Spur von ihm. Nach einigem sorgenvollen Zögern machte ich mich auf den Weg zum Hörsaal.
Wendells Vorlesung lief bereits, er musste also rechtzeitig begonnen haben – das beruhigte mich ein wenig, obwohl ich wusste, dass Pünktlichkeit allein ihn nicht retten würde. Als ich ganz hinten in dem Saal, der wie ein Amphitheater gebaut war, Platz nahm, bemerkte ich Rose in einem der unteren, vorderen Ränge, zurückgelehnt mit gezücktem Stift und Notizbuch, abwartend und boshaft. Seine ganze Haltung sprach von bösen Absichten – wäre Wendells Krawatte schief gewesen, hätte Rose es wahrscheinlich vermerkt und als Beweis gegen uns benutzt.
Und Wendell? Er bemerkte gar nicht, in welcher Gefahr er schwebte. Ohne die Notizen in seiner Hand groß zu beachten, lief er auf und ab und hielt einen Vortrag, in dem es um die Feenhügel auf den Kanalinseln zu gehen schien – ich sage schien, weil der Vortrag von zahlreichen Abschweifungen unterbrochen wurde, die durchaus einen Bezug aufwiesen, die ganze Geschichte allerdings recht wirr gestalteten. Ich hatte schon Vorlesungen von Wendell und natürlich seinen Vorträgen bei zahlreichen Konferenzen beigewohnt und weiß, dass er größeren Wert auf Stil als auf Inhalt legt, aber das erschien mir selbst für ihn strukturlos. Hin und wieder unterbrach er sich, um etwas an die Tafel zu schreiben, und warf danach die Kreide über seine Schulter.
»Entschuldigung, Professor«, rief eine junge Frau in der ersten Reihe und hob die Hand. Die Zuhörer ganz vorn machten den Eindruck, als würden sie zusammengehören, sie stießen sich häufig gegenseitig an und kicherten leise. Es waren vor allem junge Frauen und vereinzelt auch junge Männer, und sie stützten immer wieder das Kinn in die Hand, schmachteten Wendell an und tuschelten mit ihren Sitznachbarn.
»Ja?«, fragte Wendell. Offenkundig erleichtert über die Unterbrechung, nutzte er die Gelegenheit, um sich gegen das Pult zu lehnen und seinen Nasenrücken zu massieren.
»Wie lange untersuchen Sie das Kleine Volk schon?«, erkundigte sich die junge Frau. Sie sah kaum ein, zwei Jahre älter als Ariadne aus. »Ich frage nur, weil Sie schrecklich jung wirken, Professor.«
Ihr unzweideutiger Tonfall löste gehöriges Kichern bei ihren Gefährten in der ersten Reihe und einigen anderen im Hörsaal aus. Entweder ignorierte Wendell absichtlich den Tonfall und das Kichern, oder – was ich für wahrscheinlicher hielt – er war so sehr mit seinem leidvollen Zustand beschäftigt, dass er es nicht bemerkte. Einen Ellbogen aufs Pult gestützt, rieb er sich weiter die Nase. »Manchmal kommt es mir wie eine Ewigkeit vor«, sagte er mit getragener Stimme und erntete Lachen. Rose lehnte sich enttäuscht wieder zurück.
Wendell setzte seinen Vortrag fort, ohne auf die Grünzähne von Guernsey einzugehen, die man üblicherweise erwähnen würde. Ich konnte den Grund leicht erraten – sein Wissen über die Folklore der Kanalinseln ebenso wie aller anderen Regionen, die nicht zu seiner Heimat gehören, ist recht lückenhaft. Unglücklicherweise bemerkte Rose den Lapsus ebenfalls und stürzte sich darauf.
»Professor Bambleby«, sagte er mit der tragenden Stimme, die er auch in seinen eigenen Vorlesungen verwendete. »Von wem stammen die ersten Berichte über die Grünzähne von Guernsey?«
»Ah.« Wendell legte den Kopf leicht schief und ließ den Blick durch den Saal schweifen, als würde ihm die Antwort auf der Zunge liegen. Bisher hatte er auf meine Anwesenheit noch nicht merkbar reagiert, aber jetzt fand er mich zielsicher, und ich formte stumm mit den Lippen Walter de Montaigne.
»Walter de Montaigne, wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt«, sagte Wendell.
Rose schürzte die Lippen und kritzelte etwas in sein Notizbuch. Immer noch Blick in Blick mit Wendell deutete ich mit einer Kopfbewegung auf Rose und versuchte zu vermitteln, wie gefährlich die Lage war, was etwa so gut funktionierte, wie man erwarten konnte. Wendell sah mich nur ausdruckslos an.
Als er weitersprach, erlosch flackernd das Licht.
»Verdammte Elektrizität«, brummelte Wendell. »Warum man Geld verschwendet, um eine Anlage einzubauen, die so zuverlässig ist wie Musketen, begreife ich nicht. Nun ja, es ist nicht schlimm – wir haben noch die Fenster. Und so machen wir tapfer weiter wie die Büchergnome von Somerset, die nur im Dunkel der Nacht arbeiten. Verzeihen Sie, dass ich nicht Milch mit Honig servieren kann.«
Wieder Gelächter. Allmählich fragte ich mich, ob es Wendell vielleicht doch gelingen würde, seine Situation zumindest nicht weiter zu verschlimmern. Wie aufs Stichwort bemerkte ich in diesem Moment das Licht.
Es kam nicht von den elektrischen Lampen über uns, die waren immer noch dunkel, sondern von glitzernden Pünktchen, die durch den Spalt unter der Hintertür hereinschwebten. Wendell waren sie noch nicht aufgefallen, aber einigen seiner Studenten, und sie tuschelten miteinander. Die Pünktchen strahlten so hell, dass dunkle Schatten durch mein Sichtfeld huschten, wenn ich sie ansah.
Ich schob meinen Stuhl zurück, und alles schien ganz langsam abzulaufen, als steckte die Zeit in klebrigem Sirup fest. Rose stand einen Herzschlag nach mir auf, sein verächtlicher Gesichtsausdruck war wie weggewischt. Unsere Blicke trafen sich, und wir verstanden uns ohne Worte. Er öffnete den Mund und wollte etwas rufen.
Die Tür platzte auseinander.
Feen strömten in den Saal, lautlos wie ein Windhauch. Es waren vier – nein, fünf, die ineinander zerflossen wie Wasser. Sie trugen übergroße Umhänge aus Schatten, durch die man ihre Bewegungen beinahe unmöglich nachvollziehen konnte; im einen Moment schienen sie kaum mehr als wabernde Dunkelheit zu sein, im nächsten ließen sie sich auf alle viere fallen und bewegten sich wie Wölfe, in ihren langen Schnauzen blitzten Zähne auf.
Ich wusste – hatte schon erraten –, dass sie graue Sheeries waren, eine in Irland beheimatete Unterart der sozialen Feen. Im Gegensatz zu ihren im Moor lebenden Verwandten sind die grauen Sheeries tödliche Wesen, die von höfischen Feen als Meuchelmörder angeheuert werden. Sie lassen ihre Lichter über sich in der Luft tanzen und blenden damit ihre Opfer, bevor sie zuschlagen.
Ich rief etwas in dieser Art, als im Hörsaal Chaos ausbrach, und befahl den Studenten, sie sollten sich die Augen zuhalten, aber Rose stieg auf seinen Stuhl und donnerte mit volltönender Stimme: »Rennt um euer Leben!«, was sich als deutlich nützlicher erwies. Die Studenten schrien, die Hälfte von ihnen lief zur Tür und die andere Hälfte zu den hohen Flügelfenstern, die ebenerdig auf einen Garten blickten. Das bewahrte sie wahrscheinlich davor, sich gegenseitig niederzutrampeln, weil es der fliehenden Menge zwei zusätzliche Ausgänge bot. Trotzdem sah ich, wie mehrere Studenten umgeworfen und gegen Pulte gestoßen wurden und andere mit solchem Schwung durch die Fenster sprangen, dass sie in den Ententeich stolperten.
»Wendell!«, rief ich, weil die grauen Sheeries natürlich seinetwegen gekommen waren. Ich glaube, sie hatten sich nur noch nicht auf ihn gestürzt, weil zwei Studenten ihn auf ihrer Flucht umgerissen und unter sich begraben hatten. Die grauen Sheeries sind blind und spüren ihre Opfer wie Wölfe durch den Geruch auf.
Weil der Gang verstopft war, kletterte ich über die Tische nach unten und intonierte dabei immer wieder eines der Wörter der Macht. Ich hatte keine Ahnung, ob es mich nicht nur wie gewohnt unsichtbar machen, sondern auch vor den Nasen der Sheeries verbergen würde, aber es schien zu helfen, denn die Feen beachteten mich nicht. Eine ließ ein schauderhaftes Heulen erklingen, halb Mensch, halb Wolf, woraufhin sich alle im Saal verteilten und nach den Knöcheln der fliehenden Studenten schnappten. Sie schnüffelten am Boden, in der Luft und in den Ecken. Sie waren auf der Jagd.
Wendell schob die Studenten von sich hinunter und stand auf. Die Sheerie, die ihm am nächsten war, fuhr herum, und plötzlich hüllte eine Wolke winziger Lichter Wendell ein wie ein Mückenschwarm.
Aber ich hatte Rose schon seine Jacke heruntergezerrt – der Mann stammelte und schrie wie ein Kind und war zu erschrocken, um mich aufzuhalten – und legte sie Wendell über den Kopf. Es war, als würde man eine Kerze auspusten: Die Feenlichter erloschen, sobald das Gewicht der Jacke mit den eingenähten Münzen auf ihnen lag.
»Danke, Em«, sagte Wendell und warf die Jacke von sich. Dann fühlte ich mich schlagartig schwindlig und desorientiert, denn Wendell hatte mich gepackt und herumgewirbelt, weil die Sheerie auf uns zugestürzt war; er hatte sich so schnell bewegt, dass ich es nicht gesehen hatte.
»Das Wort!«, raunte er mir ins Ohr, und ich besann mich und öffnete den Mund, um es wieder zu intonieren. Einen halben Atemzug später knallte ich mit dem Rücken gegen die Tafel – er hatte mich aus der Gefahrenzone gestoßen und war schon wieder verschwunden. Meine Haut kribbelte, es fühlte sich an, als würde mich ein Geist streifen.
»Einen Bleistift!«, rief er und sprang über ein Pult – die Sheerie, die ihn packen wollte, stieß dagegen und rollte auf Rose zu, der wieder aufschrie. »Wirf mir einen deiner Bleistifte zu!«
»Bist du verrückt geworden?«, schrie ich, während ich den Stift aus meiner Jackentasche zog und in Richtung von Wendells Kopf warf.
Bevor der Bleistift Wendell erreichte, verwandelte er sich schon, er wurde länger und blitzte im Schatten auf – ein Schwert. Ich bereute, dass ich auf Wendells Kopf gezielt hatte, aber als erfahrener Schwertkämpfer fing er es geschickt auf.
Wendell mit einem Schwert in der Hand erinnert an einen Vogel, der sich von einem Zweig in die Luft schwingt – er scheint sich intuitiv zu bewegen, als müsste er nicht nachdenken. Man bekommt den Eindruck, er wäre ohne das Schwert weniger er selbst und mit der Waffe ganz in seinem natürlichen Element.
Er stieß die Klinge in die Sheerie, die ihm am nächsten war, und während sie noch fiel, war er herumgewirbelt und hatte die Sheerie hinter sich aufgeschlitzt wie überreifes Obst. Die restlichen drei waren genauso leicht besiegt.
Die meisten Studenten waren mittlerweile geflohen, aber einige zögerten noch an der hinteren Tür des Hörsaals. »Laufen Sie weg!«, rief ich ihnen zu. Und weil sie nur dastanden, besorgt und ängstlich wirkten und auch, als wollten sie gleich ihre Hilfe anbieten: »Es kommen noch mehr!«