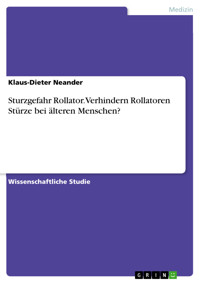Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Professional palliative care not only involves providing demanding medical and nursing care for clients, but is also emotionally burdensome for everyone involved. Worries, fears, hopelessness, despair and hatred may be expressed both verbally and non-verbally, creating a strained atmosphere. How should staff, relatives and clients speak to each other, what is the best way of dealing with the situation? The Rosenberg approach to empathetic communication offers essential ideas and specific aids by enabling us to recognize needs and wishes and find new ways of living together. This volume develops the concept of ?nonviolent communication= for practical application in the field of palliative care. On the basis of examples drawn from real life, it becomes clear that everyone involved is able to benefit. Nonviolent communication requires nothing less than a ?change in behavior= & a difficult journey, but rewarding nevertheless, especially in the field of palliative care.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Klaus-Dieter Neander, Krankenpfleger, Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege, Palliative Care, (In-)Kontinenz, Pain Nurse, Lehrer für Pflegeberufe, Pflegedienstleiter, B. Sc. Gesundheit und Management, M. M. Master of Mediation. Lehrbeauftragter für Health Care Management, Qualitäts- und Case-Management an der IU Hamburg und Lehrender für Palliative Care an der Apollon-Hochschule Bremen.
Der Illustrator
Jai Wanigesinghe, studierte an der Filmakademie Baden-Württemberg. Bei seiner Arbeit als freiberuflicher Illustrator liegen seine Schwerpunkte auf den Themen Psychologie, Gesellschaft und Klimakrise.
Klaus-Dieter Neander
Empathische Kommunikation in der Palliativbetreuung
Grundlagen und Hinweise für die Praxis
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
Piktogramme
Definition
Kommunikationsbeispiel
Merke
Internet
1. Auflage 2022
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-040852-4
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-040853-1
epub: ISBN 978-3-17-040854-8
Geleitwort von Tobias Altmann
Wenn man an Marshall B. Rosenberg denkt, kommen vielen von uns sicher unmittelbar Bilder in den Kopf, in denen er mit einer Wolfs- und einer Giraffenpuppe an den Händen zu sehen ist. Manchmal sah man ihn in seinen Seminaren auch mit Wolfs- oder Giraffenohren und gelegentlich sogar mit einer ganzen Stofftiergiraffe auf dem Kopf. Doch das Besondere an M. B. Rosenberg war nicht nur die tiefe Ernsthaftigkeit, die er selbst mit einer Giraffe auf dem Kopf auszustrahlen vermochte, sondern auch seine ansteckende Authentizität und die berührende Kraft seiner Worte. Die von ihm entwickelte Gewaltfreie Kommunikation (GfK) hat über die Jahre hinweg viele Menschen erreicht und bereichert, hat in vielen verhärteten Konflikten echte Lösungen ermöglicht und hat in unzählbaren, oftmals sehr schwierigen Gesprächen zu Entspannung beigetragen und die Gesprächspartner wieder miteinander verbunden.
In den letzten Jahren ist die GfK (oder zumindest einzelne Bausteine davon) von recht vielen Menschen angewandt worden. Einerseits ist eine große Verbreitung natürlich sehr erfreulich, andererseits ist dadurch jedoch auch eine Vielzahl unterschiedlicher Umsetzungsvarianten entstanden, was wiederum auch problematisch sein kann. So sind viele Anwenderinnen und Anwender leider nicht ausreichend tief mit der Grundidee, den vier Schritten und den zugehörigen Differenzierungen, den Voraussetzungen, den Wirkprinzipien etc. vertraut und hinreichend darin erfahren. Zu unbedacht werden oftmals Äußerungen als »zentrale Bedürfnisse« akzeptiert, zu vorschnell wird an einer Lösung gefeilt, zu achtlos werden nonverbale Signale übersehen, zu hektisch wird ein echtes Einlassen auf den Prozess einer zu oberflächlichen Ergebnisorientiertheit geopfert. Mir scheint es wichtig, zu betonen, dass die GfK vielmehr ein Prozess der authentischen Kommunikation ist, auf den man sich als Anwenderin und Anwender einlassen muss, wenn man die Früchte ernten will. Es braucht also nicht nur allgemeines Wohlwollen und die vielzitierten vier Schritte der GfK, sondern auch die wirkliche Auseinandersetzung – sowohl mit dem Gegenüber als auch mit sich selbst.
Entsprechend darf die GfK nicht nur als eine Technik gesehen werden, die wie ein Kuchenrezept angewendet werden kann. Sie erfordert auch (oder vielmehr) eine entsprechende innere Haltung. Beide Aspekte – Technik und Haltung – sind erst in ihrer Kombination wirksam. Die Haltung gibt die Richtung vor, die Technik liefert den Antrieb. Eine reine Anwendung der Technik ohne die passende innere Haltung kann in ungünstige Richtungen führen, Widerstände wecken und sogar in eine gewaltvolle Kommunikation umschlagen, die auf der Oberfläche auch noch gewaltfrei klingen mag. Die innere Haltung ohne die passende Technik bleibt unkonkret und die Energie verpufft. Es lohnt sich also, sowohl genauer auf die Technik zu achten als auch im Herzen gewaltfrei auf unser Gegenüber und gleichzeitig auch gewaltfrei auf und in uns selbst zu blicken.
Das vorliegende Buch gibt zu all diesen und vielen weiteren Aspekten der GfK wertvolle Impulse, dienliche Hinweise, hilfreiche Anleitungen und zudem auch viele pointierte praktische Beispiele. Der besondere Fokus des Buches liegt dabei auf einem sehr wichtigen Bereich im menschlichen Leben, der in den üblichen GfK-Trainings selten eine Rolle spielt, aber uns alle früher oder später intensiv und unumgänglich betrifft, nämlich die eigene Endlichkeit.
Am Ende des Lebens keine Zeit mehr zu haben und doch noch Zeit zu brauchen, um die eigenen Bedürfnisse zu klären, den Mut zu finden, die eigene Verletzlichkeit zu erfahren und sich mit dieser Verletzlichkeit anderen mitzuteilen – für solche Prozesse brauchen wir einen Menschen als Gegenüber, der unseren Prozess geduldig und wertschätzend begleitet, der sich die Zeit für uns nimmt, der unsere inneren Umwege mitgeht und unsere Launen und Anspannungen aushält, und der uns auf dem Weg zur Übernahme der Verantwortung für unsere eigenen Bedürfnisse auch in diesen existenziellen Zeiten kompetent unterstützt. Gerade bei der Pflege anderer Menschen, in der Zeit immer eine kritische Mangelware ist, ist es schwer, sich diese Zeit für einen anderen zu nehmen. Dann zusätzlich jetzt auch noch Fortbildungen zur GfK besuchen und Bücher darüber lesen? Das ist auf den ersten Blick fast schon eine Zumutung.
Allerdings lohnt sich dieser Weg wie kaum ein anderer. Wer sich die Zeit nimmt und wer sich immer wieder neu auf den individuellen Prozess seines Gegenübers einlässt, erfährt die zutiefst erfüllende Verbindung mit diesem Menschen. Die GfK ermöglicht eine authentische, vertraute und produktive Ebene im Gespräch. Und das sowohl für unser Gegenüber als auch für uns selbst als Anwenderinnen und Anwender der GfK.
Ich wünsche diesem Buch viele Leserinnen und Leser, denn es ist reich an Erkenntnissen, intensiv in der praktischen Anwendung und potent für die individuelle Entwicklung. Und nicht nur für professionelle Betreuende und Pflegekräfte: Jeder von uns, der mit dem Thema Tod und Sterben anderer Menschen in Berührung gekommen ist oder kommen kann, wird von diesem Buch profitieren. Und so schwer dieses Thema auch klingen mag, so dankbar kann man sein, wenn man gerade in dieser Zeit von einem Menschen begleitet wird, der auf diese wunderbare Art empathisch zuhören kann, wie es die GfK beschreibt. Egal ob mit oder ohne Stofftiergiraffe auf dem Kopf.
Dr. phil. Dipl.-Psych. Tobias AltmannAkademischer Rat an der Universität Duisburg-Essen
Essen, im Frühling 2021
Geleitwort von Kirsten Fehrs
Im Angesicht des Todes die richtigen Worte finden, das passende Schweigen, die hilfreichen Gesten – seit Beginn aller Kultur bemühen sich Menschen darum. Sind doch der Tod des Anderen und das eigene Sterben die unmittelbarsten und tiefsten Leid- und Ohnmachtserfahrungen, die das Leben bereithält. Die ältesten kulturellen Zeugnisse der Menschheitsgeschichte erzählen davon, wie Menschen Abschieds- und Sterberituale und eine ganze Bestattungskultur entwickelt haben, damit sie der Ohnmacht und der grundsätzlichen Infragestellung durch den Tod begegnen können. Er braucht eine Antwort; Tod und Sterben erzwingen Kommunikation. Nicht zuletzt deswegen gibt es Religionen und spirituelle Praxis.
Aber welche Art von Kommunikation ist hilfreich? Damit beschäftigt sich dieses Buch. Klaus-Dieter Neander geht der Frage nach, welchen Beitrag das Konzept der Gewaltfreien Kommunikation für die letzte Phase des Lebens leisten kann. Sie führt ja auf besondere Weise an Grenzen. Die Selbstwirksamkeit des pflegebedürftigen, schwerkranken oder sterbenden Menschen ist auf existentielle Weise in Frage gestellt. Und umgekehrt werden die Herausforderungen für pflegende, begleitende und mitempfindende Menschen nicht selten zu schwer. Solche Grenzsituationen mit ihren emotionalen Überforderungen können zum Einfallstor für Gewalt werden. Dieses Buch macht darauf aufmerksam und bietet wichtige Hilfestellungen.
Pflege geschieht in ungleichen Beziehungen, Palliativpflege ganz besonders. Ob ambulant oder stationär, ob im familiären oder im beruflichen Kontext: Immer gibt es den einen Menschen, der so stark eingeschränkt ist, dass er auf Unterstützung angewiesen ist. Und es gibt den anderen Menschen, hinreichend leistungsfähig, der diese Unterstützung gibt. So entsteht ein Machtgefälle, das schlicht unauflösbar ist. Umso wichtiger ist es, mit diesem Ungleichgewicht aufmerksam und verantwortlich umzugehen. Gerade das selbstbestimmte Sterben, das immer mehr Menschen sich für ihre letzte Lebensphase wünschen, ist auf sensible, achtsame, respektvolle Begleitung angewiesen. Es braucht eine Kommunikation, die jede Form von Übermacht oder Gewalt vermeidet. Dazu kann das Konzept der Gewaltfreien Kommunikation von Marshall B. Rosenberg eine wichtige Hilfe sein.
Aber auch Schwächere üben Macht aus, und gerade pflegende Angehörige wissen von hoch belastenden Erfahrungen zu berichten. Manche Pflegebedürftige oder Sterbende, körperlich geschwächt und in besonderer Schutzposition, nutzen die Gelegenheit, auf subtile oder weniger subtile Weise zu verletzen, unter Druck zu setzen und die Pflege und Begleitung zur Qual zu machen. Im schlimmsten Fall entstehen Gewaltspiralen, aus denen erst der Tod erlöst. Auch hierfür bietet dieses Buch nützliche Analyseinstrumente und gute Hinweise, wie bewusst reflektierte und eingeübte Kommunikation aus dem Dilemma hilft und der letzten Lebensphase ihre Würde lässt.
Die letzte Lebensphase hat ihre Herausforderungen, sie ist aber für viele Menschen zugleich eine Zeit besonderer Intensität. Rückblick und Lebensbilanz mit all den er-innerten, also neu aktualisierten Lebenserfahrungen prägen diese Zeit ebenso wie die ganz besondere und oftmals so rührende Dankbarkeit für die kleinen Dinge, für Begegnung und Beziehung, für das Leben an sich. Gewaltfreie Kommunikation schafft Raum für diese Tiefe – und sie hilft, den besonderen Schatz dieses Lebensabschnittes miteinander zu teilen. Dank an Klaus-Dieter Neander, dass er darauf so fachkundig aufmerksam macht.
Kirsten FehrsBischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck (Nordkirche)
Widmung
Dieses Buch widme ich I., die mich über viele Jahre intensiv begleitet und durch Höhen und Tiefen mit mir gegangen ist, zu einer Zeit, als ich – wie ich heute weiß – weit davon entfernt war, Gefühle und Bedürfnisse benennen zu können. Das Privileg, von ihr begleitet worden zu sein, macht mich auch heute noch sehr glücklich und unendlich dankbar.
Mein Lebenspartner Erik hat mich auf das Konzept der »Gewaltfreien Kommunikation« aufmerksam gemacht und damit hat er unsere Beziehung »gerettet« – ohne ihn wäre die intensive Auseinandersetzung mit GfK nie erfolgt. Anja Kenzler bin ich sehr dankbar und verbunden, hat sie mich doch in ihrer fröhlichen und intensiven Seminararbeit mit der Tiefe und Weite der »Sprache des Herzens« vertraut gemacht. Und ich bin den Menschen, die ich in meiner Berufspraxis kennenlernen durfte, dankbar, haben sie mir doch gezeigt, dass die »Gewaltfreie Kommunikation« möglich ist, aber auch Grenzen erfahren muss. Alle Beispiele, die auf realen Gesprächen basieren, wurden dahingehend verändert, dass eine vollständige Anonymität der Personen gewährleistet ist.
Inhalt
Geleitwort von Tobias Altmann
Geleitwort von Kirsten Fehrs
Widmung
Vorwort
1 Das Konzept der »Gewaltfreien Kommunikation«
1.1 M. B. Rosenberg und seine Lehrer
1.2 Das »Konzept« der »Gewaltfreien Kommunikation«
1.3 Technik vs. Haltung
1.4 Die einzelnen Schritte der GfK
1.4.1 Schritt 1: Beobachtung
1.4.2 Schritt 2: Gefühl
1.4.3 Schritt 3: Bedürfnis
1.4.4 Schritt 4: Bitte formulieren
1.4.5 Optionen suchen
1.5 Metapher der GfK
1.5.1 Die Giraffe
1.5.2 Der Wolf
1.5.3 Wolfsshow
1.6 Zentrale Begriffe im Konzept der »GfK«
1.6.1 Freude, Glück und Wohlbefinden
1.6.2 Trauer
1.6.3 Angst und Furcht
1.6.4 Wut, Ärger und Zorn
1.6.5 Ekel
1.6.6 Überraschungen
1.6.7 Scham, Schuld, Empörung
1.6.8 Kränkung – Zusammenhänge zwischen Wut und Scham
1.7 Gefühle in der Umgangssprache
1.8 Mit Gefühlen umgehen
1.8.1 Ich habe Schuld …
1.8.2 Der Andere hat Schuld
1.8.3 Meine Gefühle wahrnehmen und Bedürfnisse äußern
1.8.4 Pseudo- oder Nicht-Gefühle
1.8.5 Die Gefühle und Bedürfnisse des Gegenübers wahrnehmen
1.9 Bedürfnis
1.10 Bitte
1.10.1 Keine negativen Bitten
1.10.2 Eine Bitte kann abgelehnt werden
1.10.3 Eine Forderung nicht als Bitte »verpacken«
1.11 Empathie
1.11.1 Empathie bei M. B. Rosenberg
1.11.2 Empathie in der Neuropsychologie
1.11.3 Empathie bei Altmann
1.11.4 Selbstempathie
1.11.5 Empathie als Gefahr
1.12 Respekt
1.13 Konflikt
1.13.1 Konfliktmodell nach Galtung
1.13.2 Konfliktarten
1.13.3 Konfliktstufen
1.13.4 Konfliktlandkarte
2 Gefühls- und Bedürfnis-Analphabetismus
3 Warum Gewaltfreie Kommunikation häufig nicht gelingt
3.1 Affektlogik oder der »emotionale Rucksack«
3.2 Mangelnde Empathiefähigkeit
3.3 Hörfilter
3.4 Verweigerung
3.5 Wenn GfK nervt …
4 GfK wissenschaftlich
5 Kritik am Konzept der Gewaltfreien Kommunikation
5.1 Die kommunikative Ebene
5.2 Die Überforderungsebene
5.3 Verknüpfung mit esoterischen Ansätzen
5.4 Nicht nur reden – tut etwas!
6 Tod und Sterben in der Gesellschaft
6.1 Die letzte Lebensphase: sterben
6.2 Über das Sterben reden – Elisabeth Kübler-Ross
6.3 Existentielle Verzweiflung am Lebensende
6.4 Worüber reden Sterbende?
6.4.1 Vier Themenfelder
6.4.2 Patient*innenverfügung
6.4.3 »Ich möchte sterben …« – Todeswunschäußerungen
6.4.4 Todeswunsch vs. Suizid
6.4.5 Sprechen über Todeswünsche
6.4.6 Bitte um Sterbehilfe
6.5 Worüber reden Angehörige?
6.6 Reaktion von Angehörigen auf die Arbeit von Palliativfachkräften
6.7 Worüber reden Teams?
6.7.1 Palliative Fallbesprechungen
6.8 Bewusstes Sterben?
6.9 Gutes Sterben?
7 Die religiöse Dimension
7.1 Der hochreligiöse Mensch
7.2 Die spirituelle Anamnese
7.3 Leiblichkeit und Spiritualität
7.4 Ein kurzer Überblick über die monotheistischen Religionen
7.4.1 Christentum
7.4.2 Islam
7.4.3 Judentum
7.4.4 Buddhismus
7.5 Zusammenfassung
7.6 Signalsprache
7.7 Es bleibt eine Narbe zurück
8 Über den Tod reden … »gewaltfrei«?
8.1 Kommunikationsbedürfnis
8.2 Symbolsprache
8.3 Nonverbale Kommunikation
8.4 Mimik
8.5 Körperhaltung
8.6 Basale Stimulation
®
8.7 Kommunikation mit Musik
8.8 Unterschiedliche Wege zum Menschen – Kommunikation
9 Was in der Kommunikation beachtet werden sollte
9.1 Der Lake-Wobegon-Effekt
9.2 Besonderheit des »palliativen Kontextes«
10 Systemische Überlegungen
10.1 Verhältnis Kinder – Eltern
10.2 Wenn die Kraft nicht mehr ausreicht
10.3 Wenn »Dankbarkeit« gefordert wird
11 Gewaltfreie Kommunikation »vertieft«
11.1 »Doppeltes Zuhören«
11.2 Das Verstandene, das Ungehörte
12 Trauern
12.1 Warum trauern Menschen?
12.2 Das Coping-Modell nach Morse & Johnson (1991)
12.3 Das Duale Prozessmodell der Bewältigung von Verlusterfahrungen
12.4 Das Traueraufgabenmodell nach William J. Worden
12.4.1 Den Verlust des Menschen als Realität akzeptieren
12.4.2 Den Schmerz verarbeiten
12.4.3 Sich an die neue Situation ohne den Verstorbenen anpassen
12.4.4 Den Kontakt halten – auch wenn das Leben weitergeht
12.5 Anhaltende Trauerstörung
13 Aufgabe der Trauerbegleitung: Sinn geben oder aushalten?
14 Religiöse Bewältigung von Trauer
15 Frau K.
16 Zusammenfassung
Literatur
Stichwortverzeichnis
Die Uhr1
Ich trage, wo ich gehe,
Stets eine Uhr bei mir;
Wieviel es geschlagen habe,
Genau seh’ ich’s an ihr.
Es ist ein großer Meister,
Der künstlich ihr Werk gefügt,
Wenngleich ihr Gang nicht immer
Dem törichten Wunsche genügt.
Ich wollte, sie wär’ oft rascher
Gegangen an manchem Tag:
Ich wollt’ an manchem Tage,
Sie hemmte den raschen Schlag.
In meinen Leiden und Freuden,
Im Sturme und in Ruh, –
Was immer geschah im Leben,
Sie pochte den Takt dazu.
Sie schlug am Sarge des Vaters,
Sie schlug an des Freundes Bahr’,
Sie schlug am Morgen der Liebe,
Sie schlug am Traualtar.
Sie schlug an der Wiege des Kindes, –
Sie schlägt, will’s Gott! noch oft,
Wenn bessere Tage kommen,
Wie meine Seel es hofft.
Und ward sie manchmal träger,
Und drohte zu stocken ihr Lauf,
So zog sie der Meister mir immer
Großmütig wieder auf.
Doch stände sie einmal stille,
Dann wär’s um sie geschehn,
Kein and’rer, als der sie fügte,
Bringt die zerstörte zum Gehn!
Dann müßt’ ich zum Meister wandern,
Und ach, der wohnt gar weit,
Wohnt draußen, jenseits der Erde,
Wohnt dort in der Ewigkeit.
Dann gäb’ ich sie dankbar zurücke,
Dann würd’ ich kindlich flehn:
[»]Sieh’, Herr, – ich hab’ nichts verdorben,
Sie blieb von selber stehn.«
Text: Johann Gabriel Seidl
Musik: Carl Loewe
1 Johann Gabriel Seidl (1830): Die Uhr. In: Northeimer Datenbank Deutsches Gedicht (https://nddg.de/gedicht/7650-Die+Uhr-Seidl.html, Zugriff am: 23.08.2021)
Vorwort
Das Lied von der Uhr hat mich schon in Kindertagen fasziniert – ich verstand die Metapher wohl schon recht früh und war in der Lage, das Gedicht zu rezitieren, bevor ich andere zusammenhängende Sätze formulieren konnte. Die Uhr als Metapher des Lebens.
Ich begann meine Ausbildung zum Krankenpfleger 1975 in einem Kreiskrankenhaus. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mit Tod und Sterben nun »theoretisch« zu tun. Meine protestantische Mutter, die als »Gemeindehelferin« (heute nennt man diesen Beruf »Diakonin«) und »Krankenhausseelsorgerin« sehr engagiert tätig war, und meine Familie prägten mich insofern, als dass sie mich lehrten, dass Tod und Vergänglichkeit, Abschied nehmen müssen und Menschen zu verlieren zum »Leben« gehören würde, dass sie – egal was sie in ihrem Leben getan oder nicht getan haben – zum »himmlischen« Vater gehen würden, der sie unendlich liebe und dass dem Schmerz des Abschieds vom irdischen Leben der Trost einer »Zukünftigkeit« folgte. Ich hatte gelernt, die Orgel in unserer kleinen Gemeinde zu spielen, und so hatte ich die Möglichkeit, während unzähliger Beerdigungsfeiern nicht nur die evangelischen Lieder zu begleiten, sondern Menschen zu beobachten, die Abschied nehmen mussten: tief, vor Gram gebeugt, weinend, sich ein Taschentuch vor das Gesicht haltend, den Blick starr nach vorne gerichtet, keine Miene verziehend, sich gegenseitig stützend, manchmal streichelte eine Tochter ihre Mutter oder der Sohn nahm seinen Vater in die Arme. So standen sie alle an den offenen Grabstellen, in denen der Sarg verschwand und mit ihnen der Mensch, der in irgendeiner Weise zum Leben derer gehörte, die – wie man so sagt – zurückblieben. Ich war als Kind bei der ein oder anderen Beerdigung dabei gewesen… Ich kann mich aber nicht erinnern, dass mich die Zeremonie tief berührt hätte!
In der Krankenpflegeschule wurde das Thema – meiner Erinnerung nach – eher technisch besprochen: »Versorgung des toten Körpers!«. Als Schüler*innen mussten wir mit einem Kollegen bzw. einer Kollegin die Toten aus dem Badezimmer der Station holen, im Bett über die Flure des Krankenhauses schieben und sie dann in das hinter dem Krankenhaus gelegene Extrahaus bringen, in dem sie in einer Kühlbox gelagert wurden, bis das Beerdigungsinstitut den Leichnam abholte. Der Leichnam, den wir aus dem Badezimmer abholten, war von uns Pflegekräften vorher versorgt worden: Die Kinnlade wurde mit einer weißen, nassen Mullbinde »hochgewickelt«, damit der Mund nicht offen stand. In der Regel legten wir noch ein Handtuch unter den Kopf, damit dieser nicht »nach hinten« wegknickte. Die Haare wurden gekämmt, nicht selten fand ein »Totenwäsche« statt. So versorgt, wurden zwei Bettdecken über den Toten gebreitet, ein oder zwei Kopfkissen daraufgelegt, um den Patient*innen, die uns möglicherweise auf dem Flur oder im Fahrstuhl mit dem Bett sehen würden, zu suggerieren, wir würden lediglich ein durch eine Entlassung frei gewordenes Bett zur Reinigung in den Keller fahren. Wenn irgend möglich, sollte niemand erfahren, dass gerade ein Mensch verstorben war.
Wie gesagt, ich komme aus einer christlich geprägten Familie und einige andere Kolleg*innen, die sich in der Ausbildung befanden, auch, so dass wir einen »Hauskreis« gründeten, der sich mit dem Thema »Tod und Sterben« beschäftigen wollte. Ein Hauskreis, bei dem sich mehrere Menschen »in seinem Namen versammeln« und wo er mitten unter ihnen sein würde (Matthäus 18, 20), ist eine Institution, die besonders im christlich-pietistischen Umfeld dazu dient, gemeinsam die Bibel zu lesen, darüber zu reden, gemeinsam zu singen und zu beten. Der Hauskreis wird als Umsetzung der »Gemeinschaft der Heiligen« verstanden (»heilig« ist in diesem Sinne die Person, die sich in besonderer Weise Gott zugehörig weiß, z. B. indem sie sich ganz bewusst im Kreis Gleichgesinnter zu Gott bekennt, seine Schrift studiert und ihm dienen will).
Wir waren in diesem Hauskreis vielleicht fünf oder sechs Auszubildende, wir erlebten erstmalig auf den Stationen, dass jemand starb, wir waren »irgendwie« anwesend, allein gelassen, mit dem, was wir erlebten. Altgediente Kolleg*innen beeindruckten uns durch den schnoddrigen Umgang mit dem Tod (»Na, das wurde aber auch Zeit!«), mit dem Vokabular (»Machst du mal den Ex fertig!«), selten dadurch, dass sie wahrnahmen, wie uns junge Menschen diese Erfahrungen verunsicherten, dass wir es eklig fanden, wenn wir einen Leichnam waschen sollten oder seine Exkremente vom Hintern wischen mussten. Sie merkten nicht, dass wir eine Scheu davor hatten, den Toten zu berühren, der vor einer Stunde noch mit uns kommuniziert hatte; Profi-Pflegende und Ärzt*innen ließen uns in unserer Verwirrung zurück, wenn wir nach andauernder Reanimation einen Körper inmitten Kanülen und Intubationsbesteck, bei blinkendem Monitor und leise vor sich hin zischendem Beatmungsgerät betrachteten und irgendwie versuchten, das Geschehene einzuordnen. Niemand brachte uns bei, wie wir den Angehörigen, die vor der Eingangstür der Intensivstation bange warteten und – sobald wir das Reanimationszimmer verließen – ahnten, nein, spontan die Gewissheit hatten, dass ein Leben »verlöscht« war, begegnen sollten. Was sagt man den Hinterbliebenen, floskelhaft »herzliches Beileid« oder »wir konnten nichts mehr für ihn*sie tun«?
Seit diesen Tagen (seit über 40 Jahren) wurde ich in den unterschiedlichsten »Settings« immer wieder mit dem Tod konfrontiert: in meiner langjährigen Tätigkeit auf Intensivstationen und im Rettungsdienst, in meiner Tätigkeit bei langzeitbeatmeten Klient*innen in der häuslichen Pflege, in Tätigkeiten im Hospiz oder der ambulanten Palliativversorgung. Ich stand selbst am Grab von Menschen, die mir sehr, sehr viel bedeutet haben und wo das Unfassbare plötzlich über mich hereinbrach: Der Tod meiner Pflegemutter und der meines Schwiegervaters waren für mich die existentiellsten Erfahrungen, die mich betrafen, meine Familie, die Menschen, die ich liebte und die mit mir um »Fassung« rangen. Ich erinnere mich noch gut, als mein Schwiegervater (ein Landwirt in einem kleinen Dorf) verstorben war und wie wohltuend ich es fand, dass das Dorf, die weitere Familie aus einer langen Tradition, uns, die wir eng mit ihm verwandt waren, stützte, indem sie – oftmals wortlos – tat, was getan werden musste: Man kondolierte, vielleicht floskelhaft, aber es tröstete uns, man kam in das Haus meines Schwiegervaters und »war da«, einfach so, hielt mit uns das aus, was uns so unerträglich schien, hielt unser Weinen und Klagen, unsere Erschütterung, unsere Ziellosigkeit einfach »aus« … wie glücklich ich heute noch über diese Erfahrungen bin.
In dem Hauskreis lasen wir damals das Buch »Die Kunst des Sterbens – eine Anleitung« (Mauder 1976) von einem evangelischen Theologen und diskutierten darüber. Aber mir scheint, wir sprachen damals wie der berühmte Blinde über die Farbe. Viele andere Bücher, z. B. von Kübler-Ross (1975), habe ich seitdem zum Thema gelesen und viele persönliche Erfahrungen machen dürfen. Es zeigt sich nach meiner Wahrnehmung, dass auch der festeste Glaube häufig die Angst vor dem Tod nicht zu lindern vermag. Meine Erfahrungen lehren mich, dass wir immer noch »sprachlos« sind angesichts des Todes oder des bevorstehenden Todes.
2014 lernte ich das Konzept der »Gewaltfreien Kommunikation« nach Marshall B. Rosenberg kennen, die »Sprache des Herzens« (M. B. Rosenberg 2013). Ich war und bin fasziniert davon, wie Rosenberg – national und international – den Gedanken entwickelt hat, dass sich Menschen mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen verbinden und diese einander mitteilen sollen. M. B. Rosenberg war davon überzeugt, dass Gewalt auch durch Sprache entsteht bzw. »gewaltvolles Verhalten« seine Ursprünge darin hat, dass eine Person sich ihrer eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht bewusst ist bzw. sie im Gegenüber nicht erkennt.
Mir ist wichtig, den Gewaltgedanken in zwei Richtungen zu benennen: Gewalttätigkeit wird in der Regel so verstanden, dass einer Person einer anderen Person »Gewalt« antut, sie schlägt oder zu irgendetwas zwingt. In der häuslichen (ambulanten) Pflege findet mehr »Gewalt« statt, als wir gemeinhin annehmen – nicht unbedingt im Sinne von körperlicher Gewalt, die auch stattfindet, sondern in Form von Mikroaggressionen: spitze Bemerkungen, gezielte Provokationen, absichtliches Missverstehen usw. M. B. Rosenberg spricht von dieser »Gewalt«, die eben auch in der Sprache liegt, und will mit seinem Kommunikationsmodell eine Möglichkeit anbieten, diese Gewalt zu verhindern. Gewalt richten wir aber auch gegen uns selbst, wenn wir Gefühle nicht zulassen und Bedürfnisse unterdrücken. Das klingt banal, aber wie oft können wir nicht einmal ein Gefühl benennen, das uns bedrückt, es so beschreiben, dass der Gegenüber versteht, warum es mir schlecht geht. Und wir sind häufig völlig überfordert, wenn es darum geht, für uns selbst und mit anderen zu klären, welches Bedürfnis ich mir erfüllen muss und mir erfüllt werden müsste, damit es mir wieder besser gehen kann. Hier hat M. B. Rosenberg ganz klar Zusammenhänge beschrieben, die helfen können, stressige, belastende Situationen zu meistern.
Mit der intensiven Beschäftigung und dem Versuch, »Gewaltfreie Kommunikation« selbst zu praktizieren, stelle ich immer häufiger fest, wie oft wir uns gegenseitig verletzen, weil wir unüberlegt oder wenig empathisch mit dem Gegenüber reden und uns über dessen Reaktion wundern (oder empören oder ärgern). Mit dem Wissen über die »Sprache des Herzens« höre ich in der Praxis der Palliativpflege die Gespräche innerhalb der Beziehungen und Familien, höre die in verletzende Worte gepackte Sprachlosigkeit und spüre die Ängste der todkranken Person und der An-/Zugehörigen. In den Beratungsgesprächen mit Klient*innen und deren Familien gelingt es nicht selten, mit »Gewaltfreier Kommunikation« Unsagbares sagbar zu machen. Und diese Möglichkeit möchte ich den Leserinnen und Lesern eröffnen, ihnen aufzeigen, dass Sprachlosigkeit mit der »Sprache des Herzens« überwunden werden kann und befreiend wirkt:
• für die todkranke, im Sterbeprozess befindliche Person,
• für die An- und Zugehörigen, aber auch
• für die Ehrenamtlichen, Pflegenden, Mediziner*innen und Theolog*innen.
»Palliative Pflegepraxis wird als ›Face-to-Face-Dimension‹ [umschrieben, als ein] Involviert-Sein, Betroffen-Sein, Berührt-Sein. Damit tangiert die Erfahrung des sterbenden Menschen auch stets das Erleben und somit die Persona, das Person-Sein, vom professionell Begleitenden […]. […] [Aber es kommt anscheinend] zu einer Divergenz von Profession und Persona: Während der professionellen Pflegefachperson eine ›Verobjektivierung‹ von Situations(deutung) und Verhalten zugeschrieben wird, wird angenommen, dass auf der anderen Seite ihre Persona eine subjektive Deutung vornimmt und so erspürte Bedürfnisse sterbender Menschen subjektiv beantwortet. Im Rückschluss ist die Face-to-face-Beziehung […] von Fremd- und Betroffen-Sein gekennzeichnet und damit ebenso als notwendige Selbstpflege von professionell Pflegenden zu erbringen.« (Schulze 2014, S. 36f.)
Mit anderen Worten: Die Kommunikation zwischen den Beteiligten muss oder sollte für beide »gut sein«:
»[…] dass ich sagen kann, […], das war für mich auch gut. Auch so eine Begleitung für mich, kostet mich ja Kraft, aber sie muss auch für mich gut sein, wenn ich sehe, ich konnte da einen Schritt weit was bewirken, dass alle aus der Situation gut herausgehen.« (Schulze 2014, S. 37)
Gewaltfreie Kommunikation leistet aus meiner Sicht einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zum »Sorge tragen«, denn sich um den Anderen (und sich selbst) (Selbstpflege nach Orem, Cavanagh 1997, Neumann-Ponesch 2011, Moers & Schaeffer 2011) zu sorgen, bedeutet »das Wachstum des Anderen (und sich selbst) zu ermöglichen« (Maio 2019, S. 222). Sorge bedeutet aber auch, »die Unmittelbarkeit ernst zu nehmen, […] sie ist und bleibt in jeder unmittelbaren Begegnung ein Werkstück, das immer wieder neu entworfen und abgestimmt werden muss« (ebd., S. 222) und sie ist »(über-)lebensnotwendig, denn nur die Sorge kann dem hilfsbedürftigen Menschen das Gefühl der Achtung vermitteln und zum Ausdruck bringen, dass man ihm beisteht.« (ebd., S. 224)
Wenn dieses Buch bei Ihnen, liebe Leser*innen, die Idee aufkeimen lässt, dass mit der »Gewaltfreien Kommunikation« vielleicht ein Bruchteil dessen verwirklicht werden kann, was gemeinhin als »umfassende Pflege«, als »empathische Unterstützung« oder einfach als »Menschsein« verstanden werden kann, dann erfüllt es seinen Zweck.
Wir leben in einer medialen Welt und so habe ich vereinzelt Hinweise auf im Internet verfügbare Videos eingefügt, die entweder einen Sachverhalt noch einmal »anders« erklären oder aber wichtige Persönlichkeiten vorstellen, auf die ich in diesem Buch besonders eingehe (z. B. Kübler-Ross u. a.).
Für Beratung bei einzelnen Themen danke ich Pastor Nils Christiansen (Christentum) und Rabbi Dr. Walter Rotschild (Judentum), Herrn Dr. Tobias Altmann, der sich wissenschaftlich mit der »Gewaltfreien Kommunikation« auseinandergesetzt hat, für die kritische Durchsicht des Manuskriptes und sein wohlwollendes Geleitwort und Frau Pastorin Kirsten Fehrs, Bischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschlands, für die Bereitschaft, das Manuskript zu lesen und ein Geleitwort zu verfassen. Ein besonders herzlicher Dank gilt Jai Wanigesinghe für die wunderbaren Abbildungen, sein Engagement für das Thema und für seinen überbordenden Ideenreichtum, auch komplexe Themen umzusetzen. Diese Abbildungen sind in den Seminaren immer besonders beliebt und helfen, Zusammenhänge noch besser zu verstehen.
Auch in dieser Arbeit ist mir wieder bewusst geworden, wie sehr ein gutes Lektorat hilft, verworrene Sätze zu entknoten und so zu formulieren, dass das geschriebene Wort für alle verständlich ist – mein Dank gilt daher auch und in besonderer Weise meiner Lektorin Frau Anne-Marie Bergter vom Kohlhammer Verlag.
Ein Letztes: Ich schreibe als Gesundheits- und Krankenpfleger und deshalb beziehe ich in diesem Text häufig diese Berufsgruppe ein, was aber nicht bedeuten soll, dass die anderen Personen, die sich um die Palliativbetreuung verdient machen, nicht gemeint wären.
Klaus-Dieter Neander
Hamburg, im März 2021
1 Das Konzept der »Gewaltfreien Kommunikation«
1.1 M. B. Rosenberg und seine Lehrer
Marshall B. Rosenberg studierte Psychologie bei Carl R. Rogers (1902–1987) und A. Ellis (1913–2007). Rogers gilt als der Begründer der klientenzentrierten Psychotherapie und dessen Einfluss auf die Gewaltfreie Kommunikation ist unübersehbar. Rosenberg betont in seinem Modell, dass die »Benennung der eigenen Gefühle« von hervorragender Bedeutung für eine gelingende, gewaltfreie Kommunikation sei (M. B. Rosenberg 2013, S. 55ff.). Rogers schreibt: »Es war vor allem unsere Erfahrung [in der Therapie, Anm. vom Autor], dass die Klienten allmählich dahin kommen, ihre wahren Gefühle gegenüber Familienmitgliedern und auch anderen Menschen vollständiger zu äußern. Dies gilt sowohl für die oft als negativ betrachteten Gefühle […] wie auch für die eher positiv einzustufenden Gefühle […].« (Rogers 1976, S. 308) Gefühle sind Emotionen, eine Körperempfindung oder eine Stimmung (Baumgartner et al. 2015, S. 28, vgl. Röhner & Schütz 2012, S. 24) und sie dienen dazu, Kontakt zueinander zu bekommen und die eigenen Bedürfnisse zu erfassen. Auch hier zeigt sich die intensive Zusammenarbeit mit Rogers: »Eine Beziehung [wird] umso hilfreicher sein, je ehrlicher ich mich verhalten kann. Das meint, daß ich mir meiner eigenen Gefühle soweit wie möglich bewußt sein muß. […] Ehrlichkeit meint außerdem noch die Bereitschaft, sich in Worten und Verhalten zu den verschiedenen von mir vorhandenen Gefühlen und Einstellungen zu bekennen und sie auszudrücken.« (Rogers 1976, S. 47) Und: »Ich habe gelernt, dass in jeder wichtigen oder dauerhaften Beziehung anhaltende Gefühle Ausdruck finden sollten.« (Rogers 1992, S. 22)
Rogers war der Überzeugung, dass es nur dann möglich ist, Kontakt zu Klient*innen herzustellen, wenn Kongruenz (Authentizität), »unbedingte Wertschätzung« und »empathisches Verstehen« gelingen (Weinberger 2013, S. 19). Authentizität bedeutet, dass die Pflegefachkraft in Übereinstimmung mit sich selbst ist und sich dessen, was sie erlebt oder empfindet, deutlich bewusst wird. Empathisches Verstehen bedeutet, dass sich die Pflegefachkraft Mühe gibt, den inneren Bezugsrahmen des anderen möglichst exakt wahrzunehmen und dabei insbesondere auf die emotionalen Signale des Gegenübers zu achten.
Kongruenz umschreibt Rogers häufiger mit Begriffen wie »Echtheit – als reales Zugegensein«, »Wertschätzung oder bedingungsfreies Akzeptieren« oder als »präzises einfühlendes Verstehen (Empathie)«. (Rogers 1975, zit. nach Riedel & Heidenreich 2014, S. 212f.). Die Kongruenz zeigt sich in den Begegnungen zwischen der Pflegefachkraft und Klient*in und in der Haltung der Pflegefachkraft:
Definition kongruente Begegnungen
KongruenteBegegnungen zeichnen sich durch Reziprozität und Unmittelbarkeit aus, d. h. durch das sich auf den*die Andere*n einlassen, was auf verbale bzw. nonverbale Art und Weise geschieht.
Definition kongruente Haltung
KongruenteHaltung drückt sich im »Tun« und im »Sein« aus, d. h. das Tun, z. B. in Form eines Gesprächsangebotes, und das Sein, das sich wiederum durch Echtheit und Gegenwärtigkeit präsentiert (Riedel & Heidenreich 2014, S. 215ff.).
In der Palliativpraxis fällt es nicht immer leicht, diesen Anspruch umzusetzen, aber wenn Pflegende Klient*innen auf den »letzten Metern« wirklich helfen und sie aufrichtig und ehrlich begleiten möchten, dann kommen sie nicht umhin, sich mit dem Gedanken der Kongruenz vertraut zu machen. Im Ansatz von M. B. Rosenberg schlagen sich diese für Rogers enorm wichtigen Überlegungen in den Schritten zwei und drei (Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen) nieder.
Ellis begründete die »Rational-Emotive Verhaltenstheorie« (Kriz 2001, S. 147ff.). Rosenberg gibt in seinem Buch Hinweise zur Befreiung von alten Mustern (M. B. Rosenberg 2013, S. 191), die »das menschliche Potential« einschränken und die mit Hilfe von GfK aufgelöst werden. Die Empfehlungen, die M. B. Rosenberg gibt, erinnern sehr an die von Ellis postulierten »irrationalen Überzeugungen«, die er als »Hauptursachen von emotionalen und motivationalen Schwierigkeiten« definiert (Kraiker & Pekrun 1998, S. 720, vgl. Kriz 2001, S. 150): »Ich tauge nichts, wenn ich nicht immer perfekt, kompetent und leistungsfähig bin, oder wenigstens fast immer in den wichtigsten Bereichen.« (Kraiker & Pekrun 1998, S. 720) Ellis hebt in seiner Arbeit hervor, dass »übersteigerte Erwartungen« und irrationale Gedanken für mangelndes Wohlbefinden und Neurosen verantwortlich sind (Kraiker & Pekrun 1998, S. 1019). Als Beispiele dieser Erwartungen führen Kraiker & Pekrun (1998) z. B. an: von anderen total geliebt zu werden, dass der andere sich so verhält, wie man es erwartet. Die Lösungsansätze von Ellis (Kriz 2001, S. 150) und Rosenberg (M. B. Rosenberg 2013, S. 192) sind nahezu identisch.
Marshall B. Rosenberg (1934–2015) bezieht sich ausdrücklich auf Rogers (M. B. Rosenberg 2013, S. 17) und weist darauf hin, dass sein Modell der GfK »nichts Neues« enthielte (M. B. Rosenberg 2013, S. 22), was grundsätzlich z. B. auch über das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun zu konstatieren wäre. Rosenberg erfuhr in seiner Jugend Gewalt sowohl an der eigenen Person (wegen seines jüdischen Nachnamens) als auch in der Rolle des beobachtenden, verängstigten Kindes bei Rassenkrawallen in Detroit. (M. B. Rosenberg 2013, S. 21, Baumgartner et al. 2015, S. 16, Altmann 2015, S. 32). In seiner späteren Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt wurde ihm M. Ghandi (1869–1948) zum großen Vorbild: »Ich nenne diese Methode ›Gewaltfreie Kommunikation‹ und benutze den Begriff Gewaltfreiheit im Sinne von Ghandi.« (M. B. Rosenberg 2013, S. 22, vgl. auch Altmann 2015, S. 33) M. B. Rosenbergs besonderes Interesse war es darzustellen, inwieweit »Sprache« und »Worte« das Potential der Gewalt in sich tragen und zu Verletzungen der Seele und der Würde des Menschen in der Lage sind (ausführlich dazu z. B. Herrmann et al. 2007, Haller 2012, Neander 2016).
1.2 Das »Konzept« der »Gewaltfreien Kommunikation«
Gibt man den Namen M. B. Rosenberg in Google ein, erhält man 193.000 Einträge.2 Sein Buch »Gewaltfreie Kommunikation – Eine Sprache des Lebens« (M. B. Rosenberg 2013) liegt in vielen Sprachen und in deutscher Übersetzung in der 13. Auflage vor. Mit seinem Buch hat Marshall Rosenberg unzählige Menschen beeinflusst und internationale Friedensprojekte und Ähnliches initiiert, befruchtet, gar erst möglich gemacht.
1.3 Technik vs. Haltung
GfK ist allerdings nicht nur eine »Technik« oder »Methode«, sondern vor allem eine Haltung. »Auf einer tieferen Ebene ist sie eine ständige Mahnung, unsere Aufmerksamkeit in eine Richtung zu lenken, in der die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir das bekommen, wonach wir suchen.« (M. B. Rosenberg 2013, S. 23) Rosenberg legt Wert darauf, dass »[d]as Wesentliche der GFK sich in unserem Bewusstsein [abspielt, Hervorhebung vom Autor]) […] und nicht in den tatsächlichen Worten, die gewechselt werden.« (M. B. Rosenberg 2013, S. 26, vgl. auch Baumgartner et al. 2015, S. 16). Altmann (2015, S. 52) weist daraufhin, dass dieses »Bewusstsein« eine »spezifische Auffassung von Empathie [in der Gewaltfreien Kommunikation darstellt], die von der gängigen Sichtweise der Psychologie abweicht […].«
Nicht selten findet man das Konzept der »Gewaltfreien Kommunikation« reduziert auf die vier Schritte. Die »Gebrauchsanleitungen« in den Veröffentlichungen lesen sich häufig wie Anweisungen zur Anwendung eines Rasierapparates (eine besonders irritierende Beschreibung findet sich z. B. in Huber (2014)). Wenn im Folgenden die von M. B. Rosenberg beschriebenen Schritte hier kurz erläutert werden, dann unter dem Vorbehalt, dass GfK in Seminaren und in ständigen Trainings »erarbeitet und gelebt« werden muss – von »einmal lesen« wird es nicht gelingen.
1.4 Die einzelnen Schritte der GfK
Von Pflegefachkräften wird ein hohes Maß an Empathie erwartet, Pflegende müssen ein »Herz« haben, »mitfühlen« und auf Trauer und Schmerz adäquat reagieren können. So lautet die Forderung – aber können das Pflegende? Sie sind ja nicht anders sozialisiert als der Schalterbeamte am Auskunftstresen der Bundesbahn oder die Verkäuferin oder der Busfahrer. Pflegende ergreifen ihren Beruf, weil sie etwas »mit Menschen« machen wollen – nicht nur »handwerklich«, sondern zwischenmenschlich. Sie beklagen, dass sie nicht genügend Zeit z. B. für Klient*innen haben, die unter starken Schmerzen leiden, und das viel zu schnell ein Medikament gegeben wird, wo doch möglicherweise ein »empathisches Gespräch« genauso, wenn nicht sogar hilfreicher wäre.
Pflegende spüren, dass Klient*innen – wie die Pflegenden selbst – Gefühle und Bedürfnisse haben, aber sie haben kaum Ideen dazu, wie sie mit dieser Wahrnehmung umgehen sollen. Aber Pflegende können als Kolleg*innen recht rabiat miteinander umgehen und wenig empathisch sein. Ich hatte lange überlegt, wie ich meinen Teams das Modell von M. B. Rosenberg vorstellen könnte, bis sich in einer Dienstbesprechung recht spontan die Möglichkeit zum Einstieg ergab.
Als Pflegedienstleiter eines ambulanten Pflegedienstes hatte ich mit den Mitarbeitenden häufiger über Kommunikation gesprochen: über fehlende Kommunikation (Informationen waren nicht angekommen), über schlechte Kommunikation (unangemessene Wortwahl, plötzliche Wutausbrüche) und ähnliche Varianten. Natürlich hatten alle Kolleg*innen von den Kommunikationsmodellen von Schulz von Thun gehört (4-Ohren-Modell), aber bei einer Dienstbesprechung wurde uns klar, dass irgendetwas Wichtiges fehlte: Eine Kollegin trug sehr emotional und aufgeregt ein Problem vor, das sie mit einer nicht anwesenden Kollegin habe. Sie sagte, dass sie nicht bereit wäre, mit dieser Kollegin weiter zusammenzuarbeiten, mit anderen Worten: »Entweder die geht oder ich bin weg!«
Ich griff die Situation auf, notierte am Whiteboard vier Spalten, die ich mit »Situation«, »mein Gefühl« und »meine Gedanken« überschrieb; die vierte Spalte blieb zunächst frei. Ich bat die Kollegin, mit mir gemeinsam die Spalten auszufüllen. Sie brauchte wenig Zeit, um die Situation zu beschreiben, und konnte schnell sagen, was sie gedacht hat. Sehr lange brauchte sie, bis sie ihre Gefühle benennen konnte.
Nachdem wir die drei Spalten ausgefüllt hatten, fragte ich sowohl die Kollegin als auch die anderen Kolleg*innen, was denn wohl in der freien Spalte stehen müsste. Sehr spontan kam die Reaktion: »Was macht man denn mit einer solchen Situation?« Wir diskutierten und irgendwann wurde klar, dass die Kollegin Bedürfnisse nach Anerkennung, Wertschätzung und Respekt hat und dass sie dies (nicht nur) in der beschriebenen Situation vermisst hat. Wir nannten die vierte, freie Spalte »Meine Bedürfnisse«.
Ich fragte die Kolleg*innen, ob sie auch ähnliche Beispiele aus ihrem beruflichen Umfeld hätten, und wir füllten die Tabelle innerhalb von 90 Minuten mit zehn weiteren Beispielen. Die Kolleg*innen waren mit Eifer dabei und – wie sie mir später berichteten – es erleichterte sie ungemein, einmal darüber sprechen zu können. Nachdem wir die Beispiele gesammelt hatten, blieb natürlich die Frage im Raum: »Ja, und jetzt? Was machen wir damit? Jetzt wissen wir, fühlen, denken, wollen … aber davon hat sich die Situation ja nicht verändert.«
Die Kolleg*innen begannen Forderungen zu stellen: »Die soll sich mal für ihr Verhalten entschuldigen!« Ich erwiderte, was denn die Kolleg*innen machen würden, wenn die Person, die sich für ihr Verhalten entschuldigen soll, »Nein« sagt: »Nee, warum sollte ich das tun?« Auf diese Art und Weise lernten wir den Unterschied zwischen »eine Bitte aussprechen« und »eine Forderung aufstellen«. Erstere lässt ein »Nein« zu, öffnet aber den Weg zur Verhandlung. Eine Forderung, die abgelehnt wird, kann im Grunde nicht mehr verhandelt werden und es macht – da waren sich die Teilnehmenden dieser Mitarbeiter*innenbesprechung einig – Sinn, sich genau zu überlegen, ob eine »Bitte« wirklich als »Bitte« gemeint ist (also bereits mitgedacht wird, dass der Gegenüber der Bitte nicht entsprechen will) oder ob man eine Forderung als »Bitte« verklausuliert: »Kannst du das bitte zukünftig unterlassen!« Wie kann eine Bitte aussehen? Etwa so:
»Du hast mich vorhin bei der Kundin ›als zu dumm für den Job‹ bezeichnet