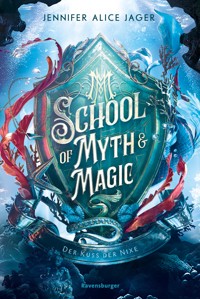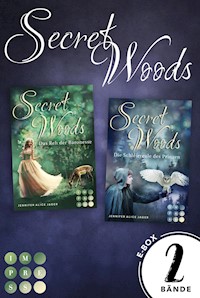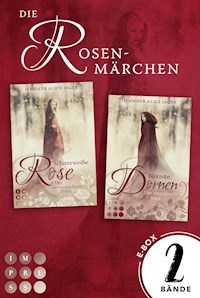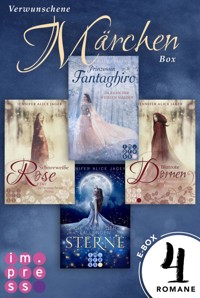4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die neue Fantasy-Reihe der Bestseller-Autorin von »Sinabell« und »Being Beastly« geht weiter! **Band 2 der märchenhaften Reihe über Buchwelten und die Magie der Tinte** Endlich kennt Scarlett die wirkliche Bedrohung ihrer Welt und die liegt nicht in den Bewohnern des Empire of Ink, dem Königreich, das einst durch die Macht des geschriebenen Wortes erschaffen wurde. Die eigentliche Gefahr lauert in der Organisation, die dieses Volk jagt. Um das Tintenreich vor dem Untergang zu bewahren, bleibt Scarlett nur eine Möglichkeit: Die Flucht vor dem Mann, der sie liebt, in eine Welt voller Drachen, Könige und Magie... Märchenhaft erzählt führt die Erfolgsautorin Jennifer Alice Jager ihre Leser in ein Königreich, in dem die Geschichten und Figuren ihrer Lieblingsbücher lebendig werden. Eine magische Welt aus Tinte und Fantasy, die vollkommen begeistert und mit außergewöhnlichen Charakteren und zahlreichen überraschenden Wendungen aufwartet. //Alle Bände der Fantasy-Dilogie über die Magie der Tinte: -- Empire of Ink 1: Die Kraft der Fantasie -- Empire of Ink 2: Die Macht der Tinte -- Empire of Ink: Alle Bände der Fantasy-Reihe über die Magie der Tinte in einer E-Box!// Diese Reihe ist abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Jennifer Alice Jager
Empire of Ink 2: Die Macht der Tinte
**Band 2 der märchenhaften Reihe über Buchwelten und die Magie der Tinte** Endlich kennt Scarlett die wirkliche Bedrohung ihrer Welt und die liegt nicht in den Bewohnern des Empire of Ink, dem Königreich, das einst durch die Macht des geschriebenen Wortes erschaffen wurde. Die eigentliche Gefahr lauert in der Organisation, die dieses Volk jagt. Um das Tintenreich vor dem Untergang zu bewahren, bleibt Scarlett nur eine Möglichkeit: Die Flucht vor dem Mann, der sie liebt, in eine Welt voller Drachen, Könige und Magie …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Das könnte dir auch gefallen
© privat
Jennifer Alice Jager begann ihre schriftstellerische Laufbahn 2014. Nach ihrem Schulabschluss unterrichtete sie Kunst an Volkshochschulen und gab später Privatunterricht in Japan. Heute ist sie wieder in ihrer Heimat, dem Saarland, und widmet sich dem Schreiben, Zeichnen und ihren Tieren. So findet man nicht selten ihren treuen Husky an ihrer Seite oder einen großen, schwarzen Kater auf ihren Schultern. Ihre Devise ist: mit Worten Bilder malen.
Für diejenigen, die nur die Augen schließen müssen, um mit den Drachen zu fliegen.
Hinter Türen aus Stahl
Oder was mir wirklich Angst macht
Sie schoben meinen Rollstuhl durch den fensterlosen Korridor. Ich wurde von zwei Soldaten eskortiert. Links von mir lagen die verriegelten Türen, an der Decke flimmerte das unstete Licht der Neonröhren. Ich hatte noch kein Wort gesprochen und hatte auch nicht vor, mein Schweigen zu brechen. Von mir würden sie nicht erfahren, wohin die anderen geflüchtet waren und was sie vorhatten.
Dabei kostete es mich alle Mühe, den Mund zu halten. Ich hatte selbst unzählige Fragen. Allen voran wollte ich wissen, was sie mit Finn anstellten. Mich würden sie wegsperren, verhören und wahrscheinlich nicht besser behandeln als einen Ink. Aber Finn war nicht hier. Ihn brachten sie nicht in einen der verschlossenen Kellerräume.
Ich schwieg weiter, zerrte immer wieder an den Handschellen, mit denen sie mich an den Rollstuhl gefesselt hatten, und versuchte mir die Angst nicht anmerken zu lassen.
Vor einer der Türen hielten wir inne. Der Soldat neben mir hielt seinen Ausweis an den Scanner, das rote Licht sprang auf Grün und die Tür entriegelte sich mit einem leisen Klacken.
Dahinter lag ein weiterer endloser Korridor – ohne Fenster, ohne Tageslicht.
Hinter den Türen, die auf beiden Seiten des Ganges lagen, sah ich Bewegungen. Schatten huschten unter den Türschlitzen hindurch, Schritte waren zu hören, irgendwo summte jemand ein trauriges Lied. Ich schluckte schwer und zwang mich ruhig zu atmen, doch ganz wollte es mir nicht gelingen.
Als plötzlich jemand gegen eine der Türen sprang und mich dunkle Augen durch den Sehschlitz fixierten, schrak ich doch zusammen.
»Ruhe da drin!«, knurrte einer der Soldaten und schlug mit der Faust gegen die Tür.
Der Mann, der mich durch schmale, gefährlich wirkende Augen beobachtet hatte, wich zurück und verschwand wieder in der Dunkelheit.
Sie schlossen die Tür gleich daneben auf und schoben mich hindurch.
Dahinter lag eine kleine sterile Zelle, mit grauen Wänden, gefliestem Boden und einer in die hohe Decke eingelassenen grellen Lampe. In einer Ecke hing eine Metallpritsche an der Wand, gleich daneben war eine Toilette angebracht. Es gab keine Fenster, keine Nischen, nicht einmal ein Kissen oder auch nur eine Spinnwebe an der Wand.
Der Mann, der mich in diese Zelle geschoben hatte, löste mir die Handschellen und ich rieb mir meine wunden Gelenke. Der zweite Soldat war in der Tür stehen geblieben und hielt dabei sein Sturmgewehr vor der Brust.
Ich kannte den Mann. Wir hatten das eine oder andere Mal zusammen trainiert. Als ich die Steilwand überwunden hatte, war er einer derjenigen gewesen, die mir applaudiert und gratuliert hatten. Nun sah er mich an, als wäre ich eine Verräterin, eine Schwerverbrecherin, die er ihrer gerechten Strafe zuführte. Während sein Kollege mich abtastete, prüfte, ob bei der ersten Durchsuchung irgendwo eine Waffe übersehen worden war, fixierte ich den Mann in der Tür mit ebenso scharfem Blick wie er mich.
»Schnürsenkel?«, fragte er seinen Kollegen.
Der Mann hob den Saum meiner Hose und stellte fest, dass ich lediglich an einem Fuß einen Krankenhausschlappen trug. Den anderen hatte ich auf der Flucht verloren.
»Nein, auch kein Gürtel oder Schmuck«, sagte er.
»Das Haargummi.« Der finster dreinschauende Mann nickte in meine Richtung. Sein Kollege griff mir in den Nacken, löste meinen Zopf und die Strähnen meines silber gefärbten Haars fielen mir ins Gesicht.
Der Soldat mit dem Sturmgewehr starrte mich an, als könne er von meiner Stirn ablesen, was ich ihm verheimlichte. Doch er kam nicht darauf. Schließlich gab er auf, trat zur Seite und ließ seinen Kollegen hindurch.
Sie schlossen die Tür, doch ich wartete noch, bis ich die Schritte der Männer nicht mehr hören konnte, bevor ich mich umdrehte und den Einschub in meiner Rückenlehne abtastete. Ein Schmunzeln huschte mir über die Lippen, als ich das kleine, viereckige Etwas fand, das ich dort versteckt hatte. Mein Tagebuch.
Eine Waffe hätte mich wahrscheinlich weitergebracht, aber bei der hätte Cooper wohl nicht weggesehen. Als sie mich aber in den Rollstuhl gesetzt und ich mein Tagebuch darin versteckt hatte, war ich mir sicher, dass Cooper mich aus dem Augenwinkel beobachtete und dennoch nichts unternahm.
Vielleicht gab es doch noch Hoffnung für ihn.
»Geht es dir gut?«, fragte eine Männerstimme neben mir.
Ich sah mich noch einmal im Raum um. Natürlich war niemand zu sehen. Ich war alleine.
»Sie haben dir doch nicht wehgetan, oder?«, fragte der Mann besorgt. Mir kam die Stimme bekannt vor, doch ich konnte sie nicht gleich zuordnen. Ich strich mir das Haar hinter die Ohren und rollte näher an die Wand.
»Mir geht es gut«, antwortete ich und legte meine Hand auf den kahlen Beton.
»Du hättest auf mich hören sollen, Kleine«, sagte er. »Ich habe dich ja gewarnt. Am Ende hat dich auch dein Juckjuckzu nicht vor ihnen gerettet, was?«
Ich schrak von der Wand zurück und riss die Augen weit auf.
»Sie sind es!«, rief ich aus. »Der Mann aus dem Park.«
Ich konnte hören, wie der Mann in der Zelle neben mir lachte.
»Man sieht sich immer zweimal im Leben«, meinte er.
»Ich dachte, man hätte Sie …«
»Zurückgeschickt? Das ist es doch, was sie euch weismachen wollen, nicht wahr? Sie sagen euch, man würde uns helfen wollen, uns heimschicken, als ob sie uns so einfach ein Flugticket zurück nach Inkhausen in die Hand drücken könnten.«
»Es ist meine Schuld«, murmelte ich. »Wenn ich Ihnen geglaubt hätte, wären Sie jetzt nicht hier.«
»Gib dir nicht die Schuld daran, Kleine. Du wusstest es nicht besser und selbst wenn du mir geglaubt hättest, wärst du eben früher hier unten gelandet, ohne den Umweg über die oberen Stockwerke.«
Ich sah an mir herab. Hätte ich ihm geglaubt, wäre ich jetzt wohl auch nicht an diesen Rollstuhl gefesselt. Gut möglich, dass ich dann aber auch nicht mehr am Leben wäre. Wer konnte schon sagen, was die Gutenberg-Organisation mit Madheads anstellte, die nicht für sie arbeiten wollten.
»Was passiert hier unten mit den Inks?«, fragte ich.
Der Mann antwortete nicht.
Sein Schweigen ließ die Einsamkeit um mich herum bedrohlich wachsen. Ich wollte nicht zugeben, dass ich Angst hatte und mich verloren fühlte. Ich hatte Jane gesagt, dass es okay wäre, dass ich durchhalten würde, und den Soldaten gegenüber hatte ich keine Miene verzogen, doch die Wahrheit sah ganz anders aus.
»Mach dir darüber keine Gedanken«, sagte er nach einer Weile. »Erzähl mir lieber, was du nach unserem letzten Zusammentreffen erlebt und herausgefunden hast.«
Ich zögerte.
Was, wenn der Mann von der Organisation auf mich angesetzt worden war? Ich hatte erwartet, dass sie mich mürbe machen wollten, indem sie mich hier eine Weile versauern ließen, und irgendwann kämen sie dann, um mich in einen ihrer Verhörräume zu bringen und mich so lange mit Fragen zu löchern, bis ich irgendwann einknickte. Aber vielleicht war das gar nicht ihr Plan. Vielleicht waren sie viel gewitzter, viel hinterhältiger, als ich es ihnen zutraute. Konnte ich mir denn sicher sein, dass sie den Mann nicht längst gebrochen hatten? Ich durfte mich nicht dazu verführen lassen, ihm etwas zu verraten.
»Sag mir erst, was sie mit dir gemacht haben«, bat ich ihn.
»Da gibt es nicht viel zu sagen«, begann er zu erzählen. »Sie haben mich in diesen Raum gesperrt. Manchmal kommen sie und stellen mir Fragen, aber viel bekommen sie von mir nicht zu hören. Ich gebe ihnen immer nur so viele Informationen, dass sie glauben, noch einen Nutzen aus mir ziehen zu können, aber zu wenig, um ihnen damit zu helfen. Das musst du auch tun. Verrate ihnen nichts, aber lass sie auch nicht glauben, du wärst nichts mehr wert. Ich habe schon viele von uns kommen und gehen gesehen. Ich will nicht, dass dir das Gleiche passiert.«
»Viele wie wir?«, fragte ich. »Es tut mir leid, du irrst, wenn du glaubst, dass ich eine Ink bin. Ich komme nicht aus der anderen Welt.«
»Wir sind uns ähnlicher, als du vielleicht glaubst«, sagte er. »Wenn wir nur mehr Zeit gehabt hätten, hätte ich dir alles erzählt. Aber hier …«
Wieder schwieg er.
Ich sah hinauf zu der grellen Deckenleuchte. Wenn ich nur lange genug hinsah, war mir, als könnte ich einen toten Punkt im Licht erkennen. Da versteckte sich etwas hinter dem Milchglas. Eine Kamera.
»Sie haben Finn«, sagte ich. »Ich weiß nicht, was sie mit ihm anstellen werden.«
»Ist er ein Freund von dir?«, fragte der Mann.
»Ein Madhead, wie ich. Die anderen konnten fliehen.«
»Alle?«
»Alle bis auf einen«, sagte ich. »Er hat es nicht geschafft.«
»Aber du lebst. Daran musst du festhalten. Egal, was sie mit uns anstellen, vergiss das nicht. Du bist eine der Letzten, sie werden dich brauchen. Das ist dein Trumpf.«
Ich umschlang meinen Oberkörper mit den Armen und zwang mich, nicht zu weinen. Es war leicht, sich zu sagen, dass man stark sein musste, leicht, zu glauben unbesiegbar zu sein. Wenn man vor dem Fernseher saß, sich mit Popcorn vollstopfte und ungerührt dabei zusah, wie die Filmhelden in ausweglose Situationen gerieten, dann wusste man es immer besser. Dann nämlich glaubt man, dass man selbst nie so dumm, so leichtgläubig und schwach sein würde. Ja, es war wirklich leicht, sich für charakterfest und moralisch überlegen zu halten, solange man nicht selbst in so eine hoffnungslose Situation geriet. Erst dann, wenn die Türen sich hinter einem geschlossen hatten, wenn es niemanden mehr gab, der zu einem stand, und der Körper von Angst und Zweifeln gelähmt war, zeigte sich, wie schwach wir alle doch in Wirklichkeit waren.
Dieser Mann, den ich als verlotterten, verwirrten Penner kennengelernt hatte, von dem ich geglaubt hatte, er wäre in einer Anstalt besser aufgehoben, hatte in den letzten Wochen mehr Stärke bewiesen, als ich glaubte, je aufbringen zu können.
»Bist du noch da?«, fragte der Mann.
»Ja«, brachte ich tonlos über die Lippen.
»Erzähl mir von deiner Mutter«, bat er mich.
Er versuchte mich abzulenken. Ein Lächeln huschte mir über die Lippen und ich richtete mich wieder auf.
»Da gibt es nicht viel zu erzählen«, meinte ich.
»Ganz egal. Erzähl einfach.«
Also begann ich ihm von Bill, ihrem neuen Freund, zu erzählen, von ihrem Job und den Kollegen, die sie ausnutzten. Mir fielen Dinge ein, die ich glaubte, längst vergessen zu haben, lustige Geschichten, die mich zum Lachen brachten, aber auch eine Wehmut in mir weckten, die mein Herz schwer machte.
»Sie hat sich nicht verändert«, sagte der Mann.
Er kannte meine Mutter? Aber woher? Ich kam nicht dazu, diese Frage zu stellen, weil im selben Moment Schritte vor der Tür zu hören waren.
»Da kommt jemand«, flüsterte ich und rollte von der Wand weg. Ich wollte nicht, dass sie mitbekamen, wie ich mit meinem Zellennachbarn sprach – falls sie es nicht schon längst wussten.
Ich hörte, wie die Verriegelung der Tür aufsprang. Mein Herz pochte wild, aber ich wollte es mir nicht anmerken lassen. Sie durften meine Angst nicht spüren.
Als Cooper die Zelle betrat, wusste ich nicht, was ich davon halten sollte. War es Erleichterung oder Wut, die mich überkam? Wohl eine Mischung aus beidem.
Hinter ihm trat ein bewaffneter Soldat in die Tür und fixierte mich mit einem Blick, als habe er einen 400 Pfund schweren, muskelbepackten Gangster vor sich stehen und nicht etwa ein siebzehnjähriges Mädchen im Rollstuhl.
»Schon gut«, sagte Cooper zu dem Mann und schickte ihn mit einer knappen Handbewegung weg. »Ich komme zurecht.«
»Wie Sie meinen«, brummte der Soldat und zog die Tür wieder zu.
Kaum dass wir alleine waren, fiel Cooper vor mir auf die Knie und wollte meine Hände ergreifen. Ich entzog sie ihm.
»Ich wusste nicht, dass sie dir das antun würden«, beteuerte er.
»Macht das einen Unterschied?«, fragte ich vorwurfsvoll. »Du wusstest, dass sie die Inks hier einsperren. Bin ich denn besser als sie? Niemand hat es verdient, hier gefangen gehalten zu werden. Wie kannst du das nur gutheißen? Und wie kannst du es wagen, so zu tun, als wären wir Freunde, nachdem du mich belogen und betrogen hast?«
Ich rollte rückwärts von ihm weg. Der Mann, der da vor mir saß, war nicht der, den ich geglaubt hatte zu kennen. Er hatte mir selbst ins Gesicht gesagt, dass er aus Überzeugung für die Gutenberg-Organisation arbeitete. Und das hatte er in dem Wissen getan, dass sie hier unten Menschen einsperrten, verhörten und wie Abfall entsorgten, wenn sie keinen Zweck mehr erfüllten.
»Ich konnte dir hiervon nichts sagen«, erklärte er. »Was hier geschieht, unterliegt einer höheren Sicherheitsstufe als deiner. Es war mir schlichtweg untersagt, mit den Madheads darüber zu reden.«
»Und das macht es besser? Ihr tötet Menschen, verdammt noch mal!«
Cooper stand schwerfällig auf. Er sah mich nicht an, als er antwortete.
»Es sind keine Menschen«, meinte er nur. »Sie sind nicht einmal am Leben.«
Ich schüttelte ungläubig den Kopf.
»Sie atmen, reden, fühlen, sehen aus wie wir, handeln wie wir. Was sonst definiert uns als Menschen?«
»Wenn du ein Buch liest, weißt du doch auch, dass die Personen darin nicht echt sind, auch wenn du über ihre Gefühle liest und ihr Handeln nachvollziehen kannst. Nur weil du die Inks anfassen kannst, heißt das nicht, dass sie realer sind als eine Person aus einer Geschichte.«
»Das haben sie dir also aufgetischt und du schluckst diese Lüge einfach. Und warum? Weil es bequem ist?«
»Scar, ich kann das jetzt nicht mit dir ausdiskutieren. Ich riskiere schon viel, weil ich hier bin.«
Ich schnaubte verächtlich.
»Du riskierst also viel? Na super«, höhnte ich.
Cooper atmete tief durch. Es kostete ihn wohl alle Mühe, die Wut, die ich ihm entgegenbrachte, zu schlucken. Dabei hielt ich mich noch zurück. Wie wütend ich tatsächlich auf ihn war, hätte ich gar nicht in Worte fassen und ihm an den Kopf werfen können.
»Ich bringe dich hier wieder raus, okay?«, versprach er. »Du musst nur etwas durchhalten. Wenn ich dem Vorstand erkläre, dass du nicht freiwillig bei dieser verrückten Flucht mitgemacht hast, werden sie sicher einsehen, dass du uns als Madhead weiter nützlich sein kannst. Dir wird nichts geschehen, das verspreche ich dir. Du darfst hier nur keinen Aufstand machen, verstanden? Ich weiß, dass dich so schnell nichts und niemand einschüchtert, aber wenn du unbeschadet aus dieser Sache rauskommen willst, dann musst du so tun als ob. Zumindest so lange, bis ich den Vorstand überzeugen konnte.«
»Was ist mit Finn?«, fragte ich in einem Ton, der nicht durchblicken ließ, ob ich mich auf seinen Vorschlag einlassen würde.
Cooper reagierte nicht gleich, was es mir nicht leicht machte, ihn weiter ungerührt anzusehen. Panik stieg in mir auf und wuchs mit jeder Sekunde, in der er mir die Antwort schuldig blieb.
»Das kann ich dir nicht sagen«, meinte er schließlich.
»Wie bitte?«, schrie ich ihn an und rollte auf ihn zu. Ich fuhr ihm gegen sein Schienbein und schlug mit den Fäusten auf ihn ein. »Du kannst mich mal, mit deiner verdammten Geheimhaltung! Alles, was du sagst, sind doch nur Lügen! Ich hasse dich!«
Ich war außer mir vor Wut und hatte keine Kontrolle mehr über das, was ich sagte und tat. Cooper versuchte meine Schläge abzuwehren, ohne mir dabei wehzutun. Immer wieder riss ich mich von ihm los, wenn er meine Fäuste abfing, bis sich seine Hände schließlich so fest um meine Arme schraubten, dass ich keine Chance mehr hatte loszukommen.
»Lass mich los!«, schrie ich vergebens.
Cooper sah flüchtig zur Tür, dann ging er vor mir auf die Knie.
»Ich würde es dir sagen, wenn ich es wüsste«, beteuerte er. »Ich würde dir alles sagen. Keine Geheimnisse mehr, ja? Ich werde dir nie wieder etwas vorenthalten.«
Tränen überkamen mich. Ich versuchte sie zurückzuhalten, versuchte mich an meinen Hass auf Cooper zu klammern, um ihm gegenüber keine Schwäche zu zeigen, doch es gelang mir nicht.
Cooper zog mich an sich heran. Ich wollte mich dagegen wehren, doch er war zu stark. Er war der letzte Mensch auf Erden, von dem ich mich trösten lassen wollte, und doch tat es gut, von ihm gehalten zu werden.
In meinem Versuch, von ihm loszukommen, rutschte ich vom Rollstuhl. Er schlang seine Arme um mich und hielt mich so lange fest, bis ich keine Kraft mehr hatte, mich zu wehren.
Was hatten sie Finn angetan? Wenn er nicht hier war, in keiner dieser Zellen, wo war er dann? Ich kämpfte gegen den Gedanken an, dass er schon nicht mehr am Leben sein könnte. Das durfte nicht sein. Er war nur meinetwegen zurückgeblieben. Alles, was sie ihm antun würden, wäre ganz allein meine Schuld.
»Schon gut«, flüsterte Cooper und strich mir übers Haar.
Lance' Geschichte
Oder wie sehr mich die Soldaten hassen
Ich sah hinauf zur Deckenleuchte. Zumindest war ich mir jetzt sicher, dass sie mich nicht hören konnten. Cooper hätte nicht so offen mit mir gesprochen, wenn dem so wäre.
Andererseits wusste ich nicht, wie viel sie ihm tatsächlich sagten. Ich war wochenlang in dieser Organisation gewesen und hatte keine Ahnung von dem, was sie in Wirklichkeit taten. Wie konnte ich mir da sicher sein, dass Cooper von deren Überwachungssystem eine Ahnung hatte? Vielleicht glaubte er so wie ich damals, alles zu wissen, und bekam doch nur mit, was man ihm weismachen wollte.
»Ein Freund von dir?«, fragte der Mann in der Zelle nebenan.
»Cooper? Keine Ahnung«, antwortete ich durch zusammengebissene Zähne.
Ich wusste es wirklich nicht. Konnte ich ihm vertrauen? Zwar hatte er mir versprochen, keine Geheimnisse mehr vor mir zu haben, aber das änderte nichts daran, dass er an den Prinzipien der Organisation festhielt.
Es war auch nicht so, dass er mich bloß hier rausholen wollte. Er wollte, dass ich rehabilitiert wurde und der Organisation weiterhin als Madhead diente. Doch das war eine Richtung, die ich ganz sicher nie wieder einschlagen würde.
»Du kanntest meine Mutter«, sagte ich nach einer Weile. »Woher?«
»Komm näher, Kleine, damit ich nicht so schreien muss«, bat er mich.
Ich rollte wieder an die Wand und legte meine Hand auf den Beton.
»Wenn ich dir das jetzt erzähle, sprich nicht laut aus, was du daraus schließt. Ich weiß nicht, wie viel sie von dem, was wir hier miteinander sprechen, mitbekommen.«
»Ich denke nicht, dass sie uns abhören«, meinte ich.
»Versprich es mir einfach«, bat er mich.
»Okay.« Ich nickte.
»Hat dir deine Mutter von ihrer Zeit an der Uni erzählt?«, fragte er.
Das hatte sie tatsächlich mehr als einmal. Damals hatte sie noch geglaubt, dass mal was aus ihr werden würde. Sie hatte große Ziele gehabt, die sie schlussendlich nicht verwirklichen konnte. Die Schuld daran gab sie anderen.
»Ja, hat sie«, bestätigte ich.
»Wir hatten ein paar Kurse zusammen.«
»Dann hast du nur so getan, als würdest du unsere Sprache nicht sprechen, als die Soldaten uns geschnappt haben?«, fragte ich.
Er lachte.
»Wie heißt du?«, fragte ich. Auch wenn mein Gedächtnis schlecht war, so würde mir beim Klang seines Namens vielleicht einfallen, ob sie mir von ihm erzählt hatte.
»Das tut nichts zur Sache«, meinte er. »Alles, was du wissen musst, ist, dass wir uns wegen Thomas nicht mehr sehen konnten.«
Wegen Thomas? Was hätte mir das sagen sollen?
»Ich verstehe nicht«, sagte ich.
»Ich war ein paar Jahre bei ihm. Thomas. Sie wollte mich nicht wiedersehen. Verstehst du jetzt?«
»Nein, tut mir leid, der Name sagt mir nichts.«
»Sicher?«, fragte er. »Steve Thomas?«
»Nein, ich …« Mit einem Mal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. S. T. Thomas. St. Thomas. Das Sankt-Thomas-Hospital. »Nein, das sagt mir wirklich nichts, also lassen wir das Thema, ja? Es ist ja auch egal.«
Ich sagte das so übereilt und mit zittriger Stimme, dass meine Verunsicherung nicht zu überhören war.
Meine Mutter hatte die Uni abgebrochen, weil ihr Freund, den sie heiraten wollte und von dem sie ein Kind erwartete, eingewiesen worden war. Er kam in die geschlossene Anstalt des Sankt-Thomas-Hospitals. Das war es, was ich nicht offen aussprechen durfte. Er war mein Vater. Ich konnte es nicht glauben.
Dann war er in Wirklichkeit gar kein Ink? War er ein Madhead wie ich und wurde irrtümlich für einen Menschen aus der anderen Welt gehalten? Alfie hatte ihn aber doch einwandfrei als Ink identifiziert und die Soldaten hatten nicht verstehen können, was er sagte. Konnte man als Madhead denn lernen, wie ein Ink zu sprechen? Ich hatte so viele Fragen und konnte keine davon stellen.
»Wie viel weißt du über die Madheads?«, fragte ich schließlich mit tonloser Stimme. »Bist du …?«
»Nein, ich bin das, was ihr einen Ink nennt«, erklärte er.
Es wollte sich mir nicht begreiflich machen. Wenn er das wirklich war, dann war ich die Tochter zweier Welten. Und nicht nur das, dann war mein Vater ein toter Mann. Ein toter Mann, der gerade mit mir sprach.
»Dein Freund, der Mann, der eben bei dir war, der hält nicht viel von uns Inks, nicht wahr?«
Ich nickte, was er natürlich nicht sehen konnte.
»Ihr seid aus der anderen Welt und die ist nicht echt. Sie besteht nur aus Geschichten«, murmelte ich. »Außerdem glaubt die Organisation, dass die Inks in ihrer Welt getötet wurden.«
»So ist es auch«, bestätigte er. »Ich muss zugeben, dass ich mich an nicht sehr viel erinnern kann. Anfangs wusste ich gar nichts, aber nach und nach kehrten ein paar wenige Erinnerungen zurück. Ich weiß, dass es seit Anbeginn verboten war, einen der unsrigen zu töten. Es war nicht nur verboten, es war schlichtweg nicht möglich. Doch dann änderte sich alles. Morgain änderte alles. Sie stürzte unsere Welt in Chaos, sie tötete ihre Widersacher.«
»Also auch dich?«, fragte ich.
»Ja, sie nahm mir das Leben. Doch statt zu sterben, kam ich in eurer Welt wieder zu mir. Es dauerte, bis ich mich eingelebt hatte, doch je mehr Erinnerungen zurückkamen, desto schwerer fiel es mir, mich einzugliedern. Ich konnte das Gefühl nicht loswerden, eine Aufgabe zu haben. Nur welche? Das machte mich schier verrückt.«
»So verrückt, dass du …« Ich sprach nicht weiter. Wenn man uns wirklich zuhörte, durften sie nicht erfahren, dass mit Thomas das Sankt-Thomas-Hospital gemeint war. Erführen sie, dass er in der Geschlossenen gewesen war, würden sie die Verbindung zu meiner Mutter ziehen können, sie würden herausfinden, dass er mein Vater war und ich somit die Tochter eines Inks.
»Dass ich mich irgendwann an die Organisation verraten habe«, ergänzte er.
»Wie soll ich dich nennen?«, fragte ich.
»Nenn mich Lance«, bat er. Sicher war das nicht sein Name. Es war nicht einmal der Name, den er meiner Mutter genannt hatte, doch es war sicherer, ihn so zu nennen.
»Sind alle Madheads so wie ich?«, fragte ich nach einer Weile.
»Ich denke schon«, sagte er. »Aber lassen wir das Thema. Wir sollten uns lieber Gedanken darüber machen, wie wir dich hier rausholen.«
Ich lachte bitter. Er war ein Gefangener, genauso wie ich. Wie hätte es uns gelingen können, zu entkommen? Und selbst wenn wir aus diesen Zellen kämen, gab es noch immer die Wachen auf den Gängen, die verschlossenen Türen und drei Stockwerke voller Soldaten, die zwischen uns und dem Ausgang lagen.
»Wir befinden uns beide in derselben ausweglosen Situation«, sagte ich.
»Nein, nicht ganz. Du kannst auf den Vorschlag deines Freundes eingehen. Lass dir von ihm helfen.«
Ich antwortete nicht darauf. Wenn das die einzige Option war, die blieb, wusste ich nicht, ob es mir nicht lieber wäre, hier unten zu versauern. Lieber bliebe ich auf ewig in dieser Zelle, als mich auf Cooper einzulassen.
***
Die Zeit verging quälend langsam. Ich hatte keine Ahnung, ob Stunden oder Tage verstrichen, konnte mich weder am Sonnenlicht noch an einer Uhr orientieren und so blieben mir nur meine Gedanken, die sich ständig im Kreis drehten.
In der Zelle nebenan saß mein Vater, doch ich wagte es nicht, ihm Fragen zu stellen. Aber wann sonst, wenn nicht jetzt? Sicher hatte er sich unser Wiedersehen auch anders vorgestellt.
Irgendwann brachte man mir ein Tablett mit Essen. Sie stellten es auf den Boden, als ob sie mich mit Absicht quälen wollten. Nachdem die Tür geschlossen war, rollte ich hin und betrachtete mit gerümpfter Nase die Schüssel Haferbrei. Doch dann wanderten meine Gedanken wieder zu Finn, dessen Leibspeise ich gerade vor mir stehen hatte. Ich wusste noch immer nicht, was mit ihm geschehen war. Saß er in einem Verhörraum oder in einer anderen Zelle, wo sie ihm gerade die gleiche Mahlzeit servierten?
»Ich weiß, es ist kein Rumpsteak, aber du solltest auf jeden Fall essen«, riet mein Vater mir. »Du musst bei Kräften bleiben, für unsere Flucht.«
»Wie stellst du dir das vor?«, fragte ich. »Wir können ja schlecht einfach hier rausspazieren.«
»Uns fällt schon was ein«, versprach er mir.
Aber so einfach war das nicht. Am Ende würde ich vielleicht wirklich auf Coopers Vorschlag eingehen müssen. Meinen Vater rettete das aber nicht.
»Weißt du, ich habe deiner Mutter früher oft von meiner Welt erzählt«, begann er. Ich ließ das Essen stehen und rollte näher an die Wand. »Ich erinnere mich noch, wie wir auf der Kühlerhaube ihres alten Ford Mustang lagen – über uns der klare Sternenhimmel – und sie an meinen Lippen hing, als ich ihr von den Nordwinden erzählte, die in meiner Welt die Sterne über den Nachthimmel treiben. Selbst tagsüber sieht man sie manchmal in kleinen Schwärmen durch die Wolken ziehen. Aber erst abends, wenn alles schläft, wagen sie sich alle aus ihren Verstecken und lassen sich von den Winden südwärts treiben. Sie hat diese Geschichten geliebt. Zumindest solange sie noch glaubte, dass es nichts weiter als Geschichten waren.«
»Wenn ich ihr etwas von den Dingen, die ich sehen kann, erzählt habe, hat sie mich beschimpft«, murmelte ich. »Ich habe früh gelernt, solche Dinge für mich zu behalten.«
»Das darfst du ihr nicht übel nehmen. Sie wusste es nicht besser«, sagte er.
Obwohl mir klar war, dass er recht hatte, tat es doch weh, daran zu denken. Alles wäre anders gekommen, wenn er bei uns geblieben wäre. Er hätte mir erklären können, wer ich wirklich war, und wir hätten versuchen können einen Weg in die Welt der Tinte zu finden – eine Welt, der ich mich schon immer viel verbundener gefühlt hatte und von der ich jetzt endlich wusste, warum das so war.
Ich öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch mir fielen keine Fragen ein, die ich hätte stellen können. Eigentlich hatte ich Hunderte, aber keine davon durfte ich hier laut aussprechen.
Auf dem Korridor waren wieder Schritte zu hören.
»Da kommt jemand«, flüsterte ich.
Ich war erleichtert, als sie meine Tür öffneten und nicht die zur Zelle meines Vaters. Wenn sie ihn holen kämen, würde ich ihn vielleicht nie wiedersehen. Ich hatte ihn doch gerade erst gefunden, da durften sie ihn mir nicht gleich wieder nehmen.
Es war Cooper, der meine Zelle betrat. Ich fixierte ihn durch schmale Augen.
»Hast du was herausgefunden?«, fragte ich.
Er warf einen flüchtigen Blick zu dem bewaffneten Soldaten an der Tür. Falls er etwas über Finn wusste, hatte er wohl nicht vor, mir das in dessen Gegenwart zu sagen.
»Der Vorstand wird dich anhören«, sagte er. »Ich habe ihnen alles erklärt. Es liegt jetzt an dir, sie zu überzeugen.«
»Was hast du ihnen erklärt?«
Cooper trat hinter mich und schob meinen Rollstuhl in Richtung Tür.
»Bitte, Scar«, flüsterte er mir ins Ohr. »Versuch wenigstens, nicht die Aufmüpfige zu spielen.«
Er sagte das so, als wäre mein Widerstand gegen die Organisation nichts weiter als das Gehabe eines protzigen Kindes. Ich warf einen Blick nach rechts, wo mein Vater schweigend auf der anderen Seite der Mauer verharrte. Wenn ich ihn wiedersehen wollte, hatte ich wohl keine andere Wahl, als über meinen Schatten zu springen.
Cooper schob mich auf den Gang, wo der Soldat, der uns als Wache begleiten wollte, schon die Handschellen bereithielt.
»Das wird nicht nötig sein«, wehrte Cooper ihn ab.
»Wie Sie meinen«, brummte der Mann und folgte uns mit etwas Abstand.
Sie brachten mich raus aus dem Gefangenentrakt, die Treppe hinauf, in den ersten Stock, wo mich alle anstarrten.
Ich trug noch immer die verschmutzte Krankenhauskleidung, die ich schon bei meiner Flucht getragen hatte, nur einen Schlappen am Fuß und offenes, strähniges Haar. Ich fühlte mich, als würden sie mein Versagen vorführen wollen. Den verächtlichen Blicken ausgesetzt, sank ich tiefer in meinen Stuhl und starrte auf den Boden.
Wir kamen am Haupteingang vorbei. In Höhe der Treppe zum Foyer hielt Cooper an, als sich jemand vor uns aufbaute.
»Hast du ihr gesagt, dass alle Missionen gestrichen wurden?«, fragte Maggie.
Ich sah nun doch auf. Sie hatte sich uns breitbeinig in den Weg gestellt, die Fäuste in die Seiten gestemmt, und einen Blick aufgesetzt, durch den Milch hätte ranzig werden können.
»Das ist nicht der richtige Zeitpunkt«, ermahnte Cooper sie.
»Und wann soll der sein?«, fragte Maggie. »Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl bei ihr. Mir war klar, dass die nur Ärger macht. Und jetzt schau, was sie angerichtet hat!«
»Ich habe keine Ahnung, was man dir erzählt hat, aber …«, begann ich, doch Cooper fiel mir ins Wort.
»Geh aus dem Weg, Maggie, oder ich sorge dafür, dass du die längste Zeit auf Mission gegangen bist.«
»Das wagst du nicht!«, zischte sie.
Cooper trat vor, packte Maggie am Arm und zog sie von mir weg. In gewisser Weise konnte ich verstehen, dass sie und die anderen Mitglieder der Organisation wütend waren. Zumindest diejenigen, die keine Ahnung von dem hatten, was im Keller geschah, würden nicht verstehen können, warum die Madheads sie verraten hatten.
Cooper stritt mit Maggie, doch sie wollte sich nicht belehren lassen. Schließlich riss sie sich von ihm los, warf mir noch einen wütenden Blick zu, dann wandte sie sich zum Gehen.
Ich sah ihr nach, da wirbelte sie doch wieder herum und tat einen großen Schritt auf mich zu. Der Soldat, der bisher unbeteiligt hinter mir gestanden hatte, sprang dazwischen, stieß mich von ihr weg und versperrte Maggie den Weg.
»Keinen Schritt näher!«, drohte er.
Ich fasste an die Greifringe, um meinen Rollstuhl zum Stehen zu bringen, doch ich war nicht schnell genug. Der Soldat hatte mich unbeabsichtigt zur Treppe hin gestoßen und ich konnte nicht verhindern, rückwärts die Stufen hinunterzupoltern. Cooper sprang mir noch nach, verfehlte aber meine Hand, nach der er greifen wollte.
Ich kippte um, stieß mir den Ellbogen an und überschlug mich mehrmals. Der Rollstuhl schlug neben mir auf, als ich im Foyer auf dem Boden landete.
Mein ganzer Körper schmerzte. Ich stöhnte und stemmte mich mühsam hoch. Hinter mir hörte ich schon Coopers Schritte, vor mir sah ich die Tür. Sie war so nah und doch unerreichbar für mich. Ich drehte mich auf den Rücken und starrte an die Decke.
»Geht es dir gut?«, fragte Cooper besorgt und ließ sich neben mir auf die Knie fallen. Er beugte sich über mich und strich mir das Haar aus dem Gesicht.
Diese Szene erinnerte mich an meinen Sturz von der Steilwand. Mein Herz hatte damals schneller geschlagen, weil er mir so nah gewesen war. An seinem Blick hatte sich nichts geändert, nur die Umstände waren andere geworden.
Er stellte den Rollstuhl auf und half mir mich aufzusetzen. Oben an der Treppe sah ich Maggie stehen. Der Soldat hielt sie fest, doch sie riss sich los und stapfte davon. Von Mitgefühl war in ihren Zügen nichts zu lesen. Auch die anderen, die an der Galerie standen und den Vorfall beobachtet hatten, blieben ungerührt.
»Es geht schon«, murmelte ich.
»Nimm es ihr nicht übel«, bat Cooper mich. »Die Leute hier haben sich der Rettung unserer Welt verschrieben. Sie haben ihr altes Leben, ihre Familie und Freunde hinter sich gelassen, um für diese Sache zu kämpfen. Aber ohne Madheads sind wir machtlos. Ohne eure Unterstützung können wir kaum etwas ausrichten.«
»Ich kann nichts dafür, dass sie keine Ahnung haben, was sie mit ihren Aktionen tatsächlich anrichten.« Ich sah Cooper vielsagend an. Es war mir klar, dass er noch immer an die Organisation glaubte. Er redete von den anderen, als wäre er keiner von ihnen, dabei dachte er genauso.
Cooper ging nicht darauf ein. Er wich meinem Blick aus und schob mir seinen Arm unter die Beine.
»Ich helfe dir«, sagte er, ohne mich dabei ansehen zu können, und hob mich hoch.
Während er mich die Treppe hinauftrug, rannte der Soldat runter, holte meinen Rollstuhl und stellte ihn mir, oben angekommen, wieder bereit.
»Und es geht dir wirklich gut?«, fragte Cooper, nachdem er mich abgesetzt hatte.
»Nur ein paar blaue Flecke«, bestätigte ich und rieb mir den schmerzenden Oberschenkel. »Ich bin bereit für meine Inquisition.« Ich deutete in die Richtung, in die wir unterwegs gewesen waren.
»Sie werden dir nur ein paar Fragen stellen«, meinte Cooper und schob meinen Rollstuhl wieder an.
Er brachte mich zu den Konferenzräumen. Dass die Leute vom Vorstand mich nicht in einem ihrer winzigen Verhörräume durchlöchern würden, hatte ich mir schon gedacht. Ich war gespannt auf das, was mich nun erwartete.
Das Tribunal
Oder warum ich meine Klappe nicht halten kann
Was mich im Konferenzraum erwartete, glich einem Tribunal. Cooper schob meinen Rollstuhl in die Mitte des Raumes und nahm selbst eine defensive Position am Rand des Geschehens ein. Vor mir stand ein langer Tisch, an dem fünf finstere Gestalten saßen. In ihrer Mitte ein Mann im Anzug, mit ergrautem Haar und gestutztem Bart. Seine Hände hatte er pyramidenförmig zusammengelegt, sein Blick durchbohrte mich. Er musste sich nicht vorstellen. Ganz zweifelsohne saß dort Professor Morrigan vor mir. Finns Stiefvater.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!