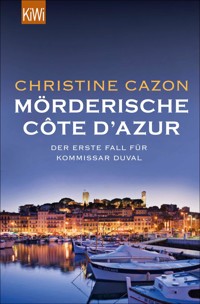Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Duval ermittelt
- Sprache: Deutsch
Tod am Traumstrand – Sein vierter Fall führt Léon Duval in die Welt der fliegenden Händler von Cannes. Ein Afrikaner wird am Bijou Plage, einem der schönsten Strände der Stadt, tot aufgefunden. Gibt es einen Zusammenhang mit den an der Grenze zu Italien ausharrenden Flüchtlingen, die immer wieder versuchen, mit selbst gebauten Booten nach Frankreich zu kommen? Oder ist alles doch ganz anders? Der Tote ist nämlich ein fliegender Händler aus dem Senegal. Von ihnen gibt es viele in der Stadt, sie verkaufen an den Stränden und in den Straßen ihre Waren an Touristen. Aber wer könnte ein Interesse daran haben, einen armen Straßenhändler zu ermorden? Duval erkennt bald, dass mehr hinter der Sache steckt, als zunächst vermutet. Zumal, als noch eine zweite Leiche auftaucht. Aber auch seine Freundin, die Journalistin Annie, die eigentlich für ein paar Tage Urlaub aus den Bergen nach Cannes gekommen ist, stellt Nachforschungen an. Sehr zum Ärger von Duval und seinen Kollegen.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christine Cazon
Endstation Côte d’Azur
Der vierte Fall für Kommissar Duval
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Christine Cazon
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Christine Cazon
Christine Cazon, Jahrgang 1962, lebt mit ihrem Mann und zwei Katzen in Cannes. »Endstation Côte d’Azur« ist ihr vierter Krimi mit Kommissar Léon Duval.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Sein vierter Fall führt Léon Duval in die Welt der fliegenden Händler von Cannes. Ein Afrikaner wird am Bijou Plage, einem der schönsten Strände von Cannes, tot aufgefunden. Gibt es vielleicht einen Zusammenhang mit den an der Grenze zu Italien ausharrenden Flüchtlingen, die immer wieder versuchen, mit selbst gebauten Booten nach Frankreich zu kommen? Oder ist doch alles ganz anders? Der Tote ist nämlich ein fliegender Händler aus dem Senegal. Von ihnen gibt es viele in der Stadt, sie verkaufen an den Stränden und auf den Straßen ihre Waren an Touristen. Im Laufe der Ermittlungen wird Duval jedoch klar, dass hinter der Sache mehr steckt als zunächst vermutet. Zumal, als noch eine zweite Leiche auftaucht. Doch er ist nicht der Einzige, der sich für diese Todesfälle interessiert, auch seine Freundin, die Journalistin Annie, recherchiert und ermittelt auf eigene Faust. Sehr zum Unmut von Duval und seinen Kollegen.
Hinweis für E-Reader-Leserinnen und -Leser
Wenn Sie sich die Karte in Farbe und zoombar ansehen möchten, dann geben Sie bitte die folgende Internetadresse im Browser Ihres Computers oder Smartphones ein:
www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karte-zu-endstation-cote-dazur
Hinweis für Leserinnen und Leser auf dem Smartphone/Tablet oder am Computer
Sie möchten sich die Karte zoombar anschauen? Dann tippen bzw. klicken Sie bitte auf die Abbildung. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden Website-Ansicht.
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum Buch
Widmung
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Danksagung
Nachwort
Der vorliegende Roman ist von der Realität inspiriert. Vieles hat hier in den vergangenen Monaten so oder ähnlich stattgefunden. Auch die Stadt Cannes und manche der beschriebenen Orte sind reell. Dennoch ist diese Geschichte fiktiv, ebenso wie die darin vorkommenden Personen. Ihre beruflichen wie privaten Konflikte und Handlungen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
À ceux qui cherchent où se trouve le futur
Mieux vaut de la poussière aux pieds qu’aux fesses.
Proverbe sénégalais
1
Das Raunen, das Gelächter und die laute, wummernde Musik waren schlagartig verstummt, kaum dass sie vor der Tür standen. Nur die Bässe vibrierten noch im Asphalt oder spürte sie sie in ihrem Körper? Ihre Ohren waren leicht taub. Wie ausgespuckt fühlte sie sich. Als habe ihr der Lärm im Nachtklub Geborgenheit gegeben. In der Nähe schlug eine Autotür zu und ein Motor startete. Sie lehnte sich kurz an die geschlossene Tür und atmete durch.
»Anaïs? Alles okay?«, fragte Jeremy besorgt und berührte leicht ihre Schulter.
Sie nickte. »Ich bin erschöpft und in meinem Kopf rauscht es.«
Er nahm ihre Hand und zog sie an sich. Dann küsste er sie sanft in den Nacken.
»Lass, ich bin total verschwitzt«, wehrte sie ihn ab.
»Ich mag deinen Geruch.« Er küsste sie erneut am Haaransatz ihres Nackens und leckte leicht an ihrem Hals. »Und ich mag deinen Geschmack«, nuschelte er dabei.
Sie schnurrte. »Du machst mir Gänsehaut«, kicherte sie leise und wand sich ein bisschen.
»Ich weiß.« Sachte pustete er ihr in den Nacken. Sie drückte sich an ihn, schlang die Arme um seinen Hals und sie küssten sich lang und ausgiebig. »Lass uns gehen.« Er zog sie mit sich und sie stakte auf ihren hohen Absätzen unsicher hinter ihm her.
»Wo gehen wir hin? Nicht ins Hotel?«
»Nein, ich habe noch eine Überraschung für dich!«
»Echt?« Sie quietschte begeistert. »Noch eine Überraschung?« Jeremy war wirklich ein Glücksgriff. Um Mitternacht hatte er ihr schon ein Kettchen mit einem Diamantherz umgehängt. »Joyeux anniversaire, mein Herz!«, hatte er dabei schon in ihr Ohr geflüstert. Und jetzt noch eine Überraschung! »Wo gehen wir hin?«, fragte sie aufgekratzt.
»An einen magischen Ort.«
»An einen magischen Ort«, wiederholte sie kichernd, »Anaïs im Wunderland, wie wunderbar!«
Die Luft war lau. Der Mond schien hell. Vollmond?
Sie blieb stehen und starrte in den Himmel. Nein, kein Vollmond. War er jetzt zunehmend oder abnehmend? Sie wusste es nie. Langsam schob sich eine Wolke vor den Mond. Es wurde dunkel und kühler. Sie verzog das Gesicht zu einem beleidigten Schnütchen.
»Chérie, komm!« Jeremy nahm ihre Hand und zog sie hinter sich her. Sie folgte unwillig.
»Ist es noch weit bis zum Paradies?«, jammerte sie. »Mir tun die Füße weh.«
»Magischer Ort habe ich gesagt, nicht Paradies«, berichtigte Jeremy. »Aber wir sind gleich da.« Sie liefen durch den Jachthafen. Hier und da war noch Licht auf den Booten. Man hörte leise Musik, Gläserklirren und Gelächter.
Anaïs war schon wieder stehen geblieben. Erneut verzog sie das Gesicht und seufzte theatralisch. »Ich mag nicht mehr laufen. Sind wir bald da? Ansonsten ist er mir egal, dein magischer Ort.«
»Allez, Chérie«, er versuchte nicht allzu viel Ungeduld in seine Stimme zu legen. »Komm«, sagte er leise und lockend, »es ist jetzt nicht mehr weit.«
Sie quengelte leise, aber Jeremy hörte sie nicht, er war schon zu weit entfernt. »Warte!«, rief sie und befreite sich ungelenk von den hochhackigen Sandaletten. Barfuß lief sie nun hinter ihm her und schlenkerte die Schuhe in der Hand. Jeremy war plötzlich ein paar unscheinbare Stufen hinaufgestiegen und streckte ihr helfend die Hand entgegen. Mit seiner Hilfe balancierte sie vorsichtig zuerst über Stufen, dann über ein paar Steine. Nun hüpfte sie zu ihm hinunter.
»Oh!«, machte sie überrascht und sah verzückt auf die kleine Sandbucht, die vor ihr lag.
»Na, habe ich dir zu viel versprochen?«
»Neiiin«, sie schüttelte den Kopf. »Oooh, wie wundervoll«, seufzte sie und lief über den kühlen Sand, dann breitete sie juchzend die Arme aus und drehte sich zwei-, dreimal im Kreis, bis sie stolperte.
Jeremy fing sie auf. »Schau, der Mond ist wieder da!«, sagte er und tatsächlich schimmerte es wieder silbrig vom Himmel.
»Komm, lass uns schwimmen gehen.«
»Aber …«, setzte sie an. »Du meinst jetzt? So? Ohne alles?« Sie zögerte. »Und wenn uns jemand sieht?«
Mit suchendem Blick und ausgebreiteten Armen drehte er sich einmal demonstrativ im Kreis. »Siehst du jemanden?«, fragte er und gab sich sofort selbst die Antwort. »Niemand! Es ist niemand da, und wenn schon, dann sind es auch Leute, die …«, er zögerte kurz, »ihre Ruhe haben wollen«, sagte er zweideutig.
Sie zögerte immer noch.
»Allez, Chérie … was ist schon dabei?« Jeremy zog bereits das Poloshirt über den Kopf und warf es auf den Sand, schüttelte seine Schuhe von den Füßen und war im Nu aus der weißen Jeans geschlüpft. Schnell streifte er noch seinen Slip ab und lief schon in das vom Mond beschienene Wasser.
»Komm!«, rief er lockend. »Das Wasser ist wunderbar, überhaupt nicht kalt, und schau, wie es glitzert!« Er zeigte auf die flimmernde Wasseroberfläche, tauchte kurz unter und wieder auf und machte mehrere energische Kraulbewegungen. Dann legte er sich auf den Rücken und ließ sich treiben.
»Anaïs, Schätzchen, komm!«
Ein Mitternachtsbad. Die romantischste aller Ideen. Und natürlich wäre es in einem Bikini nicht halb so romantisch. Sie gab sich einen Ruck. Und warf kurz entschlossen das helle, kurze Sommerkleid von sich. Dann entledigte sie sich ihres weißen Spitzen-BHs und des Stringtangas, nahm die Spange aus den hochgesteckten dunklen Haaren und schüttelte sie leicht. Sie versteckte ihre kleine Handtasche unter Jeremys Jeans und rannte dann zu ihm und ins Meer. »Hiii«, quietschte sie und stieß, während sie weiterlief, noch ein paar kieksende Schreie aus, »hiii, ooooh, es iiiist kalt, hiiii.« Und dann war sie weg.
»Anaïs!« Jeremy schrie auf und kraulte auf die Stelle zu, wo sie verschwunden war. »ANAÏS!« Er tauchte.
»Merde!«, schimpfte sie, als sie wieder auftauchte. Sie japste nach Luft, hustete und spuckte. »Da war plötzlich kein Boden mehr!«, schrie sie aufgeregt und machte ein paar hastige Schwimmbewegungen.
»Oh Mann, du hast mir vielleicht einen Schrecken eingejagt.« Jeremy stieß die Luft hörbar aus. »Alles okay?« Er zog sie zurück ins flachere Wasser, wo sie wieder stehen konnte.
»So eine Scheiße!« Sie schlug wütend ins Wasser. »Ich bin super erschrocken, da war plötzlich kein Boden mehr!« Empört sah sie Jeremy an, als sei alles seine Schuld. »Ich hätte ertrinken können!«, fügte sie dramatisch hinzu, als er nur amüsiert lachte.
»Sssssch! Alles gut!«, versuchte Jeremy sie zu beruhigen. »So schnell ertrinkt man nicht, Anaïs. Es ist ja nichts passiert. Schau, wie toll das Wasser aussieht!« Die mondbeschienene Wasseroberfläche funkelte und glitzerte unablässig. »Ist das nicht großartig?«
»Mhhh«, machte sie und schniefte. »Nichts passiert! Du bist gut, von wegen nichts passiert«, nörgelte sie leise. »Ich bin furchtbar erschrocken und habe literweise Salzwasser geschluckt. Und ich hätte wohl ertrinken können!«, wiederholte sie unzufrieden.
»Ach Schätzchen, komm her«, Jeremy umarmte sie leicht. »Alles gut«, redete er mit beruhigender Stimme auf sie ein.
»Außerdem ist das Wasser doch ganz schön frisch«, sagte sie immer noch vorwurfsvoll und zog bibbernd die Schultern zusammen, »und gar nichts glitzert!« Sie zeigte empört in den Himmel, wo sich erneut eine Wolke vor den Mond geschoben hatte. Kurzzeitig war es dunkel. »Mir ist kalt!«
»Ich seh’s«, murmelte Jeremy und leckte die erigierten Brustwarzen ihrer kleinen festen Brüste.
»Oh Jeremy«, sagte sie mit gespielter Empörung, dann kicherte sie leise und ließ ihn gewähren.
Die Wolken zogen langsam am Mond vorüber. Selbstvergessen standen sie im nun wieder silbrig funkelnden Wasser. Jeremy küsste ihren Nacken, leckte an ihrem Ohrläppchen und streichelte mit beiden Händen gleichzeitig zart über die Gänsehaut ihrer Schultern. Sie genoss es sichtlich, schmiegte sich in seine Berührungen und legte ihren Kopf in den Nacken. »Mmmmhhhhh«, seufzte sie lang und intensiv.
»Meine kleine Meerjungfrau …«, murmelte er leise und begann nun, ihren ganzen Körper mit kleinen leckenden Küssen zu bedecken, »ist fast ertrunken, na so was aber auch.« Sie wand sich unter seinen Küssen. Er nahm sie fest an der Hand und zog sie Richtung Strand. »Komm«, sagte er rau.
Ein, zwei Schritte folgte sie ihm weich und träumerisch, aber dann riss sie sich los. »Erst musst du mich fangen!«, rief sie neckisch und lief durch die flachen Wellen in die andere Richtung davon.
»Och, Anaïs, sei nicht kindisch«, rief er ihr nach. Blödes Klischee, dachte er verärgert, auf dieses alberne Spiel hatte er gerade überhaupt keine Lust. Aber na gut, was war nicht Klischee bei einem Mitternachtsbad. Er setzte ihr nach und sprang in großen Sätzen am Strand entlang. »Warte, ich krieg dich!«
Sie juchzte wie ein Kind und lief durch das flache Wasser, dass es spritzte. Immer wieder drehte sie sich dabei nach ihm um. Als er ihr näher kam, begann sie im Zickzack zu laufen und lachte quietschend. »Iiiih!« Das war kein Lachen mehr. Sie stoppte abrupt, verlor die Balance, stolperte, fiel ins seichte Wasser und schrie erneut. »Iiiiiiih!«
»Anaïs!« Jeremys Herz krampfte sich zusammen. Er rannte die letzten Meter auf sie zu. »Anaïs, was ist los?!«
»Iiiiiiiiih! Iiiiiih!« Sie zappelte im Wasser, robbte rückwärts und schaffte es schließlich, sich wieder aufzurichten. Dabei schrie sie ununterbrochen.
Dann schlug sie die Hände vors Gesicht, ihr Schreien war jetzt erstickter, weniger schrill.
»ANAÏS!« Jeremy brüllte nun.
Irgendwo hatte jemand ein Fenster aufgerissen. »Ist jetzt bald Ruhe!«, brüllte eine wütende Männerstimme. »Es gibt Leute, die müssen morgen arbeiten! Verdammtes Touristenpack!« Andere Stimmen waren zu hören. »Herrgott noch mal, kann man nicht einmal durchschlafen in dieser Stadt?«, zeterte eine Frau von einem Balkon. »Halt’s Maul, Arschloch!«, brüllte jemand und trat zusätzlich gegen eine Aluminiumdose, die laut scheppernd auf der Straße oberhalb des Strandes entlangflog. »Was ist passiert? Brauchen Sie Hilfe, Mademoiselle?«, rief jemand und beugte sich von oben über die Strandbegrenzung.
»Was ist los?« Jeremy stand nun neben ihr. Anaïs atmete stoßweise und starrte ins flache Wasser. Jetzt wandte sie sich ab und verbarg wimmernd ihren Kopf an seiner Brust. Ihr Körper bebte leicht. Er drückte sie an sich und strich ihr beruhigend über die nassen Haare. Dann sah auch er die dunkle Masse im flachen Wasser liegen. Er schnappte nach Luft. »Herrjeh!« Unwillkürlich presste er Anaïs noch fester an sich.
Im friedlichen Auf und Ab der Wellen, die leise und regelmäßig an den Strand plätscherten, wurde der Körper des Mannes, denn es war ein Mann, ohne Zweifel, leicht angehoben und rhythmisch vor- und zurückgetragen, so schien es, aber in Wirklichkeit war es nur seine Kleidung, die von den Wellen bewegt wurde und seinen Körper leicht umspielte. Der Körper selbst lag unbeweglich im flachen Wasser.
»Einen Notarzt!«, wollte er schreien, aber Jeremy brachte nur ein eigenartiges Krächzen hervor. Er räusperte sich und rief noch einmal, nun mit kräftigerer Stimme, der Person zu, die sich noch immer von der Straße über die Brüstung beugte: »Einen Notarzt! Und die Polizei! Rufen Sie die Polizei!«
2
Manchmal fragte er sich, ob er normal war. Er hatte extra ein paar Tage freigenommen, denn Annie war gestern von ihrem Berg heruntergekommen und sie wollten etwas Zeit gemeinsam verbringen. Viel zu wenige Momente hatten sie miteinander gehabt, seit sie sich gefunden hatten. Gerade an einem einzigen Wochenende hatte er es geschafft, sich mit ihr zum Skifahren in den Bergen zu verabreden. Das heißt, verabredet hatten sie sich öfter, nur einmal aber war es auch gelungen, das gemeinsame Skifahren umzusetzen. Und sosehr sie es beide genossen hatten, sowenig wollte es sich ein zweites Mal realisieren lassen. Über Weihnachten war er in Paris gewesen, hatte bei Freunden gewohnt und von dort aus die Kinder besucht. Von einem gemeinsamen Weihnachtsfest »wie früher«, wie es sich zumindest Lilly auf ihrem krakelig geschriebenen Wunschzettel an den Père Noël gewünscht hatte, hatten sie aber abgesehen. Matteo hatte natürlich keinen Wunschzettel mehr geschrieben. Er glaubte nicht mehr an »diesen Scheiß«, wie er seinem Vater großspurig verkündete, aber, sagte er gönnerhaft, für Lilly würde er das Spiel noch mitspielen. Lilly glaubte gegen jede Vernunft und gegen alle verräterischen Zeichen noch fest und vertrauensvoll an den Weihnachtsmann. Es war aber vermutlich das letzte Jahr, in dem sie diesem Kinderglauben noch anhing.
Er hatte den Kindern Annie noch nicht vorgestellt. Es war ziemlich genau so gewesen, wie Annie vorausgesehen hatte. Die Kinder wollten ihren Vater, wenn sie ihn sahen, ganz exklusiv genießen. Papa hier und Papa dort, Lilly klebte an ihm und plapperte ununterbrochen und wäre am liebsten abends nicht eingeschlafen, nur um noch mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Und manchmal krabbelte sie nachts in sein Bett und schlief dort an ihn gekuschelt weiter. Auch Matteo suchte seine Nähe und Aufmerksamkeit, wenn auch nicht so oft und nicht ganz so drängend wie Lilly. So viel Anhänglichkeit und gute intensive Zeit hatte er vorher nie mit ihnen erlebt. Es rührte ihn, machte ihn glücklich, aber es erschöpfte ihn auch und er war immer auch erleichtert, wenn sie nach ein paar Tagen wieder nach Paris zu ihrer Mutter flogen. Ein schlechtes Gewissen hatte er deswegen auch. Daher hatte er es auch lange nicht gewagt, ihnen überhaupt von Annie zu erzählen. Weder im November, schon gar nicht an Weihnachten und auch nicht in den Februarferien. Erst kürzlich hatte er ihnen gegenüber seine Freundin Annie erwähnt. Die Begeisterung seiner Kinder darüber hielt sich in Grenzen. Denn sosehr sie Ben, den neuen Freund ihrer Mutter, akzeptiert hatten, sowenig wollten sie die neue Freundin ihres Vaters kennenlernen. Er vermutete, dass sie von Hélène beeinflusst waren, die sich nur schwer an den Gedanken gewöhnen konnte, dass Duval wohl tatsächlich eine feste Beziehung eingegangen war. Dass sie nur ungern »ihre Rechte« an eine andere Frau abtreten wollte, verstand Duval nun wirklich überhaupt nicht, immerhin war ihre Trennung von Hélène ausgegangen.
Vorerst verbrachte Duval daher seine freie Zeit entweder mit den Kindern oder mit Annie. Annie. Die geduldig wartete und ihn häufig nur am Telefon erreichte, per Mail oder manchmal über Skype. Er hasste Skype. Skypen mit den Kindern war nett, wenn er Lillys zahlreiche Zahnlücken sehen konnte, die im Hintergrund auf dem Sofa hopste, während Matteo stolz sein Zeugnis in die Kamera hielt. Aber für eine Liebesbeziehung fand er Skype unbefriedigend. Im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn er Annie sehen wollte, dann richtig und nicht nur etwas verzerrt lächelnd mit einem Kussmund. Er wollte sie riechen, spüren, seinen Kopf in ihre wilden blonden Locken versenken, sie küssen und … Das alles schoss Duval durch den Kopf, als sein Mobiltelefon klingelte und er auf dem Display sah, dass es Villiers war. Er wusste augenblicklich, dass aus der geplanten kleinen Woche Verliebtheit an der frühsommerlichen Côte d’Azur nichts werden würde. Sie hätten wegfahren sollen. Wenigstens nach Italien. Unerreichbar sein. Die Arbeit drängte sich unbarmherzig in den Vordergrund. Aber er war nicht einmal wirklich verärgert. Nur resigniert, einen kurzen Moment. So war es eben. Aus den Augenwinkeln schielte er zu Annie. Sie verzog keine Miene. Augenblicklich hatte sie die Situation verstanden. Sie hatte Antennen dafür. Glücklicherweise tickte sie genauso. Denn auch sie musste in ihrem Job als Journalistin flexibel sein. Wenn etwas passierte, musste man eben schnellstens vor Ort sein, als flic und als Journalist ebenso, punktum.
»Oui, Villiers?«, meldete sich Duval.
»Guten Morgen Chef, tut mir leid …« Er war aufrichtig. Es tat ihm wirklich leid. Villiers, der alte Schwerenöter, fand nichts schlimmer, als sich aus den Armen einer Frau, und seien es die seiner eigenen, zu lösen, um zu einem hässlichen Tatort zu eilen. Er wusste natürlich, dass Duvals Freundin Annie Châtel in Cannes war, und er hätte Duval gerne ein paar ungestörte amouröse Tage und Nächte mit ihr gegönnt. Er fand ohnehin, dass sein Chef sich viel zu wenig Zeit für die angenehmen Dinge des Lebens nahm.
»Schon gut. Was ist passiert?« Duval war bereits hellwach und sachlich.
»Eine Leiche am Strand.«
»Aha. Wo?«
»Bijou Plage. Hier ist die Crème de la Crème angerückt. Scheint was Besonderes zu sein. Der Staatsanwalt will Sie haben.«
»Gut. Ich komme. Bis gleich.«
»Bis gleich, Chef.«
»Und?« Annie sah Duval fragend an.
»Eine Leiche am Bijou Plage.«
»Oh! Bijou Plage! Ausgerechnet.« Sie war aufgeregt und gleichzeitig bestürzt. Sie mochte die kleine Bucht am Ende des Boulevard de la Croisette. »Nimmst du mich mit?«
»Du hast doch frei, willst du dir nicht lieber einen schönen, faulen Vormittag machen?«, wehrte er halbherzig ab.
»Léon! Spinnst du? Ein Toter in Cannes und ich bin vor Ort! Und dann noch an meinem geliebten Bijou Plage! Und du willst, dass ich mich noch mal im Bett herumdrehe? Léon, ich lechze nach etwas Action! Verstehst du das?«
Duval zuckte die Achseln. Natürlich verstand er Annie. Sie war eine Vollblut-Journalistin und seit man sie ins Hinterland strafversetzt hatte, schrieb sie allenfalls kleine Artikel über lokale Veranstaltungen.
»In den letzten Monaten gab es nicht gerade viel Aufregendes für mich zu berichten«, rechtfertigte sie sich auch sofort. »Wider Erwarten mag ich meinen neuen Einsatzort und ich beschwere mich nicht, oder sagen wir, meistens nicht, aber nach all den hundertsten Geburtstagen im Altersheim, den pittoresken Handwerkermärkten, einer Einweihung eines Wanderwegs oder eines Brunnens und der Suche nach einem verschwundenen Hund muss ich auch mal wieder was anderes erleben.«
»Hattest du nicht gerade noch über einen Unfall in den Gorges de Daluis geschrieben?«, frotzelte Duval.
»Der Autounfall? Toll.« Sie verdrehte die Augen. »Mach dich nur lustig über mich. Alles in allem ist es da oben journalistisch gesehen etwas fad.« Sie schnaufte. »Und deswegen muss ich jetzt einfach zum Bijou Plage fahren. Das verstehst du doch?«
»Hmh«, machte er. Das konnte alles bedeuten. Auch Zustimmung. Natürlich verstand er es. Er verstand nur immer noch nicht, warum er sich ausgerechnet in eine Journalistin hatte verlieben müssen.
»Ich kann auch mein eigenes Auto nehmen und fahre dir hinterher«, schlug sie vor, »aber das ist doch ein bisschen albern, oder?«
»Wäre mir trotzdem lieber. Dann bist du unabhängig.«
»Dann bist DU unabhängig, willst du sagen«, korrigierte sie ihn und angelte bereits nach ihren Kleidern, die sie gestern Nacht neben dem Bett hatte fallen lassen.
»Annie, sei nicht so kleinlich mit den Worten«, knurrte er unwillig. »Allez!«, verscheuchte er die Katze, die auf dem Sessel auf seiner Kleidung gelegen hatte. Sie maunzte unwillig und rührte sich nicht. »Allez, Tigrou, verschwinde«, insistierte Duval. Lilly hatte die Rotgetigerte so getauft, aber es schien nicht so, als hörte sie wirklich auf diesen Namen. Sie gähnte und streckte sich zunächst noch ausgiebig, bevor sie den Sessel dann mit einem gelangweilten Hopps freigab. Duval schüttelte das weiße Poloshirt, um es von eventuellen Katzenhaaren zu befreien, besah es kurz kritisch und schnüffelte daran, warf es sich dann entschlossen über und schlüpfte in eine Jeans.
»Ich bin nicht kleinlich, ich bin korrekt«, gab sie zurück. »Kann ich noch einen Kaffee …?«
»Natürlich, du hast alle Zeit der Welt, du hast frei und bist unabhängig«, gab Duval trocken zurück. »Ich glaube, es gibt sogar noch Kaffee von gestern in der Kanne.«
»Igitt«, sie schüttelte sich. »Du weißt, dass ich deinen aufgewärmten Kaffee hasse.«
»Annie, trink ihn, mach dir frischen oder lass es bleiben«, nuschelte Duval halblaut und verschwand im Badezimmer.
Während die Rotgetigerte nervös maunzend um ihre Beine strich, wärmte sich Annie einen Kaffee in der Mikrowelle auf.
»Na, du«, sagte sie zu der Katze, »du willst Futter, was?« Die Rotgetigerte maunzte noch lauter. »Natürlich«, schien sie sagen zu wollen. Annie öffnete den unteren Küchenschrank und die Katze drängte sich ungestüm hinein.
»Warte! Tigrou, warte!« Annie öffnete die große verbeulte Metalldose und entnahm mit einem blauen Sandförmchen etwas Trockenfutter, das sie in das Schüsselchen am Boden vor der Heizung gab. Die Katze stürzte sich darauf, als habe sie schon wochenlang nichts mehr gefressen. Sie schnurrte laut, während sie krachend das Futter schmauste und die Körnchen dabei wild nach rechts und links flogen. Annie besah das Sandförmchen. Ein blauer Fisch. Sie lächelte. Vermutlich von Lilly. Sie stellte die Dose zurück und nahm ihren Kaffee aus der Mikrowelle. Er roch bitter und verbrannt und sie verzog das Gesicht. Sie verstand es nicht. Duval war so anspruchsvoll mit dem Essen, selbst mit dem Espresso unterwegs, und zu Hause trank er diesen schrecklichen aufgewärmten Kaffee. Mit Zucker und Milch ginge es vielleicht. Sie fand den Zucker in der Blechdose im Küchenschrank, aber im Kühlschrank war keine Milch. Duval trank seinen Kaffee schwarz mit Zucker.
»Hast du vielleicht noch Milch irgendwo?«, fragte sie, als er in der Küche auftauchte.
»Du hast mir einen riesigen Knutschfleck gemacht, wie soll ich so unter die Leute gehen?«, antwortete er und zeigte vorwurfsvoll auf seinen Hals.
»Was? Ich? Nie im Leben.« Sie besah sich den dunklen Fleck an seinem Hals. »Hm …«, machte sie.
»Siehst du!«
»Ich mache keine Knutschflecken!«, sagte sie entschieden. »Vielleicht hattest du den schon?«, vermutete sie.
»Na, jetzt mach mal einen Punkt!«
»Aber wenn ich dir doch sage, ich mache keine Knutschflecken«, wiederholte sie. »Ich finde das vulgär«, fügte sie deutlich hinzu. »Hast du jetzt Milch oder nicht?«, wechselte sie entschieden das Thema.
»Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Ich habe ihn mir auch nicht gemacht, aber ich muss jetzt mit diesem vulgären Fleck am Hals rumlaufen. Wie sieht das denn aus?«
»Aber ich kann mich gar nicht erinnern …«, sie schüttelte ratlos den Kopf.
»Ekstaaaase …«, sagte er mit dramatisch-dunkler Stimme.
Sie lachte kurz auf. »Ich kann mich echt nicht erinnern …«
»Das sagen sie alle, aber bei einem Polizisten zieht das nicht, da musst du dir schon was anderes einfallen lassen.« Er umfing sie und versuchte seinerseits einen Kuss auf ihrem Hals zu hinterlassen.
»Naaaaiiiiin«, schrie sie und wehrte sich. Er ließ sie abrupt los.
»Haltbare Milch ist vielleicht im Vorratskämmerchen … Milch habe ich nur, wenn die Kinder da sind.«
»Was?«
»Das wolltest du doch wissen?«
»Ja, schon …«
»Du hast ›Nein‹ gesagt, oder? Nein heißt nein«, sagte er sachlich. »Wenn ich, als Polizist, mich nicht daran halte …«
»Aha«, sie lachte kurz auf und sah ihn irritiert an. Er meinte es wohl ernst. »Gut so«, bestätigte sie dann. Sie warf nun einen Blick in die Vorratskammer. Bis auf ein paar Konservendosen und einige Flaschen Wein war sie so gut wie leer. Milch gab es natürlich keine.
Na, dann nicht, sie dachte es nur.
»Würde es dich stören, wenn ich ein paar Sachen einkaufe?«, schlug sie ihm vor. »Dein Kühlschrank ist so leer und in der Vorratskammer, da weinen vermutlich selbst die Mäuse, die darin leben. Und wir könnten was kochen heute Abend, was meinst du?«
»Ach«, machte Duval abwehrend und stellte den Kragen des Poloshirts auf. »Geht es so?«
»Was?«, fragte sie nach.
»Mit dem Knutschfleck, meine ich.«
»So halbwegs«, sie grinste. »Entschuldige, aber ich kann mich wirklich nicht erinnern.«
Er zuckte mit den Schultern. »Passiert eben.«
»Sollen wir heute Abend was kochen oder nicht?«
Duval seufzte. »Sagen wir mal so: Ich stehe gern in der Küche und trinke ein Glas auf dein Wohl, während du etwas kochst, Annie. Wenn du einkaufen und kochen willst, nur zu, aber rechne nicht mit meiner aktiven Unterstützung.« Duval grinste schräg. Seine Aktivitäten in der Küche waren generell schnell erschöpft. Er war in der Lage, sich ein Entrecôte oder ein Faux Filet in einer Pfanne zu braten. Dazu machte er sich vielleicht ein paar Nudeln oder er öffnete eine Dose Erbsen. Für mehr fehlte es ihm zwar nicht an Fantasie, aber zumindest an küchentechnischen Fertigkeiten, ganz zu schweigen von seiner Energie nach einem langen Arbeitstag. Das Schnippeln und Brutzeln in der Küche mochte andere vielleicht entspannen, ihn selbst strengte es an. Gutes Essen hingegen mochte er durchaus. »Wir können aber genauso gut ins Restaurant gehen, mach dir keinen Kopf …«, lenkte er daher beruhigend ein.
»Oh, aber so habe ich das ›wir‹ gar nicht gemeint«, wehrte Annie ab, »ich koche ganz gerne, das weißt du doch«, sagte sie gut gelaunt, »und vor allem hier, wo ich wieder täglich alles frisch kriegen kann! In den Bergen ist die Auswahl in den Läden und auf den Märkten viel kleiner und für gute Produkte muss man oft weit fahren. Da habe ich, zugegeben, manchmal keine Lust. Aber hier, mit dem fantastischen Marché Forville vor der Haustür«, sie machte ein enthusiastisches Clown-Gesicht, »das ist doch das Paradies!«
»Wenn du meinst«, Duval war deutlich leidenschaftsloser, was Einkäufe auf dem Markt anging. Er erstand das Nötigste für den Tagesbedarf in der kleinen Epicerie Aux deux Palmiers bei Bernard. Brauchte er hingegen einen Rundumschlag von allem und vor allem größere Mengen seines geliebten Luberon-Rosé, erledigte er die Einkäufe in einem mittelgroßen Supermarché am Rande der Stadt. Pragmatisch wie er war, fand er dort alles, was er brauchte, oder brauchte nur, was er fand – vor allem auch einen Parkplatz.
»Erst fahren wir mal an den Bijou Plage und dann, wenn es nicht zu spät ist, schau ich mal, ob ich was finde, was mir gefällt«, sagte Annie gut gelaunt. Die Aussicht auf Aktion und Einkaufen schien sie zu beflügeln.
»Bestimmt findest du was.« Duval sah sie lächelnd an. Es war ihr wirklich ernst. In Gedanken schien sie schon die Marktstände abzulaufen und das Angebot zu einem mehrgängigen Essen zusammenzustellen.
Die Katze maunzte schon wieder. »Na, hast du Hunger, Katze?«, fragte Duval geradezu zärtlich und strich ihr über das Fell. Sie schnurrte und rieb sich an ihm.
»Ich habe ihr eben etwas gegeben«, empörte sich Annie.
»Vielleicht war es nicht genug«, befand Duval und wiederholte die Prozedur mit dem Futter. Und die Katze stürzte sich erneut wie ausgehungert darauf. »Siehst du«, sagte Duval.
Annie verzog das Gesicht. »So wird sie dick und fett.«
»Ach was, das ist eine Jagdkatze«, Duval öffnete die Tür zum kleinen Innenhof, und die Katze spazierte nun langsam und gebieterisch mit hochgerecktem Schwanz hinaus. »Die geht jetzt in den Park Mäuse jagen.« Die Rotgetigerte sprang auf die Mauer, die den Hof vom dahinterliegenden Park trennte, ruckelte sich dort zurecht und besah sich das Leben im Park.
»Jagdkatze, was du nicht sagst.« Annie war spöttisch. »Nach zwei Portionen Futter geht die nicht mehr Mäuse jagen, selbst wenn sie vor ihrer Nase spazieren laufen.«
Duval besah die Katze zweifelnd und zuckte dann mit den Schultern. Er wärmte sich ebenfalls einen Kaffee in der Mikrowelle auf, warf ein Stück Zucker hinein und suchte im Küchenschrank nach ein paar trockenen Keksen.
Annie trank einen Schluck des Kaffees, verzog das Gesicht und ließ ihn dann resigniert stehen. Sie würde unterwegs einen Kaffee trinken. Am Bijou Plage vielleicht.
Bijou Plage. Der kleine Privatstrand zwischen dem Port Canto und dem Palm Beach Casino war ein mythischer Ort, der Ort schlechthin, zeitlos und unumgänglich, so hieß es. Zumindest, wenn man etwas auf sich hielt und gleichzeitig dem aufgeregten »Sehen und gesehen werden«-Trubel der Croisette entgehen wollte. Der flache Strand mit dem weichen, natürlichen Sand, den blau-weiß gestreiften Sonnenschirmen und Liegestühlen sowie einem kleinen Strandrestaurant war zwar für alle geöffnet, aber man war hier dennoch unter sich und gleichzeitig in guter Gesellschaft. Hier herrschten Diskretion und ein gewisses Understatement. Man kannte sich und wusste, wer man war, und musste niemanden mit protzigen Diamantcolliers oder mit dem Herumwedeln von goldenen Kreditkarten beeindrucken. Und gleichzeitig war man, obwohl nur ein paar Minuten vom Carré d’Or Cannes’ entfernt, zumindest gefühlt, weit weg von allem. Man konnte hier essen oder nachmittags auch nur einen Tee trinken: die Füße im warmen Sand, den Blick auf die Iles des Lérins und auf das Esterelgebirge gerichtet. Versteckt geradezu. Man musste es schon wissen oder vom Namen angezogen sein, Bijou Plage. Ein Schmuckstück, ein kleines Juwel. Alle waren hier. Schon immer. Früher war es hier mondäner. Oder vielleicht kamen einem die früheren Stars nur mondäner vor? In den Sechzigerjahren, als der benachbarte Port Pierre Canto noch der erste und einzige Jachthafen von Cannes war, sah man Charles Aznavour und Jean-Louis Trintignant, später kam Alain Delon, und Jean-Paul Belmondo kam immer noch, hin und wieder zumindest, begleitet von Freunden. Und neben den Stars trafen sich hier auch immer schon die Cannois. Nicht jedermann natürlich. Bijou Plage musste man sich schon leisten können.
Für eine Tasse Kaffee aber mischte sich nachmittags häufig auch anderes Publikum zwischen die Stars und betuchten Cannois: junge Mütter, die mit ihren Kindern von einer nahen Grundschule noch einen Abstecher an den Strand machten, bevor es nach Hause und zu den Hausaufgaben ging. Sie gönnten sich einen Moment unter Freundinnen, plauderten oder tippten auf ihren Smartphones herum, während ihre Kinder im Sand spielten oder im flachen Wasser planschten.
Bijou Plage war neuerdings aber auch Veranstaltungsort während des Filmfestivals oder für das Festival de la musique. Der große TV-Animateur und Samstagabendshow-Entertainer Patrick Sébastien hatte dort vor Kurzem ein Interview gegeben. Duval erinnerte sich, in Nice Matin davon gelesen zu haben. Er war nur einmal mit Annie am Bijou Plage gewesen. Annie hatte eine Schwäche für Bijou Plage, die er nicht ganz nachvollziehen konnte, sonst war sie nicht so vom edlen Lifestyle angezogen. Einen Cocktail, von einem Animateur spektakulär und frisch gemixt, hatten sie dort beim Sonnenuntergang eingenommen. Sicher war es schön dort, aber auch nicht schöner als anderswo, fand Duval und er bevorzugte ganz klar den Strand am anderen Ende von Cannes. Vor allem, weil er ihn von zu Hause aus in einer Viertelstunde zu Fuß erreichen konnte. Duval war da pragmatisch. Für Bijou Plage brauchte man immer das Auto. Und das bedeutete doppelte Parkplatzsuche. Einmal am Strand und dann wieder zu Hause, was dem schönsten Abend häufig einen angestrengten Ausklang bescherte. Das galt es zu vermeiden. Daran dachte er, als er langsam auf der Suche nach einem freien Platz am versteckten Zugang von Bijou Plage vorbeifuhr. Er war in seinem Privatwagen unterwegs, noch immer fuhr er den kleinen türkisfarbenen Fiat 500, den er für ein paar Hundert Euro erstanden hatte. Es war allerdings nicht das wieder sehr schick gewordene rundliche Retro-Modell, sondern der kleine eckige und vollkommen unmodische Nachfolger. Buchstäblich eine kleine Kiste. Sie hatte noch ein paar Schrammen und Beulen dazubekommen, seitdem sie Duval gehörte, aber ihm war das Aussehen seines Autos vollkommen egal. Hauptsache es sprang zuverlässig an. Die auffällige Farbe war ein Plus. Dank der türkisfarbenen Lackierung konnte er auch von Weitem schon sehen, wo oder wo auch nicht sich sein Auto befand. Denn wenn er spätabends mehrfach die Runde durch das Viertel gedreht hatte, um seinen Wagen abzustellen, wusste er anderntags oft nicht mehr, wo er ihn letztlich geparkt hatte.
Die Stadt versuchte seit Langem des wilden Parkens seiner autoverliebten Bewohner Herr zu werden und den Ruf der südfranzösischen Schlampigkeit loszuwerden. Mehr und mehr wurde daher reglementiert, unerbittliche Politessen verteilten Strafzettel oder man erhielt ein zunächst unsichtbares »Knöllchen« über die sogenannte Vidéoverbalisation. Die Überwachungskameras, die zunächst der Sicherheit der Bürger dienen sollten, konnten auch zur Überwachung von Parkplatzvergehen oder anderen Unkorrektheiten eingesetzt werden. Man wollte kein wildes Parken mehr auf den Bürgersteigen, kein Parken in zweiter Reihe und man sollte sich auch nicht mehr zu dritt auf zwei Parkplätzen drängeln.
Meistens begann es mit einer harmlosen Baustelle. Nach dem gewaltigen Regen im letzten Herbst, der in Cannes zu einer katastrophalen Überschwemmung ganzer Stadtviertel geführt hatte, wurden monatelang ganze Straßenzüge repariert. Das alte und enge System der Kanäle, die Cannes unterirdisch durchzogen, war aufgrund der Schlamm- und Wassermassen, die es nicht mehr aufnehmen konnte, geradezu explodiert und hatte Kanäle und Straßen zum Bersten gebracht. Tatsächlich konnte man die städtischen Dienste für einmal so koordinieren, dass sie gleichzeitig auch die Telefon- und Stromkabel unterirdisch verlegten. Denn nur ein paar Hundert Meter entfernt von der schicken und modern aussehenden Innenstadt hingen im restlichen Cannes noch immer sämtliche Kabel wie durchhängende Wäscheleinen von Haus zu Haus und von Mast zu Mast. Während dieser Bauarbeiten also suchte man sich zähneknirschend einen Parkplatz in einer anderen Straße und natürlich ein Stückchen weiter weg als sonst. Waren die einstigen Straßen nach endlosen Wochen im Baustellenzustand erneut befahrbar, so erkannte man sie nicht wieder. Wunderbar großzügig und ordentlich sahen sie nun aus, ausgestattet mit komplizierten Parkbuchten, detailliert eingezeichneten Parkplätzen sowie Begrenzungspfosten davor und dahinter, nur wurden sie dem Bedarf an Parkplätzen nicht mehr gerecht. Hatten sich vorher Stoßstange an Stoßstange etwa 30 Autos in einer Straße gedrängelt, so reichte es nun gerade noch für die Hälfte. Duval fluchte jeden Tag aufs Neue. Was dachten die sich bei der Stadt? Dass sich die Bürger von ihren Autos trennen würden? Und auf den chaotischen, schlecht getakteten und steten Streiks unterworfenen Nahverkehr umsteigen würden? Lächerlich. Da konnten sie den öffentlichen Nahverkehr noch so subventionieren, das klappte nicht in Cannes. In Nizza vielleicht, da waren sie immerhin so schlau gewesen, einen kostenlosen Großparkplatz an der Autobahnausfahrt zu errichten, der an ein eng getaktetes Straßenbahnnetz angeschlossen war, das einen von dort relativ zügig in die Innenstadt brachte. Aber in Cannes wurde nichts davon zu Ende gedacht. Und auch hier, am hinteren Ende der Croisette, dem Boulevard de la Croisette, wie es offiziell hieß, das durchaus weniger frequentiert war als der Anfang der Prachtstraße mit dem Palais des Festivals und den Luxusboutiquen und auch weniger als der mittlere Teil, rund um das edle Hotel Martinez oder das altehrwürdige Hotel Carlton, auch hier, wie gesagt, gab es immer weniger Parkplätze. Duval stellte seinen Wagen nun kurz entschlossen auf einen der freien Behindertenparkplätze, die es immerhin zahlreich in der Nähe von Bijou Plage gab. Denn kurz hinter dieser kleinen Bucht befand sich der sogenannte Handi-Plage, ein Abschnitt mit barrierefreiem Strand- und Meerzugang.
Annie fuhr an ihm vorbei, hupte kurz und gestikulierte wild. Duval tat so, als verstünde er nicht. Sie zeigte mit empört aufgerissenen Augen auf das Schild, das die Parkplätze als Behindertenparkplätze auswies, aber Duval verzog nur das Gesicht. »Ich bin im Dienst«, rief er ihr zu, »ich darf das!« Kurz darauf sah er sie auf der Gegenfahrbahn langsam in die andere Richtung fahren. Sie warf ihm einen gespielt verzweifelten Blick zu. Aber Duval hatte nur ein Achselzucken dafür übrig. Siehst du, schien er sagen zu wollen. Nein, es war nicht leicht, einen freien Platz zu finden, da musste man eben nehmen, was es gab. Basta.
Duval ging die paar Schritte zurück Richtung Bijou Plage. Der Zugang war gesperrt. Ein Wachmann hob für Duval das gelbe Absperrband an, sodass er darunter hindurchschlüpfen konnte. Er eilte die wenigen Stufen zum Strand hinunter. Das Morgenlicht fiel warm und gelb auf den kleinen Strand. Noch war es frisch, aber dort, wohin die Sonnenstrahlen fielen, konnte man bereits die frühsommerliche Wärme ahnen, die sich in den letzten Tagen eingestellt hatte.
Auf der untersten Stufe blieb er einen Augenblick stehen und atmete ein und aus. Ankommen am Strand war für Duval noch jedes Mal großartig. Diese Weite und das Blau beglückten ihn immer wieder. Manchmal konnte er gar nicht fassen, wie beglückend es war. Und das immer wieder aufs Neue, obwohl er das Meer jeden Tag sehen konnte und obwohl er fast jeden Morgen am Strand lief. Aber dieser Moment, in dem ihn nichts mehr trennte, keine Straße, keine Grünanlage, keine Strandbegrenzung, dieser Moment, wo er sich allein und direkt vor und mit dem großen Blau wiederfand, war immer wieder einzigartig und ließ ihn noch jedes Mal freier atmen. Aufatmen geradezu. Manchmal seufzte er dabei leise, aber es war ihm selbst nicht bewusst. Jeden Tag war das Licht anders, war das Blau anders, war die Luft anders und waren es die Wellen. Eine unendliche Variation von Himmelblau und Meerblau gepaart mit einem ebenso variantenreichen Rhythmus des Wellenrauschens. Was für ein Glück! Wenn er Richtung Süden blickte und den Wellen lauschte, vergaß er, dass sich oft nur zehn Meter hinter ihm die Autos der Touristen an der Uferstraße aneinanderreihten, die von Einheimischen auf Motorrollern hupend und in rasantem Slalom überholt wurden. Auch das Rattern der TGVs und Regionalbahnen hörte man, wenn überhaupt, nur wie von Ferne. Selbst die leisesten Wellen legten einen beruhigenden akustischen Schleier über all den Lärm der Stadt. Das war, wenn man es genau nahm, vielleicht das einzig Besondere am Leben in Cannes: das Licht, das Blau und das Meer. Denn ansonsten war das Leben hier genau wie überall sonst auch, sofern man nicht zu der kleinen Schicht der wohlhabenden oder zumindest pensionierten Einwohner gehörte, die ihren Tag mit Sonnenbaden, Golf- oder Bridgespielen und Essengehen verbrachte. Die meisten Einwohner von Cannes standen wie Duval jeden Morgen auf und gingen zur Arbeit. Alltag eben. Er atmete noch einmal tief ein und aus, riss sich vom Anblick des Meeres los und scannte das Treiben in der kleinen Bucht ein. Die Terrassentüren des flachen, lang gestreckten Restaurants waren geöffnet, man hatte bereits einige Stühle, Tische und die typischen blau-weiß gestreiften Sonnenschirme auf die Terrasse gestellt, als Zeichen, dass man hier sehr wohl geöffnet habe, aber natürlich war es nur ein leeres Symbol. Niemand kam an einen abgesperrten Strand zum Frühstücken und der muskulöse junge Mann, der wohl dafür zuständig war, die Terrassenmöbel und Liegestühle zu verteilen, stand mit freiem, schon ansehnlich gebräuntem Oberkörper untätig auf der Terrasse, sah dem Treiben der Polizeibeamten zu, wartete ab und rauchte.
Duval war erstaunt, die ganze noble Gerichtsbarkeit aus Grasse anzutreffen. Nicht nur Madame Marnier, sondern sogar Staatsanwalt Tilly hatte sich frühmorgens an den Strand von Cannes bemüht und sprach mit dem Gerichtsmediziner, der gerade die Achseln hob und ein zweifelndes Gesicht machte. Madame Marnier stand auf der Terrasse des Restaurants und telefonierte. Für einen Moment trafen sich ihre Blicke. Duval grüßte sie von Weitem. Sie nickte erkennend zurück, sprach aber weiter in ihr Mobiltelefon.
Die Police scientifique war selbstverständlich ebenfalls anwesend: zwei Personen in weißem Overall bewegten sich wie Außerirdische über den Strand. Duval erkannte Dermez und glaubte in dem anderen Overall den »kleinen Martin« zu erkennen, der an jeder Stelle, wo er etwas von Interesse entdeckt zu haben glaubte, kleine Nummernschilder aufstellte. Ein Blitzlicht leuchtete auf. Und noch einmal und noch einmal. Ein Kollege folgte dem kleinen Martin und machte Aufnahmen.
»Bonjour Commissaire …«, der Staatsanwalt begrüßte Duval. »Mit all den Unruhen, die wir zurzeit so haben, dachte ich, es ist besser, wenn ich mir selbst ein Bild mache.«
»Bonjour Monsieur le Procureur! Bonjour Docteur!« Duval drückte zunächst dem Staatsanwalt die Hand, dann dem Gerichtsmediziner, der sogleich in seinen üblichen jammernd-aggressiven Ton verfiel, wie immer, wenn man sofort eine verbindliche Aussage von ihm erwartete.
»Wie ich dem Herrn Staatsanwalt schon sagte, ich kann so noch gar nichts mit Bestimmtheit sagen. Es gibt bislang zumindest keinen Hinweis auf Fremdeinwirkung. Keine äußeren Verletzungen, soweit ich das sehen kann. Nirgends Blut ausgetreten. Man hat wohl auch keine Waffe gefunden.«
Der Staatsanwalt nickte bestätigend.
»Es ist also durchaus möglich, dass der Mann ertrunken ist, aber ich würde ihn doch gern erst noch genauer ansehen.«
»Natürlich, Docteur.« Duval hatte nichts anderes erwartet. Er warf einen Blick auf das ovale Gesicht des Toten, dessen, in einem vergangenen Leben, vermutlich tiefschwarze Hautfarbe bereits ein unbestimmtes, fahles Grüngrau angenommen hatte. Duval besah den Körper des Toten und seine Hände und betrachtete dann sein Gesicht. Kein junger Mann, die krausen schwarzen Haare, die unter der verrutschten Wollmütze hervorsahen, waren grau durchzogen. Die Haut des Toten war grobporig, die Lippen des leicht geöffneten Mundes wulstig und das Weiß um die dunklen Augen, die ins Leere starrten, war gelblich und stellenweise blutunterlaufen. Was hatte er erlebt in dieser Nacht? Oft konnte man in den Gesichtszügen eines Toten noch erahnen, was er in seinen letzten Augenblicken erlebt hatte. Ein alter Mensch, der zu Hause vor dem Fernseher friedlich eingeschlafen war, sah anders aus als jemand, der sein Leben in einem angstvollen Todeskampf verloren hatte. Ertrinken war ein grausamer Tod. War dieser Mann ertrunken? Duval konnte es nicht einschätzen. Die offenen Augen und der halb offene Mund gaben jedem Toten diesen erstaunten Ausdruck, als habe er gerade noch etwas sagen wollen.
»Lag er schon so da?«, fragte Duval.
»Auf dem Rücken, meinen Sie?«, fragte der Arzt zurück und gab gleich selbst die Antwort. »Nein, er lag mit dem Kopf nach unten, genauso, wie typischerweise Ertrunkene angeschwemmt werden. Insofern ist es wirklich nicht auszuschließen, dass er heute Nacht ertrunken ist. Gut möglich sogar. Er lag schon ein paar Stunden im Wasser, das ist sicher.«
»Nun, ich lasse Sie dann mal in Ruhe arbeiten …« Der Staatsanwalt machte bereits Anstalten, sich schon zu verabschieden.
»Ich verstehe noch nicht so ganz …«, begann Duval und machte eine umfassende und fragende Geste Richtung Strand. Die Anwesenheit derart vieler Polizisten und Gerichtsbarkeit wegen eines vermutlich ertrunkenen Afrikaners irritierte ihn.
»Sie wissen es nicht?«, fragte der Staatsanwalt.
»Was?«, fragte Duval mit einem leicht verärgerten Ton. Er kam sich vor wie ein Idiot. Was war denn verdammt noch mal vorgefallen in den anderthalb Tagen, in denen er nicht im Dienst gewesen war?!
»Ventimiglia!«, sagte der Staatsanwalt und sah Duval forschend an. Er schien wirklich nichts davon zu wissen, der Commissaire.
Duval schüttelte unmerklich den Kopf.
»Nun«, fuhr der Staatsanwalt fort, »gestern Nacht hat es eine konzertierte Aktion der Flüchtlinge von Ventimiglia gegeben«, fuhr er daher fort. »Eine Gruppe von etwa 200 Personen hat mit allen Mitteln versucht die Grenze nach Frankreich auf dem Landweg zu überwinden und es kam am Grenzübergang Italien–Frankreich zu einer wütenden Auseinandersetzung.« Der Staatsanwalt machte eine Pause und sah Duval prüfend an. »Davon war schon in den Frühnachrichten zu hören!«
Duval zuckte mit den Achseln. Die Frühnachrichten hatte er, wohlig an Annie geschmiegt, verschlafen.
»Anscheinend waren Journalisten vor Ort …« Der Staatsanwalt beendete den Satz nicht, aber Duval verstand die Anspielung auch so. Es hatte sich herumgesprochen, dass der Commissaire mit einer Journalistin verbandelt war. Diese Paarkonstellation kam zwar vor, war aber nirgends gern gesehen. Polizisten wurde nur allzu leicht unterstellt, dass sie Informationen unter der Hand an die Presse weitergaben. Von Journalistinnen nahm man hingegen an, dass sie nur der Informationen wegen mit einem Polizisten ins Bett gingen. Das Misstrauen in eine derartige Beziehung war groß.
Duval reagierte nicht darauf. Er hatte ein reines Gewissen und Annie war in der vergangenen Nacht ebenfalls nicht in Ventimiglia gewesen. Das konnte er bezeugen. Notfalls mit seinem Knutschfleck. Unwillkürlich zog er den Hemdkragen zurecht und hielt einen Moment lang die Hand an den Hals.
Der Staatsanwalt schien nichts bemerkt zu haben, und wenn, so ließ er es sich nicht anmerken. Er sprach weiter. »Ein kleines Grüppchen war wohl in den Bergen unterwegs und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass manche Frankreich über die ehemaligen Zollpfade erreicht haben. Und gleichzeitig hat sich mindestens eine Gruppe mit einem selbst gebauten Floß auf den Seeweg begeben«, erklärte der Staatsanwalt weiter.
»Mit einem selbst gebauten Floß?«, unterbrach Duval.
»Allerdings. Aus Plastikkanistern und Plastikflaschen notdürftig zusammengebastelt.« Der Staatsanwalt schnaufte. »Es war nach einem knappen Kilometer schon fast abgesoffen, weil viel zu viele Personen daraufsaßen und andere sich halb schwimmend daran festklammerten. Keiner wollte es loslassen, also kippelte dieses Ding hin und her und war so stabil wie eine Luftmatratze. Hätte vielleicht klappen können, trotz alledem, aber das wissen wir ja auch, dass die Versuche sich intensivieren, wenn das Meer ruhig ist. Außerdem war es relativ hell. Der Himmel war weniger
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: