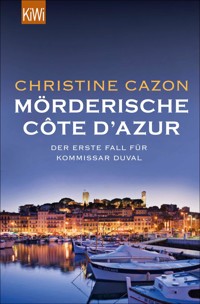9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Christine Cazon, Erfinderin des Kommissars Léon Duval, erzählt in diesem sehr persönlichen Buch, wie und warum sie nach Frankreich kam und wie aus der Praktikantin auf einem Bio-Bauernhof eine Schriftstellerin wurde. Nach etlichen privaten und beruflichen Rückschlägen – Trennung und Krankheit – beschließt die Deutsche Christine Cazon eines Tages, ihr Leben umzukrempeln und nach Frankreich zu gehen. Doch die neue Heimat gibt sich spröde. Viel Arbeit, wenig Geld, kaum Anerkennung. Dazu Sprachschwierigkeiten – der Traum vom Aussteigen sieht anders aus. Und auch hier in Frankreich schlägt das Schicksal zu, immer wieder. Doch Christine Cazon verschließt sich nicht, geht mit offenen Augen durch die Welt und den französischen Alltag – und beginnt zu schreiben. Zunächst einen Blog, aus dem das Buch »Zwischen Boule und Bettenmachen« wird, dann sehr erfolgreiche Krimis. Mit viel Humor und Selbstironie, aber auch voller Wärme und Sympathie für ihre Mitmenschen erzählt Christine Cazon über ihr Leben in Frankreich und liefert dabei erstaunliche Einblicke in ihre ganz persönliche Glückssuche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Christine Cazon
Von hier bis ans Meer
Wie ich in Südfrankreich das Glück suchte und mich selbst fand
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Christine Cazon
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Christine Cazon
Christine Cazon, Jahrgang 1962, hat ihr altes Leben in Deutschland gegen ein neues in Südfrankreich getauscht. Sie lebt mit ihrem Mann und Katze Pepita in Cannes, dem Schauplatz ihrer Krimis mit Kommissar Léon Duval.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Christine Cazon, Erfinderin des Kommissars Léon Duval, erzählt in diesem sehr persönlichen Buch, wie und warum sie nach Frankreich kam und wie aus der Praktikantin auf einem Biobauernhof eine Schriftstellerin wurde.
Nach etlichen privaten und beruflichen Rückschlägen beschließt die Deutsche Christine Cazon eines Tages, ihr Leben umzukrempeln und nach Frankreich zu gehen. Doch die neue Heimat gibt sich spröde. Viel Arbeit, wenig Geld, dazu Sprachschwierigkeiten, und auch hier in Frankreich schlägt das Schicksal immer wieder zu.
Doch Christine Cazon verschließt sich nicht, geht mit offenen Augen durch die Welt und den französischen Alltag – und beginnt zu schreiben. Zunächst einen Blog, aus dem später das Buch Zwischen Boule und Bettenmachen wird, dann sehr erfolgreiche Krimis. Mit viel Humor und Selbstironie, aber auch voller Wärme und Sympathie für ihre Mitmenschen erzählt Christine Cazon ihr Leben in Frankreich und liefert dabei erstaunliche Einblicke in ihre ganz persönliche Glückssuche.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
1. Teil
Die Sache mit dem Glück
Ein anderes Leben
Der Hof
Eine Entscheidung
Avignon
Patrick
Schnee
Ans Meer
Sommerfrische
Kinder, Küche, Katastrophe
Immer zu zweit
Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau
Das Cannes des Kommissars Duval
Immer wieder Sommer
Alltag oder Zwischen Putzeimern, Krimis und Kochbüchern
»Wool War I«
»Je suis … française«
2. Teil
Noch mal: die Sache mit dem Glück
»Change ma vie«
Essen
Lob auf das Internet oder Mein Ich, Version 3.0
Mein Wort des Jahres
Heimat und Fremde
»C’est aujourd’hui dimanche« – Kriegsenkel
Herzland Frankreich
Dank, Literaturauswahl und lebensverändernde Links
à Thierry
Il est où le bonheur, il est où?
Il est où?
Christophe Maé
1. Teil
Bin müde und leer,
Will nach Süden ans Meer.
Bin auf meinem Weg ohne Wiederkehr,
Schon so lang.
Hannes Wader: Schon so lang
Die Sache mit dem Glück
Vorletztes Jahr wurde ich mit einer Handvoll anderer Menschen ausgewählt, bei Horst Lichters Fernsehsendung Auf der Suche nach dem Glück teilzunehmen. Horst Lichter reiste mit seinem Motorrad an der Côte d’Azur entlang, suchte wunderbare Plätze auf und traf sich mit unbekannten Menschen, die dort leben. Ist man hier glücklich? Oder glücklicher? Und warum? Das war die Frage, die er allen stellte.
Was für ein Glück! Ich dachte von nun an ständig an das Glück und vor allem, warum ich es nicht spüre. Denn stellen Sie sich vor, nach einem langen Gespräch mit Horst Lichter und Hardy Krüger, der ihn begleitete, einem Gespräch über das Leben und die Liebe, antwortete ich auf die abschließende Frage, ob ich glücklich sei, mit »Nein«. Bam. Das muss man sich mal vorstellen. Ich sagte in etwa »Ich lebe an der Côte d’Azur, habe einen lieben und guten Mann, ich schreibe und bin damit erfolgreich, das Meer ist eine Viertelstunde zu Fuß entfernt … und nein, ich kann nicht so pauschal sagen, dass ich glücklich bin, ich spüre es nicht, das Glück.« Und dann hielt einer der zwölf Herren, die sich bei den Dreharbeiten in dem engen Büro versteckt hatten, ein Schild hoch, auf dem »zum Ende kommen« stand. Und ich dachte, was? Und das wird mein letzter Satz? Dass ich nicht glücklich bin?! Gut, das wurde natürlich rausgeschnitten, und Horst Lichter sprach von »Glücksmomenten« und dass man »manchmal erst hinterher spüre, dass man glücklich war«. Ich nickte eifrig, um damit in den letzten Drehsekunden noch ein positives, »glückliches« Statement abzugeben, aber stimmte das? Und was hat es denn nun auf sich mit dem Glück?
»Was erwartest du denn noch?«, fragte mich meine Mutter fassungslos, als ich mich vor vielen Jahren von meinem langjährigen Freund getrennt hatte. »Das war doch so ein netter Mann. Seriös. Aufrichtig. Intelligent. Mit einem Doktortitel! Gut aussehend und sportlich war er auch. Was willst du denn noch?«, fragte sie. Mein damaliger Freund war wirklich ein guter Mann. Sanft und ruhig, seriös, und er liebte mich aufrichtig. Aber ich fand ihn nicht cool genug, nicht witzig genug, zu verträumt und zu langsam, und vor allem war ich nicht prickelnd verliebt in ihn. Ich spürte nicht das Glück durch meine Adern pulsen, wenn ich mit ihm zusammen war. Ich fühlte mich wohl mit ihm, wie man sich wohl in alten warmen Hausschuhen fühlt. Aber das sollte alles sein? So sollte es bleiben bis zum Ende meines Lebens? Dieses gemütliche Hausschuhgefühl zu zweit vor dem Fernseher? Und wo ist das Abenteuer? Das Glück? Die großen Gefühle? Die Leidenschaft? Hallo? Ich trennte mich, weil ich glaubte, dieser Mann mache mich nicht glücklich. Überraschenderweise fühlte ich mich nach der Trennung weder glücklich und befreit, noch stürzte ich mich in Abenteuer, das einzige Gefühl, das ich hatte, war, dass ich gerade meinen einzigen und besten Freund aus meinem Leben gekickt hatte. Und er fehlte mir. Ich war eher unglücklich. Ziemlich unglücklich, um ehrlich zu sein. Das wiederum konnte ich gut spüren. Das Unglück. Als wäre ich dafür gemacht. »Ich habe keine Glücksbegabung«, sage ich manchmal.
Aber dann begegnete mir tatsächlich ein neuer Mann. Er war so anders als die Männer, mit denen ich bisher zu tun gehabt hatte. Ein Franzose. Ich war hin- und hergerissen von ihm. Ich bewunderte ihn für seine freie Art und schämte mich gleichzeitig für ihn. Er war Holzfäller, aber nachdem er im deutschen Wald und in dem ihn umgebenden Land vor Einsamkeit fast verrückt geworden war, war er nach Köln gezogen und fuhr dort Pakete aus. Als er mich eines Tages in kariertem Hemd und unmodischer Hose, unrasiert und umwölkt von Patschuli-Öl, an meinem Arbeitsplatz aufsuchte, dachte ich, ich müsse im Erdboden versinken vor Scham. »Hier ist einer, der sagt, er ist dein Freund, Christiane, kannst du mal kommen, bitte?«, rief mich die Dame vom Empfang an. »Gutten Tack«, lachte der Franzose und küsste mich vor den Augen der Rezeptionistin. »Iesch ’atte in die Nähe zu tun und iesch dachte, iesch komme diesch mal besuchen!«, strahlte er. »Ja«, quälte ich mir gestelzt ab, »dann komm mal mit hoch.« In meinem Büro hätte ich ihn gern versteckt, aber die Kolleginnen waren hocherfreut über seine Anwesenheit. Er war auch so nett und lustig und charmant mit seinem drolligen Deutsch. Ich aber sah nur das Proletarische und wie schlecht er angezogen war.
Er war vollkommen frei und scherte sich nicht darum, was die anderen von ihm dachten. Er ließ sich auch weder kontrollieren noch von mir auf typisch deutsche Art verplanen. Wollte ich mit ihm zusammen sein, musste ich mich seinem Rhythmus und unterwegs seinem Fahrstil anpassen. Was habe ich damals geschimpft und geschrien über seine, wie ich fand, verantwortungslose Art, Auto zu fahren. Der Franzose brachte mich aus der Ruhe, warf mich aus meinem Konzept und holte mich aus der viel besungenen Komfortzone heraus. Mit diesem Mann aber hatte ich die aufregendste Zeit meines Lebens. Wir verbrachten spontane Wochenenden in Frankreich, zelteten im Regen, schliefen manches Mal auch wie ein Taschenmesser zusammengefaltet im Kofferraum seines vergammelten Citroëns. Wir wanderten ohne Karte, querfeldein, eines seiner deutschen Lieblingswörter, rund um Köln und in der Eifel und ließen uns überraschen, wo wir ankamen. Ich folgte ihm, manchmal murrend und unglücklich (sich aus der Komfortzone zu begeben ist ja nicht immer so komfortabel), aber immer bewundernd. Sogar nach Afrika ging ich mit. Vier Wochen in Mali und Burkina Faso, die mich völlig aus dem Gleichgewicht gebracht und mich nachhaltig beeindruckt haben. Afrika. Da war ja nun gar keine Komfortzone. Da, wo wir waren, war schon mal kein Komfort. Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt. Der Franzose wollte sich in Burkina Faso niederlassen, dort ein kleines Hotel aufmachen, und er versuchte während unserer Reise, dieses Projekt voranzubringen und die verschlungenen afrikanischen Wege dafür zu gehen. Ich begleitete ihn und überlegte im Stillen, ob ich mir eine Zukunft mit ihm in Afrika vorstellen konnte. Wir trafen an Geld und Einfluss unfassbar reiche Menschen und noch viel mehr unfassbar arme und dennoch wahnsinnig großzügige Menschen. Alle aber wollten mitverdienen an dem zukünftigen Hotelchen, wie der Franzose es nannte. Es war mühsam. Stundenlang wurde geredet und schäumend Tee aufgegossen, und ich verstand gar nichts. Ich hatte auch nichts zu sagen, das nur nebenbei. Einmal im Hause eines sehr wohlhabenden Politikers, parkte man mich mit einer Cola in einem großen, leeren, vor Marmor und Gold strotzenden Raum vor dem Fernseher, so lange, bis die Herren nebenan mit ihrer Besprechung fertig waren. Mir war alles anstrengend, vor allem dass wir angestarrt, angefasst und angebettelt wurden mit einer Beharrlichkeit, die ich verstörend fand. Ich wollte nicht unfreundlich sein zu all den Menschen, mit denen er zukünftig leben und arbeiten wollte, aber ich ertrug so vieles nicht. Die Kinder, die mir mit großen Augen beim Essen in den Garküchen am Straßenrand zusahen, sodass ich meinen nur halb leer gegessenen Teller immer schnell an eines von ihnen abgab. All die Kinder, die mich anbettelten. All die Erwachsenen, die mich anbettelten. Dazu diese Hitze. Der rote Staub. Dieses laute Durcheinander. Das Warten auf jemanden, auf den Bus, auf einen Telefonanruf. Das lange Reden und Verhandeln für alles und nichts, und all das immer und immer wieder. Herrje. Was war das anstrengend. Mein heimlicher Traum, mit ihm zusammen auszuwandern, zerplatzte. Hier würde ich nicht leben können. Oder doch? Sollte ich es versuchen? Sollte ich mich wirklich so weit aus meiner Komfortzone wagen? Ich war in dieser Frage noch zu keinem Ergebnis gekommen, als er mich verließ. Sein befristeter Arbeitsvertrag in Deutschland war beendet, er hatte keine Lust, länger in Deutschland zu bleiben, seine Zukunft lag in Afrika, und bis es damit losging, zog er zurück nach Frankeich und wohnte dort zunächst bei seiner Familie. »Und ich? Und wir? Was wird aus uns?«, fragte ich unter Tränen. »Wir hatten ein sehr schönes Jahr zusammen«, sagte er und fuhr auf den Seitenstreifen. Er küsste mich noch einmal, ließ mich an der Zufahrt zur Stadtautobahn aussteigen, hob grüßend die Hand und fuhr davon.
Von dieser Trennung habe ich mich fast nicht mehr erholt. Sie kostete mich beinahe das Leben, das kann ich ganz ohne Übertreibung sagen. Ich konnte buchstäblich nicht mehr aufhören zu weinen. Ich heulte und heulte. Ich telefonierte und fuhr ihm hinterher, ich rief ihn an den absonderlichsten Orten an, obwohl ich sehr wohl spürte, ich interessierte ihn schon nicht mehr. Er war weg. Aber mir fehlte er so. Alles kam mir schal vor. Ich war nicht sicher, ob ich in Afrika hätte leben wollen, aber in Köln schien ich auch nicht mehr leben zu können. Dass ich mein eigenes Abenteuer leben musste und nicht das der anderen, das habe ich da noch nicht gespürt.
Ein anderes Leben
Ich hatte Unfälle und Fahrradunfälle angehäuft. War Kellertreppen hinuntergefallen und habe mich einmal so spektakulär mit dem Fahrrad überschlagen, dass mehrere Autos mit quietschenden Reifen nur knapp vor mir zum Stehen kamen und die Fahrer besorgt aus dem Wagen sprangen. Alles in Ordnung? Es sah so schlimm aus! Wie durch ein Wunder hatte ich außer blauen Flecken nie etwas abbekommen. Dabei wollte ich mich so gern rausziehen aus diesem Leben, wenigstens einen Moment in einem weißen Bett in einem Krankenhaus zu ruhen schien mir eine Wohltat. Ich konnte nicht mehr.
Erschöpft war ich. Zutiefst erschöpft. Ein Burn-out, gepaart mit einer tiefen Lebensunzufriedenheit, eine Midlife-Krise Anfang vierzig, eine Depression. Irgendwie war alles zusammengekommen. Mir war alles zu viel. Auch ein Jahr später weinte ich noch immer um den Franzosen. Niemand wollte es mehr hören. Ich fühlte mich einsam, aber wenn das Telefon klingelte, hob ich nicht ab, jeder Kontakt war mir zu viel. Post machte ich auch nicht mehr auf. Freunde, die versuchten, einfühlsame Worte zu finden, blaffte ich an: »Gar nichts wisst ihr. Gar nichts. Lasst mich nur alle in Ruhe.« Mir schien, ich müsse nur einmal richtig ausschlafen, aber wenn ich dann ausgeschlafen hatte, hatte es immer noch nicht gereicht, um diese bleierne Müdigkeit abzuschütteln. War ich im Büro, sehnte ich mich nach dem Moment, in dem ich frei hatte, hatte ich frei, wusste ich nichts mit mir anzufangen und lief nur stundenlang durch die Stadt und kaufte ein. Essen, Kleider, Kram. Danach war ich natürlich immer noch müde und erschöpft. Ich hatte eine Therapeutin. Ich hatte die meiste Zeit in meinem Leben eine Therapeutin. Es gab so vieles, das nicht funktionierte. All diese Ängste, die Essstörungen, immer wieder diese tiefen Traurigkeitsphasen. Die Therapeutin gab irgendwann auf: »Ich kann nichts mehr für Sie tun, Sie brauchen andere Hilfe.« Die Hausärztin schlug mir eine psychosomatische Kur vor. Das lehnte ich empört ab und nahm stattdessen Antidepressiva, die mir nicht halfen. Irgendwann schickte sie mich zu einem Psychiater. Ein Psychiater! Ich war doch nicht verrückt! Der Psychiater war zwar erstaunlich verständnisvoll, stellte mir aber schon nach der dritten Sitzung ein Ultimatum. Die von der Ärztin vorgeschlagene Kur oder eine andere. Ich dürfe erst wiederkommen, wenn ich mich entschieden hätte. Natürlich bin ich nie wieder zu diesem Psychiater gegangen. Ich brauche doch keine Deppenkur! Ich rannte im Hamsterrad, immer schneller, immer hektischer, bis ich eines Tages zusammenbrach. Ich kann mich heute nicht mehr daran erinnern, in welchem Zustand ich war, ob ich ohnmächtig geworden war oder in Tränen ausgebrochen bin. Ich habe das verdrängt. Aber man schickte mich von der Arbeit zu meiner Hausärztin, und dort sagte ich nun: »Ich kann nicht mehr. Ich will diese Kur machen.«
»Endlich«, sagte die Hausärztin, lächelte warm und schrieb mich krank.
Wochen später, Mitte Dezember, war ich dann im Krankenhaus am Rande des Ruhrgebiets angekommen. Ich war so erschöpft, dass ich all die anderen Menschen, die mit mir auf dieser Station waren, nur am Rande wahrnahm. Sie waren seltsam, das merkte ich. Es wurde gestrickt, gesungen und Scherze gemacht wie bei einem Betriebsausflug. Das war mir zu viel. Ich verstand es auch nicht. Waren wir nicht alle hier, weil es uns nicht gut ging? Ich hatte monatelang so getan, als sei alles in Ordnung, ich wollte endlich einmal zeigen, dass nichts in Ordnung ist. Ich schwieg. Ich lächelte nicht. Ich zog mich zurück. Ich wollte niemandes Krankengeschichte wissen. Ich wollte auch meine nicht jedem erzählen. Ich wollte meine Ruhe. Ich hatte genug zum Nachdenken. Man nahm es mir übel. Arrogant sei ich. Man wollte nicht mit meiner Motzfresse am selben Tisch sitzen. Ich hatte gedacht, hier dürfe ich sein, wie ich bin, aber es war nicht so einfach.
»Wenn das mein Leben ist, dann will ich es nicht«, raunzte ich meinen Pfleger gleich am ersten Tag an.
Ungerührt drückte er mir ein kleines Büchlein mit Gedanken von Blaise Pascal in die Hand. »Lesen Sie mal«, sagte er, »das könnte etwas für Sie sein!« Ich hatte noch nie von Blaise Pascal gehört, blätterte blasiert und lustlos darin herum und blieb dann doch an einem Satz hängen: »Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point«. »Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht versteht.« Dieser oft zitierte Satz ist Ihnen vielleicht bekannt, für mich war er damals neu und die Idee dahinter auch. Mehr als neu. Unerhört geradezu. Kann das sein? Darf das sein? Ich hatte gelernt, dass man Entscheidungen mit dem Kopf trifft. Da hört man nicht auf seinen Bauch oder auf sein Herz. Auch nicht bei wichtigen Entscheidungen. Da schon gleich gar nicht.
Mein Pfleger war ein Glücksgriff, auch wenn ich es nicht gleich erkannte. Wie ich mir mein Leben denn wünschen würde, fragte er mich eines Tages. Was würde ich machen, wenn ich ganz frei wäre? Frei von allem. Frei von Geldsorgen. Frei von Ängsten. Auch frei von Ängsten, einen Prestigeverlust zu erleiden. Wenn ich mich um nichts und niemanden kümmern müsste, was würde ich dann tun?
In meinem Kopf ratterte es. Was würde mein Herz sagen, wenn es entscheiden könnte, was ich gerne leben wollte? »Ein Jahr nach Frankreich«, flüsterte es mir zu. »Sag es!« Und nein, es hatte nicht nur mit dem Franzosen zu tun, wenn auch die Vorstellung, dass ich die gleiche Luft atmen könnte wie er, mir klammheimlich gefiel. Nach Frankreich hatte ich immer schon gewollt.
Frankreich war früh in mein Leben gekommen, schon als ich klein war und wir dort, ganz nah an der luxemburgischen Grenze, ein paarmal Freunde der Großeltern besuchten. Maria und Joseph. Sie dick und rund, er mager und kettenrauchend. Daran erinnere ich mich und an die Stallkaninchen hinter dem Haus. Ich erinnere mich an einen kleinen Lieferwagen, der direkt vor dem Haus hielt und in den man richtig hineingehen konnte, um einzukaufen. Und daran, dass ich in dem engen Wohnzimmer, wo alle laut redeten, aßen, tranken, rauchten und zusätzlich der Fernseher lief, auf dem Sofa selig schlief. Ich, das empfindliche Kind, das solche Probleme mit dem Einschlafen hatte.
Ich erinnere mich an eine riesige Sammlung von Schlüsselanhängern, eine sehr kleine, feine und besondere Schreibschrift auf Visitenkärtchen und für ein paar Wochen ein französisches Au-pair: Joëlle. Und ich erinnere mich an Marc-Albert, den kleinen Bruder von Joëlle, in den ich ein bisschen verliebt war, wie man eben verliebt ist mit fünf oder sechs Jahren.
In unserer Familie wurde mit Französisch ohne Mühe ziemlich mühevoll Französisch gelernt. Mir scheint im Nachhinein, die Schallplatte ist bei der Lektion »Wecken im Hotel« hängen geblieben. Ich kann sie immer noch aufsagen: »Levez-vous, Mademoiselle, il est l’heure«, sagt der Zimmerservice und klopft an die Tür. »Ah, je suis tellement fatiguée«, antwortet eine junge Dame und verschluckt gähnend die Endsilbe. »Schö sswieh tellmooh fohtig«, wiederholte mein Vater daher so oft, dass ich meiner Französischlehrerin Jahre später nicht glauben wollte, dass es eigentlich fatigué heißt, mit einem betonten accent aigu am Ende. Irgendwann verlor sich trotz all des erlernten Französisch der Kontakt dorthin, aber ich war schon ein bisschen süchtig geworden nach Frankreich.
Als Jugendliche entdeckte ich in einem kleinen Programmkino in Darmstadt die Filme von François Truffaut und war fasziniert von Fanny Ardant und Gérard Depardieu in La femme d’à côté. (Die Frau nebenan) oder noch einmal Fanny Ardant und Jean Louis Trintignant in Vivement Dimanche (Auf Liebe und Tod). Wie Großartig! Noch nachhaltiger hat mich aber Pourquoi pas? (Warum nicht?), ein Film von Coline Serreau, beeindruckt. Ich war so verliebt in Samy Frey und in die unerhörte Geschichte einer Liebe zu dritt in diesem Film. In diese freche Leichtigkeit. Ach, Frankreich!
Nach dem Abitur hätte ich gerne ein Jahr in Frankreich gelebt, in einem Dachkämmerchen in Paris vielleicht oder meinetwegen auch als Au-pair-Mädchen in Lyon. Ein Auslandsjahr war damals aber noch nicht üblich, und ich konnte nicht mal richtig begründen, warum ich so gerne in Frankreich leben wollte, sodass meine Eltern, trotz ihrer eigenen Frankreichliebe und vieler im Nachbarland verbrachter Ferien, fanden, so ein Auslandsjahr sei reine Zeitverschwendung.
Herumgammeln hieß das damals. Und herumgammeln sollte ich nicht. Sondern was Vernünftiges lernen und arbeiten. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe vernünftig so allerhand gelernt und gearbeitet und studiert und wieder gearbeitet. Und nach Frankreich kam ich nur noch auf Zeit, im Urlaub.
Diese Sehnsucht, in Frankreich »richtig« zu leben, wurde wieder groß, als der Film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain (Die fabelhafte Welt der Amélie) in die Kinos kam. Damals kam ich komplett deprimiert aus dem Kino, gerade hatte mich mein Franzose verlassen, und es schien mir, als könnte ich nicht mehr glücklich sein in Deutschland.
Ich suchte das Französische jetzt überall, kaufte mir morgens Croissants und trank abends französischen Wein, kochte mit Olivenöl und Kräutern der Provence und war begeistert, wenn ich irgendwo gesalzene französische Butter oder original Kekse aus der Bretagne fand. Ich hörte französische Musik: Benjamin Biolay zum Beispiel, als ihn noch kaum einer kannte. Und Carla Bruni. Ihr Liedchen Quelqu’un m’a dit fand ich erstaunlich tröstlich. Ich hörte die schmelzende Stimme von Henri Salvador, und ich hörte Jane Birkin, die die Chansons von Serge Gainsbourg interpretierte.
Und ich sah erneut französische Filme: Le bonheur est dans le pré (Das Glück liegt in der Wiese) oder Une hirondelle a fait le printemps (Eine Schwalbe macht den Sommer). Dieser Film schien wie für mich gemacht zu sein: Eine Informatikerin steigt aus, macht eine Ausbildung in der Landwirtschaft und übernimmt einen Ziegenhof. Ich wollte auch raus und weg. Endlich weg. Nach Frankreich. Als mich der Krankenpfleger nun fragte, was ich gern machen würde, gab es darauf nur eine Antwort:
»Ein Jahr ins Ausland gehen«, sagte ich, ohne zu zögern. »Nach Frankreich.«
»Toll!«, sagte er. »Machen Sie das!«
»Was?« Ich sah ihn groß an. »Und meine Rente?«
Da lachte er, dieser etwas bieder aussehende Mann, der zu Hause eine kleine Familie hatte. Er war kein abgedrehter Guru mit linksgedrehtem Rastazopf, und deswegen trafen mich seine Worte noch viel stärker. »Ihre Rente«, sagte er. »Gute Frau! Wenn Sie jetzt schon an Ihre Rente denken, dann können Sie sich auch gleich umbringen. Leben Sie doch erst mal!«
Leben Sie doch erst mal! Leben. Wie geht das: »leben«? Wenn das mein Leben ist, dann will ich es nicht, hatte ich gesagt. Welches Leben wollte ich denn? Sollte ich wirklich nach Frankreich? »Ja!«, zischelte mein Herz. Aber zunächst versuchte ich wieder zu arbeiten, doch der Wiedereinstieg gelang nicht. Und als ich, buchstäblich am letzten Tag vor der endgültigen Rückkehr, den Job kündigte, war ich danach so erleichtert, dass ich wusste, ich war auf dem richtigen Weg. »Du bist frei!«, jubelte mein Herz. »Auf nach Frankreich!«
»Na, na!«, ließ sich die Vernunft hören. »Hör auf zu träumen! Ohne Geld geht gar nichts.« Daher meldete ich mich zunächst arbeitslos und verbrachte Stunden damit, alle Papiere auszufüllen, in Warteschlangen anzustehen und vor verschlossenen Türen zu sitzen. Vielleicht kennen Sie das. Muss ich nicht detailliert erzählen. Es war keine schöne Zeit. Ich bewarb mich unter anderem auf eine Stelle als Buchhändlerin auf Amrum, aber der Inhaber wollte mir nicht glauben, dass ich wirklich aus der Großstadt wegwollte, und meinte, ohne Inselerfahrung würde ich da schnell den Inselkoller bekommen. Amrum! Stellen Sie sich das mal vor! Wer immer da heute die Buchhandlung führt, dem sei herzlich zugewinkt!
Weg wollte ich. Am liebsten ins Ausland. Die Idee, einmal ausgesprochen, hatte mich nicht losgelassen. Die Dame vom Arbeitsamt schüttelte den Kopf. Mit über vierzig gehe da nix mehr. Ich schrieb trotzdem Bewerbungen nach Rom und nach Paris in jämmerlichem Englisch und bekam nie eine Antwort. Einen Englischsprachkurs konnte ich immerhin bekommen, und dann ganz überraschend eine Möglichkeit, nach Birmingham zu gehen.
»Birmingham?« Ich sah die Dame vom Arbeitsamt zweifelnd an.
»Ja, Birmingham. Sie wollten doch ins Ausland?«
»Ja, aber …«
»Na also«, unterbrach sie mich, »dann füllen Sie mal so schnell wie möglich diesen Antrag aus …« Sie gab mir eine Internetadresse. Der Antrag war mehrseitig, sollte in Englisch ausgefüllt werden, online natürlich, und ich sollte darin begründen, warum ich so gerne nach Birmingham wollte.
Bei meiner Gesangslehrerin, die ich seit Kurzem hatte, weil mir das Singen in der Kur so gut getan hatte, bekam ich nachmittags keinen Ton raus. Sie fragte, was mich beschäftige, und ich erzählte von Birmingham.
»Willst du denn nach Birmingham?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich will viel lieber nach Frankreich. Nach Südfrankreich am liebsten. Oder nach Italien.«
»Dann geh nach Südfrankreich. Da sehe ich dich auch. Ich sehe dich nicht in England, nicht in Birmingham. Geh nach Südfrankreich«, ermunterte sie mich.
»Aber es gibt nur Birmingham. Ich habe kein Geld, um in Südfrankreich einfach so zu leben«, wandte ich ein. »Birmingham ist vom Arbeitsamt unterstützt, das wird bezahlt.«
»Na und?! Du willst nach Birmingham gehen, wo es dir nicht gefällt, nur weil es bezahlt ist?!« Sie schüttelte entschieden den Kopf. »Such dir selbst einen Job in Südfrankreich! Warum suchst du dir nicht eine Au-pair-Stelle? Granny-Au-pair gibt es doch!«
So begann ich, Au-pair-Stellen in Frankreich zu suchen. Ich bewarb mich hier und da, obwohl es mir nicht so richtig zusagte. Ich hatte eigentlich keine Lust darauf, mich um Kinder zu kümmern, ich wusste nicht mal, wie man mit Kindern umgeht oder was ich mit ihnen anfangen sollte. Ich hatte selbst nie einen Kinderwunsch gehabt. Jahrelang dachte ich, das Bedürfnis würde sich eines Tages einstellen, mit dem richtigen Mann vielleicht, aber nein, als mein langjähriger Lebenspartner mir die Pistole auf die Brust setzte und sagte, er wolle Kinder, und zwar jetzt, war dies mit ein Trennungsgrund. Aber wenn die Kinderbetreuung eine Möglichkeit wäre, gegen Kost und Logis in Frankreich zu leben, dann wollte ich es versuchen. Natürlich hat es nicht geklappt. Aber ich habe dadurch den Radius erweitert für das, was ich tun könnte. Ich begann Kleinanzeigen für Jobangebote im Ausland zu lesen. Erstaunlicherweise gab es eine ganze Menge. Ich telefonierte und schrieb Mails und besah mir den einen oder anderen Ort. Von all den angedachten Projekten hatte sich nur der Aufenthalt auf einem Bauernhof im Hinterland von Nizza konkretisiert. Mein Herz hatte laut »Ja!« gerufen und sich gegen die Vernunft durchgesetzt, gegen die Frage, was das alles bringen solle, gegen die Ängste vor Tieren und Allergien, die sie mir unablässig aufzählte. Ich wollte es nicht hören. »Mein Herz hat seine Gründe«, dachte ich übermütig und lief los, also natürlich flog ich und landete auf diesem Hof, von dem ich vorher noch nicht einmal ein Bild gesehen hatte. Gott sei Dank, denn wenn ich gewusst hätte, was mich erwartete, dann wäre ich dort nicht hingegangen.
Der Hof
Das Leben auf dem Bauernhof in den französischen Seealpen aber war ein Schock. So klein und ärmlich hatte ich es mir nicht vorgestellt. Und all diese Gerüche. Die Fliegen. Der Kuhstall befand sich noch unter dem Haus, und die Hühner liefen frei auf dem Gelände herum, und wir warfen ihnen unsere Essensreste über die Holzveranda zu. Und so viele Menschen. Ich hatte mir eine einsame und idyllische Alm auf einer frischen grünen Bergwiese vorgestellt, alles bilderbuchmäßig wie im Heidi-Film. Gerüche gab es nicht in meiner Fantasie. Aber nein, hier war nichts romantisch. Hier war raues landwirtschaftliches Leben. Ich schluckte und verscheuchte mit einer Handbewegung die Vernunft, die spöttisch applaudierte und mit den Augen rollte. »Super, diese Herzentscheidung«, sagte sie verächtlich. »Das wird schon«, zischte ich ihr zu und stapfte die wackelige Holztreppe zu meinem Dachkämmerchen hinauf. Ich war in meinem eigenen Abenteuer angekommen.
Anfangs aber fühlte ich mich sehr verloren. Nicht nur der Hof war fremd, mit all den Tieren, den Geräuschen und Gerüchen. Die Sprache sowieso (zuzüglich des landwirtschaftlichen Vokabulars), aber es war vor allem diese alternative Welt, die mich befremdete. All die wild aussehenden Männer mit langen Bärten, verfilzten Rastalocken, die mit nacktem Oberkörper Holz spalteten und danach ihre sehr eigenen Tabak-Kräuter-Mischungen rauchten, die irgendwo auf dem Gelände in Hütten oder Wohnwagen eine Zeit lang mitlebten, verschwanden und wiederkamen. Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen auf dem Hof. Was für eine Welt. Ich sah das alles mit Staunen an und verstand die Regeln nicht. Heute weiß ich, es gab keine Regeln oder fast keine. Alles war möglich. Und die Tür stand immer offen. Vorurteilsfrei für jeden. Immer waren wir mindesten zwölf am Tisch, aber wir hätten auch überraschend zwanzig sein können, dann hätte man einfach noch ein paar Teller dazugestellt und hätte das, was da war, geteilt. Teilen – partager –, das war das oberste Gebot. Das war und ist das Lebensmotto dort. Großzügig wurde für Gäste immer alles auf den schweren Holztisch gestellt: Bier und Wein, Brot, selbst gemachte Wurst, Schinken, Pasteten. Und alles, was Küche, Keller und der Garten hergaben. Genauso haben sie mich aufgenommen. Wie selbstverständlich. »Komm ruhig«, hatten sie am Telefon gesagt. »Sehen wir dann schon.«
Es war sicher nicht das Paradies, das ich mir erhofft hatte. Keine Heidi-Idylle. Keine Stille und Einsamkeit auf Almwiesen. Es war sehr irdisch, sehr lärmig zwischen all den Menschen, die dort lebten und ein und aus gingen, es wurde geraucht und getrunken und laut erzählt. Es roch fremd nach Tieren und vergorener Milch, überall surrten Fliegen, und alles ging langsam in einem Rhythmus, den ich nicht verstand. Es war ein alternativer Aussteigerhof.
In den späten Sechzigerjahren hatte man hier eine Landkommune gegründet und versuchte sich mit Freunden und Gleichgesinnten in den unterschiedlichsten Lebensformen. Sogar eine Schule hatten sie seinerzeit ins Leben gerufen und einen alternativen Lehrer eingestellt für all die Kinder, die eigenen und die, die man als famille d’acceuil, als Pflegefamilie, angenommen hatte. Als Pflegefamilie bekommt man für die Pflegekinder, die man aufgenommen hat, eine monatliche staatliche Unterstützung. Geld, ohne das der Hof nicht funktioniert hätte. Famille d’acceuil waren sie immer noch. Jetzt lebten zwei behinderte Männer mit auf dem Hof. Diese beiden Männer, ein ehemaliger Soldat, der bei einem gewalttätigen Streit eine Kopfverletzung erlitten hatte, was ihn geistig auf ein gedächtnisloses Kinderniveau reduzierte, und ein kleiner Mann asiatischer Herkunft, der bulimisch, kettenrauchend, düster und ruhelos war. Er immerhin bekam einmal im Jahr Besuch von seiner Familie.
All das aber machte, dass ich nicht im Paradies war, sondern mitten im Leben. Ich staunte, war abgestoßen und angezogen gleichzeitig. Ich liebte es, im Garten oder auf dem Feld alleine zu arbeiten, mit dem Blick auf die Berge und den blauen, wolkenlosen Himmel, aber alleine war ich selten. Zu neugierig waren alle, mich kennenzulernen. Erzähl mal, warum bist du hier? Was hast du gemacht? Was willst du machen? Es fiel mir schwer, mich mitzuteilen, nicht nur, weil mein Französisch so erschreckend rudimentär war. In mir war noch alles durcheinander; ich war so schnell abgereist und konnte es manchmal noch gar nicht glauben, dass ich es gewagt hatte.
Diese Zeit auf dem Hof war nicht voller Glück, und doch nenne ich sie meine Rettung. Weil sie mich mit dem Leben konfrontiert hat, im ursprünglichsten Sinn, mit Geburt und Tod von Tieren, mit Säen, Pflanzen, Wachsen und Ernten im Garten und auf den Feldern. Mit dem unmittelbaren Kontakt zur Natur, durch den ich erstmals verstanden habe, dass es keine Kirschen gibt, wenn ein später Wintereinbruch die Blüten erfrieren lässt, dass es keinen Kohl gibt, wenn die Raupen ihn abfressen, und dass man sie daher so schnell wie möglich ablesen und töten muss. Igitt, wie war es eklig, die ersten Raupen mit meiner behandschuhten Hand zu zerquetschen. Dass man ein Huhn schlachten muss, wenn man eines essen will, oder ein Schwein schlachten muss, wenn man Pastete und Würste und Rillettes machen und Schinken essen will. Dass Tiere unverhofft sterben oder von anderen gefressen werden. Dieses Hofleben war so intensiv und aufregend für mich, die ich so ein keimfreies Stadtleben gewohnt war, dass ich die ganze Zeit im Hier und Jetzt war. Es gab kein Abschalten und, für mich zumindest, keine Routine. Der Käse muss dann gemacht werden, wenn die Milch gestockt, Kühe gemolken, wenn ihr Euter voll war. Schweine, Kälber, Kaninchen, Hunde und Katzen mussten gefüttert werden, und zwar jeden Tag. Die Kinder, die es auch hier gab, wollten beschäftigt oder in die Schule gefahren und wieder abgeholt werden. Das Unkraut wucherte zwischen den Kartoffeln und den Rüben, man kam kaum nach, es gab immer etwas zu tun. Und dazwischen wurde gegessen und getrunken und erzählt und manches Mal gefeiert. Und nach diesen übervollen Tagen schlief ich muskelkaterig und tonnenschwer auf meiner Matratze auf dem Boden des Dachkämmerchens ein.
Anfangs habe ich mich noch geschminkt, ich war es so gewohnt, ich ging in Deutschland nie ungeschminkt aus dem Haus. Man machte sich lustig über mich. »Wen willst du beeindrucken, Christjann, die Kühe? Die Rüben?« Aber es ging um mein Bild von mir, das ich im Spiegel nicht ansehen mochte. Im Laufe der Zeit wagte ich es dann, ohne Wimperntusche aufs Feld oder in den Stall zu gehen. Und nichts passierte. Natürlich nicht, sagen Sie. Aber es passierte auch nichts, wenn ich Nachbarn traf oder den Postboten. Niemand sagte: »Du siehst so blass aus heute?!« Oder: »Was ist mit deinen Augen?« Ich lernte, mein ungeschminktes Spiegelbild anzusehen, und es wurde normal. Den Kühen war es egal, wie ich aussah, den Rüben auch und sogar den Menschen. Hier zählte nicht, wie ich aussah, sondern wer ich war. Ich genoss es. Ich ließ mir die Haare wachsen, schminkte mich nicht mehr, zog mich pragmatisch an, und ich liebte es, in meinen Bergstiefeln oder im Sommer barfuß herumzulaufen. Ich sah gerne meine von der Erde schwarz verfärbten Finger, die ich mir an der Hose abwischte. Ich konnte mich ohne Probleme überall hinsetzen, auf die Wiese, auf die Mauer, auf die Erde. Ich wurde in gewisser Weise »wild«, ursprünglich. Ich machte mir keine Gedanken darüber, wie ich aussah, es war mir egal, ob ich mich schmutzig machen könnte. Ich vergaß all das Äußerliche und war einfach da. Ich lebte. Oder sagen wir, ich begann zu leben.
Und ich sah ebenso mit Staunen, dass alles, was mir in meinem früheren Leben so wichtig gewesen war, hier nicht nur unbekannt war, sondern absolut keinen Wert hatte. Wenn man zu einer gewissen Zeit den angesagtesten Bücherregalbauer nicht kannte, gehörte man damit in Köln oder in anderen Städten nicht »dazu«. Zu der kleinen schicken, intellektuellen Schicht, die wusste, was in ist, wo man essen ging, welche Ausstellung man gesehen haben musste. Ich wagte es auf dem Hof nicht mal, diesen Bücherregaldesigner zu erwähnen oder von der Suche nach der richtigen Espressomaschine zu erzählen, wie viel Zeit hatte ich darein investiert?! Wozu? Hier hatte man für die Bücher ein paar Bretter in gemauerte oder gegipste Nischen gelegt, und es gab eine klassische Kaffeemaschine. Wichtig war, dass sie rechtzeitig angeschaltet wurde, damit man nach dem Essen einen frischen Kaffee trinken konnte. Mehr war nicht nötig. Und mehr ist wirklich nicht nötig.
Was ist wichtig? Was ist wirklich wichtig?
Ich habe in den fünf Jahren, die ich in den Bergen verbracht habe, so gut wie kein kulturelles Leben gehabt. Also zumindest nicht in dem Sinn, wie ich es kannte. Filme, Ausstellungen, Bücher, zumindest aus deutscher Sicht, kamen nur noch via Wochenzeitung zu mir, und auch wenn ich Kolumnen und Kritiken las, so drang alles nur merkwürdig unwirklich bis zu mir vor. Für die französische Kultur war mein Französisch noch viel zu rudimentär. Ich konnte den Radiosendungen auf France Culture oder France Inter nicht folgen, und die Stimmen rauschten nur als Geräusch an mir vorbei. Ich versuchte, Liedtexte zu verstehen. Die Sängerin Camille hatte ihr erstes Album veröffentlicht, und ihre fremd klingende Musik schallte über den Hof. Ich verstand Camilles poetische Texte nicht, aber dennoch hat mich dieses Album tief berührt. Poesie verstehe ich übrigens auch fünfzehn Jahre später immer noch nicht. Es wird mir erst in der fremden Sprache bewusst, welch verfeinerte Form von Sprache Poesie ist.
Wie wenig verstand ich anfangs. Und wie wenig konnte ich sagen. Ich überschätzte meine Fähigkeiten, und ich unterschätzte ganz klar, was für eine Herausforderung es ist, mit Anfang vierzig noch eine Sprache zu lernen. Natürlich habe ich Französisch in der Schule gelernt. Aber wie viel Französisch habe ich in all den Jahren gesprochen? Und klar, einen Milchkaffee konnte ich bestellen. Aber viel mehr konnte ich nicht. Ich habe es an anderer Stelle schon einmal geschrieben, aber dieser »Sprachverlust« im Erwachsenenalter macht demütig. Nicht nur, dass ich damit alle meine Sprachfähigkeiten verlor: meine ironischen Spitzen, meine kleinen witzigen Wortspielchen, meine Schlagfertigkeiten, all das Indirekte, Subtile. Ich war froh, wenn ich einen klaren Satz von vorne bis hinten sagen konnte. »Kann ich bitte das Salz haben? Danke.« Nein, ich verlor viel mehr. Ich verlor meine Kontrolle: Der Sprachverlust reduzierte mich auf das Niveau und auf die Hilflosigkeit eines Kleinkinds. Ich suchte, ganz wie ein Baby, nach einer anderen Form der Orientierung. Wer lächelt mich an und ist lieb zu mir? Wer kümmert sich um mich? Wer hilft mir?
Ich war froh, dass ich die banale Fernsehserie Plus belle la vie (eine Art Lindenstraße) verstand und der Handlung folgen konnte. Ich war in jeder Hinsicht weit entfernt von französischen Filmen, Literatur, französischer Kultur. Und ich brauchte sie auch nicht. Der Alltag war so prall gefüllt mit Aktivitäten, dass ich abends müde ins Bett fiel. Welches Buch Dennis Scheck in Deutschland gerade dramatisch in die Tonne gekloppt hatte, war mir hier auf dem Hof vollkommen egal.
Waren die Menschen auf dem Bauernhof glücklich? Es sah für mich so aus. Also versuchte ich, ihre Art, das Leben anzugehen, zu studieren. Vielleicht machte es mich auch glücklich. Ich habe niemanden und nichts kritisiert, ich war ja auch nicht da, um einen kleinen Bauernhof neu zu organisieren oder rentabler zu machen. Ich suchte nach einem anderen Leben als dem, das ich in Deutschland gelebt habe. Das zwar gut aussah, mich aber nicht glücklich gemacht hatte. Alles, was mich auf dem Hof befremdete, schrieb ich in meine Tagebücher. Blogs gab es noch nicht, ich zumindest kannte keinen, und Internet, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, gab es noch so gut wie gar nicht auf diesem Hof. Dass es überhaupt eine wackelige und schwache Verbindung gab, lag an den jungen Menschen, die auf dem Hof lebten. Ich steckte altersmäßig zwischen zwei Generationen. Die Elterngeneration, ehemalige Hippies, Aussteiger, Babacools, wie man sie in Frankreich nennt, stammen aus der 68er-Bewegung, etwa 15 Jahre älter als ich, waren schon Großeltern zweier kleiner Mädchen, als ich dort ankam. Die Kindergeneration war 15 Jahre jünger als ich, aber sie waren schon junge Eltern. Ich war ein exotisches Wesen dazwischen, kinderlos und ohne Bedürfnis, mich niederzulassen. Aber sie ließen mich so sein, wie ich war, und sie nahmen mich vorurteilslos auf, und das war das Beste, was mir bis dahin passiert war. Den Ort, wo ich dauerhaft sein wollte, den hatte ich noch nicht gefunden. Mich hatte es all die Jahre immer weitergetrieben. Langsam zwar, aber doch musste ich nach ein paar Jahren weg, woanders hin. Neu anfangen. Dort, wo ich nicht war, schien es immer besser zu sein. War ich dann dort und die Anfangseuphorie des Neuen verflogen, wurde es auch dort wieder schwer und auf Dauer unlebbar für mich. Und wieder zog ich weiter. Immer musste ich weiter.
Einmal war ich an Ostern mit einem früheren Freund in den Süden gefahren. Wir wollten so weit fahren, bis es südlich warm würde. Wir landeten am Gardasee auf einem großen Campingplatz. Von unserem Stellplatz ganz oben beobachtete ich unter mir zwei italienische Familien, die offensichtlich an diesem sonnig milden Osterwochenende die Campingsaison eröffneten. Zwei benachbarte oder auch befreundete Familien kamen zeitgleich an, begrüßten sich laut und lange, räumten die Autos aus, halfen sich gegenseitig, ein Vordach vor dem jeweiligen Wohnwagen aufzustellen, trugen Taschen voller Lebensmittel, Kleider und Bettwäsche hinein. Es wurden sogar Blumenkästen als Platzbegrenzung aufgestellt, ob sie mit echten oder mit Plastikgeranien bepflanzt waren, das weiß ich heute nicht mehr zu sagen. Die Rollen waren klar verteilt, alles schien eingespielt. Die Männer bauten, die Frauen räumten, die Kinder rannten herum und fuhren mit Rädchen über den Platz. Im Laufe des Nachmittags stellten beide Männer einen Grill auf, etwas später prostete man sich zu, Fleisch und Würste wurden auf den Grill geworfen, Frauen trugen Schüsseln mit Salaten, Teller und Besteck nach draußen, und der Abend wurde eingeläutet, und es wurde gegessen. Ich saß da und sah diesem, in meinen Augen, zutiefst spießigen Leben zu und war neidisch. Neidisch auf die Zufriedenheit, die diese Familien ausstrahlten. Nein, ich wollte keinen festen Stellplatz auf einem Campingplatz am Gardasee haben und auch nirgends sonst. Ich wollte auch dieses Leben nicht haben, keinesfalls, aber die Zufriedenheit dieser Familien, die kannte ich nicht, und ich sehnte mich danach.
Hier auf dem abgelegenen Hof schienen alle zufrieden zu sein. In einem mir unerklärlichen Rhythmus zu arbeiten, lange zu essen, ein Mittagsschläfchen zu machen, das so heilig war, dass ich mich nicht traute, an einem Tag, als die Kühe aus ihrem abgesperrten Terrain abgehauen waren und nun auf dem weit entfernten Wiesenfußballplatz herumstanden, jemanden zu wecken, um sie wieder zurückzuführen. Rückblickend weiß ich, ich hätte die Kühe besser in Ruhe das Gras auf dem holperigen Fußballfeld fressen lassen, aber ich dachte damals, ich müsse sie sofort zurückholen, und außerdem glaubte ich, ich würde das alleine hinkriegen, konnte ja nicht so schwer sein, zusammen mit den zwei kleinen Nachbarsjungen, die begeistert und stockfuchtelnd auf die Kühe zurannten und laut brüllten. Hey, was für ein Spaß! Ich brüllte wiederum die Jungs an, damit aufzuhören, und versuchte, die nun auseinanderlaufenden Kühe ruhig zurückzuführen. Ich wusste gar nichts. Wusste nicht mal, welches die Leitkuh war, an die ich mich hätte wenden müssen. Ich wusste nicht, wie ich sie führen oder scheuchen sollte, mit einem Stock, mit der Hand, und wie mit ihnen sprechen. Ein bisschen Angst hatte ich ja auch vor ihnen und ihren Hörnern. Ich mache es kurz, es wurde eine Katastrophe, denn die Kühe fanden den Ausflug zunehmend amüsant, und sie begannen, mit uns Fangen zu spielen. Schwerfällig sprangen sie herum und liefen in alle Richtungen davon, bis eine von ihnen den Gemüsegarten des Nachbarn entdeckte. Na so was! Bunte Blumen. Ach, was war das hübsch. Sie beugte sich über eine kleine Hecke, rupfte die Blumen dahinter ab und malmte sie mit ihrem kräftigen Kiefer gemächlich platt. »Nein, non«, schrie ich zweisprachig und versuchte, sie wegzustoßen, aber sie ließ sich nicht beirren und machte einen Schritt über die niedrige Hecke und noch einen und stand schon mitten im Salat. Frischen Salat mit ganz zarten Blättchen gab es da. Mit der Zunge fuhr sie sich genüsslich über die Nüstern und rupfte los. »Non!«, schrie ich wieder. »NEIN! NON, NON, NON!« Ich war dem Nervenzusammenbruch nahe und stapfte nun auch quer durch den Garten, um den Salat zu retten. »Raus, raus«, brüllte ich und fuchtelte vor ihr und hinter ihr mit den Armen. Was hieß »raus« auf Französisch? Ich hatte keine Ahnung. »RAUS! Marguerite oder Lulu oder wer immer du bist«, schrie ich. Für mich sahen sie irgendwie alle gleich aus. Aber vermutlich hieß sie Florette und fühlte sich nicht angesprochen, und sie bewegte ihren schweren Körper nur ein bisschen nach links, um besser an den Pflücksalat zu kommen. Alles, was ich mit meinem Gebrüll und Gefuchtel erreichte, war, dass die anderen Kühe neugierig wurden, und eine nach der anderen stapfte nun über den kleinen Vorgarten in den penibel angelegten Gemüsegarten. »Bitte!«, versuchte ich es nun höflich, wie ich es einmal in dem Kinderfilm Ein Schweinchen namens Babe gesehen hatte. »Bitte, liebe Kühe, kommt aus dem Gemüsegarten! Bitte!«, sagte ich flehentlich. Aber die Kühe kicherten, zeigten mir ihre Hinterseite, ließen ungerührt ihren Schwanz baumeln und stapften in ihrer Schwere durch sämtliche Beete und fraßen die Blumen und den Salat und die Tomaten und was weiß ich.
Wutschnaubend kam der Nachbar abends auf den Hof gestapft, die Hofleute mussten lange auf ihn und seine Frau einreden und sie letztlich als Wiedergutmachung in das teuerste Restaurant in der Gegend einladen. Auf mich aber war er noch wochenlang böse. »Warum hast du mich denn nicht gerufen?«, fragte der Patriarch des Hofs fassungslos, als er sah, was geschehen war. »Mais tu faisais la sieste«, erklärte ich kleinlaut.
»Ah ja, die Sieste«, nickte er verstehend. Denn ja, er wurde fuchsteufelswild, wenn man ihn in der Sieste, dem heiligen Mittagsschlaf, störte. »Aber trotzdem«, brummelte er … Ich machte nun vorsichtshalber auch eine Sieste, einfach, damit ich nicht sah, was in der Zeit geschah und ich nicht noch einmal mutterseelenallein mit den Kühen Abenteuer erleben musste.
Eine Entscheidung
»Das sind die Glücklichen«, dachte ich, als ich in Nizza auf dem Kieselstrand saß, in die Sonne blinzelte und nebenan, auf einer Terrasse eines Strandrestaurants, in elegantes Weiß gekleidete Menschen in offensichtlicher Feierlaune Champagnergläser klirren ließen.
Ich saß nur zehn Meter weiter, hatte denselben Blick auf das schmerzhaft schöne türkisblaue Mittelmeer, hörte die Möwen kreischen, spürte den leichten Wind, der nachmittags aufkommt, und genoss die schon warmen Strahlen der Frühlingssonne auf meinem Körper. Ich hatte mich entschieden, hierbleiben zu wollen. Nicht in Nizza, aber in Südfrankreich. In den Bergen, dort, wo ich bereits mehrere Monate auf dem kleinen Bauernhof verbracht hatte. Ich fühlte mich hier viel lebendiger als in Deutschland. Eine Freundin, die aus Köln zu mir in die Berge gereist war und die den ganzen großstädtischen Alltag und ihre Sorgen mitgebracht hatte, ließ mich diese bislang nur vage angedachte Idee nur noch viel deutlicher spüren. Ihr großstädtisches Tempo und all das, wovon sie so aufgeregt berichtete, und was vor ein paar Monaten auch noch mein Leben ausgemacht hatte, all das wollte ich nicht mehr. Ich fühlte mich in meiner Abgeschiedenheit in den Bergen wohl. Diese Ruhe, diese Ereignislosigkeit und das langsame Leben inmitten von Natur waren Balsam für meine innerlich so gehetzte Seele. Ich wollte nicht zurück in die deutsche Großstadt. Ich wollte auch nicht in eine französische Stadt, obwohl mir Nizza wirklich zu jeder Jahreszeit wundervoll erschien. Vor allem jetzt im Frühling, da es in den Bergen noch einmal geschneit hatte, war es hier so mild, so hell und schon so grün. Dazu diese großartige Architektur und natürlich die weite Bucht und dieses Blau des Meeres, das in mir eine Sehnsucht auslöste nach … Ja, wonach? Nach dem großen Glück!
Warum war ich nicht glücklich?
Ich wollte so sehr anders leben als in Deutschland. Frei sein. Lockerer sein. Unkomplizierter sein. Und das ganze Jahr habe ich mich nicht wirklich frei und auch nicht locker oder unkompliziert gefühlt. Auch nicht wirklich glücklich. Alles war nur sehr fremd und sehr anders. Aber es zog mich an, und ich dachte, ich müsse noch ein bisschen mehr davon leben, um das Glück zu spüren. Zurück, da war ich sicher, zurück wollte ich auf keinen Fall, und da meine Untermieter in Köln ihrerseits ihren Vertrag verlängerten und in meiner Wohnung blieben, entschied ich mich hierzubleiben. Allerdings hätte ich mir mehr Glücksgefühl gewünscht, nachdem ich mich zu dieser Entscheidung durchgerungen hatte. Eine unbändige Freude, die mich innerlich bersten, mich vor Übermut springen ließe. Irgend so etwas. Nichts von alledem spürte ich. Das Glück, es war gerade auf der Restaurantterrasse nebenan, bei den anderen. Ich war vielleicht noch nicht ganz am richtigen Ort. Aber ich war auf dem Weg. Das zumindest sagte ich mir damals und fuhr wieder hoch in die Berge.
Avignon
Die beiden jungen Frauen auf dem Hof hatten mit einer weiteren Freundin eine Theatergruppe gegründet. »Du machst mit, Christjann, oder?«, fragten sie. (Christjann, so nennen mich hier alle, diese französische Art, meinen richtigen Vornamen, Christiane, auszusprechen. Manche glauben auch, ich hieße Christine, und nennen mich so, denn Christiane ist ein Vorname, der in Frankreich eine und zwei Generationen früher üblich war. Die französischen Christianes sind in der Regel siebzig Jahre und älter. Als ich mir später einen Autorennamen suchte, einen nom de plume, war als Vorname Christine naheliegend.) »Mach dich nicht lächerlich!«, raunte die Vernunft noch, aber da hatte mein Herz schon »Jaja« gerufen. Alles wollte ich ausprobieren. Klar, machte ich mit. Ein bisschen Angst, vor den anderen aufzutreten und zu sprechen, hatte ich schon, aber zunächst probten wir ja nur im Gemeindesaal des zehn Kilometer entfernten Nachbarorts, improvisierten, schritten, hüpften, schrien und versuchten, glaubwürdig zu lachen und zu weinen. Die meiste Zeit nahm sowieso das Warten ein. Das Warten darauf, dass meine beiden jungen Hoffrauen fertig waren und mich im Auto mit nach unten nahmen. Sie waren für mich absolut unberechenbar, und ich wartete gefühlt Stunden auf sie. Hatten wir nicht
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: