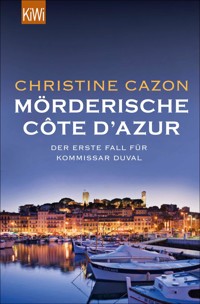9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Duval ermittelt
- Sprache: Deutsch
Mord und Intrigen an der Côte d'Azur: Léon Duval ermittelt in seinem zweiten Fall wieder in Cannes Gerade hat Kommissar Léon Duval seinen ersten Fall – die Ermordung eines berühmten Regisseurs während der Internationalen Filmfestspiele – erfolgreich gelöst, da warten auch schon die nächsten Herausforderungen auf ihn und sein Team: Ein Spaziergänger entdeckt eine Leiche, im ehrwürdigen Hotel Beauséjour wird Schmuck gestohlen, und eine Frau verschwindet. Duval und seine Kollegen, die eigentlich auf eine ruhige Nachsaison gehofft hatten, beginnen mit den Ermittlungen. Doch je mehr Duval an Informationen zusammenträgt, desto mehr muss er sich fragen, ob es zwischen all diesen Fällen nicht einen Zusammenhang gibt. Warum verschwindet die Tochter der Hotelbesitzerin scheinbar spurlos, und was weiß ihr Geliebter? Welche Rolle spielt Nicole Bouvard, Mitgesellschafterin des Hotels, und wie passt der Tod eines Journalisten in das Szenario? Eine knifflige Aufgabe für Léon Duval, die viel Fingerspitzengefühl und Diplomatie erfordert. Nicht nur im Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten, sondern auch mit allen Beteiligten dieser scheinbar unentwirrbaren Intrige.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Christine Cazon
Intrigen an der Côte d‘Azur
Der zweite Fall für Kommissar Duval
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Christine Cazon
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Christine Cazon
Christine Cazon, geboren 1962, lebt mit ihrem Mann und zwei Katzen in Cannes.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Gerade hat Kommissar Léon Duval seinen ersten Fall – die Ermordung eines berühmten Regisseurs während des Filmfestivals – erfolgreich abgeschlossen, da warten auch schon die nächsten Herausforderungen auf ihn. Ein Spaziergänger entdeckt eine Leiche, im ehrwürdigen Hotel Beauséjour wird Schmuck gestohlen, und eine Frau verschwindet. Und je mehr Informationen Duval und seine Kollegen bei ihren Ermittlungen zusammentragen, desto mehr müssen sie sich fragen, ob es zwischen all diesen Fällen nicht einen Zusammenhang gibt.
Warum verschwindet die Tochter der Hotelbesitzerin scheinbar spurlos und was weiß ihr Geliebter? Welche Rolle spielt Nicole Bouvard, Mitgesellschafterin des Hotels, und wie passt der Tod eines Journalisten in das Szenario? Eine knifflige Aufgabe für Léon Duval, die im Umgang mit allen Beteiligten viel Fingerspitzengefühl und Diplomatie erfordert. Und dabei hatte Duval sich so auf eine ruhige Nachsaison und ein paar herzhafte Pilzgerichte gefreut.
Hinweis für E-Reader-Leserinnen und Leser
Wenn Sie sich die Karte in Farbe und zoombar ansehen möchten, dann geben Sie bitte die folgende Internetadresse im Browser Ihres Computers oder Smartphones ein:
www.kiwi-verlag.de/buecher/specials/karte-intrigen-an-der-cote-d-azur.html
Hinweis für Leserinnen und Leser auf dem Smartphone/Tablet oder am Computer
Sie möchten sich die Karte zoombar anschauen? Dann tippen bzw. klicken Sie bitte auf die Abbildung. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden Website-Ansicht.
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum Buch
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Epilog
Dieser Roman ist inspiriert von wahren Begebenheiten.
Die im Roman handelnden Personen und ihre beruflichen und privaten Handlungen und Konflikte sind dagegen frei erfunden.
La vérité est si obscurcie en ces temps
et le mensonge si établi
qu’à moins d’aimer la vérité
on ne saurait la reconnaître.
Die Wahrheit ist in dieser Zeit so sehr verdunkelt und die Lüge so allgemein verbreitet, dass man die Wahrheit nur erkennen kann, wenn man sie liebt.
Blaise Pascal
1
Es war noch früh. Er mochte es, zu dieser Tageszeit unterwegs zu sein. Die Luft war noch nachtkühl und ließ ihn leichter atmen. In der Regel begegnete er niemandem. Die ersten Jogger liefen nicht vor sieben durch das Wäldchen, wenn die Sonnenstrahlen durch die Blätter fielen. Dann kamen auch andere Hundebesitzer für ihren Morgenspaziergang, und die Geräusche nahmen allmählich zu. Aber jetzt mit dem ersten, noch fahlen Tageslicht, war er allein mit Tiffany und dem Gezwitscher der Vögel und dem unablässigen Gurren der Tauben. Von Weitem hörte man die Hunde des Tierheims bellen. Tiffany blieb abrupt stehen, stellte ihr Schwänzchen auf und spitzte die Ohren.
»Na, was ist, Tiffany? Was erzählen sie dir?« Erst vor Kurzem hatte er den noch jungen Jack-Russel-Terrier aus dem Tierheim zu sich genommen. Eigentlich war der Hund zu jung für ihn. Oder er schon zu alt für den Hund, wie man’s nimmt. Er hatte sogar gedacht, dass er sich gar keinen Hund mehr zulegen sollte. Es könnte ihm ja jeden Tag etwas zustoßen, und wer kümmerte sich dann um das Tier? Nachdem Benny, sein Rauhaardackel, nach langem Leiden endlich eingeschlafen war, wollte er nie wieder einen Hund haben. Zu sehr hatte er geweint, als er seinen treuen Gefährten in aller Frühe hier im Wäldchen begraben hatte. Nie wieder wollte er diese Traurigkeit spüren. Wie einsam konnte man sein ohne Hund. Und wie leer war seine Wohnung plötzlich. Er hatte immer einen Hund gehabt. Und jedes Mal war ihm der Tod des Tieres nahegegangen, aber niemals hatte er sich selbst so todessehnsüchtig gefühlt wie nach dem Tode von Benny. Eines Tages stand er dann doch wieder vor dem Tierheim, vielleicht hätten sie ja einen alten Hund für einen alten Mann, die beide noch ein bisschen Trost und Gesellschaft bräuchten in ihrem Leben. Aber dann war es dieses vorwitzige Hündchen gewesen, das ihn im Sturm erobert hatte. Der Blick, mit dem sie ihn angesehen und eine Pfote auf seinen Arm gelegt hatte, als er sich zu ihr hinunterbeugte, hatte sein Herz zum Schmelzen gebracht. Sie hatte ihn um den Finger gewickelt. Sie war frech, verzogen und ungestüm. Unter dem Tisch kaute sie stillvergnügt seine Hausschuhe an, sprang kläffend den Vorhängen im Wind hinterher und sie hüpfte morgens in sein Bett und leckte ihm vor Freude jaulend über das Gesicht. Er schimpfte und lachte gleichzeitig. Aber er fühlte sich wieder lebendig. »Ein paar Jahre werden wir schon noch zusammen haben, was Tiffany«, sagte er und beugte sich zu dem kleinen Hund hinab, »und jetzt werden wir dich erst mal erziehen, du verzogenes Hundevieh!« Aber Tiffany wirkte alarmiert und beachtete ihn nicht. »Was ist los, Tiffany? Das Grab von Benny hat dich doch sonst auch nicht interessiert, was ist los?«
Der Hund sträubte das Fell und begann leise zu knurren. Dann zog er energisch an der Leine.
»Nein! Aus! Hierher, Tiffany!« Aber der Hund ließ sich nicht beirren. Er begann zu bellen.
»Tiffany!« Der Alte zog den Hund zurück und überlegte nervös, wie er reagieren sollte, wenn er plötzlich einem Wildschwein gegenüberstünde, die in diesem Stadtwäldchen die Erde umwühlten oder auch die Mülltonnen der nahe gelegenen Häuser nach Essbarem durchsuchten. Tiffany bellte wütend, zerrte an der Leine und war mit einem Ruck unversehens samt Leine im Dickicht verschwunden. Sie begann erneut wütend zu bellen und zu jaulen. Sonst hörte man kein Geräusch – keinen Kampf, kein Fauchen. Der Alte folgte ihr zögernd, er merkte, wie sich sein Herz zusammenkrampfte, dann schob er entschlossen die Zweige auseinander. »Oh, mein Gott!«, entfuhr es ihm.
Es war windstill, und die Wellen plätscherten gemächlich auf den Sand. Das zarte Blau des Himmels und das dunklere Blau des Meeres trafen sich am Horizont. Kein einziges Wölkchen war am Himmel zu sehen, die Sonne schien bereits warm. Es würde ein angenehmer Tag werden. Duval lief und war glücklich. Der Strand vor ihm war leer. Nur ein paar Möwen standen in Grüppchen herum und warteten darauf, dass mit den Wellen etwas Essbares angeschwemmt käme. Hin und wieder lagen auf dem Sand ein paar gelartige Flecken halb aufgelöster Feuerquallen, die in den letzten Tagen wieder vermehrt im Mittelmeer gesichtet worden waren und die die verbliebenen Urlauber davon abhielten, ins Wasser zu gehen. Seit ein paar Tagen war die Hochsaison vorbei, die meisten Sommertouristen waren abgereist und an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt, und in Cannes war es schlagartig ruhiger geworden. Im September war man zwar noch immer nicht ganz unter sich, aber auch die verbliebenen Urlauber kamen selten vor zehn Uhr an den Strand. So früh morgens war er hier noch fast allein, abgesehen von ein paar älteren Herrschaften, die gerne unbeobachtet ihre alterssteifen Glieder strecken wollten oder bereits eine Runde schwammen. Die frühen Strandbesucher kannten sich alle, jeder hatte seinen festen Platz, man grüßte sich respektvoll, und auch Duval hob freundlich die Hand, wenn er an ihnen vorbeilief. Man nickte freundlich zurück, als regelmäßiger früher Strandläufer gehörte er inzwischen dazu. Manchmal wechselte man ein paar Worte, nicht viele, ein freundliches bonjour! Und dann, mit einem Blick in den Himmel, prüfend Wolken und Wind zur Kenntnis nehmend, eventuell einen kleinen Satz zum Wetter: »Wird es so bleiben?« »Ah … wer weiß?!« Aber die wichtigste Frage überhaupt, die selbst Wildfremde morgens am Strand zu einem kleinen Schwatz vereinte, lautete: Elle est bonne? Gemeint war das Wasser. Wie ist es heute Morgen? Die Frage ist im Prinzip nur rhetorisch gemeint, die Güte von Wasser und Meer ist bereits impliziert: Elle est bonne? Wie sollte es nicht! Duval hatte noch nicht einmal gehört, dass das Meer und das Wasser morgens nicht »gut« seien. Denn so wie man auf die Frage des Befindens stets mit einem positiven Ça va! antwortete, so lautete auch die Antwort auf die Frage zur Güte des Wassers stets gleich: Aaah, elle est bonne! Und die Quallen? Ach, die Quallen, die haben damit nichts zu tun … und überhaupt, da hinten gibt es keine. Ein echter Ganzjahresschwimmer lässt sich von ein paar Quallen, seien sie auch noch so feurig, doch nicht vom Schwimmen abhalten!
Vielleicht würde er heute mal wieder richtig essen gehen können, er hatte die Sandwiches, die er im Sommer auf die Schnelle verschlungen hatte, so satt. Am Strand vielleicht, da war nun weniger los. Oder er könnte bis nach Théoule fahren. Im benachbarten Örtchen hatte er ein kleines Restaurant entdeckt, das zwar in einer unscheinbaren Seitenstraße lag und keinen spektakulären Blick bot, ihn kulinarisch aber jedes Mal in Entzücken versetzte. Allein beim Gedanken an das köstliche Essen lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Er war schon lange nicht mehr dort gewesen. Im Sommer war es fast unmöglich, in angemessener Zeit dorthin zu kommen, so sehr reihten sich die Autos im stop and go auf der Corniche, der Küstenstraße, aneinander.
Der Sommer war anstrengend gewesen. Während das gesamte Land zwei Monate lang in Ferienstimmung war, überall sämtliche Bäcker, Metzger und alle Handwerksbetriebe gleichzeitig geschlossen hatten, selbst die medizinische Versorgung zu wünschen übrig ließ, und sogar die Hauptstadt Paris wie ausgestorben wirkte, zumindest dort, wo sich keine Touristen drängelten, und nur ein paar übrig gebliebene Gestalten an den Bistrotischen ihr Gläschen Roten tranken und müde das träge Sommerleben betrachteten, so platzte das kleine Cannes während der Sommermonate aus allen Nähten. Alle schienen sich entschieden zu haben, an die Côte d’Azur zu reisen, denn nur hier gab es so etwas wie eine Sonnengarantie. Cannes vibrierte vor Geschäftigkeit. Die Einwohnerzahl hatte sich in kürzester Zeit verdreifacht, die Terrassen der Restaurants leerten sich quasi nie, und auch am Strand war es schwierig, eine freie Liege oder einen Platz für sein Badehandtuch zu finden. Cannes war laut im Sommer. Tag und Nacht erschallte von irgendwo Musik, alle Strandbars waren mit Lautsprechern ausgestattet, selbst vom Strandrestaurant des edlen Carlton wummerten elektronische Töne in den Wind. Da zahlte man ein kleines Vermögen, um ein Zimmer mit Meerblick an der Croisette zu haben, und dann wurde man bis nachts um drei mit Musik beschallt. Überall betrunkene Autofahrer, Schlägereien vor Diskotheken, Streitereien zwischen nachts feiernden Urlaubern und entnervten Anwohnern. Die Polizei war in Cannes während des Sommers im Dauereinsatz, und man forderte zusätzlich, wie jedes Jahr für die »heiße Zeit«, Verstärkung aus anderen Départements an. Denn auch Diebe und Einbrecher hatten Hochkonjunktur: Da die Urlauber nur allzu oft sorglos ihren Reichtum spazieren trugen, verschwanden am Strand teure Handys oder Sonnenbrillen, im Gewühl der Innenstadt wurden Geldbörsen, Handtaschen oder Halsketten hastig entrissen, Autodiebstähle waren an der Tagesordnung, und es gab jede Menge Einbrüche in Hotels und Ferienwohnungen, da bei der Hitze natürlich jedermann Fenster und Türen sperrangelweit geöffnet ließ.
Zusätzlich hatte ihm diese feuchte Hitze zu schaffen gemacht, trotz klimatisierter Autos und Büros war er an manchen Tagen völlig erschöpft. Das frühmorgendliche Schwimmen im Meer, das er sich angewöhnt hatte, tat ihm zwar gut, die Frische hielt jedoch an den schwülheißen Tagen nur kurz an. Manchmal ging er deshalb abends noch einmal los, aber es war nicht das Gleiche wie am Morgen: Es war laut, Familien und vor allem junge Menschen sprangen kreischend ins Wasser, spielten Ball oder picknickten in Gruppen. Abfall lag herum, die Müllsäcke quollen über, und das Meer war aufgewühlt. Er bevorzugte den frühen Morgen, wenn die Müllabfuhr und die Maschinen, die den Sand wieder gleichmäßig verteilten, bereits durch waren, sodass der Strand für eine kurze Zeit wie unberührt wirkte.
Die rentrée im September war für alle so etwas wie ein zweiter Neubeginn des Jahres. So sehr alle die vergangenen zwei Monate in Ferienlaune gewesen waren, so sehr waren jetzt alle in Aufbruchsstimmung. Es ging wieder los. Die Arbeit in den Läden, Büros und Arztpraxen setzte sich ächzend wie ein großes Mühlrad nach einem langen Stillstand wieder in Gang. Schulen und Universitäten öffneten ihre Tore. Seine Kinder hatten nach neun Wochen Sommerferien sehnsüchtig die Rückkehr zur Schule und zu den Klassenkameraden erwartet. Er dachte daran, wie stolz ihm Lilly ihren neuen rosafarbenen Schulranzen gezeigt hatte, und wie sehr sie sich darauf freute, ein neues Kleid, das sie extra für die rentrée bekommen hatte, anzuziehen. Im nächsten Jahr käme Matteo schon ins Collège. Wie schnell das ging. Seit er seine Kinder nicht mehr täglich sah, schienen sie ihm riesige Wachstums- und Entwicklungsschübe zu machen. Während alle wieder zur Arbeit zurückkehrten, hoffte er, dass es mit der rentrée für ihn und die Kollegen vielleicht endlich etwas ruhiger werden würde.
Auf dem Rückweg nahm er im Vorüberlaufen bei der Épicerie aux Deux Palmiers zwei Croissants mit. Bernard, der freundliche Besitzer, blätterte in einem dicken Heft, das zusätzlich mit Zetteln gespickt war, und trug die Summe ein. Bei ihm konnte man noch anschreiben lassen, wenn sich das Ende des Monats finanziell schwierig gestaltete, und das tat es immer öfter bei seinen Kunden. Duval jedoch ließ nicht anschreiben, sondern arbeitete ein Guthaben ab, das er zuvor eingezahlt hatte. So war er der Sorge enthoben, zum morgendlichen Schwimmen Geld mitzunehmen. Er kaufte auf dem Rückweg oft Croissants, manchmal zusätzlich noch etwas Obst, ein Baguette oder eine Flasche Rosé – was er alles woanders vielleicht günstiger bekommen hätte, aber er mochte den immer liebenswürdigen kleinen Mann in seinem altmodischen Lebensmittelladen und wollte ihn gerne unterstützen. Außerdem konnte er sich darauf verlassen, dass die Produkte frisch und von guter Qualität waren. Wer weiß, wie lange es diese kleinen Läden überhaupt noch gab? Dieser würde vermutlich verschwinden, wenn Bernard sich zur Ruhe setzte. Das eine oder andere Mal hatten sie schon darüber gesprochen, Bernard liebäugelte damit, sich mit seiner Frau ein kleines Häuschen auf dem Land zu kaufen. Weit weg von Cannes bedauerlicherweise, aber die Immobilienpreise waren hier so überhöht, dass die Stadt für die echten Cannois unerschwinglich geworden war. Meistens wechselten sie noch ein paar allgemeine Worte über das Wetter, die Befindlichkeit, oder sie ließen, mit einem Blick auf die Überschrift der Tageszeitung Nice Matin, einen sarkastischen oder resignierten Satz zur politischen Lage fallen. Aber heute hielt Duval sich nicht lange auf.
»Habe ich noch was gut, Bernard?«
»Keine Sorge, Monsieur Duval, noch über zwanzig Euro. Warten Sie, wenn Sie es genau wissen wollen …«, er blätterte erneut in dem dicken Heft.
»Nein, nein, schon in Ordnung. Bis morgen, Bernard!«
»Bis morgen!«, rief der Épicier zurück, aber Duval war schon verschwunden und schlenkerte die kleine Papiertüte mit den duftenden Croissants beim Laufen.
»Bonjour, was gibt’s Neues?« Duval grüßte gut gelaunt in die Runde und schenkte sich einen Kaffee ein. Die Anschaffung einer Kaffeemaschine mit integrierter Thermoskanne hatte die triste Automaten-Kaffee-Situation im Kommissariat entschieden verbessert.
»In einem Hotel auf der Croisette ist mal wieder geklaut worden. Es hört nicht auf … Die Kollegen vom Einbruch haben den Fall gestern Abend schon aufgenommen.« LeBlanc hielt ihm den Bericht hin.
»Und gestern Morgen hat ein Spaziergänger im Parc de la Valmasque einen Toten entdeckt, übel zugerichtet anscheinend, aber den hat Kollege Galliano auf dem Schreibtisch. Wir dürfen uns nur um den Einbruch kümmern.« Villiers machte eine Grimasse.
Duval rührte nachdenklich den Zucker in den Kaffee. Seine selbst gewählte Versetzung von der Großstadt Paris ins provinzielle Cannes hatte zur Folge, dass er sich in einer Police Judiciaire wiederfand, die alles einschließlich Mord aufzuklären hatte, je nachdem, was der Richter anordnete. Vorbei die Zeit in der Brigade Criminelle, der Mordkommission, die innerhalb der Polizei gerne als die Königsdisziplin angesehen wurde, und vorbei auch die Zeit einer großen Freiheit. Hatte er seinen ersten Mordfall in Cannes auch bravourös gelöst, so konnte er doch nicht darauf hoffen, dass man ihn von nun an mit jedem Mord betraute. Die Entscheidungen der Gerichtsbarkeit waren unergründlich. Er fügte sich, er hatte auch keine andere Wahl. Aber bislang schätzte er den Kollegen Galliano nicht besonders. Und das lag nicht nur daran, dass Robert Galliano, ein dunkler, gut aussehender Typ mit kunstvoll rasiertem Dreitagebart, seit Duvals Ankunft mit ihm in einer Art Wettstreit zu liegen schien. Duval hatte vielmehr den Eindruck, dass Galliano bei den Ermittlungen oft nicht so genau hinsah und sich mit dem erstbesten Ergebnis zufriedengab. So hatte er eine schöne Erfolgsstatistik vorzuweisen, und schnelle Ergebnisse waren immer gut für die Karriere, die Galliano offenbar fest im Blick hatte. Dass man ihn mit einem Mord betraut hatte und Duval selbst »nur« Schmuck auf den Schreibtisch warf, begriff er als Abstrafung. Er überflog den Bericht. In einem Hotelzimmer war ein Safe leer geräumt worden. Schmuck und Bargeld waren verschwunden. Der von den Kollegen hinzugezogene Sicherheitstechniker, der seinerzeit die Safes im Hotel eingebaut hatte, konnte mittels eines Speicherchips nachweisen, dass der Safe mit dem Mastercode geöffnet worden war. Um 13.02 Uhr. Am helllichten Tag.
»Croisette ist doch schick«, sagte Duval, ohne sich seine eigene Gekränktheit anmerken zu lassen. »Oder wären Sie lieber durch das Wäldchen gestreift?«
»Naja, es ist bald Pilzsaison, und ich glaube, der Kollege würde gern das eine oder andere Pilzomelette schmausen …« LeBlanc war ungewohnt heiter.
Duval lachte auf. »Und im Valmasque findet man noch welche?«
»Schon, man muss natürlich wissen, wo …« Villiers gab sich geheimnisvoll. Niemand gab gern seine Pilzstellen preis. »Letztes Jahr habe ich dort einen Bovisten gefunden, der war groß wie ein Fußball und wog anderthalb Kilo.«
»Im Ernst? Was haben Sie mit ihm gemacht?«
»Na gegessen.«
Duval lachte. »Daran hatte ich keinen Zweifel. Wie haben Sie ihn zubereitet?«
»Ach so, als Schnitzel, in Scheiben geschnitten und paniert. Superlecker!«
»Ich gehe lieber ins Esterel, da gibt es sogar Pfifferlinge«, warf LeBlanc ein.
»Pfifferlinge sind sehr fein. Habe ich schon lange nicht mehr gegessen«, sagte Duval.
»Ja, aber es ist viel zu trocken dieses Jahr. Bislang hat es noch nicht einmal geregnet, was soll da wachsen? Pilze brauchen Regen und Sonne. Ich denke, es ist noch zu früh.«
»Wie machst du die Pfifferlinge?«, fragte Villiers jetzt interessiert, und LeBlanc setzte an, ihm sein Rezept detailgenau zu erzählen. Duval hörte mit einem Ohr zu. »Speck … Zwiebeln … mit Weißwein ablöschen … leise köcheln lassen …«
»Nimmst du Knoblauch?«
»Niemals!« LeBlanc war entschieden.
LeBlanc und Villiers hatten begonnen, sich in Schwung zu reden.
»Vielleicht liegt unser nächster Toter im Esterel, und falls es zwischendurch mal geregnet hat, liegt er inmitten von Morcheln und Pfifferlingen, aber bis dahin können wir genauso gut auch in der Stadt bleiben und dem Hotel einen Besuch abstatten.« Damit schnitt Duval die Pilzdiskussion ab, die sonst noch ewig dauern konnte. »Keine Post?«, fragte er dann und sah auf den Schreibtisch.
»Die Post streikt mal wieder«, informierte ihn LeBlanc.
»Pilze und Streiks, beide sprießen im September besonders gut«, ließ sich Villiers vernehmen.
»Streiks gehen doch immer«, antwortete seufzend Duval, »selbst in der besten Saison. Ich erinnere mich, dass Anfang Juli die korsischen Fährarbeiter fast drei Wochen die Fähren lahmgelegt haben. Pünktlich Anfang August streikten sie bei der Air France und zum hochheiligen 15. August hat sich die SNCF auch noch mal kurz eine Auszeit genommen. Wirklich, manchmal ist es zum Haare raufen mit diesem Land.«
»Streiks sind kein Freizeitvergnügen, auch wenn das hier eine landläufig verbreitete Meinung zu sein scheint!« Léa Leroc klang streng. »Es geht vor allem darum, auf verschlechterte Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen! Wenn ich mir erlauben darf darauf hinzuweisen, dass das Briefverteilzentrum in Nizza nur streikt, um auf die Umstrukturierung aufmerksam zu machen, die vorsieht, dass dort ab Oktober acht Arbeitsplätze abgebaut werden sollen.«
»Sie klingen wie eine Gewerkschaftsbroschüre, Léa. Sind Sie Mitglied?«
»Aber sicher, Commissaire.« Sie grinste. »Aber keine Angst, ich streike nicht.«
»Soviel ich weiß, ist es Ihnen auch untersagt zu streiken, oder irre ich mich da?«
Sie zog eine Grimasse. »Ganz recht. Ich finde Streik in der Polizei auch absurd, aber gewerkschaftliche Arbeit halte ich für unerlässlich.«
»Schön, schön. Dann lassen Sie uns doch gleich mal unsere ebenso unerlässliche Polizeiarbeit tun und uns zum Hotel begeben.«
Isabelle de Breuil hatte Sorgen. Warum war sie nur mit zwei nichtsnutzigen Kindern gestraft, denn ja, es war doch die Schuld ihrer Kinder, dass sie sich in dieser misslichen Lage befand! Sie spürte, dass ihr das Hotel, das seit vier Generationen in Familienbesitz war, langsam entglitt, und zu allem Übel war nun Schmuck aus dem Zimmer von Stammgästen verschwunden. Was für eine Katastrophe! So eine Negativschlagzeile hatte ihr gerade noch gefehlt. Nicole würde einen riesen Aufstand machen, dass man sich als Gast nicht mehr sicher fühlen könne im Hotel. Das wäre Wasser auf ihre Mühle, die hysterisch Sicherheitsfenster und -türen und überhaupt ein modernes Sicherheitssystem für das Hotel forderte.
Was war nur schiefgelaufen mit André und Angélique? Georges, der Sohn von Nicole, der seit einiger Zeit für ein »Praktikum«, wie Nicole heuchlerisch sagte, im Hotel mitarbeitete, war ein ganz anderes Kaliber, wie sie neidvoll anerkennen musste. Ein »Praktikum« – als hätte sie nicht verstanden, dass es darum ging, ihr auf die Finger zu sehen. Sicher, sie hatte mit der Wahl ihres Ehemannes kein gutes Händchen gehabt, er hatte zwar die Konten des Hotels umsichtig geführt, war aber ein Schürzenjäger, und sie hatte es bald sattgehabt, dass er ein Zimmermädchen nach dem anderen vernaschte. Solange er seine Eskapaden im Hotel auslebte, hatte sie darüber hinwegsehen können, immerhin behelligte er sie nicht mehr. Aber an dem Tag, an dem sie nach Hause kam und eins der Zimmermädchen in ihrem Ehebett vorfand, hatte sie einen Schlussstrich gezogen. Und trotzdem, bei allem, was sie gegen ihn vorzubringen hatte, war er, wenn auch knauserig und im Grunde kleinbürgerlich, ein geschäftstüchtiger Mensch. Er hatte einen realistischen Sinn für Zahlen und hatte es doch auch zu etwas gebracht, soweit sie das von Ferne beurteilen konnte. Mit seiner zweiten Frau hatte er sich vor ein paar Jahren in der Corrèze niedergelassen und behauptete steif und fest, dass sie die Entscheidung wegen der Landschaft und des Klimas gefällt hätten. Wie lächerlich. Das Klima der Corrèze! Es gab nichts Ungemütlicheres. Er hatte sich, geizig, wie er war, für seinen Wohnsitz eines der Départements mit den geringsten Lebenshaltungskosten ausgesucht. Das war der einzige Grund. Isabelle rümpfte ein wenig die Nase. Hinterste Provinz natürlich. Aber dort konnte er für sein Geld eine große Villa mit einem riesigen Grundstück erstehen und den Grandseigneur geben. Vermutlich trimmte er vormittags seinen Rasen mit seinem albernen Traktor auf exakt vier Zentimeter, immerhin regnete es dort ausreichend, und er musste ihn nicht mit immensen Kosten künstlich bewässern wie sie. Und nachmittags errechnete er bis auf zwei Stellen hinter dem Komma, wie viele Zinsen er erwirtschaftet hatte. Die Überprüfung seiner Konten war seine Lieblingsbeschäftigung. Sie seufzte erneut. Wie konnten zwei Menschen mit einem realistischen Verhältnis zu Geld zwei Kinder zeugen, die so absolut nicht mit Geld umgehen konnten? Während sie alles, was sie anfasste, zum Laufen brachte, schmolz das Geld in den Händen ihres Sohnes wie Schnee in der Sonne. Er hatte seine Anteile am Hotel schon fast komplett verkauft, um seinen kostspieligen Lebenswandel zu finanzieren. Alle Projekte, die er jedes Mal mit viel Begeisterung und großem finanziellen Aufwand begann, ließ er schon ein paar Monate später wieder fallen. Eine Kunstgalerie war seine letzte Investition. Er gefiel sich als Galerist, aber er hatte zu wenig Ahnung von Kunst und ließ sich von seinem Geschmack leiten, der in ihren Augen allenfalls besserer Kitsch war. Außerdem ein bisschen vulgär. Sie rümpfte erneut die Nase. Frauenakte. Darin immerhin war er seinem Vater wohl ähnlich. Von André erwartete sie nicht mehr viel Unterstützung für das Hotel. Seitdem er seine Anteile verkauft hatte, schlug sie sich nun mit Nicole Bouvard als Miteigentümerin herum, die sofort und unverblümt vorgeschlagen hatte, ihr das Hotel abzukaufen, um aus dem altmodischen Dreisternehotel etwas völlig anderes zu machen. Ein Spa-Resort schwebte ihr vor. Als bräuchte man mit dem Meer vor der Haustür ein Hotel mit einer Wellnessanlage. Sie wollte aus dem Hotel ein Fünfsternehaus machen und plante große Umbaumaßnahmen. Als Erstes forderte sie einen Aufzug. Neue Fenster und eine neue Heizungsanlage standen auch auf ihrer Liste, ein modernes Sicherheitssystem und zu guter Letzt wollte sie einen Pool. Tatsächlich war das Fehlen des Aufzugs ein Manko, aber das Personal hatte bislang noch jeden Koffer auch in die abgelegensten Räume getragen, und Gäste, die nicht gut zu Fuß waren, logierten im Erdgeschoss. Sie hatten zwar keinen Blick aufs Meer, aber einen direkten Zugang zum Garten. Bisher waren damit alle zufrieden gewesen. Isabelle de Breuil blickte aus ihrem Büro im Erdgeschoss in den alten baumbestandenen Garten. Kein anderes Hotel an der Croisette konnte mit so einem Garten aufwarten. Und darin sollte nun ein vulgärer Pool Platz finden? Nicht, solange sie hier das Sagen hatte. Das Hotel für Monate zu schließen, um die Modernisierung voranzutreiben, wie es Nicole Bouvard forderte, kam für sie nicht infrage.
Nicole Bouvard belästigte sie nun fast täglich und verlangte Einblick in die Zahlen. Das Hotel hatte über all die Jahre so wie es war immer genug Geld eingebracht. Und das trotz steigender Kosten und obwohl die Steuerabgaben inzwischen ein gutes Drittel der Einnahmen auffraßen. Sie hatten eine gute und dem Haus treue Klientel, ein bisschen überaltert vielleicht, aber genau diese Klientel hatte das Geld. Was sollten all diese Luxus-Investitionen? Und das Hotel, das seit fast hundert Jahren in Familienbesitz war, und es auch bleiben sollte, war unantastbar. Verkaufen! Niemals. Wenigstens von Angélique hatte sie sich dabei Unterstützung erwartet, wer sollte das Hotel denn übernehmen, wenn nicht sie? Beide Kinder kannten das Hotelgewerbe von klein auf und beide hatten sie die Hotelfachschule besucht. Mit nur mäßigem Erfolg, wie Isabelle de Breuil unwillig zur Kenntnis nehmen musste. Angélique konnte rechnen, keine Frage, aber sie wollte schnell viel Geld verdienen und das arbeitsame Hotelgewerbe war ihr zu mühselig. Weder sie noch André hatten Lust vor den Gästen zu buckeln. Angélique flatterte gelegentlich durchs Hotel, machte ein bisschen Wind, scheuchte die Zimmermädchen auf, trank ein Gläschen Champagner an der Bar und schwatzte ihr dann einen Scheck ab. Geld, Geld, Geld jetzt und sofort für ein Designer-Abendkleid, eine Autoreparatur, eine als Fortbildung ausgegebene Reise und was nicht noch alles. Das alles zusätzlich zu der Summe, die sie ihren beiden Kindern großzügig monatlich zur Verfügung stellte, damit sie ein standesgemäßes Leben führen konnten. Isabelle, die gehofft hatte, ihre Kinder mit der Übergabe ihres Hotelanteils endlich mit in die Verantwortung zu nehmen, sah sich enttäuscht. André und Angélique waren noch dabei »zu leben«. »Leben! Maman, hast du eine Ahnung was das eigentlich ist, das Leben?«, hatte ihre Tochter sie mit leichter Verachtung in der Stimme gefragt. »Meine liebe Tochter, mein Leben war harte Arbeit, um uns drei zu ernähren, alleine, denn dein Vater hat dazu nicht einen Centime beigetragen, damit du es weißt. Und ich arbeite immer noch, wie du vielleicht bemerkst! Ich habe die Verantwortung für eine Menge Menschen, und wie es aussieht, arbeite ich vor allem, um dir und deinem Bruder euer ausschweifendes Leben zu ermöglichen!«, hatte sie scharf geantwortet. »Arbeit! Das ist alles, was du hast, Maman, wie arm ist das! Ich spreche vom Leben, von Gefühlen, von Leidenschaft! Du lebst doch gar nicht wirklich. Und nichts, was du zeigst, ist echt, alles Fassade, alles ist inszeniert und immer nur für die Gäste: Meine reizende Tochter tanzt an Weihnachten Ballett für die Gäste, mein Sohn spielt abends im Salon Klavier für die Gäste, nicht jetzt Angélique, sei brav Angélique, wir haben Gäste, nicht so laut, du störst die Gäste … was ist das denn für ein Leben? Damit hast du Papa aus dem Haus getrieben. Verkauf endlich diesen alten Kasten und fang an richtig zu leben!« »Aber das Hotel IST mein Leben, mein ganzes Leben, verstehst du das nicht? Im Übrigen verbiete ich dir, so mit mir zu sprechen!« Ein Wort gab das andere, aber letztlich hatte sie ihr erneut einen Scheck ausgestellt. Sie hatte sich jedoch geweigert, ihr baldmöglichst einen Vorschuss auf ihr Erbe auszuzahlen, denn das war es, was sie wollte. Geld. Jetzt und sofort. Isabelle konnte sich nicht vorstellen, wofür ihre Tochter eine solch große Summe Geld benötigte, und Angélique blieb vage. Nur um zu »leben«?! Isabelle machte ein verächtliches Geräusch. Eines Tages würde sie hoffentlich zur Vernunft kommen. Die Erwähnung ihrer gescheiterten Ehe funktionierte immer. Keinesfalls wollte sie, dass Angélique sich mit ihrem Vater gegen sie verbündete. Aber vielleicht leierte sie ihm ebenso raffiniert einen Scheck nach dem anderen aus den Rippen? Angélique, Angélique, Isabelle de Breuil schüttelte den Kopf. Und jetzt schien sie von den ehrgeizigen Plänen Nicoles angetan zu sein. Als ob man in einem Luxushotel nicht arbeiten müsste. Und wie lange würde es dauern, bis sich die Investitionen amortisiert hätten? Sie schüttelte energisch den Kopf. Das kam überhaupt nicht infrage.
Vor der kommenden Gesellschafterversammlung musste sie unbedingt noch einmal mit Angélique sprechen. Es würde nicht einfach werden. Angélique konnte störrisch sein. Und jetzt meldete sie sich wieder mal nicht. Dass ihre Tochter lange kein Lebenszeichen von sich gab, war zwar nicht neu, aber die Gesellschafterversammlung nahte in Riesenschritten, und dass sie ihre Tochter gerade jetzt nicht erreichen konnte, ärgerte sie. Angélique ging schon geraume Zeit mit dem Anwalt Roland Arnaud aus. Auch das war ein Streitpunkt zwischen ihnen. Maître Arnaud war zwar ein charismatischer Typ, aber sie traute ihm nicht über den Weg. Ein Emporkömmling, und außerdem noch verheiratet. Er hatte sich um Angéliques Scheidung gekümmert, und dabei waren sie sich nähergekommen. Sie zweifelte stark an seinen ernsten Absichten. Aber natürlich wollte dieses dumme Ding davon nichts wissen. Sie hatte mehrfach Nachrichten auf ihrem Festnetz- sowie auf dem Mobiltelefon hinterlassen, aber Angélique antwortete nicht. Sie wählte die Nummer von André.
»Bonjour, Maman …«, sagte er freundlich, aber etwas gelangweilt, als er abnahm.
»Bonjour, mein Großer«, sagte sie und ärgerte sich sofort über diese mütterliche Formulierung, »wie geht es dir?« Sie wartete seine Antwort nicht ab, sondern sprach eilig weiter. Ihr Ton war autoritär, aber sie war sich nicht bewusst, dass sie diesen Ton jedes Mal anschlug, wenn sie mit ihrem Sohn sprach. »André, sag mir bitte, hast du etwas von Angélique gehört? Nein? Weißt du, wo sie steckt? Ist sie bei Maître Arnaud? Nein, das werde ich natürlich nicht tun.« Das fehlte noch, dass sie diesen Schnösel anrief, damit sofort alle Welt erführe, dass sie ihrer Tochter hinterhertelefonierte. »Aber, ich muss sie sprechen! Wenn sie sich bei dir meldet, sagst du es ihr bitte? Ich kann auf dich zählen, oder?«
»Natürlich, Maman. Geht es dir gut?« Er klang weiterhin gelangweilt.
Wie sollte es ihr gut gehen mit all den Sorgen? Aber ihr Sohn schien davon keine Kenntnis zu haben, oder es interessierte ihn einfach nicht. Daher antwortete sie nur »Sehr gut, natürlich. Und dir? Wie geht es dir?«, fragte sie dann noch einmal der Form halber.
»Gut, Maman, sehr gut sogar. Schön, dass du nachfragst. Ich habe nämlich gerade ein fantastisches Geschäft gemacht!« Seine Stimme klang triumphierend.
»Das freut mich für dich. Hast du etwas verkauft?« Hatte sich doch ein Käufer für all diese prallen Busen und Schenkel gefunden?
»Nein, ich habe gekauft!« Sie ahnte Schlimmstes. »Ja, du weißt doch, Maman, die Ausstellung, die ich gerade laufen habe … warum bist du eigentlich nicht zur Vernissage gekommen? Du hast die Einladung doch erhalten?«
»Ja, ja, habe ich, verzeih, ich hatte es wirklich fest vor, aber ich habe gerade schrecklich viel um die Ohren – ich bereite die Gesellschafterversammlung für das Hotel vor, du weißt ja, wie viel Arbeit das ist.« Natürlich wusste er gar nichts. Nicht ein einziges Mal hatte er ihr bei den Vorbereitungen geholfen in all den Jahren. Und sie hatte keine Lust gehabt, einen Abend damit zu verplempern, indem sie mit langweiligen Menschen Begeisterung heuchelnd vor obszönen Aktbildern herumstand.
»Weißt du, Maman«, hatte André schon weitergeredet, »niemand sieht die Qualität von Pierre. Dieser Pinselstrich, dieser feine Ausdruck. Alles Banausen. Ich dachte, ich muss das ein bisschen pushen und habe daher Pierre alle Bilder abgekauft …«
»Du hast WAS?« Isabelle de Breuils Stimme wurde schrill.
»Reg dich nicht auf, Maman, zum halben Preis natürlich, und gerade habe ich diskret eine Meldung an Nice Matin gegeben, dass ein Kunstkenner, der ungenannt bleiben möchte, die gesamte Ausstellung aufgekauft hat. Das wird morgen einen Run geben, sage ich dir!«
Isabelle de Breuil schnappte nach Luft. »Ganz ruhig, Isabelle, ganz ruhig«, redete sie sich gut zu.
»Was sagst du dazu, Maman?«
»Ich weiß nicht, mein Junge, ich weiß nicht … was für eine, hm, bizarre Idee! Aber musstest du die Gemälde dafür unbedingt kaufen? Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass du mit so einem windigen Coup Käufer anziehst!«
»Das verstehst du nicht, Maman, und das ist kein windiger Coup, so macht man das heute, und ich werde sie dreimal so teuer verkaufen, wie ich sie gekauft habe! Und wenn nicht, dann ist es immer noch eine super Geldanlage! Pierre und ich trinken gerade ein Gläschen Champagner darauf.«
»…«
»Willst du mir nicht gratulieren?«
»Hör zu, ich gratuliere dir, wenn du sie alle zum dreifachen Preis verkauft hast. Ich muss Schluss machen, wenn du Angélique siehst oder hörst, sag ihr, ich warte dringend auf ihren Anruf!«
»Das ist typisch, Maman, nie vertraust du mir. Nie! Nicole unterstützt ihre Kinder ganz anders. Sie glaubt an ihre Fähigkeiten. Du hast mich nie …« Aber Isabelle de Breuil hatte schon aufgelegt.
Vertrauen! Diesem Nichtsnutz! Als sie ihm das letzte Mal vertraut hatte, hatte er nach bereits sechs Monaten einen großen Teil seines Hotelerbes verschachert, um sich diese dämliche Galerie in der Rue d’Antibes zu kaufen. Und seitdem hatte sie diese Kröte von Nicole als Miteigentümerin im Hotel. Sie sah in den Garten mit der ausladenden Palme und den Oleanderbüschen, die noch immer in verschiedenen Rot- und Rosatönen üppig blühten. Hier hatte sie schon als kleines Mädchen Verstecken gespielt und später ihre Kinder. Ein Paradies. Was war nur schiefgelaufen?
Duval war überrascht am Ende der Croisette dieses Hotel im Stil der Belle Époque zu entdecken. Das weiße dreigeschossige Haus lag etwas zurückgesetzt in einem großen Vorgarten, in dem zwei symmetrisch angeordnete Springbrunnen plätscherten. An den Seiten, eingerahmt von niedrig gestutzten Buchsbaumhecken luden Steinbänke zum Verweilen ein. Ein breiter Treppenaufgang führte zum Eingang, über den sich ein verspieltes Glasdach wölbte. Die Anlage wirkte zwischen den achtstöckigen modernen Appartementhäusern, die sich am Ende der Croisette aneinanderreihten, wie aus der Zeit gefallen. Innen ging die Zeitreise weiter. Die Eingangshalle war mit dunklem Holz und altrosa gemusterten Tapeten gestaltet. Rechts lag der Rezeptionstresen, links eine kleine Sitzecke mit einem Sofa und mehreren Sesseln, alle mit altrosa Samt bezogen. Eine geschwungene Marmortreppe führte zu den oberen Etagen.
Duval stellte sich und seine Leute an der Rezeption vor und wurde von einer jungen Frau in das Büro von Isabelle de Breuil geführt. Das Büro erinnerte eher an einen kleinen Salon: Teppiche, voluminöse Gardinen vor den bodentiefen Fenstern, mehrere grazile Louis-quinze-Sesselchen waren locker um einen runden Tisch gruppiert. Der antike beinahe leere Schreibtisch von Madame de Breuil kontrastierte mit dem großen Computerbildschirm. Ein in die Wand gebauter Schrank, dessen Türen offen standen, gab den Blick auf Ordner und eine Hängeregistratur frei. Madame de Breuil schien ihre Arbeit im Griff zu haben. Alles war aufgeräumt, nur wenig lag herum, ein geöffneter Ordner, ein sauber geordneter Papierstapel, in den drei Ablagekästchen nur wenige Blatt Papier.
Die weißhaarige dezent geschminkte und wohlfrisierte rundliche Dame erhob sich flink hinter ihrem Schreibtisch und eilte ihm entgegen. Sie begrüßte ihn wortreich mit einem professionellen Lächeln, gleichzeitig musterte sie seine Erscheinung. Dann nickte sie unmerklich, er schien Gnade vor ihren Augen gefunden zu haben.
»Ah, Monsieur le Commissaire, gut, dass Sie da sind. Obwohl, es macht auf die Gäste keinen guten Eindruck, wenn man immer wieder so viel Polizei im Hotel sieht. Ganz abgesehen davon, dass man sich in unserem Haus nicht sicher fühlen kann, wenn Dinge verschwinden. Ich hoffe, Sie können das alles schnellstmöglich aufklären …«
»Madame de Breuil«, unterbrach Duval ihren Redefluss, »wenn Sie mir vielleicht zunächst erzählen würden, was sich zugetragen hat?«
»Natürlich, verzeihen Sie, Commissaire, lassen Sie mich überlegen … wo fange ich an – nun, Monsieur und Madame Rochefort sind Stammgäste in unserem Haus, müssen Sie wissen. Sehr, sehr kultivierte Leute, sehr vermögend, sehr angenehme Gäste im Übrigen, wenn sie alle so wären … nun gut, Monsieur und Madame Rochefort hatten gestern Abend eine Einladung für ein Galadiner im Palm Beach Club, und als Madame ihren Schmuck, den sie anlässlich des Diners tragen wollte, aus dem Safe nehmen wollte – denn natürlich haben wir in jedem Zimmer einen kleinen Safe installiert, das versteht sich von selbst –, war er leer. LEER! Einfach ausgeräumt, ohne äußere Spuren von Gewaltanwendung. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie mir zumute ist! Im Safe befand sich laut ihren Angaben nicht nur Geld, sondern auch Familienschmuck von unschätzbarem Wert. Ich fasse es nicht. Das ist der Gipfel! Und das in meinem Haus – das ist in all den Jahren noch nie vorgekommen …«
»Wer hat Zugang zu den Gästezimmern?«, wollte Duval wissen.
Madame de Breuil schien diese Frage unangenehm zu sein. »Lassen Sie mich vorausschicken, dass ich meinem Personal hundertprozentig vertraue. Wir haben immer mal wieder neue Praktikanten für ein paar Monate, aber die allermeisten Angestellten arbeiten schon lange für mich, wir sind hier so etwas wie eine große Familie.«
Duval nickte. »Sie wollen sagen, das gesamte Personal könnte sich Zugang verschaffen?«
»Nun, offiziell gehen nur die Zimmermädchen in Abwesenheit der Gäste in die Räume, mit einem Generalschlüssel. Ich überprüfe stichprobenartig die Arbeit.« Sie räusperte sich kurz. »Aber in der Regel hängt der Generalschlüssel an der Rezeption. Er ist im Prinzip für jeden vom Personal erreichbar.«
»Hm. Erzählen Sie mir doch etwas über das Hotel, Madame de Breuil. Seit wann ist es in Ihrem Besitz?«
Isabelle de Breuils Augen begannen zu strahlen, als sie anfing zu erzählen: »Das Hotel wurde um die Jahrhundertwende gebaut und ist seit 1920 im Besitz meiner Familie. Meine Urgroßeltern haben es zusammen mit meinen Großeltern gekauft. Das Hotel war damals, obwohl fast neu, schon völlig abgewirtschaftet und heruntergekommen. Es war ja im Ersten Weltkrieg als Lazarett requiriert worden, wissen Sie?! Fast alle Hotels hatten dieses Schicksal. Gerade erbaut und schon in ein Lazarett verwandelt. Der Erbauer des Hotels, ein Ungar, hatte gehofft, die russische und englische Aristokratie als Gäste anzuziehen, Cannes wurde damals gerade sehr schick, vorwiegend noch als Winterdomizil. Aber dann kam ihm der Erste Weltkrieg dazwischen. Die Gäste blieben aus, und das Hotel wurde requiriert. Und danach war er bankrott. Meine Familie konnte es günstig erstehen, und meine Großeltern haben es mit der finanziellen Hilfe ihrer Eltern dann wieder hergerichtet. Als es gerade anfing wieder halbwegs zu laufen, kam der Zweite Weltkrieg.« Sie atmete durch. »Ich bin Gott sei Dank erst nach dem Krieg geboren, aber auch da war es harte Arbeit. Wir haben alle zusammen im Hotel gewohnt. Ich bin hier groß geworden.« Sie blickte in ihrem Büro um sich. »Das kann man heute keinem mehr verständlich machen, aber wir haben zu fünft in zwei kleinen Räumen im Keller gelebt. Die Großeltern in einem Raum, meine Eltern mit mir im Nebenzimmer. Gleich daneben war das Wäschezimmer. Aber wir hatten sowieso kein Familienleben. Alle haben damals mitgearbeitet. Ich auch. Nur ab und zu habe ich mit den Wäschemädchen im Garten Versteck gespielt.« Sie lächelte und sah in den Garten. »Die Oleanderbüsche standen damals schon, können Sie sich das vorstellen? Und die Orangenbäume auch. Die haben im Winter 1956 Frost bekommen, sie haben sich nie davon erholt, deshalb sind sie so klein, und sie tragen nur jedes zweite Jahr. Aber ich kann mich nicht dazu durchringen, sie auszutauschen, sie waren von Anfang an da.« Sie sah den Commissaire an. Duval nickte freundlich.
»Wohnen Sie immer noch im Hotel?«
»Nein!« Sie lachte. »Es ging dann doch aufwärts. Meine Eltern haben irgendwann eine Villa gekauft. Aber mein Vater hat oft dennoch im Hotel geschlafen. Und ich habe mich nach meiner Scheidung auch wieder kurzzeitig in einem Zimmer eingerichtet. Die Kinder wohnten bei meinen Eltern. Aber das war alles nur vorübergehend. Jetzt wohne ich mit den Kindern in der Villa meiner Eltern.«
»Ihre Kinder?«
»Ja, Angélique und André.«
»Die sind jetzt erwachsen, vermute ich. Sie arbeiten im Hotel mit?«
Isabelle de Breuil sah ihn mit einem eigenartigen Ausdruck in den Augen an. »Ob sie wirklich erwachsen sind, das bezweifle ich manchmal«, sagte sie, »Angélique ist 36 Jahre alt, und André ist dieses Jahr vierzig geworden, und nein, sie arbeiten nicht im Hotel mit. André hat sich zu seinem Geburtstag dieses Jahr eine Galerie geleistet. Das sagt wohl alles. Ich habe die Hoffnung aber noch nicht ganz aufgegeben, dass zumindest Angélique sich eines Tages dazu entschließen kann.« Sie klang bitter.
Vor der Tür hörte man einen kurzen Tumult und eine weibliche Stimme, die autoritär sagte »das wollen wir doch mal sehen!«, dann klopfte es laut, und zeitgleich wurde die Tür aufgerissen. Eine zierliche, aber energisch wirkende Frau stand im Zimmer. »Verzeihung, Madame de Breuil!«, rief der Rezeptionist durch die offene Tür und machte eine hilflose Geste, »aber Madame Bouvard wollte nicht warten …«
»Nein! Madame Bouvard wollte nicht warten!«, zeterte Nicole Bouvard, »als Miteigentümerin dieses Etablissements erwarte ich augenblicklich in Kenntnis gesetzt zu werden, wenn es in diesem Haus ein Delikt gegeben hat! Wie konnte das geschehen, Madame de Breuil? Das ist eine Katastrophe! Ich habe Ihnen gleich gesagt, dass Ihre Sicherheitsvorkehrungen nicht ausreichend sind. Sie wollten es nicht wahrhaben, aber Sie sehen es immer wieder: Ihr Haus ist völlig überaltert, völlig unzureichend alles. Unfassbar, dass es so etwas in einem Hotel noch geben kann! Und jetzt auch noch ein Diebstahl! Jeder kann in diesem Haus ungehindert ein- und ausgehen. So geht das nicht mehr. Wollen Sie uns in den Ruin treiben? Und wer sind Sie?«, herrschte sie Commissaire Duval an.
»Commissaire Duval, Police Nationale«, stellte Duval sich knapp vor und fragte dann höflich »… und Sie sind Madame …?!«
»Bouvard.« Sie schien kein bisschen eingeschüchtert und setzte sich, ohne dass man sie aufgefordert hätte, auf einen der kleinen Sessel und knallte ihre große Handtasche energisch auf den Tisch. »Immerhin, zumindest die Polizei ist schon da. Wenn Sie den Fall dann bitte fix aufklären könnten, hier wird schon genug gefaulenzt …«
Isabelle de Breuil schnappte nach Luft.
»Sie sind Miteigentümerin dieses Hotels?«, fragte Duval, ohne sich von ihrer Attitüde beeindrucken zu lassen.
»Allerdings.« Sie schlug die Beine übereinander. »Und ich werde verhindern, dass man dieses alte Gemäuer verkommen lässt.«
»Das ist ja wohl die Höhe!« Jetzt wurde Isabelle de Breuil laut. »Seit fast hundert Jahren ist dieses Hotel in Familienbesitz, und es kann keine Rede davon sein, dass hier irgendetwas verkommt.«
»Genau. Wir leben jetzt im 21. Jahrhundert, Madame de Breuil, aber es geht hier noch zu wie vor hundert Jahren. Hören Sie auf, setzen Sie sich zur Ruhe, überlassen Sie das Hotel jüngeren Leuten, Sie können nicht mehr mithalten.« Sie begann in ihrer Handtasche zu kramen. Halblaut, aber so, dass es noch gut hörbar war, sagte sie dabei: »Oh, wie ich diese Menschen hasse, die sich auf ihrem ererbten Besitz nur ausruhen, anstatt etwas Großes daraus zu machen.«
»Was wollen Sie damit sagen? Ich habe mein ganzes Leben lang hart gearbeitet!«, empörte sich Madame de Breuil.
»Natürlich.« Es klang verächtlich. »Man sieht ja wie dynamisch Sie dieses Haus führen.« Sie strich wie gedankenverloren über eine abgeschabte Stelle des Samtbezuges der Sessellehne.
»Madame Bouvard, wenn Sie bitte draußen warten wollen, so lange, bis ich mein Gespräch mit Madame de Breuil beendet habe?«
»Ah bon?« Nicole Bouvard erhob sich unwillig. »Dann beeilen Sie sich bitte, ich habe nicht ewig Zeit, ICH habe nämlich zu tun. In einer halben Stunde habe ich eine wichtige Telefonkonferenz!« Sie zog die Tür knallend hinter sich zu.
»Gut«, wandte Duval sich ungerührt wieder an Madame de Breuil. »Wir werden mit allen Angestellten des Hotels sprechen müssen. Auch mit den Gästen, das verstehen Sie sicher. Gibt es einen Raum, wo wir das relativ ungestört und, sagen wir mal, diskret machen können?«
Isabelle de Breuil nahm das Wort »diskret« dankbar zur Kenntnis. Immerhin hatten sie ihr keinen vulgären flic geschickt, sondern jemanden mit Manieren. »Am besten vielleicht im Salon de thé. Dort werden Sie vermutlich am wenigsten gestört, und es stört auch den Ablauf im Haus nicht.«
Duval nickte. »Das Zimmer von Monsieur und Madame Rochefort liegt im Erdgeschoss?«
»Ja.«
»Können wir uns das bitte ansehen? Ich würde mir auch gern das gesamte Hotel ansehen, den Garten, den Keller. Sind die Herrschaften jetzt da?«
»Das vermute ich.«
»Gut, dann werden wir dort und mit ihnen beginnen.«
Monsieur und Madame Rochefort waren ein rüstiges Ehepaar in den Siebzigern, klassisch und teuer gekleidet, aber mit dem eleganten Pariser Understatement und nicht mit der schillernden Ich-zeige-was-ich-habe-Attitüde der Reichen der Côte d’Azur. Madame trug ein hellblaues Chanelkostüm und Monsieur einen zweireihigen marinefarbenen Blazer mit Einstecktuch zu einer leichten grauen Hose. Duval glaubte, das Cerruti-Logo auf den geprägten goldfarbenen Knöpfen zu erkennen. Sie lebten in Paris und residierten seit Jahren im Hotel Beauséjour, und das mehrfach im Jahr. »Wir ziehen das Hotel einem eigenen Appartement vor, der Service hier ist angenehm, und wir können unseren Aufenthalt ganz sorglos genießen.« Er hielt kurz inne und sah seine Frau an. »Konnten, muss ich jetzt vielleicht sagen …« Madame Rochefort aber blickte unverwandt aus dem Fenster. »Wissen Sie«, fuhr Monsieur Rochefort fort, »ein eigenes Appartement macht einem Sorgen, wenn man nicht vor Ort ist, weil man immer Angst haben muss, dass eingebrochen wird.« Er hielt erneut inne und lachte dann ein wenig hilflos. »Offenbar kann auch ein Hotel das nicht mehr garantieren.« Er seufzte. Dann schüttelte er den Kopf. »Aber ein Appartement kommt dennoch nicht infrage für uns. Freunde von uns besitzen eines in einer Wohnanlage, immerhin mit einem gewissen Standing in der Basse Californie, aber sie haben dort sehr unangenehme Nachbarn. Das vergällt einem den schönsten Aufenthalt. Außerdem ist der Unterhalt eines Appartements teuer. Ständig muss irgendetwas im Haus erneuert werden, die Lichtanlage im Hausflur oder die Sprechanlage, der Aufzug muss gewartet werden, oder es müssen neue Plätze für die Mülltonnen geschaffen werden, die immer mehr und immer größer werden. Fast jeden Monat werden Sie für irgendeine Sache zur Kasse gebeten, von der Sie nur ein paar Wochen im Jahr profitieren. Das haben wir zu Hause auch, das wollen wir in den Ferien gerade nicht. Daher investieren wir lieber in einen Hotelaufenthalt. Aber wenn man hier jetzt auch Sorgen haben muss, müssen wir vielleicht doch noch einmal umdenken.« »Nein, chéri, bitte nicht!« Monsieur Rochefort zog die Augenbrauen hoch. Sie waren beide trotz des Verlusts sehr beherrscht, nur Madames Stimme zitterte ein wenig, wenn sie sprach, und Duval bemerkte ihre geröteten Augen. Natürlich waren sie versichert, natürlich gab es Aufnahmen des Schmucks, der sentimentale Erinnerungswert, den der gestohlene Familienschmuck besaß, konnte jedoch mit keinem Scheck von der Versicherung ersetzt werden.
»Wann haben Sie den Verlust bemerkt?«
»Gestern Abend, gegen 19 Uhr. Das haben wir aber den Kollegen schon zu Protokoll gegeben.«
Duval nickte. »Erzählen Sie es mir noch mal, bitte.«
»Nun, wir hatten für gestern Abend zwei Plätze zur Gala im Palm Beach Club. Das war endlich ein Anlass für meine Frau, ihren Schmuck zu tragen.«