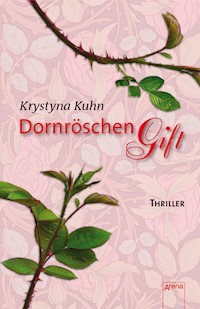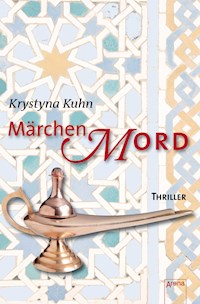2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Aussiedlermädchen aus Kirgisien, ertränkt und mit viel Liebe rituell aufgebahrt, bringt die Frankfurter Polizeipsychologin Hannah an ihre Grenzen: Was weiß Jelenas Freundin, die nach dem Mord spurlos verschwunden ist? Was der verschwiegene Kolja? Es gibt zu wenige Anhaltspunkte für ein schlüssiges Täterprofil, und Hannah läuft allmählich die Zeit davon ... Der neue fesselnde Roman aus der Feder der deutschen Krimientdeckung Krystyna Kuhn.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
ISBN 978-3-492-98244-3
Oktober 2015
© für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2015
© Piper Verlag GmbH, München 2005
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich Fahrenheitbooks nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
»Selig sind, die das Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen.«
Marina
Freitag abend, 19:30 Uhr.
Marina wählte die 110.
»Pomogitje!« und weiter: »Uschasnaja bedá!« Sie war überrascht, daß sie die ersten Worte auf russisch sagte. Aber es war die beste Sprache, um Panik auszudrücken. Das Russische war erprobt im Verkünden und Verbreiten von Unglück. In keiner anderen Sprache war die Fallhöhe der Dramatik größer.
Am anderen Ende antwortete jemand auf deutsch, geschult, sachlich zu bleiben, auch wenn die Welt untergeht. »Ich kann Sie nicht verstehen. Wer spricht da?«
Verzweifelt versuchte Marina, sich zu konzentrieren und, was sie gesehen hatte, in Worte zu fassen. Deutsche Worte, nicht russische, zu denen ihre Gedanken automatisch flüchteten. »Meine Freundin. Tot.«
»Hier ist die Notrufzentrale. Wie heißen Sie?«
»Ich glaube, sie ist tot«, ignorierte Marina die Frage.
Die Frau blieb unberührt durch den Tod.
»Sagen Sie mir Ihren Namen. Und wo Sie sich befinden.« Plötzlich wurde Marina wütend. »Tschjort wosmi!« fluchte sie auf russisch. Der Teufel sollte sie holen, der Satan sie zum Schweigen bringen.
»Ich kann den Anruf nicht bearbeiten, wenn Sie mir nicht Ihren Namen nennen und sagen, wo Sie sich befinden.«
Die Kraft der Wut fiel in sich zusammen, machte der Angst Platz. Die den Atem beschlug, die Stimme lähmte.
»Meine Freundin«, flüsterte Marina. »Sie heißt Jelena Epp.«
»Ihren Namen. Ich brauche Ihren Namen.«
»Gutleutstraße 178.«
Wer, verdammt noch mal, hatte behauptet, der Tod komme auf leisen Sohlen? Der Tod kam gewalttätig.
Sobald Marina an ihn dachte, legte sich der eiserne Ring um ihr Herz.
Es war Stunden her, seit Jelena in der Schule angerufen hatte.
»Du machst es?« hatte Marina auf russisch gefragt, damit die Sekretärin nichts verstand.
»Vielleicht. Ja vielleicht.«
»Es ist für dich das beste. Glaube mir. Wir werden dir helfen. Kolja sitzt im Gefängnis, und dort gehört er auch hin. Sei froh, daß du ihn los bist. Ich komme nach der Schule sofort zu dir, wenn ich hier fertig bin.«
»Ich warte.«
Gegen 19:00 Uhr fuhr Marina mit dem roten Klapprad in die Gutleutstraße. Sie klingelte und klingelte. Nichts. Jelena öffnete nicht. Sie drückte wahllos auf eine der anderen Klingeln, bis jemand ihr öffnete. Die alte Frau in der Wohnung gegenüber hatte die Tür einen Fußbreit geöffnet und schloß sie schnell, als Marina an ihr vorbeiging.
In Jelenas Flur stand der beißende Geruch, den Marina kannte. Von den Toiletten zu Hause. Als hätte jemand Spiritus über den Boden ausgeschüttet, der sich in die Lunge fraß, so daß sie husten mußte. Erst danach bemerkte sie, daß trotz allem noch der Duft nach Jelenas Parfüm im Flur hing.
In der improvisierten Küche im Flur stand nicht wie sonst Geschirr mit Kascha herum, in dem der Löffel wie eingegipst steckte. Keine Gläser mit Rotweinresten, in denen Fliegen klebten, in Alkohol und Zucker erstarrt, keine Wodkagläser, keine Bierflaschen, keine leeren Aluschalen, keine McDonald's-Tüten, keine Zigarettenkippen. Nicht einmal im Spülbecken war altes Geschirr.
Marina rief Jelenas Namen. Noch drei Schritte bis zum Schlafzimmer, noch zwei, dann der letzte Schritt und gleich darauf der erste Blick.
Sie lag auf dem Bett. Jelena lag auf dem breiten dunkelbraunen Cordbett. Der Rücken war in der alten Matratze eingesunken. Die Augen waren geschlossen, ebenso der Mund. Die Arme lagen gerade neben dem Körper. Entspannt. Das schwarzgefärbte Haar wirkte noch unnatürlicher als sonst. Die Locken ringelten sich, und am Ansatz zeigten sich deutlich die ersten hellen Stellen.
Über der rechten Augenbraue war ein winziger, roter Punkt. Nicht mehr als ein Kratzer. Aber daran merkte Marina, daß sich etwas verändert hatte.
Und jemand hatte das Bett umgestellt. Es unter das Fenster geschoben, das geöffnet war. Im Moskitonetz davor hingen Insekten, die sich verzweifelt festklammerten und vom letzten Gewitter, das Wochen her war, Blätter und kleine Zweige von den Bäumen im Hinterhof.
Jelena mußte zu viel von dem Zeug genommen haben. Anders konnte es nicht sein. Sollte sie den Arzt rufen? Sie stellte ihre Tasche neben dem Bett ab. Rüttelte Jelena an der Schulter.
Plötzlich kippte Jelenas Kopf mit einem Ruck zur Seite. Die Welt ging aus den Fugen. Sie sprang aus dem Gelenk. Die Hand der Freundin war feucht. Und noch etwas. Jelenas Finger waren kalt. Doch draußen war einer der heißesten Tage seit 40 Jahren. Ein Jahrhundertsommer, eine Jahrhunderthitze, eine Trockenheit wie in der Wüste.
Marina rief Jelenas Namen erst leise, dann immer lauter. Sie packte sie an den Schultern, schüttelte sie. Doch Jelena wurde mit jeder Bewegung, die Marina machte, schwerer. Sie legte das Ohr auf die Brust der Freundin. Ließ ihren Kopf lange so liegen. Bis sie die Seife roch. Auf Jelenas Händen. Im Gesicht. Am Hals. In den feuchten Haaren. Der Körper roch nach Wasser.
Marina wußte sofort, was die Kette mit dem Kieselstein bedeutete. Sie löste sie von Jelenas Hals. Dann nahm sie die Photos von der Wand.
Als sie die Wohnung verließ, ließ sie die Tür offen, damit Jelenas Seele ihren Weg nach draußen fand.
Das Gartentor quietschte. Es war bereits dunkel, doch die Hitze des Tages stand noch in der Luft. Marina war mit dem Fahrrad in der Betonwüste Frankfurts herumgefahren auf der Suche nach einem Ort der Zuflucht, an dem sie nachdenken konnte. Sie schob das Fahrrad durch das ungemähte Gras hinter die Regentonne. Aus der Tonne stank es verfault und modrig. Ihre Hand glitt über die Wasserfläche. Auch hier hatten sich unzählige Insekten eingenistet, ihr Leben eingerichtet, Kolonien gegründet. Marina stellte die Tasche auf der kleinen Veranda vor dem Gartenhaus ab, setzte sich auf den alten Stuhl mit der Bespannung aus Kunststoff. So blieb sie sitzen. Auf dem Fensterbrett der Hütte lag ein Stein. Sie hob ihn hoch und fand darunter einen Schlüssel.
Sie horchte ins Dunkel hinaus. Nahm ihren Herzschlag wahr.
Die Klopfzeichen der Angst.
Bis jemand im Nachbargarten laut auflachte.
Stimmen setzten ein. Die Grillen begannen zu zirpen.
Das erste Kapitel
Wiels de Tiet es boolt hia – denn die Zeit ist nahe.
Offenbarung 1,3
Freitag abend, 20:30 Uhr.
»Also, die Wissenschaft geht davon aus, daß das Universum sich vervielfacht. Hörst du mir zu? Und zwar vollständig.« Ben, mein fünfzehnjähriger Sohn, stand in der Tür und erklärte mir einen Zeitungsartikel, der mich nicht interessierte. Er hatte seine beste Jeans an. Der Schritt der Hose hing in den Kniekehlen, der Bund kam erst knapp unterhalb der Hüfte zum Stillstand. Jeden Moment würde sie zu Boden rutschen. Die blonden Haare hatte er mit viel Gel zum Stehen gebracht.
»Das Universum pulsiert. Es zieht sich zusammen, dehnt sich aus. Es entstehen neue Universen. Paralleluniversen.«
Der Rap aus Bens Zimmer dröhnte unbeirrt.
»Im Moment pulsiert nur unser Reihenhaus. Kannst du nicht die Musik in deinem Zimmer leiser machen?«
»Hast du verstanden?«
»Aber ja. Unser Reihenhaus zieht sich zusammen, dehnt sich aus. Es entstehen neue Reihenhäuser, ach nein Universen...«
»In denen es Kopien von dir gibt.«
»Kopien? Von mir?«
Das Bügeleisen zischte vor Aufregung und stieß verwundert Dampf aus.
»Wenn es ein Paralleluniversum gibt, das mit unserem identisch ist, dann gibt es dich dort ebenfalls.«
»Ich soll mir vorstellen, daß ich ein Parallel-Ich habe?«
Ben nickte.
»Und?«
»Was, und?«
»Was bedeutet das für mich?«
»Das ist doch der reinste Wahnsinn. Eine phantastische Vorstellung. Andere unbekannte Universen, parallel zu unserem. Ein geheimnisvoller Zwilling, Drilling. Eine Sensation, wenn sich herausstellt, daß das wahr ist – es handelt sich dabei nicht um eine verrückte Idee, sondern um einen ernstzunehmenden Forschungsansatz.«
Bevor Ben mir das Geheimnis der Paralleluniversen erklären konnte, kam Philipp zur Tür herein, und endlich verließen meine beiden Männer das Haus, um ins Cineplex in der Mainzer Landstraße zu fahren, wo – wie in allen Kultursendungen betont wurde – die erste Verfilmung von Stansilaw Lems Astronauten lief. Für den Film war intensiv geworben worden. Sogar ich hatte die apokalyptischen ersten Sätze des Vorspanns im Kopf: In den frühen Morgenstunden des 30. Juni 1908 konnten Zehntausende von Bewohnern Mittelsibiriens eine außergewöhnliche Naturerscheinung beobachten. Am Himmel stieg eine blendend weiße Kugel auf und brachte unter ihrer Bahn den Erdboden zum Beben. Überall, wo der Meteor sichtbar wurde, versetzte ein gewaltiges Dröhnen Mensch und Tier in panischen Schrecken.
Schnitt.
Die Stimme wurde ausgeblendet. Und das nächste Bild versetzte den Zuschauer in Panik. Eine riesige Feuersäule raste auf ihn zu, um ihn aus dem Kinosessel zu reißen und in der Atmosphäre verglühen zu lassen...oder so ähnlich.
Ich teilte Bens und Philipps Leidenschaft für Spektakel dieser Art nicht. Aus meiner Erfahrung als Psychologin wußte ich, Apokalypsen fanden in den Seelen meiner Patienten statt und nicht im Weltall. Weltuntergang – das war für die meisten Menschen der alltägliche Wahnsinn. Sie fürchteten sich mehr vor dem Montagmorgen als vor gigantischen Staubmassen, die die Erde der Zukunft umhüllen, um die Menschheit auszulöschen.
Jeden Freitag hatte Judith, Professorin für Religionsgeschichte und Witwe eines Cellisten aus dem Frankfurter Orchester, ihren Hausmusikabend.
»Das ist meine Art, den Sabbat zu feiern«, erklärte sie.
Aus dem Nachbargarten war die Klarinette zu hören. Ich lag in der Totenstellung auf dem Fußboden und versuchte die Töne zu ignorieren, damit mein Gewicht von 60 Kilo sich endlich anfühlte wie 30 und mein Körper eins wurde mit dem Fußboden. Aber die Vorstellung, daß Kopien von mir im Universum existierten, ließ mich nicht los. Wäre das wahr, würde es die ganze westliche Zivilisation auf den Kopf stellen. Ich müßte beginnen an Wiedergeburt zu glauben, die Toten fänden keine Ruhe.
Eva Cranach, eine Studienkollegin, hatte mir vor drei Monaten dringend Entspannungsübungen empfohlen. Es sei die einzige Möglichkeit, die Hochspannung in meinem Kopf auf eine niedrigere Voltzahl herunterzufahren. Ansonsten prophezeie sie mir ewige Verdammnis. Als ich sie fragte, wie diese aussehen würde, sagte sie nur: »Stell dir einen Hamster in seinem Laufrad vor.«
Also entschied ich mich für Yoga. Die Abbildungen in den einschlägigen Broschüren erinnerten mich an die mongolischen Artisten und ihr Programm Begnadete Körper im Tigerpalast. Für eine berufstätige Mutter war es allerdings schwer, die vollkommene Erleuchtung zu erreichen. Trotz komplizierter Stellungen, Entspannungsübungen, Atemtechniken, gesunder Ernährung und Meditation.
Vorschriftsmäßig streckte ich die einzelnen Glieder. Eine unsichtbare Kraft zog meinen Kopf aus den Schultern, die Schultern vom Hals, die Beine aus den Hüften. Fast konnte ich mir vorstellen, wie es sich anfühlte, wenn die Muskeln entspannt waren, die Atmung gegen Null ging, der Geist klar wurde und gelöst.
Da klingelte es an der Haustür. Nero, der dreijährige sibirische Husky, erhob sich sofort und hechelte vor meiner Nase. Er mußte sich mit aller Gewalt zurückhalten, um nicht den Schweiß von meinem Gesicht zu schlürfen. Hunde sind beneidenswerte Geschöpfe. Die Gewinner der Evolution. Die Lieblinge der Götter, die einfach nur sie selbst sein können, während der Mensch der Zukunft sich nicht nur mit dem eigenen, sondern noch unendlich vielen Parallel-Ichs herumschlagen muß. Ich widerstand im Gegensatz zu Nero der Versuchung aufzuspringen, um dem Besucher zu öffnen, sondern murmelte die Formel wie einen Rosenkranz: Ich entspanne die Zehen; die Zehen sind entspannt. Ich entspanne die Waden; die Waden sind entspannt.
Eva hatte mir eindringlich erklärt, ich müsse mein Verhalten ändern. Ich dürfte nicht länger den Jasager spielen (der ich in meinen Augen nicht war), ich müßte lernen, Leuten am Telefon das Wort abzuschneiden (was ich als unhöflich empfand) und nur, weil jemand, den man nicht eingeladen hatte, an der Tür klingelte, mußte man noch lange nicht öffnen.
Ich zwang meine Augen, sich zu schließen und nach innen zu schauen. Ich verschränkte, wie ich es gelesen hatte, die Finger über dem Bauch, achtete darauf, daß er sich beim Einatmen vorschriftsmäßig hob, bis die Finger auseinandergedrückt wurden. Fühlte, wie sie sich beim Ausatmen wieder ineinanderfügten. Ich rollte den Kopf langsam von einer Seite zur anderen, um aus der Mitte heraus zur Ruhe zu kommen.
Nero dagegen hyperventilierte bereits. Seine Ohren standen in die Höhe. Seine Schritte kratzten über das Parkett. Die Klarinette nebenan schraubte die Töne nach oben.
Daher hörte ich nicht, wie die Terrassentür leise geöffnet wurde. Ich bemerkte die langsamen Schritte nicht. Ich sah nicht, daß sich ein Schatten über mich legte. Erst als jemand sagte: »Seit wann sprichst du mit dir selbst, Hannah?«, öffnete ich die Augen. Die Entspannung fiel in sich zusammen. Wenn ich jetzt starb, was passierte dann mit meinem Parallel-Ich? Starb es zusammen mit mir? Existierte es weiter? Eine billige Kopie in einem anderen Universum? Oder stieg meine Seele im Tod tatsächlich in den Himmel auf, um dort in einem anderen Universum in einen Körper zu wechseln, der meinem gleich war? Als Psychologin hatte ich schon die verrücktesten Versuche erlebt, sich die Welt zu erklären. Von jedem Wahnsinn, den ich mir anhörte, blieb ein Stück in mir zurück.
Mein Blick stieg von unten nach oben. Eine Waffe unter der Lederjacke. Entschlossen richtete ich mich auf.
»Bist du verrückt geworden?« zischte ich. »Das nennt man Hausfriedensbruch!«
»Wie lange hätte ich denn noch klingeln sollen?« Kriminalhauptkommissar Ron Fischer stand über mich gebeugt.
»Bist du nicht auf die Idee gekommen, daß ich nicht zu Hause sein könnte?«
»Was willst du, ich bin bei der Kripo. Das Auto vor der Tür. Nero bellt. Die Terrassentür ist angelehnt. Alles am Tatort spricht dafür, daß du zu Hause bist.«
»Vielleicht möchte ich niemanden sehen.«
»Seit wann möchtest du mich nicht mehr sehen?«
»Schon immer, wenn du es genau wissen willst.«
»Habe ich etwas in deiner Entwicklung verpaßt?« Ron ließ eine Zeitschrift auf den Wohnzimmertisch fallen, setzte sich in den Sessel und zog die Zigaretten hervor. »Bist du jetzt endgültig durchgeknallt?«
Theoretisch war Ron einer meiner besten Freunde, nur in der Praxis haperte es. »Rauchverbot«, sagte ich und erhob mich aus meiner unwürdigen Position.
»Echt?« antwortete Ron und zündete sich die Zigarette an.
»Was willst du um diese Uhrzeit?«
Er schaute mir nicht in die Augen, so daß ich sofort wußte, er wollte etwas von mir, wußte nur nicht, wie er es mir beibringen sollte. »Hast du schon den Artikel gesehen?«
»Welcher Artikel?«
»In GEO. Franka hat es geschafft!«
Franka – die Lebensgefährtin von Dr. Henning Veit, dem Rechtsmediziner. Was heißt Lebensgefährtin. Ich glaube, sie hatten nicht länger als einen Monat zusammengelebt. Dann brach Franka, die Anthropologin, in die südrussische Steppe auf, um in einem Team von Archäologen Grabstätten zu öffnen, in denen man die Skelette der sagenumwobenen Amazonen vermutete. Wir waren uns nur kurz begegnet, hatten aber in dieser kurzen Begegnung viele Gemeinsamkeiten entdeckt.
»Wie meinst du das, sie hat es geschafft?«
»Die Skelette dieser Kriegerinnen weisen tatsächlich gemeinsame DNA auf.« Ron drückte die halbgerauchte Zigarette in der leeren Chipsschüssel auf dem Wohnzimmertisch aus. Er war eindeutig nervös.
»Aber das ist doch nicht der Grund, weshalb du hier bist?«
»Na ja«, er zögerte, »ich muß zu einer Familie, du weißt schon, ihnen mitteilen, daß... und da dachte ich...«
»Du weißt, wie man eine Todesnachricht überbringt. Das ist doch nicht das erste Mal.«
»Hast du nicht gepredigt, man sollte immer zu zweit sein?«
Er ging neben Nero auf die Knie, um ihn zu streicheln. Der legte sich auf den Rücken und blickte kurz zu mir herüber, als wollte er sagen: Endlich bin ich in guten Händen.
Bis zu Zarifa Hanifi war das schwerste, was mein Beruf als Polizeipsychologin von mir verlangte, einer Familie die Todesnachricht zu überbringen. Seit dem Tag vor einem halben Jahr wußte ich es besser. Das schlimmste war, einen Menschen zum Tode zu überreden. Wie ich es getan hatte. Die Todesnachricht war auf Platz zwei der Rangliste gerutscht.
»Notfallseelsorge ist nicht mehr mein Job. Du weißt doch. Am Montag ist mein erster Arbeitstag im Vermißtendezernat.«
»Nur noch dieses eine Mal.« Rons tiefe Stimme war überzeugend. »Ich finde niemand anderen. Für dich ist es Routine.«
Ich wischte mir mit dem Handtuch den Schweiß von der Stirn. »Nimm den Pastor mit.«
»Der fühlt sich nicht zuständig!«
»Wie, nicht zuständig?«
»Die Leute gehören nicht zu seiner Gemeinde, sagt er.«
»Sind die katholisch oder was?«
Rons Hand griff nach der Wasserflasche und nahm einen kräftigen Schluck. »Nein, etwas anderes, so etwas wie Baptisten. Ich kenne mich da nicht so aus.«
»Ich auch nicht, ich bin mit achtzehn aus der Kirche ausgetreten«, sagte ich. »Und was ist mit Henri?« Henri war Rons Kollege und sein bester Freund.
»Stimmt, der ist noch zahlendes Mitglied.«
»Na also...«
»Aber noch am Tatort!« ergänzte Ron.
»Ihr seid doch nicht nur zu zweit.«
»Sound of Mainhattan. Alle sind in Alarmbereitschaft! Wenn du nicht mitgehst, muß ich alleine zu der Familie.«
»Ja, verdammt noch mal, ich komme mit. Himmel, könnt ihr mich nicht alle in Ruhe lassen? Und was mache ich mit dem da? Der ist kurz vorm Platzen.« Ich deutete auf Nero.
»Nimm ihn in Gottes Namen mit!«
Und Nero, vom Tag seiner Geburt an der Überzeugung, sein eigentlicher Name sei Gott, war bereits zur Tür hinaus.
Es gab eine Zeit, da hätte ich mich standhaft geweigert, Ron als Freund zu bezeichnen. Doch dann hatte er eine Art Persönlichkeitswandel durchlebt. Seit er mit Berit, einer Illustratorin mit scharfem Blick für äußere Details zusammenlebte, hatte sich sein Aussehen verändert. Er rasierte sich nicht nur, er versuchte den Bartwuchs mit Stumpf und Stiel auszurotten. Die Jeans waren gebügelt, er trug gepflegte Schuhe aus schwarzem Leder. Benutzte wie jeder zivilisierte Mann After-shave und hoffentlich Achselspray. Früher hatte er das Wort Geduld nicht gekannt. Noch nie etwas gehört von Einfühlungsvermögen, Sensibilität oder Toleranz. Doch im letzten Jahr hatte er sich verändert. Alles in allem hatte ich ihm als Psychologin bei verschiedenen Privataudienzen in Kneipennächten ein günstiges Persönlichkeitsprofil für die Zukunft prognostiziert. Vermutlich zu früh, denn jetzt diagnostizierte ich einen Rückfall ins Machohafte.
»Nicht schlecht!« sagte ich, als ich ins Auto stieg. »Von welcher Mafia wirst du denn unterstützt? Ein BMW-Cabrio? Kannst du dir das leisten?«
Nero kam von seiner zu kurzen Pinkelpause zurück und sprang hinten auf die neuen Ledersitze. »Das Auto ist gerade einmal eine Woche alt!«
»Ben behauptet zwar, er sei ein kluger Hund. Aber ehrlich gesagt, versuche ich seit Jahren vergeblich ihm beizubringen, sich die Füße abzuputzen. Es klappt einfach nicht. Aber der erste Dreck ist immer der schlimmste, später gewöhnt man sich daran.«
Anstelle einer Antwort trat Ron auf das Gaspedal und trieb den Motor hoch. Eine Staubwolke ging nach oben.
»Um was geht es genau?« fragte ich, als Ron an der nächsten Ampel scharf abbremste.
Er reichte mir ein Photo. Mit einer Sofortbildkamera aufgenommen. Auf den ersten Blick sah ich nur ein Bündel. Dann erkannte ich einen Körper in Rückenlage auf einem Bett. In ein weißes Nachthemd gehüllt. Der Kopf ruhte erhöht auf dem Kissen. Der Körper war in die Matratze eingesunken. Schulterlange schwarze Locken breiteten sich über dem weißen Stoff aus. Die Arme lagen im 30-Grad-Winkel vom Körper entfernt mit geöffneten Handflächen. Und: Das Gesicht war jung. Zu jung für den Tod.
»Wie alt ist sie? Vierzehn? Fünfzehn? Das hättest du mir auch gleich sagen können.«
»Bei dem Mädchen handelt es sich um die sechzehnjährige Tochter der Familie Epp«, erklärte Ron, ohne auf meine Anklage einzugehen. »Die Familie ist vor drei Jahren nach Deutschland gekommen. Russische Aussiedler«, fuhr er fort. »Aus irgendeinem Kaff in Kirgisien.« Er schaute auf seinen Zettel. »Ebenezer.«
Nero begann zu jaulen.
»Wo habt ihr sie gefunden?«
»In einer Wohnung in der Gutleutstraße.«
»Hatte sie ihren Ausweis bei sich, oder woher wißt ihr, wer das Mädchen ist?«
»Wir wurden angerufen.«
»Das heißt, es gibt Zeugen.«
»Eine weibliche Stimme. Die Anruferin hat russisch gesprochen und sich geweigert, ihren Namen zu nennen, hat nur wiederholt, daß in diesem Haus eine Tote liegt, die Jelena Epp heißt.« Seine Finger trommelten ungeduldig auf dem Lenkrad.»Jelena Epp ist für uns keine Unbekannte. Sie hat mehrere Anzeigen wegen Ladendiebstahls, außerdem war sie die Freundin eines Anführers der Russengang. Der sitzt zur Zeit in der JVA Wiesbaden. Bewaffneter Raubüberfall an einer Tankstelle. Der Pächter wurde erschossen.«
»Woran ist das Mädchen gestorben?«
»Noch kein Ergebnis.«
»Aber kein Selbstmord?«
Ron zuckte mit den Schultern. Einige Minuten herrschte Stille im Auto. Nero knurrte.
Drei Monate war es her, daß Zarifa vor meinen Augen gesprungen war. Sie war auf einer Baustelle mitten auf der Zeil auf einen Kran geklettert. Niemand beachtete sie. Erst als sie schon auf dem Tragarm stand, sich dem Abgrund zuwandte, sich nur mehr mit einer Hand festhielt, sich vorbeugte und in die Tiefe starrte, fiel einem Passanten auf, daß hier kein Bauarbeiter im Einsatz war, daß es ein Mädchen war, das dort oben stand, mit dem Blick in die Tiefe und nur den einen Gedanken im Kopf: sich umzubringen. Und noch immer wußte ich nicht, wie ich es hätte verhindern können. Das war das schlimmste.
Wenn ich die Augen schloß, sah ich Zarifa Hanifi auf dem Baukran stehen.
Wie heißt du?
Wie alt bist du?
Sollen wir jemanden anrufen?
Schweigen ist für eine psychologische Betreuung vor Ort äußerst kontraproduktiv. Am Reden halten war alles. Hatte ich mich überschätzt? War ich zu sicher gewesen, daß dieses Mädchen nicht springen würde? Einfach, weil ich da war, mit den üblichen Worten auf sie einredete. Weil ich wußte, jemand, der seinen Selbstmord so inszenierte, wollte nicht wirklich springen, hatte sich noch nicht endgültig für den Tod entschieden?
Gib dir eine Chance, deinen Eltern.
Gib dem Leben eine Chance.
Und auch der Angst.
Weißt du wirklich, was du tust?
Floskeln. Eingeübt.
Das Mädchen war für einen Moment zurückgewichen. Von unten näherte sich ein Polizist. Kletterte das Gerüst hoch.
Zeit. Ich brauchte noch Zeit.
Ich machte dem Kollegen ein Zeichen, daß er warten sollte. Doch er bemerkte es nicht. Blieb nicht stehen. Ich redete und redete. Er kam näher. Es war noch zu früh. Ich wurde nervös. Ich verlor den Faden.
Sekundenbruchteile. Mein Blick hing einen Moment zu lang an dem Mann, der nur noch wenige Stufen entfernt war. Zarifa bemerkte es. Drehte sich kurz um. Und dann sprang sie. Stürzte in atemberaubender Geschwindigkeit nach unten.
Das erste Mal hatte ich es nicht geschafft, jemanden im letzten Moment zu überzeugen, daß das Leben eine Versuchsreihe in Sachen täglichem Überleben war. Für jeden von uns. Nicht mehr und nicht weniger. Das war es, was ich immer in solchen Fällen sagte. Daß man gegenüber dem Leben nur schuldig wurde, indem man es wegwarf, nicht wenn ein Versuch schiefging. Daß es immer eine andere Möglichkeit gab.
Vielleicht war sie doch nicht ganz so sinnlos.
Die Idee von unendlich vielen Paralleluniversen. Die Vorstellung von unzähligen Alternativen, die das Leben bietet.
Die Ampel an der Alten Oper schaltete auf Grün. Die Reifen quietschten, als Ron losfuhr. Die Mainzer Landstraße ist mit über acht Kilometern die zweitlängste und eine der meistbefahrenen Straßen der Stadt. Sie endet in Höchst am Bolangaropalast. Dort, wo 1813 Napoleon seine letzte Nacht auf deutschem Boden verbrachte, worauf wir alle unglaublich stolz sind. Warum auch immer.
Frankfurt hat viele Gesichter. Zu viele. Zarifa Hanifi hatte in Fechenheim gewohnt. Eine Woche nach ihrem Tod war ich zu dem Wohnblock gefahren. Hätte ich dort leben müssen, hätte ich mich auch im entscheidenden Moment fallen lassen.
Ron fuhr vorbei an den Bankentürmen der City, an grauen Behördenzentren, Gewerbe- und Industrieansiedlungen, brachliegenden Grundstücken, an den bekannten Großmärkten mit ihren öden Parkflächen und brachte schließlich das Auto vor einem schmalen grauen Gebäude zum Stehen. Das »Wohnheim« lag einklemmt zwischen zwei Autohäusern. Exklusive Gebrauchtwagen von BMW und Mercedes. In der untergehenden Sonne hatte die Fassade des fünfstöckigen Hauses die Farbe kalter Asche.
»Aus welchen Ländern kommen die Leute, die hier leben?«
»In diesem Haus wohnen nur Aussiedler. In Sozialwohnungen, die ihnen von der Stadt zugewiesen werden.«
Wir stiegen aus. Ich blickte an dem Gebäude hoch. »Die Stadtverwaltung hat offenbar noch nie etwas von artgerechter Haltung gehört.«
»Spare dir deinen Zynismus.«
»Was heißt Zynismus? Artgerecht heißt dem natürlichen Lebensraum angepaßt. Mehr nicht.«
»Was soll die Stadt deiner Meinung nach machen? Ihnen ein Häuschen im Grünen schenken?«
»Möchtest du hier wohnen?«
Ron ignorierte meine Frage und sagte: »Spar dir dein Mitleid. Nicht einmal die Hälfte der Leute verdient es. Das kannst du mir glauben. Die wollen sich nicht anpassen.«
Nero war dabei, das Fenster im neuen BMW zu zerkratzen.
»Verflucht. Laß ihn raus. Sonst ruiniert er mein Auto noch völlig.« Ron hielt den Autoschlüssel in die Luft. Mit einem Surren verschlossen sich die Türen hinter Nero. Ich band ihn an der Straßenlaterne fest, an der ein altes rotes Klapprad lehnte.
Ron zog einen Zettel aus der Innentasche seiner Jacke und fuhr mit dem Finger die Klingeln an der Haustür entlang: Hamm, Wilms, van Dyck, Loewen, Friesen, Klaasen, Penner, Pauls, Reimer, Martens, Jantzen, Willer, Froese, Epp.
»Das sind nur deutsche Namen«, sagte ich.
»Sag ich doch, Aussiedler.«
»Wie heißt die Familie?«
»Epp.« Ron schaute auf seinen Zettel. »Abram und Ruth Epp.«
»Was ist das denn für ein Name, Abram?«
»Ein biblischer vermutlich.«
Ich entspannte mich. War die Familie religiös, würden sie den Tod der Tochter besser verkraften.
In diesem Moment sprang die Haustür auf. Ron konnte sie gerade noch festhalten, bevor sie an meine Stirn knallte.
Das Mädchen hatte es verdammt eilig. Der beige-braunkarierte Rock reichte hinunter zu den klobigen Schuhen. Die braunen Haare steckten unter einem Dreieckstuch. Sommersprossen. Und eine vollgepackte Tasche aus braunem Filz. Bestickt mit einem Labyrinth aus Gold und Rot, in dessen Zentrum eine Frau ihre Arme in Richtung eines imaginären Himmel streckte. Ansonsten war die Tasche nicht groß genug für alles, was das Mädchen hineingestopft hatte.
Sie steuerte auf das Fahrrad und Nero zu. Meinen Gruß ignorierte sie, doch auf Neros Gewinsel sprach sie sofort an. Der Hund erhob sich hoffnungsvoll. Wie immer war er schamlos vertrauensselig. Rollte sich augenblicklich auf den Rücken, streckte ihr den Bauch entgegen. Demonstrierte pure Unterwürfigkeit. Von mir hatte er das jedenfalls nicht.
Als wir in das Haus hineingingen, hörte ich, wie sie ihm etwas auf russisch sagte. Neros Gewinsel ging in das Geheule seiner Vorfahren über. Ein einsamer Wolf aus der sibirischen Taiga. Bei minus 50 Grad. Er sollte eine Ausbildung zum Hundeschauspieler machen.
»Sollten wir nicht einen Dolmetscher kommen lassen?«
»Sind doch angeblich Deutsche.«
Ein Treppenhaus, bei dessen Renovierung man in Grautönen geschwelgt hatte. Wir drängten uns an einem Kinderwagen vorbei, aus dem ein Teddybär lehnte, der aussah, als hätte Nero tagelang auf ihm herumgekaut. Tapfer versuchten die Bewohner gegen die Tristesse anzukämpfen, indem sie wenigstens die Hausordnung, die unten im Flur aushing, peinlich einhielten. Ich wünschte, mein Treppenhaus wäre so sauber. Im ersten Stock informierte ein Schild, daß die Sozialarbeiterin montags und mittwochs von 11–13 Uhr Sprechstunde hatte und diese Zeiten einzuhalten seien. Eine Etage höher verwies ein Schild auf den öffentlichen Fernsprecher.
Im vierten Stock hielt Ron an. Die Wohnung lag links am Ende des Flurs, in den auch tagsüber kein Tageslicht fiel. Jemand hatte die Tür zusätzlich mit zwei weiteren Sicherheitsschlössern gesichert. Aus der Wohnung daneben hörte ich Leute reden, ein unverständlicher Singsang tiefer Stimmen. Der Name Epp stand auf dem Schild aus Pappe. Auf deutsch und russisch. Was mich in wenigen Minuten erwartete, waren Entsetzen, Trauer, Verzweiflung, Angst, unermeßlicher Schmerz. Schuldgefühle vielleicht. Der Tod des eigenen Kindes stürzt Eltern in Verzweiflung. Ein gewaltsamer Tod aber bringt die Welt zum Einsturz.
Ich atmete tief durch und nickte Ron zu.
Bereits der erste Blick, den ich auf die Frau warf, deprimierte mich zutiefst. Eine Zeugin Jehovas ohne Alter, in Sack und Asche. Vielleicht war die Bluse mit dem Rosenmuster unter der braunen Strickjacke einmal ein Schmuckstück gewesen. Doch unzählige Handwäschen in scharfer Seifenlauge hatten das Rosenmuster bis auf die grauen Umrisse herausgeätzt. Die braunen Haare waren von Grau überzogen, dasselbe schimmelige Grau wie auf meinen Gartenmöbeln aus Teakholz, die ich nicht pflegte. Unzerstörbar war nur das grüne Tuch um die Schultern. Eine Frau, der kalt war bei einer Außentemperatur von noch immer 24 Grad. Hochgradig depressiv, diagnostizierte ich. Ich kannte den verschleierten Blick, den schleppenden Gang, die Müdigkeit, die sich in jedem ihrer Körperteile breitmachte. Die Ringe unter den Augen. Vielleicht war sie nicht älter als ich, doch sie sah uralt aus, fühlte sich vermutlich auch so.
Ron griff in das Innere seiner Lederjacke. Die Frau zuckte zusammen. Bevor er ihr seinen Dienstausweis unter die Augen halten konnte, reichte ich ihr schnell entschlossen die Hand: »Hannah Roosen. Das ist Herr Fischer...«
»Wir müssen Sie in einer dringenden Angelegenheit sprechen«, unterbrach mich Ron. »Sie sind Frau Epp? Ruth Epp, die Mutter von Jelena Epp?«
»Was ist passiert?« Es fiel ihr schwer, die Worte auf deutsch zu finden. »Was ist mit Jelena?«
»Dürfen wir eintreten?« Ron machte einen Schritt nach vorne. Frau Epp wich zurück. Wir folgten ihr den langen schmalen Flur entlang.
Auf den ersten Blick sah das Wohnzimmer kleiner aus, als es war. Die Wände waren nicht tapeziert, sondern in kalkigem Weiß gestrichen. Geradeaus an der Wand die durchgesessene dunkelbraune Couch. Rechts die Schrankwand. Ein zweiarmiger Kerzenständer aus hellem Holz, Kristallgläser, ein Teeservice aus braunem Ton mit hellgebranntem Rand. Links der Tisch mit vier Stühlen. Darauf ein Tischtuch. An der einen Seite saß ein etwa 2ojähriges Mädchen mit einer Jacke, an der sie einen Knopf annähte. Auf der anderen Seite ein Stapel Bücher, Papiere eng beschrieben.
»Meine Tochter Olga.«
»Hallo«, sagte ich und trat an den Tisch, um ihr die Hand zu geben. Ein dickes, altes Buch lag neben einem Stoß Papier. Johann Heinrich Jung-Stilling, Das Heimweh. Auf dem Stoß Papier lag eine Liste mit Namen. Dieselben Namen wie auf den Klingeln unten an der Haustür.
Olga stand kurz auf, nahm meine Hand, schaute mich aber nicht an. Was die Kleidung betraf, so hatte sie diese vermutlich bei Woolworth in der Abteilung Mode ab 50 gekauft. Ich hätte nicht gedacht, daß es Polyesterröcke in Größe 36 gab und karierte Blusen mit Schleifen um den Hals noch verkauft wurden. Sie ließ meine Hand sofort wieder los.
Die Luft war stickig. Dicke Vorhänge versperrten den Blick auf die Straße, gegen den Lärm der Autos halfen sie nicht.
»Ist Ihr Mann zu Hause?« fragte Ron.
Frau Epp schüttelte den Kopf, lud uns jedoch mit einer leisen Handbewegung ein, Platz zu nehmen. Sie ahnte wohl, die Nachricht, die sie gleich erfahren würde, sollte ihr Leben verändern.
Ron nahm breitbeinig auf dem Sofa Platz und beugte sich nach vorne, als ob sie ihn so besser hören könnte.
»Jelena, so heißt doch Ihre Tochter?«
»Jelena, da, da, deutsch Helena.«
Olga Epp blickte nicht von ihrer Näharbeit auf.
»Sie wissen, wo sie sich zur Zeit aufhält?« Ron kehrte den Beamten hervor.
Frau Epp sprang plötzlich auf und stieß hervor: »Tee, ich mache Tee, ja?«, als könne sie so vor der Wahrheit fliehen. Ohne unsere Antwort abzuwarten, verließ sie den Raum.
Wie hatte es diese Menschen hierher verschlagen? Wo, verdammt noch mal, lag Kirgisien? Hinter dem Ural. Wo Asien beginnt und Sibirien. In der Grauzone der Welt. Eine unermeßliche eisige Fläche mit tiefgefrorenen Mammuts und riesigen Straflagern.
Ruth Epp kam mit dem Tablett zurück, das sie vor uns abstellte. Nervös nahm sie die Teekanne in die zitternde Hand und begann hektisch einzugießen, froh eine Beschäftigung zu haben, die ihr Sicherheit gab und damit die Illusion, ihr Leben würde weitergehen wie bisher.
»Ihre Tochter«, begann Ron, »Jelena.« Die Teekanne in der Hand zitterte. »Wie alt ist sie?«
Was sollte dieses Ratespiel? Ich versuchte, Blickkontakt zu ihm aufzunehmen. Doch er schaute nicht in meine Richtung. Ebensowenig blickte er Frau Epp an, die vor ihm stand, die Teekanne in der Hand.
»Sechzehn«, antwortete Ruth, »sie ist Ende Juni sechzehn geworden.« Sie spürte, warum Ron hier saß: Er wollte ihr Leben verändern, ihre Hoffnungen zunichte machen, ihr den Boden unter den Füßen wegziehen. Er hatte bereits begonnen, ihr lebenslangen Schmerz mit Fragen zu injizieren. Langsam und unaufhörlich sollte sie erfahren, was es bedeutete, das eigene Kind zu verlieren. Ron spürte offenbar nichts von alldem. Aber ich. Ich machte mir ihre Gefühle bewußter, als ich sollte. Wie wäre es, wenn jemand mir Bens Tod mitteilen würde? Für einen kurzen Moment kam Panik in mir hoch.
»Wann haben Sie Ihre Tochter zum letzten Mal gesehen?« Ron ließ nicht locker. Keine Antwort.
In diesem Moment hörten wir den Schlüssel an der Wohnungstür. Im Halbdunkel des Flurs ein Mann. Ron und ich erhoben uns gleichzeitig. Er war kleiner als ich und trug eine Brille mit einem schweren, schwarzen Gestell. Die grauen Haare waren vom Schweiß verklebt. Über der braunen Hose aus undefinierbarem Material trug er ein weißes Hemd, darüber eine schwarze Anzugjacke. Die hervorgehobenen Wangenknochen, die dichten Augenbrauen, der Blick. Diese Haltung, die auf eingeübter Ablehnung und anerzogenem Mißtrauen beruht, nicht auf Respekt gegenüber dem Besuch.
Die Schuhe stellte er ohne hinzusehen auf ein Regal unter dem Spiegel. Eingeübtes Alltagsritual. Wenn man von draußen kam, zog man die Schuhe aus. Sofort kamen mir meine Sandaletten dreckig vor. Ich hatte den Staub von Frankfurts Straßen in die Wohnung getragen.
»Ron Fischer, Polizeipräsidium Frankfurt. Sie sind Abram Epp?«
Abram Epp nickte. »Guten Abend.« Der Akzent war nicht zu überhören.
»Kommissar Fischer. Woher kommen Sie?«
»Ich war bei Nachbarn.«
»Und wo waren Sie vorher?«
»In der Gebetsstunde. Wie jeden Freitagabend um diese Zeit.«
Warum kam Ron nicht endlich zum Punkt? Ich konnte mich nicht länger beherrschen, sondern streckte ihm die Hand hin und begann: »Ihre Tochter Jelena...«
Abram Epp wandte sich mir zu, aber er ignorierte meine Hand.
»Sie wohnt nicht bei uns«, sagte er.
»Beim Einwohnermeldeamt ist hier ihr Wohnsitz gemeldet. Mainzer Landstraße 324. Ist das korrekt?« Ron schaute auf den Zettel in seiner Hand.
Verdammt! Konnte er nicht endlich sagen, was los ist?
»Wir müssen Ihnen eine traurige Nachricht überbringen«, griff ich ein. Plötzlich starrten mich alle an.
Ich mußte die Sache zu Ende bringen. »Wir haben ein junges Mädchen tot aufgefunden und haben Grand zu der Annahme, daß es sich dabei um Jelena handelt.«
»Warum sollte es Jelena sein?« Abram Epp stellte die Frage in einem abweisenden Ton. Er blieb höflich, doch gleichzeitig spürte ich seine Ungeduld. Als sei er überzeugt, daß die Sache ihn nichts angehe, als wolle er uns zu verstehen geben, daß wir uns nicht in seine Angelegenheiten mischen sollten.
»Wir haben den Hinweis erhalten«, sagte Ron, »daß es sich um Ihre Tochter handelt. Ein Anruf. Aber natürlich, endgültige Gewißheit haben wir nur, wenn jemand von Ihnen sie identifiziert. Kennen Sie die Wohnung in der Gutleutstraße?«
»Was?« Ruth Epp unterbrach Ron und sah ihren Mann an. Er übersetzte ins Russische.
»Njet, njet, njet...« Ruth schüttelte den Kopf und schlug dann die Hände vors Gesicht. Die Teekanne fiel zu Boden. Schweigen. Der Tee verdampfte auf dem Teppich.
Dann, von einem Moment zum anderen, stieß sie diesen hohen Ton aus, der nicht enden wollte, der immer so weitergehen würde, bis ihr die Luft wegblieb, die sie vergaß, einzuatmen, auszuatmen, einzuatmen, auszuatmen.
»Sollen wir einen Arzt rufen?« fragte Ron nervös.
Keine Antwort. Statt dessen trat Abram auf seine Frau zu und sagte etwas zu ihr, das ich nicht verstand. Es war kein Russisch, dafür fehlten die Töne, die Zischlaute, die fremde Intonation. Was der Mann sprach, war eine Art Deutsch. Reduziert auf Umlaute und langgezogene Vokale. Ruth Epp wurde ruhiger. Doch im nächsten Moment holte sie aus und schlug ihm ins Gesicht. Dann begann sie am ganzen Körper zu zittern.
Sein Gesicht war bleich und angespannt. Ich fragte mich, wo dieser Ausdruck seinen Ursprung hatte. In Trauer oder Härte.
Ich schob ihn zur Seite, nahm ihre Hände, drückte sie fest an meinen Körper, lehnte mich gegen sie, umschlang sie mit beiden Armen. Mit leisem Wimmern versuchte sie sich zu befreien, aber ich wußte aus Erfahrung, daß ihr Widerstand nicht lange dauern konnte, wenn mein Körper ihr Halt gab.
Nach wenigen Minuten spürte ich, wie sie nachgab. Die Anspannung in ihrem Körper löste sich. Die Beine knickten weg. Ich fing sie auf, führte sie zum Sofa.
»Ich habe einen Sohn«, begann ich, »er ist fünfzehn.«
»Wie? Wie ist sie gestorben?« fragte Ruth.
»Das muß erst die Obduktion feststellen.«
Abrams Hand griff an ihre Schulter. »Keine Obduktion«, sagte er.
»Das werden Sie nicht verhindern können.« Rons Ton war ausgesprochen hart.
»Sie ist keines natürlichen Todes gestorben«, sagte ich, »wir müssen herausfinden, wer ihr das angetan hat.«
Ich hatte versucht, Rons Äußerung abzumildern. Doch Abram Epp schaute mich an, als würde ich Jelenas Körper hier und jetzt vor seinen Augen aufschneiden, zerstören, zerstückeln.
Ruth Epp begann zu weinen und den Kopf zu schütteln und wiederholte etwas in dieser Sprache, die in einem Moment fremd klang, im nächsten so vertraut war wie ein Kinderlied.
Alle saßen wir da und hörten das Klagelied der Mutter. Es bestand aus einem unaufhörlichen Gemurmel, aus immer denselben Formeln. Eine Aneinanderreihung von Frage- und Ausrufezeichen. In einer Sprache, die ich nicht verstand, aber die geeignet schien, um Schmerz auszudrücken.
»Was sagt sie?« fragte ich.
Niemand antwortete.
Rons Handy klingelte. Nur ich schien zu hören, wie Olga in diesem Moment sagte: »Sie fragt, warum Gott dies zuläßt.«
Keiner beachtete sie, alle starrten Ron an, der das Zimmer verließ. Wir hörten ihn auf dem Flur telefonieren.
Plötzlich war Ruth Epp völlig ruhig. »Ich möchte sie sehen.« Sie wandte sich zu mir, ergriff meine Hand. Ihre Finger waren eiskalt. »Ich habe sie auf die Welt gebracht, und nun ich muß ihr helfen, von hier zu gehen. Sie verstehen?«
»Ich denke, es ist gut, wenn sie ihre Tochter noch einmal sieht, um Abschied zu nehmen.« Ich wandte mich zu Abram. »Ich kann sie begleiten.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich begleite sie.«
Ich zog meine Visitenkarte hervor, notierte darauf die Nummer eines Arztes sowie der Notfallseelsorge. Den Zettel streckte ich Ruth entgegen.
»Wenn etwas ist. Sie können jederzeit bei einer dieser Nummern anrufen oder bei mir. Soll ich nicht doch mitkommen?«
Bevor ich ihr die Karte in die Hand drücken konnte, hatte Abram sie an sich genommen.
»Die anderen kümmern sich«, sagte er, ohne zu erklären, wer sie waren, die anderen.
Ich beobachtete Olga, die am Fenster stand ohne sich zu bewegen, als gehöre sie nicht dazu, als sei sie mit den Gedanken in einer anderen Welt, in einer anderen Landschaft.
In diesem Moment kam Ron zurück. Laut sagte er: »Ihre Tochter war schwanger, wußten Sie das?«
Was war nur los mit ihm? Wer eine Todesnachricht überbrachte, mußte besonders sensibel sein. Man konnte nicht einfach über die Gefühle der Angehörigen hinwegtrampeln.
»Ich habe es bereits gesagt, meine Tochter«, sagte Abram Epp schon in der Tür, »wohnt nicht mehr hier. Sie ist weggegangen, gleich nachdem wir hier einzogen sind.«
Es war Mitternacht, als ich wieder zu Hause war. Nero verzog sich in Bens Zimmer. Ich war zu müde, um ihn daran zu hindern. Wie ich zu müde gewesen war, um Ron zu fragen, weshalb er sich benommen hatte wie ein Vertreter des KGB. Ausgerechnet bei Menschen, die durch Begegnungen mit Institutionen wie der Polizei für ihr Leben traumatisiert waren.
Und noch eines würde ich ihm klarmachen: So ging man nicht mit Menschen um, die gerade ihre Tochter verloren hatten.
Aber Ron hatte keine Kinder. Gehörte also zu denen, die es nicht verstehen, was es bedeutet, Kinder zu haben.
Prometheus, vom obersten Gott Zeus an einen Felsen gefesselt, ist nichts gegen den Zustand, Eltern zu sein. Auch ihm wurde täglich ein Stück seines Innersten herausgehackt. Ein Martyrium, das im wirklichen Leben nur die eigenen Kinder verursachen können.
Das zweite Kapitel
Ekj hab äa Tiet jejäft omtokjieren un äare Huararie to loten, oba see kjieed nich om. Und ich habe ihr Zeit gegeben, daß sie sollte Buße tun, und sie will nicht von ihrer Unzucht lassen.
Offenbarung 2,21
Mein erster Arbeitstag im neuen Team. Doch niemand rollte einen roten Teppich für mich aus.
Nur Nina Vatana, die EDV-Spezialistin, schenkte mir eines ihrer asiatischen Lächeln. Daß das neue Team mich an meinem ersten Tag ignorierte, war mir angenehm. Das schaffte Distanz. Und Distanz hatte ich nötig. Nie wieder Leidenschaft zeigen. Nie wieder meine Seele preisgeben. Nie wieder Gefühle investieren.
Der Besprechungsraum, in dem wir uns an diesem Montag morgen trafen, lag im vierten Stock mit Blick auf eingemauerte Beete, in denen eine Bewässerungsanlage versuchte, nach sechs regenlosen Wochen frischgepflanzte Rosen am Leben zu erhalten. Das neue Polizeipräsidium übte sich nach außen in Understatement und erhielt dadurch einen sozialistischen Touch.
Hauptkommissar Lothar Glaser, kurz vor der Pension, war dabei seinen Drehbleistift mit neuen Minen zu füllen. Ich hatte schon von ihm gehört. Die einen hielten ihn für phlegmatisch, die anderen nannten ihn überlegt und geduldig.
Mir gegenüber saß Dr. Gregor Johnson. 20 lange Jahre Chefarzt der forensischen Psychiatrie in Frankfurt. Nun Gutachter. Er war mir bestens bekannt. Aus Symposien und Kongressen, wo er mit seinen Kenntnissen hausieren ging und jeden Vortrag mit dem Satz begann: »Sie fragen sich, was sind das für Menschen, die grausame Morde begehen. Doch jeder von Ihnen hier ist in der Lage, einen anderen Menschen zu töten. Jeder von Ihnen ist zu einem Mord fähig.«
Ich wußte, was dies in seinen Zuhörern bewirkte. Ein schlechtes Gewissen. Ein jeder begann in seinem Innersten sofort nach der genannten Mordlust zu suchen, nach versteckten Aggressionen im Unbewußten, nach Grausamkeiten, nach seinen verborgensten Fähigkeiten, einen anderen Menschen zu töten, ihn zu foltern, ihn zu verstümmeln. Alle trugen wir das Kainsmal offen auf der Stirn. Er legte sie frei in uns, die Erbsünde. Machte das Taufgelöbnis rückgängig. Jeder fragte, wie er sich so in sich getäuscht haben konnte, zu glauben, er sei ein friedlicher Bürger dieses Staates.
»Der heißeste Sommer seit Menschengedenken«, murmelte Johnson nun vor sich hin. »Im Frühjahr Hochwasser, die alles überschwemmen und zerstören, und nun diese Hitzewelle. Alles geht kaputt. Die Erde trocknet aus. Der Rhein hat den niedrigsten Wasserstand seit hundert Jahren.«
Es hörte sich an, als müßte die Menschheitsgeschichte neu geschrieben werden. Die sieben Plagen waren über Deutschland gekommen.
»Sie müßten einmal meinen Rasen sehen«, fuhr er fort, »verbrannt. Völlig verbrannt.«
Mein Rasen war seit Jahren vermoost, und Moospflanzen besitzen spezielle Blattzellen, die das Wasser speichern und weiterleiten. So bestens von der Natur ausgerüstet, überlebte mein Rasen friedlich. Weder hatte ich Zeit noch Geld, ihn ständig zu bewässern.
»Genau fünf Jahre ist es her, daß alle Bambusstöcke eingegangen sind. Im Todesjahr meiner Frau. In einem unerklärlichen Rhythmus sterben die Stöcke alle auf einen Schlag an verschiedenen Orten der Welt zur gleichen Zeit.«
»Ohne Grund?« Nina Vatana war beneidenswert braun, wie das Gras in Johnsons Garten, und so schlank und biegsam wie die Bambushalme, von denen er sprach. Ihre Höflichkeit und Zurückhaltung waren ein psychologisches Rätsel. Unwillkürlich wandte sie sich immer gerade dem zu, der sprach, widmete ihm ihre völlige Aufmerksamkeit. Ein kommunikatives Wunder. Ihr Vater hatte ein thailändisches Spezialitätenrestaurant in der Innenstadt, ihre Mutter war Deutsche.
»Eines der letzten Geheimnisse der Natur. Was die Blüte und damit das Absterben auslöst.« Johnson lehnte sich nach vorne und rieb die Fingerspitzen aneinander. Fingermotorik und Gehirntätigkeit stehen auf komplizierte Weise miteinander in Kontakt. Vielleicht käme seine überragende Intelligenz, von der jeder sprach, abrupt zum Stillstand, würde man ihm die Finger abhacken. »Vermutlich ist das periodische Sterben genetisch programmiert. Eine Art Reinigungsprogramm der Natur.«
Diese Schlußfolgerung überraschte mich nicht. Alle letzten Geheimnisse der Natur erklärten sich neuesten Trends zufolge aus der Genetik oder Hirnforschung. Erst vor kurzem hatte ein Neurologe in einer Fachzeitschrift geschrieben, der Ursprung der Religion läge im menschlichen Gehirn, genauer gesagt im rechten Schläfenlappen.
Wo auch sonst?
Im rechten Fuß vielleicht?
Jahrelang hatte ich berufliche Kontakte zu Johnson vermieden. Und nun fand ich mich in einem Arbeitsteam mit ihm wieder. Das gab keinen Anlaß zur Hoffnung. Im Gegenteil. Ich fühlte mich wie in der Gruppentherapie einer geschlossenen Abteilung.
Ich überlegte, ob ich eine Diskussion anzetteln sollte, um der Langeweile ein Ende zu bereiten, statt dessen schweiften meine Gedanken ab.
Zarifa Hanifis Sprung von diesem Baukran auf der Zeil hatte mich mit sich gerissen. Im Gegensatz zu ihr kam ich lebend unten an, zeigte allerdings alle Anzeichen eines klassischen Burnouts. Als diplomierte Psychologin hätte ich es sofort merken müssen. Wie immer reagierte zuerst der Körper, unschätzbarer ehrlicher Seismograph der menschlichen Psyche. Zunächst erklärte ich die Schwindelanfälle damit, daß mein Gehirn Zarifa immer wieder in die Tiefe stürzen ließ. Dann kam die Höhenangst dazu und die Angst in einen Aufzug zu steigen. Heiserkeit übernahm meinen Rachenraum. Mein Beruf war es, mit anderen Menschen zu sprechen. Nun saß ich vor ihnen und krächzte irgend etwas von zur Ruhe kommen, auf den Körper hören. Krächzte, bis die Stimme wegblieb und war froh zu krächzen, denn ich hatte ihnen nichts mehr zu sagen.
»Eine Grippe«, so meine Diagnose.
»Du bist fertig«, erwiderte Philipp. »Am Ende. Du mußt damit aufhören.«
Er hatte recht. Ich konnte meine Arbeit als Mitarbeiterin des Psychologischen Diensts der Polizei nicht mehr ertragen. Nicht die Klagen von scheidungsgeschädigten Kollegen, ihre Alkoholprobleme, die Details ihres psychischen Zusammenbruchs, nicht die Gespräche über menschliches Leid, nicht die Schockzustände von Unfallopfern. Ich wollte nicht mehr plötzlich nach Dienstschluß oder in der Nacht angerufen werden, um Todesnachrichten zu überbringen. Vor jedem Katastropheneinsatz stand jetzt die Angst. Und am allerwenigsten wollte ich noch einmal zu einem Selbstmörder gerufen werden, der dabei war, sich von irgendeinem Hochhaus zu stürzen, um der Menschheit mitzuteilen: Ecce homo. Denn plötzlich wußte ich keine Antworten mehr auf diese Botschaften menschlichen Leids.
Dann kam der Anruf von Christian Fuchs, Leiter einer, wie ich gehört hatte, neuen Arbeitsgruppe. Wir trafen uns in seinem Büro im Polizeipräsidium.
»Was wissen Sie über den Bereich Kriminalpsychologie?« war seine erste Frage.
»Das übliche«, antwortete ich diplomatisch. Die letzten Monate hatten mein Selbstbewußtsein auf ein Minimum heruntergefahren, bis ich bei Sokrates angelangt war: Ich weiß, daß ich nichts weiß.
»Dann beginnen Sie damit, sich einzuarbeiten«, sagte Fuchs. »Sie kennen den Fall Edersee?«
»Die beiden Mädchen. Wer in Deutschland kennt den Fall nicht?«
Vor 89 Jahren war die Talsperre am Edersee geflutet worden. Als in den letzten Wochen der Regen ausblieb, sank der Pegel rasant. Jeden Tag 30 Zentimeter. Und der See gab den Blick frei auf eine versunkene Welt. Die Reste der Dörfer Berich, Alt-Asel und Alt-Bringhausen erschienen. Größte Attraktion jedoch war die alte Steinbogenbrücke bei Axel-Süd. Gewöhnlich lag sie zehn Meter unter der Wasseroberfläche. Jetzt konnte man sie wieder überqueren. Aber das war es nicht, was Fuchs meinte. Als der erste Brückenpfeiler sichtbar wurde, tauchte aus dieser Welt noch etwas anderes auf: die Leichen zweier Mädchen, Larissa und Madleine. Arm in Arm, aneinandergeklammert, fand man ihre Skelette in einer Mülltonne. Der Mörder hatte sie genau über der Brücke ins Wasser versenkt. Die Mülltonne am Boden mit Kies beschwert. Den Deckel mit einer Klebepistole fest verschlossen. Die beiden Mädchen waren vor zwei Jahren im Abstand von einer Woche verschwunden. Vom Mörder fehlte jede Spur. Das einzige, was er den Mädchen gegönnt hatte, war eine letzte Umarmung.
»Und«, so erklärte mir Fuchs, »das war der Auslöser, daß der Innenminister diese neue Arbeitsgruppe ins Leben gerufen hat. Sie ist sein Baby sozusagen. Sie wissen, daß bald Ländtagswahlen sind. Das Projekt läuft zunächst für zwei Jahre. Und zwar für den Bereich ›Vermißte Kinder und Jugendlichem Wir hinken in diesem Bereich sogar Österreich hinterher.«
Ich nickte. Auch ich wollte Österreich nicht hinterherhinken.
»Und wie sieht die Arbeit konkret aus?« fragte ich.
»Sie werden Akten durcharbeiten, Täterprofile vergleichen, verurteilte Straftäter interviewen. Sie werden aber auch bei aktuellen Fällen die Kriminalpolizei unterstützen, ihr Hinweise auf Ermittlungsstrategien und Taktiken liefern, helfen, den Täterkreis einzugrenzen. Alles mit dem Ziel einer schnelleren Aufklärung von Vermißtenfällen, in denen Verdacht auf Gewaltverbrechen besteht. Ziel ist es, eine Studie über den Einsatz von Methoden der Kriminalpsychologie in der praktischen polizeilichen Ermittlungsarbeit zu erstellen.«
Akten studieren, Statistiken erstellen, Grafiken zeichnen, Fachartikel schreiben im Stil von Der Einsatz von Tatortanalyse und Täterprofilen bei versuchten und vollendeten Sexualdelikten in Deutschland von 1971 bis 2004. »Klingt wie der Job, nach dem ich mich sehne.«
»Wie Sie selbst wissen«, erklärte Fuchs, »sind Fälle, in denen Kinder und Jugendliche betroffen sind, ein besonders sensibler Bereich. Wenn Kinder zu Opfern werden«, er hielt im Reden inne und schaute mir direkt in die Augen, »wird einem erst klar, was ein Mensch einem anderen antun kann.«
Der Stift in der rechten Hand wurde hin- und hergedreht. Hatte er selbst Kinder?
»Dazu der Zeitdruck. Alle warten. Die Polizei, die Journalisten, die Angehörigen des Opfers. Dann sind in Zukunft Sie gefragt. Spurensuche, genaue Analyse des Tatorts, selbst kleinster Details der Vorgehensweise des Täters. All dies kann uns zum Handlungsmuster, zur Motivation, zur Persönlichkeitsstruktur des Täters führen. Warum hat sich der Täter ausgerechnet dieses Opfer ausgesucht? Warum hat er dieses und kein anderes Tatwerkzeug benutzt? Warum hat er die Leiche liegen lassen? Oder warum hat er sie versteckt? Und die wichtige Frage: Wird er die Tat wiederholen?«
Er beugte sich nach vorne. Eine Strähne der sorgfältig nach hinten gekämmten Haare fiel nach vorne. »Wir arbeiten gegen die Zeit. Damit haben Sie Erfahrung.«
Das Arbeitsmaterial waren Akten, Daten und Fakten. Es war einfacher, zu diesem Material die nötige Distanz aufzubauen als zu einem Menschen, der auf einem Baukran steht. Der erklärt, es hätte keinen Sinn, mit ihm zu sprechen, er würde in jedem Fall springen. Mit diesem Blick schon ins Jenseits gerichtet. »Aber es dauert unendlich lange, genügend Erfahrungen in kriminalistischer Arbeit zu sammeln, um solche Analysen zu erstellen«, sagte ich.
»Wir geben Ihnen Zeit, sich in das Gebiet einzuarbeiten. Sie werden alle Lehrgänge, die es zu diesem Thema gibt, besuchen. Und Sie werden die zuständigen Beamten bei ihrer Arbeit begleiten«, sagte Fuchs. »Tatortanalytiker ist ein Job, für den ein akademischer Abschluß alleine nicht ausreicht. Zumal sich die Methoden auf Erfahrung gründen. Ganz ehrlich: Die besten Analytiker, das sind und bleiben unsere Leute bei der Kripo. Da mache ich mir nichts vor. Aber ich habe keine Kapazitäten, ich kann keine Leute dafür abstellen. Die fehlen dann woanders. Dieses neue Team, das sich der Innenminister in den Kopf gesetzt hat, könnte ein Segen für uns sein, denn auf einen Schlag stehen uns mehr Leute zur Verfügung. Greenhorns zwar, wie Sie, aber eben zusätzliches Personal.«
»Klingt nicht, als ob Sie sich wirklich nach mir sehnen.«
»Sie können in kritischen Situationen die Ruhe bewahren. Sie sind vertraut mit der Polizeiarbeit, Sie haben langjährige Erfahrungen in der praktischen Psychologie. Und den Rest lernen Sie. ›Training on the job‹«
Training on the job
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: